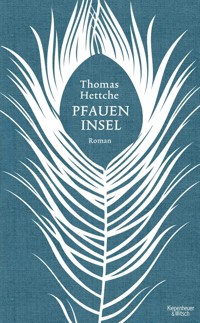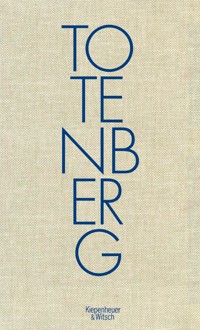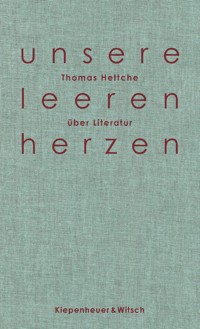
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum erzählen? Thomas Hettches Essays sind ebenso genaue Diagnosen unserer krisengeschüttelten, entzauberten Moderne wie mutige Bestandsaufnahmen seines eigenen Bewusstseins und Denkens. Eine Frage bestimmt das Schreiben dieses Autors: Welche Tröstung kann Literatur für unsere leeren Herzen heute noch bieten?»Unsere leeren Herzen« setzt nach »Fahrtenbuch« und »Totenberg« Thomas Hettches essayistisch-erzählerischen Erkundungen fort, mit denen er, neben dem hochgerühmten Romanwerk, seine intellektuelle Autobiografie fortschreibt.Ohne kulturpessimistische Larmoyanz, aber im Wissen, dass sich metaphysische Sinnfragen in unseren fundamental bedrohten westlichen Gesellschaften immer dringlicher stellen, befragt Thomas Hettche in seinen Essays leidenschaftlich die Literatur nach ihrem Sinn und ihrer Zukunft. Gegen den naiven Glauben einer Abbildbarkeit der Welt, der unsere Gegenwart beherrscht und das Glücks- wie das Erkenntnisversprechen der Literatur verrät, spürt Hettche in »Unsere leeren Herzen« den Quellen eines anderen Realismus, ja einer anderen Moderne nach. Über Thomas Mann, E. T. A. Hoffmann, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, Wilhelm Raabe, Ernst Jünger, Karl Ove Knausgård, Thomas Brasch, Franz Fühmann, Peter Kurzeck, Georg Lukács, Wolfgang Koeppen, Immanuel Kant, Ovid, Robert Louis Stevenson, Paulus Böhmer, David Bowie, Michel Houellebecq u.v.a.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Thomas Hettche
Unsere leeren Herzen
Über Literatur
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Thomas Hettche
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Thomas Hettche
Thomas Hettche gehört seit seinem Debut »Ludwig muß sterben« (1989) zu den herausragenden literarischen Stimmen dieses Landes. »Der Fall Arbogast« wurde in 13 Sprachen übersetzt, sein Bestseller »Pfaueninsel«, der die Geschichte einer Kleinwüchsigen im Preußen des 19. Jahrhunderts erzählt, wurde u.a. mit dem Wilhelm-Raabe-, dem Wolfgang-Koeppen-Preis, dem Solothurner Literaturpreis und dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Thomas Hettches Essays sind ebenso genaue Diagnosen unserer krisengeschüttelten, entzauberten Moderne wie mutige Bestandsaufnahmen seines eigenen Bewusstseins und Denkens. Eine Frage bestimmt das Schreiben dieses Autors: Welche Tröstung kann Literatur für unsere leeren Herzen heute noch bieten?
»Unsere leeren Herzen« setzt nach »Fahrtenbuch« und »Totenberg« Thomas Hettches essayistisch-erzählerischen Erkundungen fort, mit denen er, neben dem hochgerühmten Romanwerk, seine intellektuelle Autobiografie fortschreibt.
Ohne kulturpessimistische Larmoyanz, aber im Wissen, dass sich Sinnfragen in unseren fundamental bedrohten westlichen Gesellschaften immer dringlicher stellen, befragt Thomas Hettche in seinen Essays leidenschaftlich die Literatur nach ihrem Sinn und ihrer Zukunft. Gegen den naiven Glauben einer Abbildbarkeit der Welt, der unsere Gegenwart beherrscht und das Glücks- wie das Erkenntnisversprechen der Literatur verrät, spürt Hettche den Quellen eines anderen Realismus, ja einer anderen Moderne nach.
Inhaltsverzeichnis
Vexierbild
Die Sprache der Fische
Realismus
Fortschritt
Die Moderne
Literatur und Freiheit
Literatur und Konvention
Literatur und Moral
Literatur und ihre Zwecke
Das Bild einer Toten
Marsyas
Paris
Mitsou
Literatur und die Unendlichkeit
Das Buch
Die Eberjagd
Peter Schlemihl
Aus der Ohm/wachsen Inseln
Theorie
Wir Barbaren
Die Liebe
Vexierbild
Etwas erzählen? Aber ich weiß nichts. So beginnt die Erzählung Das Eisenbahnunglück, in der Thomas Mann einen Schriftsteller von einem wenig spektakulären Unfall berichten läßt, der ihm auf der Fahrt mit dem Schlafwagen 1. Klasse von München nach Dresden zustößt. Im Jahr 2015, als ganz im Osten, am Rande Europas, plötzlich um dessen Grenze gekämpft wurde und ganz im Westen, in Paris, der Terror alles erschütterte, war ich selbst monatelang mit dem Zug unterwegs von Lesung zu Lesung, und eines Tages kam mir dabei jene Geschichte wieder in den Sinn. Bei einem Zwischenstopp zu Hause zog ich ungeduldig den Band mit Thomas Manns Erzählungen aus dem Regal, um irritiert feststellen zu müssen, daß die Geschichte, an die ich mich zu erinnern geglaubt hatte, offenkundig nicht Das Eisenbahnunglück war.
Wieder unterwegs, verfolgte ich die Nachrichten auf dem Smartphone, das ich nicht aus den Händen ließ, und starrte hinaus in das vorüberziehende Land. Tatsächlich erinnerte ich mich an wenig mehr als an den Eindruck einer bestimmten Atmosphäre der Furcht und daß es eine Eisenbahngeschichte gewesen war, eine Geschichte, die mit diesen Schienen zu tun hatte, auf denen ich jetzt fuhr und die einst aus topographischen Zufälligkeiten das Land geformt, die Kirchenuhren harmonisiert und alle Orte zu Punkten im Gewebe einer standardisierten Zeit und eines einheitlichen Raums gemacht hatten. So trostlos die heute verfallene Infrastruktur, die man nun als Reisender schier endlos passiert, all die überwucherten Gleise, die zerfallenen Stellwerke, die verrammelten Bahnhöfe, deren immer triumphale Backsteinarchitektur noch jetzt, da der Wind durch sie hindurchpfeift, an Stationsvorsteher in Uniform, an Wartesäle, Warenlager und all die Vorposten des Staates denken läßt. Phantombilder nie gewesener Vergangenheit, die einen unweigerlich begleiten, wenn man aus den unwirtlichen, von Vandalismus gezeichneten Überresten der Provinzbahnhöfe hinaustritt. Und deutlicher noch spürt man den Verlust jener Vergangenheit, seit der Terror eine geschärfte Aufmerksamkeit für den Augenblick zu verlangen scheint. Der Terror ist eine Frage, geeignet, uns in Frage zu stellen. Seine Gewalt wird verstärkt durch unsere Schwäche, deren Anzeichen die Verwahrlosung ist.
In einer der Städte meiner Lesereise, es war Minden in Westfalen, besuchte ich vor der abendlichen Lesung noch den Dom, den es dort gibt. Es war ein sonniger Februartag. Ich stand in dem menschenleeren hohen Kirchenschiff des ottonischen Baus und ließ die Proportionen auf mich wirken, betrachtete die Fenster, die Renaissance-Epitaphe an den Wänden, und ging schließlich vor zum Altar, um das Kruzifix anzusehen, das darüber schwebt. Doch als ich zu dem Kreuz hinaufspähte, verstand ich mit einem Mal, daß es sich bei meinem kunsthistorisch-genießerischen Blick, der ganz darauf aus war, sich überwältigen zu lassen, tatsächlich nur um die säkulare Schrumpfform jenes religiösen Empfindens handelte, das diesen Bau vor langer Zeit hervorgebracht hatte. Proust fiel mir wieder ein – als Denkmäler eines vergessenen Glaubens überdauern allein die Kathedralen, zwecklos und stumm –, und ich schämte mich meiner Genugtuung, ganz allein hier zu sein und ungestört an den leeren Bankreihen vorüberzugehen, und ich spürte schmerzlich, wie schön diese Kirche jetzt wäre mit all den Menschen, denen sie einmal ein Ort der Anbetung war. Wie leer, dachte ich, unsere Herzen sind!
Bevor ich wieder hinausging, blieb mein Blick an einem Stifterbild hängen, gleich links vom Eingang. Es drücke dieses Bild des sechzehnten Jahrhunderts, erklärte die daneben angebrachte Erläuterung, das Selbstvertrauen einer protestantischen Mindener Händlerfamilie nach der Reformation aus, in der großen Zeit der Hansestadt, als auch die schönen Häuser der Weserrenaissance entstanden, deren figurengeschmückte Giebel und vielfach gegliedertes Ziegelmauerwerk mir auf dem Weg vom Bahnhof schon aufgefallen waren. Lange besah ich die sorgsam gemalten weißen Krägen der Männer, die allesamt Spitzbärte trugen, und die kunstvoll gefältelten, ebenso weißen Hauben der Frauen. Es war dem Auftraggeber offenbar wichtig gewesen, seine ganze Familie abbilden zu lassen, sich selbst neben seiner Frau groß am Bildrand und dahinter, wie die immer kleiner werdenden Innenpuppen einer russischen Matrjoschka, seine zahlreichen Kinder, nach Geschlechtern getrennt und in der Größe sorgsam abgestuft, ganz am Rand winzige Wickelkinder. Alle trugen die gleichen schwarzen Gewänder, hatten dieselbe Haltung und denselben unendlich erwachsenen Ausdruck. Wohlanständigkeit, dachte ich zunächst, doch dann fiel mir der Widerspruch auf zwischen der vermuteten Modernität dieser Kaufmannsfamilie und ihrer maskenhaft-genealogischen Darstellung, und plötzlich sah ich nur noch einen Familienclan vor mir in körperfeindlicher Verhüllung, und das Sprichwort von der Haube, unter die jemand kommt, verlor für mich, kaum daß ich es dachte, alles Gemütliche.
Zurück auf dem Marktplatz, wollte es mir nicht mehr gelingen, hinter den stolzen Giebeln der reichverzierten Bürgerhäuser jene modernen Bürger zu imaginieren, die am Abend im Ratskeller die Politik der Stadt betrieben, sondern auch dort sah ich jetzt Sippen am Werk, die, unerbittlich aufeinander angewiesen, ebenso bigott wie glaubensvoll im asketischen Eifererschwarz in den heute leeren Kirchen sich versammelten. All die hochaufragenden Giebel um mich her schienen mir mit einem Mal näher an den vielstökkigen Lehmbauten von Sanaa als an den Einfamilienhäusern unserer Vorstädte, und ich verstand: Die Frage des islamistischen Terrors lautet, ob die Versprechungen, die die Kirchen leerten, tatsächlich eingelöst sind. Wir zögern mit der Antwort, verrostet doch der stahlgewordene Anspruch jener bürgerlichen Emanzipation, die einst die Kraft zu haben meinte, den metaphysisch heimatlosen Menschen auf ihren Schienen zu führen.
In seinen Notizheften schreibt Henning Ritter: Das Jahr 1979 könnte sich eines Tages als das wichtigste und folgenreichste seines Jahrhunderts erweisen. Denn damals wurde im Iran bewiesen, dass der Säkularisierung genannte Prozess umkehrbar ist und nicht, wie man bis dahin glaubte, unumkehrbar. Wie unerfreulich das Regime Chomenis auch gewesen sein mag, es enthielt eine optimistische Botschaft: Modernisierung ist kein Schicksal, das keine Auswege offen lässt. Seither hat es vielerlei Phänomene der Wiederkehr gegeben, als bedeutsames die Wiederkehr der Religion. Die Literatur hat von einer solchen Wiederkehr mit all ihren Wiedergängern und Gespenstern immer erzählt. Das Unheimliche und die Eisenbahn bedingen einander. Wieder zu Hause, suchte ich noch einmal nach jener Geschichte, an die ich mich dunkel zu erinnern meinte, und wollte schon aufgeben, als ich ratlos ein letztes Mal den Band mit Thomas Manns Erzählungen durchblätterte und bei einem Text hängenblieb, der unverdächtigerweise Der Kleiderschrank heißt, tatsächlich aber von einem Eisenbahnreisenden erzählt. Kein Bahnunglück – seltsam, daß wir auch noch heute kein anderes Wort für einen Verkehrsunfall auf den Gleisen haben –, sondern ein spontaner Entschluß veranlaßt ihn, seinen Zug zu verlassen und in einer fremden Stadt zu übernachten. Alles ist ganz konkret, die Gepäckaufbewahrung, das Gaslicht in der nächtlichen Provinzstadt, das möblierte Zimmer, und doch ist die Szenerie ganz unheimlich. Nachdem Thomas Manns Held das Flüßchen am Stadttor überquert hat, das mitsamt dem Kahn an Styx und Charon gemahnt, fällt er aus der modernen Zeit.
Ich schloß das Buch und legte es weg. Daran hatte ich mich in Minden erinnert. Ein Schritt aus dem Fahrplan hinaus führt sofort ins Phantastische. Die Frage des Terrors lautet: Können wir unsere Gesellschaft tatsächlich weiter als säkulare denken? Indem der Terror zu unserer Wirklichkeit wird, zeigt er die Lügenhaftigkeit einer Realität, von der man versprach, sie komme ohne Opfer und Transzendenz aus. Etwas erzählen? Aber ich weiß nichts. Mit diesen Worten läßt Thomas Mann seinen Erzähler zögern, und dieses Zögern erzählt, daß es nicht die Geschichte ist, um die es ihm geht. Es geht um eine alltägliche Realität, deren Haut zerreißt. Es geht um eine Literatur, die angesichts der Realität des Terrors beides in den Blick nimmt: das Tatsächliche und seine Bedeutung. Die Tatsachen, schreibt Ludwig Wittgenstein, gehören alle zur Aufgabe, nicht zur Lösung.
Thomas Mann: Das Eisenbahnunglück./Der Kleiderschrank. In: Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, Band 2.2. Frühe Erzählungen 1893–1912. Frankfurt am Main 2004. | Marcel Proust: Der Tod der Kathedralen. In: Frankfurter Ausgabe. Herausgegeben von Luzius Keller. Werke I, Band 2. Nachgeahmtes und Vermischtes. Aus dem Französischen von Henriette Beese, Ludwig Harig und Helmut Scheffel. Frankfurt am Main 1989. | Jürgen Habermas: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Main 2005. | Henning Ritter: Notizhefte. Berlin 2010. | Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt am Main 1963.
Die Sprache der Fische
Beim Betrachten eines römischen Mosaiks des Tierbeschwörers Orpheus, das sich in Rottweil am Neckar erhalten hat, muß ich an eine Begegnung während meiner Anreise am Vortag denken, die mir nicht aus dem Kopf geht. Feierabendverkehr auf der Autobahn, eine Baustelle, Schrittgeschwindigkeit. Ich überhole einen Tiertransporter, dessen untere Luken sich auf der Höhe meiner Seitenscheiben befinden, und plötzlich sehe ich Schweine rechts von mir, schöne, saubere Schweine mit weißen Härchen und rosa Haut. Ihre Schnauzen recken sich aus den vergitterten Öffnungen, schnuppern und schnüffeln die Luft, die sie auf dieser Fahrt zum ersten und letzten Mal in ihrem Leben riechen. So eng eingepfercht, daß neben jeder Schweineschnauze ein gekringeltes Schweineschwänzchen zu sehen ist, drängen die einen sich neugierig an den Hinterbacken der andern vorbei, um hinauszusehen, und sehen mich dabei mit ihren zartbewimperten hellen Augen an.
Ich überhole den LKW, um diesen Blicken zu entkommen, dann überholt er mich aufs neue, die Schweine verschwinden aus meinem Gesichtsfeld, tauchen wieder auf, verschwinden erneut, so geht das über Kilometer. Schließlich aber endet die Baustelle, die Geschwindigkeitsbegrenzung wird aufgehoben, und gleichauf mit dem Führerhaus des Viehtransporters sehe ich zum Fahrer hinauf, und er sieht zu mir herab, während er mich mit triumphierendem Lächeln überholt. Die ruckartige Beschleunigung wirft die Schweine, die wieder in mein Blickfeld kommen, durcheinander, ich höre ihr Quieken und sehe einen langen Moment in ihre jetzt angstgeweiteten Augen, bevor die Autobahn auch vor mir endlich frei ist, ich wie erlöst Gas gebe und nun endgültig an ihnen vorbeiziehe.
Und als ich dann, einen Tag später, im Dominikanermuseum in Rottweil vor jenem römischen Mosaik stehend, nicht aufhören kann, an diesen Moment zu denken, lese ich auf einem kleinen Schildchen plötzlich, Orpheus symbolisiere die Überlegenheit des Menschen über die Natur. Sofort protestiere ich innerlich gegen diese Deutung des Schutzheiligen der Dichter, der so schön sang, daß ihn selbst die Tiere verstanden. Es geht nicht um Überlegenheit. Aber wer benennt, bringt zum Schweigen, was er bezeichnet. Im stummen Blick der Tiere schaut diese unvermeidliche Schuld uns an. Deshalb ängstigen und betören ihre Blicke uns gleichermaßen. Immer schon haben die Schriftsteller diese Schuld aufzuheben versucht, und so haben Tiere in der Literatur von jeher eine besondere Stellung, zu der auffallend oft gehört, daß sie sprechen können. Als sollten all die flüsternden Hunde und Füchse und Fische der Romane eine alte, magische Angst vor unseren sprachlosen Mitgeschöpfen besänftigen und als könnten wir Schriftsteller nicht von dem Glauben lassen, gerade das, was von der Natur uns trennt, die Sprache, könnte auch das sein, was uns mit ihr versöhnt. Denn nie können wir ihr entkommen. Nicht einmal vorstellen können wir uns, daß ein Lebewesen ohne Sprache sei. In Rilkes Sonetten an Orpheus heißt es:
Sieh in der Schüssel, auf heiter bereitetem Tische,
seltsam der Fische Gesicht.
Fische sind stumm …, meinte man einmal. Wer weiß?
Aber ist nicht am Ende ein Ort, wo man das, was der Fische
Sprache wäre, ohne sie spricht?
Im Sommer 1792 verlangte das revolutionäre Paris die Auflösung der königlichen Menagerie in Versailles im Namen der Menschen und der Tiere. Viele der exotischen Tiere landeten bei den Pariser Metzgern, jene fünf aber, die überlebten, bildeten den Grundstock des Jardin des Plantes, des ersten wissenschaftlichen Zoos der Welt. Als ich nach meinem Museumsbesuch am Rande des Wochenmarktes von Rottweil in einem Café sitze, trottet ein Exemplar jener Hunderasse an mir vorüber, die den Namen der Stadt trägt und die sich in dieser Gegend bis in die Zeit zurückverfolgen läßt, als man Orpheus hier aus unzähligen bunten Steinchen sein Denkmal setzte. Von jeher werden Rottweiler dazu gezüchtet, für die Viehhändler und Metzger das Vieh in die Schlachthöfe zu treiben. Und in der Erinnerung an die hellbewimperten, entsetzensoffenen Augen der Schweine denke ich, alles wäre gewonnen, verstünden wir nur die Sprache der Metzgerhunde.
Rainer Maria Rilke: Die Sonette an Orpheus. In: Sämtliche Werke. Herausgegeben vom Rilke-Archiv. In Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke besorgt durch Ernst Zinn. Erster Band. Frankfurt am Main 1955.
Realismus
Wir leben inmitten einer Revolution, deren Tragweite einzuschätzen uns deshalb so schwerfällt, weil wir auf die Wahrnehmung katastrophaler Umstürze eingerichtet sind, nicht auf langsame Veränderungen. Ereignete sich der Umbruch unserer Gegenwart in einer uns gemäßen Taktung, dann sähen wir: Massen stürmen durch die Straßen, Brände brechen aus, Fenster zersplittern, Türen werden aus den Angeln gehoben, Explosionen sind zu hören. Keine Zeit, die Zerstörung zu betrauern. Alles hängt davon ab, schnell zu verstehen, welche neuen Sichtachsen und Perspektiven sich dadurch ergeben, daß die Paläste unserer Vergangenheit zusammenstürzen. Benommen steige ich die trümmerübersäten Stufen zum Literaturmuseum hinauf, an dem ich mich – wo sonst? – gerade befinde.
Katastrophe ist immer Gegenwart. Was ihr als erstes zum Opfer fällt, ist Historie und Wissenschaft, es zerklirren die Sammlungsschränke der Archive, und die Exponate rollen über den Boden, es wird wieder freigesetzt, was für alle Zeiten geordnet schien, und erneut muß sich erweisen, was wozu taugt. Manches kann man essen, manches verheizen. Manches kann man lesen, als wäre es gerade eben erst geschrieben. Ich gehe die zerbrochenen Vitrinen entlang und trete vorsichtig auf die knirschenden Glasscherben unter meinen Füßen, während man draußen nach dem Fleisch der Giraffen aus dem aufgelassenen Zoo schreit. Schließlich bleibe ich stehen, greife durch das zersplitterte Glas und ziehe probeweise Wilhelm Raabe hervor. Muß ihn erst losnesteln von den Nadeln, mit denen die Literaturgeschichte ihn angeheftet hat neben den Erläuterungstafeln zum Realismus, dicht bei den Häuten von Keller, Fontane und Freytag. Ich schüttle den staubigen Balg, schüttle ihn auf wie ein Kissen, und im Nu gewinnt er Volumen. Ich stelle ihn auf seine Füße, und siehe da: Er lebt.
Und? Kann er uns von Nutzen sein in unserer Zeitlupenkatastrophe? Raabe, der geboren wurde, als Goethe noch lebte, und im selben Jahr starb, als Rilkes Malte Laurids Brigge erschien?
Es ähnelt seine Epoche in vielem der unseren, 1848 gleicht 1968, bald nach dem großen Aufbruch war die politische Utopie ausgeträumt. Der Fortschritt, den man erkämpft hatte, führte zu einem ökonomischen und gesellschaftlichen Umbau, den man so nicht gewollt hatte und der schnell auch das Feld der Literatur erreichte: Verlage, Zeitschriften – Westermanns Monatshefte, Die Gartenlaube –, Feuilletons, Lesevereine, Büchereien, günstige Volksausgaben der Klassiker in der Reclamschen Groschenbibliothek, wie Raabe spottete, alles boomte! Das Ergebnis aber war keineswegs größere Bildung, sondern die Ausbildung eines Massengeschmacks, der nach immer neuem Lesefutter verlangte. Die erste Generation von Autoren konnte eine ökonomische Existenz als freie Schriftsteller führen. Unterhalt gegen Unterhaltung nannte Wilhelm Raabe das, der dazugehörte. Früh erfolgreich, kam er zeitweise aus der Mode, setzte sich dann jedoch durch, auch ökonomisch.
Daß er heute weitgehend vergessen ist, hat mit einer einschneidenden Neubewertung der Literatur seiner Zeit zu tun. Bezeichnend, wie sich etwa Georg Lukács in einem Aufsatz von 1909 darüber mokierte, Mörike sei Pfarrer, Storm Richter gewesen und Keller Staatsschreiber, es sei in ihren Leben also all das geordnet, woraus für andere die unlösbare Tragik des Verhältnisses von Kunst und Leben entstand. Dieses vermeintliche Philistertum war in den sozialen Erschütterungen des neuen Jahrhunderts plötzlich démodé, lieber schwärmte man für den Furor Flauberts, die Christusgestalt Dostojewski, den heiligen Trinker Poe, entdeckte Hölderlin, Büchner und Kleist wieder, das Brennen der Kerze an beiden Enden. Und dabei ist es geblieben. Die Genieästhetik der Goethezeit im jeweils neuen Gewand ist noch immer das Paradigma, innerhalb dessen wir Literatur lesen und bewerten.
Heute scheint dies zweifelhafter denn je. Zum einen gibt es die bürgerliche Welt, gegen die sich die verschiedenen Avantgarden richteten, nicht mehr. Durch ihre geschleiften Bastionen bricht zur Zeit die Technik und räumt ab, was noch übrig war. Zum andern haftete jener Vorliebe für die Tragik des Künstlers immer schon etwas Vampirhaftes an, als ob sein Leid vorrangig dazu diene, die eigene Fühllosigkeit zu sublimieren, was sich noch verstärkt im digitalen Raum, den die aktuelle Revolution errichtet. Wobei die jeweiligen Leiden der Künstler, über die ihre Werke einzig diskutiert werden, wie Moden wechseln. Zur Zeit importiert man das Leid gern und besieht sich Folterspuren an Leib und Seele, die in anderen Kulturkreisen zugefügt werden. Voyeurismus, notdürftig gerechtfertigt durch das Pathos des aufklärerischen, kritischen Diskurses seit nunmehr über hundert Jahren.
Das Dispositiv dieses Diskurses, der unser Denken bestimmt, ist ein großes Nicht mehr. Doch glauben wir sie tatsächlich noch, diese ewige Auflösungsgeschichte, so lange erzählt, und immer, als wäre es ein böses Märchen, zu einem nie eingetretenen guten Ende hin? Auflösung der Tradition, Auflösung der künstlerischen Formen, Auflösung der bürgerlichen Öffentlichkeit – und all das bejaht im Zeichen der Avantgarde? Hilft uns das in einer Zeit, in der es längst nicht mehr darum gehen kann, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, die in den Erschütterungen der Gegenwart gerade dabei sind einzustürzen? Könnte nicht vielleicht jenes große Nicht mehr genauso gut wieder ein Noch nicht sein? Zumindest in der Literatur? Haben wir uns nicht viel zu sehr daran gewöhnt, immer nur als Verfallsgeschichte zu sehen, was doch mit Fug und Recht auch ein Werdendes genannt werden könnte? Raabes Schreiben, hieße das, verstanden als utopisches Projekt.
Noch immer steht er vor mir in den knirschenden Scherben des Sammlungsschrankes, in denen er eingesperrt hing, befreit durch die Katastrophe unserer Gegenwart, die lärmend draußen tobt. Zögernd betrachte ich ihn. Weshalb gerade Raabe?
Zunächst, weil er den Dichterhabitus konsequent verschmähte. Er schien ihm im neuen massenmedialen System der Literaturproduktion überlebt, heftig polemisierte er gegen die Literatur-Unsterblichkeitsansprüche der Kollegen und setzte sein Selbstverständnis als Handwerker dagegen, inklusive Dienstjubiläen und Eintritt in den Ruhestand. Man hat das als Philistertum denunziert. Tatsächlich aber ist Raabes Weigerung, über sich selbst Auskunft zu geben, atemberaubend aktuell. Er verzichtete auf ein Schicksal, das ihn im Zusammenklang mit seinen Werken interessant gemacht hätte, weil, wie er die Aufgabe des Schriftstellers begriff, er keines mehr haben konnte. Sein Lebensradius, von der Arbeit bestimmt, war klein, seine Tagebücher sind unergiebig, es gibt keine Leitartikel und Bekenntnistexte von ihm. Was er über sich zu sagen hatte, hat er in seiner Literatur gesagt.
In einer lakonischen Notiz von 1871 heißt es, er hoffe, es beginne nach abgeschlossenem Frieden eine sehr günstige Zeit für die »Romanschreiber«. Diese Hoffnung bringt eine ästhetische Haltung zum Ausdruck, die nicht das Leid der Menschen bejaht, weil es bessere Kunst hervorbringe. Stattdessen wünscht Raabe den Menschen Frieden und also die Freiheit von äußerlichen Nöten, die es braucht, Literatur um ihrer selbst willen lesen zu können. Darauf richtete sich sein permanentes Nachdenken über die Wirkung seiner Texte. Raabe nahm den ganz unterschiedlichen Bildungshintergrund seiner großen Leserschaft stets ernster als jene, die wie Storm ihr Heil in der Kanonisierung suchten. Raabes Weg war ein anderer. Seine Romane sollten, vor allem die späteren, ebenso eine naive wie eine komplexe Lektüre ermöglichen, darauf richtete sich sein ganzer Ehrgeiz. Daß nur wenige es merken werden, nämlich die Komplexität der Struktur, rühmte er stolz an seinem Stopfkuchen.
Sein ganz konkretes Erzählen, das thematisch provinziell, biedermeierlich anmutet, löst sich bei genauerem Hinsehen stets auf, indem Raabe seine Geschichten durch vielfältige Perspektivwechsel und durch ein Zitatgewebe, aus dem die Romanräume geschichtet zu sein scheinen, immer wieder brach. Wobei gerade die überschaubaren Räume ihm seine charakteristische Beweglichkeit in der Zeit ermöglichten, sein Springen vor und zurück im Erzählen, als wäre die Geschichte der Faden, der die verschiedenen Bedeutungsebenen wie Stoffe miteinander vernäht, Schicht um Schicht, dabei eine Unzahl von Anspielungen, Bezügen, Zitaten aller Gattungen und Textformen einarbeitend, von literarischen Texten über Märchen und Zeitungsmeldungen bis zu zeitgenössisch trivialen Kriminal- und Kolonialgeschichten.
Die Raabeforschung liest derlei gemeinhin als Zerstücklung, Fragment oder Bruch und schlägt den Autor wahlweise mit Jean Paul der Romantik oder mit Bachtin einer subversiven Literatur des Grotesken zu. Ich halte dies für zutiefst ideologisch: Einzig der Perspektive des Nicht mehr wird Modernität zuerkannt. Es ist offensichtlich, wie sehr sich dieser Schriftsteller, statt um die Gestaltung eines Zerbrechenden, um ein sich Fügendes bemüht hat, nicht um Auflösung, sondern um Vermittlung. Raabes Kunst liegt gerade darin, den Eindruck zu erwecken, als gäbe es keine Hierarchisierung all dieser Binnengeschichten und Zitate, sondern alles wäre immer schon da, Teil eines allgemeinen Erzählraums, dem der Leser wie der Roman, den er gerade liest, gleichermaßen und gleichberechtigt angehören. Ganz so, als machte er auf diese Weise den Ort seiner Romane, die als Fortsetzungstexte auf den Seiten der Zeitschriften inmitten anderer Texte aller Couleur erschienen, zum fruchtbaren ästhetischen Boden seines Schreibens.
Wilhelm Raabe schuf so eine schwebende Balance der Erzählung, die mir das Entscheidende an seinen Romanen ist. Jede Ordnung – im Stopfkuchen etwa oder den Akten des Vogelsangs – wird im Fallen geschildert, jedoch darin gehalten, destabilisiert und stabilisiert