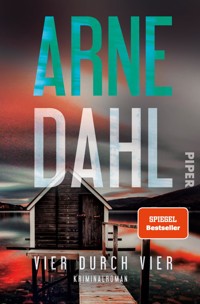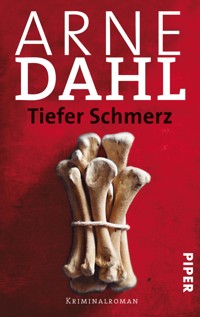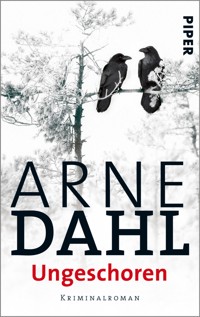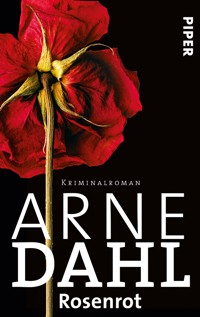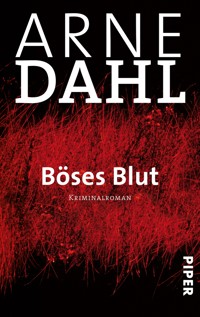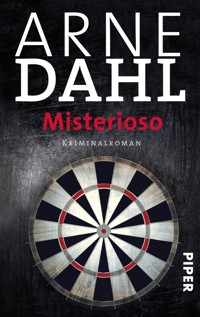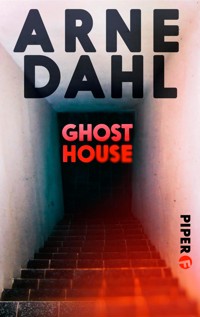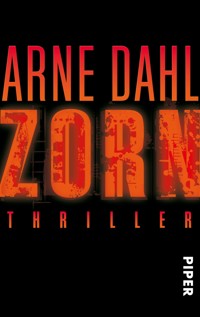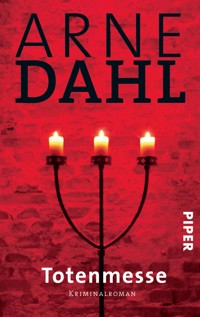
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Banküberfall samt Geiselnahme in Stockholms Nobelviertel Östermalm eröffnet für die Sonderermittler um Kerstin Holm und Paul Hjelm die gnadenlose Jagd nach einer geheimen Formel, für die viele Leute über Leichen gehen würden. Der raffiniert verschachtelte Fall, der die geballte Kompetenz des Stockholmer A-Teams erfordert, führt bis nach Wolgograd und zurück in die Zeit des Kalten Krieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95115-9 © Arne Dahl 2004 Titel der schwedischen Originalausgabe: »Dödsmässa«, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2004 © der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2009 Umschlagkonzeption: semper smile, München Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München Umschlagfoto: bobsairport Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Guide
Fossilien, dachte er, überall Fossilien. Auf der obersten Treppenstufe hielt er inne.
Sein Fuß bedeckte zur Hälfte das wohlbekannte Muster auf der rötlichen Granitfläche der Kellertreppe. Mit einem leisen Kratzen bewegte er den Fuß zehn Zentimeter zur Seite, sodass der ganze Orthozeratit sichtbar wurde. Das Urzeitrelikt glänzte schwach im Dämmerlicht, das durch die vom Großstadtstaub verschmutzte Scheibe der Kellertür hereinfiel.
Er blickte zu den petroleumgrauen Wolken auf und sah in einem Augenblick der Klarheit, dass der Himmel dahinter vollkommen blau war.
Klarblau.
Es dauerte nur einen Augenblick. Dann war der Himmel wieder grau, grau wie gewöhnlich, grau von verbrannten fossilen Brennstoffen.
Unter dem Fuß Fossilien und Fossilien über dem Kopf, in den Lungen, im Blutkreislauf.
Die Unauslöschlichkeit des Vergangenen.
Aber der Himmel kann wieder blau werden, dachte er und schlug mit der Hand auf die Innentasche seines Kordjacketts.
Er schloss die Augen und atmete tief. Er sollte an den Tod denken. Er war ein bisschen enttäuscht von sich selbst. Es kamen keine existenziellen Gedanken über den magischen Charakter des Todesaugenblicks, über den Zustand, von dem niemand erzählen kann. Keine göttliche Offenbarung, keine letzte Einsicht in einen Sinn jenseits des Vergehens, kein Leben, das vor seinem inneren Auge Revue passierte.
Er lachte auf. Stumm. Da war nicht viel Leben, das Revue passieren könnte. Vielleicht geschah es gerade jetzt, ohne dass er es merkte. Vielleicht rollte die Leere, die Nichtigkeit, die Erbärmlichkeit vorüber, ohne auf seiner Hirnrinde einen einzigen Abdruck zu hinterlassen.
Die leere Geschichte seines Lebens.
Stattdessen dachte er an Dinosaurier. Eine Welt, die unterging und einer neuen den Weg bereitete. Tote Dinosaurier, die unter die Erde gepresst und zu Öl, Kohle und Gas werden, die dort ruhen, bis die nächste Welt sie ausgräbt und verbrennt und die giftigen Rückstände zum Himmel schickt.
Der Himmel ist von ausgestorbenen Dinosauriern bedeckt.
Er lachte erneut. Wieder stumm. Strich mit der Hand über den Umschlag in seiner Innentasche und dachte an die drei. Die drei Karten, die drei toten Brüder, die schweigende Bruderschaft im Keller, die von einer flammenden Hölle umzingelten glasklaren Gedanken.
Vater, dachte er.
Vorsichtig schob er die Kellertür einen Spaltbreit auf. Die feuchte Kühle des Frühsommermorgens drang sofort durch die Kleidung. Nahm er an. Denn spüren konnte er sie nicht. Auch den muffigen Großstadtgeruch nahm er nicht wahr. Er musste sich auf anderes konzentrieren.
Manchmal schaltet ein Sinn den anderen aus. Um mehr Raum zu bekommen. Alles, was er benötigte, waren Ohren und Augen. Nie mehr würde er einen Geruch oder einen Geschmack wahrnehmen, nie mehr eine Berührung spüren. Aber er würde noch sehen und hören. So viel wie möglich. Bis zum Ablieferungsort. Dann würde der Tastsinn für die letzten Sekunden alles übernehmen. Er hoffte, dass es wenige sein würden.
Ja, Herrgott, dachte er und blickte hinaus. Die Straße lag verlassen da. Etwas anderes hatte er auch nicht erwartet. Sie wussten, wie man unsichtbar bleibt. Alle beide. Beide Lager.
Wenn es nicht mehr als zwei waren.
Die frühen Stunden. Wann enden die frühen Stunden?
Während er auf die Straße schlich, fiel ein letzter Blick auf das Fossil auf der Treppe. Näher bin ich einem Haustier nie gekommen, dachte er.
Näher bin ich einer Familie nie gekommen.
Der Ablieferungsort, dachte er. Darum geht es jetzt. Nur darum.
Es war eine Seitenstraße, etwas verwahrlost. Eine Gasse. Ein Ort für einen Überfall. Ein verborgener Ort. Eine verborgene Tür zu einem verborgenen Ort.
Als würden sie ihn nicht kennen.
Als würden sie nicht auf der Lauer liegen.
Als wären sie nicht schon jetzt, vor dem Anstieg, hinter ihm her.
Es war eine flache Stadt. Er kannte nicht viele andere Erhebungen. Doch hier kam man herauf und hatte einen Überblick über die materialisierten Träume.
Träume, die sich materialisieren, werden zu Albträumen.
Er liebte diesen Ort, den winzigen Park mit einer einzigen Bank, auf der man sitzen und sehen konnte, wie die Mauer sich ausbreitete, mit dem Niemandsland als einer Zone, die mehr mit Wahnsinn als mit Minen vermint war. Und es gab ziemlich viele Minen.
Doch jetzt blieb er nicht stehen. Im Laufschritt durchquerte er die Stadt. Keine Spur von Leben.
Und dort unten im Grau – einem künstlichen Nebel, der vermutlich aus verbrannten fossilen Brennstoffen bestand, alten Dinosauriern – schlängelte sich die Mauer dahin, bis sie von dem grauen Himmel verschluckt wurde, der die Sonnenscheibe, die er nur sah, wenn er sich umdrehte, nicht zu verdecken vermochte.
Denn die Sonne geht im Osten auf.
Und sein Blick war nach Westen gerichtet.
Als er sich umwandte, um die Sonne zu sehen, ahnte er in der Stille eine Bewegung. Vielleicht war die Bewegung nicht hinter seinem Rücken, sondern in seinem Kopf. Dort hatten sich im Verlauf der letzten Wochen viele Dämonen eingenistet. Im gleichen Maße, in dem sie in der Außenwelt auftauchten. Oder umgekehrt.
Es war schwer, die äußeren Dämonen von den inneren zu unterscheiden.
Ihre Zahl war Legion.
Herrgott, der Ablieferungsort. Es war noch zu weit. Sie durften noch nicht kommen. Wie sollte er es schaffen? Er machte längere Schritte, aber er durfte nicht rennen. Dann wüssten sie, dass er sie gesehen hatte, und würden ihn einfach greifen. Dann wäre die Hölle los.
Sie hielten sich noch zurück, warteten. Er wusste nicht genau, worauf.
Noch einmal fuhr er mit der Hand über die Innentasche – und zugleich über sein Herz. Doch, es schlug noch. Unter dem Tagebuch und den drei Teilen in dem ockerfarbenen Umschlag.
Ohne das schlagende Herz wäre nichts. Nur drei Papierstücke.
Die drei toten Brüder, deren Vater er gewissermaßen war.
Vater, dachte er. Hätte ich dich doch getroffen.
Wenn du dies hier hättest sehen können, dachte er und machte längere Schritte. Sein Blick schweifte über die Stadt. Die Fassaden der Häuser, die noch standen, waren zerfressen. Eine graue Ruinenstadt mit noch grauerem Himmel.
Davon hast du nicht geträumt. Jetzt weiß ich, wie du gedacht hast. Jetzt habe ich endlich deine Worte gelesen.
Deine Träume waren größer als das hier.
Aber das hier ist alles, was ich gesehen habe. Meine Stadt. Die Mauer, die ewige Mauer, dort draußen und ebenso in meinem Kopf. Und die fossilen Brennstoffe bewohnen meinen Körper.
Ein einziges Mal hatte er die Stadt verlassen können. Es war nicht einfach gewesen. Nach Moskau. Um die Vergangenheit zu besuchen.
Um die Vergangenheit zu verändern.
Noch sah er den Park nicht. Wenn die ersten Baumkronen auftauchten, würde er anfangen zu laufen. Erst dann. Die Frage war vor allem, wann sie ihn greifen würden. Denn wer es tat, spielte kaum eine Rolle.
Es gab drei Wege zum Park. Er hatte sie im Kopf. Die anderen sicher ebenso, aber es sollte möglich sein, sie zu täuschen. Es sollte möglich sein.
Rein theoretisch.
Noch ein Blick zurück über die Schulter. Ein Mensch jetzt – oder eher eine rasche Bewegung zu einer Haustür hin. Einen Moment noch als Abbild auf der Netzhaut. Eine optische Erinnerung.
Er wusste, wer sie waren. Diese übertrieben gut geschneiderten Anzüge, als hätten sie alle denselben Schneider. Die Anzüge des Bruderlands sahen anders aus. Als hätten sie überhaupt keinen Schneider. Aber sie waren bestimmt auch in der Nähe.
Die russischen Anzüge. Wie eine Schar von Bauern.
Noch keine Baumwipfel. Und das Licht der Dämmerung, das sich durchs Grau zwingt. Aber noch keine Menschen.
Keine außer ihnen. Verstecken sie sich nicht mehr? Die gut geschneiderten Anzüge scheinen jetzt überall zu sein. Oder sind sie nur in meinem Kopf?
Zwei jetzt. Scharfe Konturen gegen die matte Sonnenscheibe. Kein Grund, sich länger zu verstecken.
Dann war es so weit. Er bog an einem Zaun ab, lief über einen Spielplatz, schwang sich über eine Hecke, nahm eine Seitenstraße an einer Kreuzung und rannte. So schnell er konnte.
Der zweite der drei Wege zum Park.
Schritte. Er hörte die Schritte. Das Knirschen auf dem Kies des Spielplatzes. Du schaffst es. Du kannst es schaffen. Du kannst es immer noch schaffen.
Er bog um eine Kurve und rannte eine größere Straße entlang, bog wieder ab, durch einen Hinterhof, in eine Waschküche und auf der anderen Seite wieder hinaus. Keine Schritte mehr.
Wirklich nicht? Er konnte nicht stehen bleiben, um zu horchen. Und noch keine Baumwipfel.
Er tat es trotzdem. Blieb stehen. Lehnte sich an eine Haustür, die tief in die Fassade eingelassen war. Horchte.
Kein Laut. Sah sich um.
Ein Straßenkehrer fünfzig Meter entfernt. War es nicht zu früh für Straßenkehrer? Er meinte, unter dem Blaumann einen bäurischen Anzug zu erkennen.
Und lief in die entgegengesetzte Richtung. Bis er tatsächlich über den Fassaden die Baumwipfel sah.
Waren sie wirklich da?
Nichts war sicher. Außer dem Ablieferungsort, dem Umschlag in der linken Innentasche. Und der Pistole in der rechten.
Er rennt. Dreht sich um. Der Straßenkehrer ist weg. Bewegungen in den Gassen. Verdammt. Bäurische Anzüge.
Und vor ihm der Park. Kurz, weit; weit, kurz. Weiß nicht, kann sich nicht entscheiden. Läuft.
Schritte, Laufschritte. Wo? Woher? Hinter ihm? Vor ihm?
In den Park. Zwischen die Bäume. Der tiefste Punkt des Wäldchens. Laufschritte. Wo? Bitte, ihr dürft mich jetzt nicht sehen, nicht jetzt, wo ich den Umschlag in das Loch hinter den Zweigen des am schwersten zugänglichen Baums schiebe.
Seht mich jetzt nicht, ihr Teufel.
Und er durchquert den Park. Etwas leichter. Jeder Schritt ein Sieg. Jeder Schritt, den er lebend tut. Er ist jetzt fast auf der Straße. Läuft wie wild jetzt, rast. Ein Scharren auf dem Asphalt. Der Straßenkehrer. Er nimmt ihn aus dem Augenwinkel wahr.
Alles ist so unsäglich dumm.
Es sind vier. Ein Straßenkehrer und drei in bäurischen Anzügen. Er wird ihnen nicht entkommen. Eigentlich läuft er nicht vor ihnen davon, sondern von dem Baum weg, dem Ablieferungsort. Jeder Schritt ein Sieg.
Sie kommen näher und näher. Dann bleiben sie plötzlich zurück. Warum? Er läuft weiter und begreift. Er sieht die Umrisse gegen die verschmutzte Sonnenscheibe, die noch immer nicht komplett ist. Er sieht die Umrisse der maßgeschneiderten Anzüge. Er hält inne. Sieht sich um. Der Straßenkehrer und die drei Bauern warten ab, gehen langsam weiter. Die Maßgeschneiderten auch, von der anderen Seite.
Er selbst ist zwischen ihnen. Ohne Ausweg.
Doch hinter ihm ist eine kleine Kirche. Sie dient nur noch als Kartoffellager. Er erkennt sie. Er ist hier getauft worden.
Ich wünschte, ich könnte beten.
Zu dir, Gott, an den ich nicht glaube.
Und die Zeit wandelte sich. Er blieb stehen. Atmete aus. Lächelte. Lachte vielleicht. Sank in die Hocke, den Rücken an der Kirchenwand. Nur Fassaden. Keine Alternative. Keine Alternative zur rechten Tasche. Zur rechten Innentasche.
Er zog die Pistole hervor. Nicht um zu töten. Sondern um zu sterben.
Er hockte an der Wand. Die Pistole schleifte über den Asphalt. Zeichnete unlesbare Figuren. Er schaute nach rechts. Die Straßenkehrergang näherte sich. Bauernlümmel. Ihre Blicke waren nicht mehr auf ihn gerichtet. Vielmehr auf die vier Maßgeschneiderten, die von links kamen. Er wandte den Blick dorthin.
Keiner sah ihn an. Keiner schien ihn zu sehen.
Und da begann er zu schießen. Nach beiden Seiten. Hoch über ihre Köpfe. Er wollte nicht sterben als einer, der getötet hat.
Ich sterbe, ohne getötet zu haben, dachte er und schoss.
Sie dürfen mich nicht kriegen. Das habe ich immer gewusst. Sie würden mich dazu bringen, alles zu verraten.
Er hatte noch eine Kugel.
Er drückte nicht ab. Wartete. Beobachtete ihre Reaktionen. Sah, wie es beide Lager durchzuckte. Ein kollektives Zucken von einer abgründigen Einsicht.
Sie kam in der Sekunde, in der er den Mund öffnete und den Pistolenlauf hineinschob.
Sie kam viel zu spät.
Vater, dachte er.
Dann war der Himmel vollkommen klarblau.
Viggo Norlander war kein Polizist. Heute nicht. Nicht an diesem schönen Sonntag Mitte März.
Heute war er Pfleger.
Kümmerte sich um einen Pflegefall.
Einen Wahnsinnigen, der in die Randbezirke des Universums fahren und Geld für alte Möbel zum Fenster hinauswerfen wollte, statt neue bei Ikea zu kaufen.
»Es wird Spaß machen«, hatte der Pflegefall gesagt. »Ein Familienausflug.«
»Schnauze«, hatte Viggo Norlander mit erlesener Finesse entgegnet.
Woraufhin sich die beiden Familien in einem alten Minibus der Marke Toyota Picnic zusammenpferchen ließen. Neun Personen auf einem Familienausflug nach Roslagen. Und von diesen neun Personen hatte nur eine gute Laune.
Nämlich der Pflegefall.
Der auch noch fuhr, und zwar gern, aber erbärmlich. Darin waren die übrigen acht einer Meinung.
Der sehr weißhaarige Pflegefall an Viggo Norlanders Seite besaß zweifellos eine gewisse Fähigkeit, in seiner eigenen Welt zurechtzukommen.
Er sah sich um und verkündete der sauertöpfischen Schar: »Seht nur, wie schön der Schnee auf dem Dach der Roslags-Bro-Kirche glitzert. So ein Anblick muss die heimkehrenden Kreuzfahrer nach dem zweiten Kreuzzug im Winter 1150 empfangen haben. Nach Jahren von Krieg und Leid die Rückkehr ins Paradies.«
»Du solltest lieber auf die Straße achten, Arto«, entgegnete seine Frau schüchtern von der Rückbank.
Arto Söderstedt waren ihre Worte jedoch ebenso entgangen wie die Tatsache, dass der Minibus auf der schlecht geräumten Landstraße schon dreimal den Straßengraben tangiert hatte.
Seine Frau Anja war eine tolerante Ehefrau, die sich selten den Einfällen ihres Mannes widersetzte. Vielleicht war sie auch nur realistisch genug, um einzusehen, dass es sinnlos gewesen wäre. Stattdessen warf sie einen besorgten Blick auf die zweite Frau im Wagen, Viggo Norlanders Lebensgefährtin Astrid. Obwohl deren Töchter Charlotte und Sandra immer wieder wie Fäustlinge auf ihren Kindersitzen hin und her geworfen wurden, schien sie die Situation nicht zu beunruhigen. Dagegen war sie immer noch wütend auf Viggo.
»Aber du begreifst nicht, Astrid«, hatte Viggo Norlander gesagt, als sich das Paar am Samstagabend zu entspannen versuchte, nachdem die beiden kleinen Mädchen endlich im Bett waren. Viggo hatte sie durch ein Bettwetthüpfen aufgeputscht, was ihm nicht nur schmerzende Knochen, sondern auch eine Gardinenpredigt eingebracht hatte.
»Was begreife ich nicht?«, hatte Astrid in einem Tonfall gefragt, der in seiner Sanftheit mindestens so entschieden war wie Arto Söderstedts zerstreute Variante.
Viggo Norlander hatte es versucht: »Er hat sich in den Kopf gesetzt, irgendwo in Norrland auf einer Auktion einen alten Schreibtisch zu kaufen. Klingt das wirklich aufregend? Wir könnten stattdessen etwas Nützliches tun, wir sollten … tja … zu Ikea fahren und einen Badezimmerschrank kaufen.«
»Ich finde, es klingt spannend«, hatte Astrid geantwortet.
Damit war die Entscheidung gefallen.
Jetzt erwiderte Astrid Anjas Blick und verdrehte die Augen zum Himmel. Es war ein Augenverdrehen von der Art, die Frauen auf der ganzen Welt beherrschen. Es bedeutet: Männer! und überwindet jede Sprachbarriere.
Hinten im Wagen waren die Proteste deutlicher. Von den fünf Kindern der Familie Söderstedt hatten die beiden ältesten, Mikaela und Linda, freibekommen. Aber Peter, Stefan und die kleine Lina waren mit von der Partie, und wenn sie sich nicht prügelten, bockten sie.
Der Einzige auf der Vorderbank, der das ewige Gezanke hörte, war Viggo Norlander. Er versuchte, es auszublenden, indem er sich in den Straßenatlas vertiefte. Es gelang ihm nicht besonders gut. Er konnte die Kinder auch nicht anbrüllen, weil es nicht seine waren. Und der Vater legte die übliche Verantwortungslosigkeit an den Tag, wie er da mit dämlichem Lächeln am Steuer saß.
»Pflegefall«, sagte Norlander.
Was mit einem engelblauen Blick und den Worten quittiert wurde: »Wenn Pulverschnee unberührt auf den Feldern liegt und die Schneeflocken sich in kleinen Wolkenformationen an die Dachfirste klammern, dann ist es die beste Zeit des Jahres. Spätwinter. Siehst du nicht, wie schön es ist, Viggo? Nimm mal die Augen von der Karte und guck raus.«
Norlander lag sein Lieblingsausdruck ›Schnauze‹ auf der Zunge, doch der Blick durchs Fenster war wirklich betörend. Die tief stehende Sonne breitete ihre Strahlen über die zuckerwattegleiche Schneedecke und verwandelte die Landschaft in ein Meer aus Licht- und Farbschattierungen. Und am Waldrand sprang doch wahrhaftig ein Rehkitz hervor. Es fehlte nur noch ein ordentlicher Elch.
So war es meistens. Söderstedt ließ Norlanders Widerstand in sich zusammenfallen, und es war diesem verflixten Finnen nie anzumerken, dass er kämpfte. Doch es herrschte stets eine Art Machtkampf bei diesem Zweigespann in der Spezialeinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter bei der Reichskriminalpolizei, besser bekannt als die A-Gruppe. Der Machtkampf bestand meistens darin, dass Söderstedt versuchte, Norlander dazu zu bewegen, den Blick zu heben, beispielsweise von einer Straßenkarte.
Und wieder einmal war es gelungen. Anscheinend ohne jede Anstrengung. Norlanders Blick schien ewig auf der Winterlandschaft verweilen zu wollen.
Also hatte er keine Möglichkeit zu beurteilen, wie viel Zeit vergangen war, als Arto Söderstedts unverkennbar finnlandschwedische Stimme verkündete: »Wir sind da.«
Der Minibus bremste etwas nachlässig, schleuderte und kam als Letzter in einer langen Schlange am Straßenrand geparkter Wagen zum Stehen. Sämtliche neun Insassen saßen einen Augenblick reglos da, bevor sie wie auf einen wortlosen Beschluss zu der Ansicht kamen, dass sie auch diesmal nicht im Straßengraben gelandet waren.
Söderstedt sprang geschmeidig aus dem Wagen, stieg aufs Trittbrett und klopfte vorsichtig an den neuen Dachgepäckträger. Er zog zur Probe an ein paar Gummistrippen und sah, dass alles gut war.
Norlander seinerseits sprang in den Straßengraben und versank bis zu den Hüften im Schnee.
Während der Rest beider Familien sich auf der Fahrerseite aus dem Wagen zwängte, hörten sie – ohne eine Miene zu verziehen – eine Serie atemberaubender Flüche. Schließlich offenbarte sich ein schneebedecktes und äußerst erbostes Wesen vor der Motorhaube.
»Yeti«, sagte Peter Söderstedt zu seinem jüngeren Bruder. Sie lachten eine Weile.
Charlotte Olofsson-Norlander, bald vier Jahre alt, zeigte auf ihren Papa und fragte: »Mama, was ist denn mit Papa?«
»Schneeblind«, sagte Astrid Olofsson und zog mit ihren Töchtern ab. Nach und nach folgten die anderen. Arto Söderstedt schloss zu Viggo Norlander auf und sagte: »Lass gut sein jetzt, Viggo. Der Alltag ist nichts anderes als eine Serie von Missgeschicken. Wenn man das akzeptiert, ist das Leben gar nicht so schlecht.«
Norlander blieb stehen, in der Absicht zu explodieren. Stattdessen betrachtete er seinen sonderbaren Kollegen und stellte zu seiner Verwunderung fest, dass sein Zorn sich legte. Er lachte, ging weiter und sagte: »Jetzt erzähl mal von diesem bescheuerten Schreibtisch.«
»Ich habe es ja schon versucht«, sagte Arto Söderstedt. »Da warst du nicht besonders empfänglich.«
»Ich kann nur nicht begreifen, warum ein zweihundert Jahre altes, verrottetes Teil besser sein soll als ein ordentlicher Ikea-Schreibtisch.«
»Es ist eine Entdeckung, Viggo. Ein deutsches Barockstück mit zahllosen raffinierten Fächern und Schubladen. Ein bisschen abgenutzt, aber mit einer Aura von Geschichte. Ein Schreibtisch aus dem 18. Jahrhundert. Stell dir nur mal vor, was der mitgemacht hat. Alle, die daran gesessen und geschrieben haben, alles, was in seinen Fächern und Schubladen gelegen hat. Meine Dokumente werden Teil einer Geschichte sein.«
»Aber alles, was du brauchst, ist ein Schreibtisch.«
»Nein«, sagte Arto Söderstedt. »Das ist ganz und gar nicht alles, was ich brauche.«
Er sah auf die Uhr. Es war zwei. »Eine halbe Stunde noch, dann ist er dran«, sagte er. »Gutes Timing.«
Inzwischen waren sie am Hof angelangt. Er lag am Rand des Ackerlands, und das Einzige, was als Erklärung für die vielen geparkten Autos dienen konnte, war ein in Blockbuchstaben geschriebenes Schild: ›Frühjahrsauktion. Sonntag, 16. März, 13.00 Uhr‹
Die Familien waren verschwunden. Das einzig sichtbare menschliche Wesen war ein dicker bärtiger Mann, der auf dem Altan des Hauses stand und allmächtig aussah. Als das Duo sich näherte, vollführte er eine Geste nach links. Sie starrten ihn so lange an, bis er sich genötigt sah, seine Geste zu erklären. »Wir haben die Auktion ins Freie verlegt«, sagte er in breitem Roslagsdialekt. »Bei dem schönen Wetter. Folgen Sie den Fußspuren.«
Der Schnee auf der linken Hofseite war auf breiter Front niedergetreten. Das Interesse für antike Möbel und Gegenstände hatte in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Söderstedt wusste, dass es am Fernsehen lag. Es gab neuerdings eine Reihe von Fernsehprogrammen, die sich mit Antiquitäten befassten, und diese Programme übten auch auf ihn eine gewisse Faszination aus. Enthusiastische Experten, die sich umständlich durch die Geschichte eines Objekts hindurchkommentierten, während der Besitzer wie auf Kohlen saß und nur wünschte, dass es endlich zur entscheidenden Frage kam: Was war der Mist wert?
Nein, das war ungerecht. Vielleicht gab es einen Zusammenhang zwischen dem verstärkten Geschichtsinteresse in Schweden und dem wachsenden Interesse an Antiquitäten.
Er fragte sich nur, wie dieses Interesse aussah.
Und vor allem fragte er sich, wie weit es die Preise in die Höhe treiben würde. Wer war er also, um den ersten Stein zu werfen?
Als die beiden Familienväter um die Hausecke kamen, bewarfen Peter und Stefan Klein-Lina mit Schneebällen, und Charlotte wusch ihrer Schwester Sandra das Gesicht mit Schnee. Die Mütter standen ein paar Meter entfernt und unterhielten sich, sodass die verantwortungsbewussten Väter einschreiten und die Ordnung wiederherstellen mussten. Durch Schimpfen.
Das Ergebnis war dürftig, aber als der Auktionator nach einer wohl nur kurzen Pause zurückkehrte, wurde die Aufmerksamkeit in eine neue Richtung gelenkt, und die Kinder konnten einander in Ruhe weiter malträtieren.
An der rückwärtigen Veranda des Hauses war eine große Anzahl unterschiedlicher Gegenstände zu besichtigen. In ihrer Mitte schritt der Auktionator mit passendem Bauernkäppi einher. Die Dinge wurden über die Köpfe der potenziellen Käufer hinweg ausgerufen, und es war kaum möglich zu folgen. Söderstedt spürte eine gewisse Unruhe, er könnte den Schreibtisch verpassen.
»Was für ein Haufen Mist«, flüsterte Norlander.
»Es sind Goldstücke darunter«, flüsterte Söderstedt zurück. »Sieh dir mal das Service da an.«
Das Service, vermutlich von der Manufaktur Rörstrand aus den frühen Zwanzigerjahren, komplett in vierundzwanzig Teilen, ging für zweitausend Kronen weg, und Söderstedt war ein wenig beruhigt. Die Gefahr überhöhter Preise schien sich in Grenzen zu halten.
Sie waren von Menschen eingeschlossen, und es wurden immer mehr. Alle waren wegen des Schreibtischs gekommen, dachte Söderstedt. Mindestens zehn Antiquitätenhändler aus Stockholm sind hier, um den Preis in die Höhe zu treiben.
Dagegen hatte er keine Ahnung, wo die Kinder steckten. Er erlaubte sich die Annahme, dass die Mütter zur Vernunft gekommen waren und ihre mütterlichen Pflichten erfüllten. Denn sein Interesse galt im Augenblick einem vermutlich 1764 in der Werkstatt des angesehenen Leipziger Möbeltischlers Weissenberger hergestellten Barockschreibtisch.
»Und jetzt, meine Damen und Herren«, rief der Auktionator, »eine Kollektion Flickenteppiche aus einem waschechten Roslagshaushalt aus den Vierzigern. Ländliche Handarbeit von hoher Qualität.«
Eine klapperdürre Dame um die fünfundsiebzig tauchte an Söderstedts linker Achselhöhle auf und zischte: »Grässlich!«
Er warf ihr einen erstaunten Blick zu.
»Nicht das geringste Unterscheidungsvermögen«, verdeutlichte die Dame. »Wie sie Krempel und Antiquitäten vermischen, verrät abgrundtiefe Unkenntnis.«
»Kann man auf solchen Auktionen keine Schnäppchen machen?«, fragte Söderstedt und suchte vergebens nach Norlander, um eventuell aus dessen Lieblingsausdruck einen Vorteil zu ziehen.
»Natürlich kann man«, sagte eine Männerstimme in Söderstedts rechtes Ohr. »Gleich kommt hier ein Prachtstück. Ein Schreibtisch. Er soll um halb drei ausgerufen werden.«
Arto Söderstedt betrachtete den Mann und nickte. Widerwillig sagte er: »Haben Sie vor, dafür zu bieten?«
Der Mann, robust, gut trainiert, um die fünfzig, zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht«, sagte er. »Ich suche Besteck. Besteck und Krüge. Aber wer weiß?«
»Ich biete vielleicht«, sagte die alte Dame. »Ich habe gehört, dass das Mindestgebot bei zweitausend liegt.«
»Ich habe eins fünf gehört«, sagte Söderstedt und fand die Unterhaltung allmählich ganz angenehm.
»Es ist jetzt vier Minuten vor halb drei«, sagte der Mann und sah auf seine Armbanduhr. Sie weckte Söderstedts Interesse. Eine Rolex, wahrscheinlich späte Fünfzigerjahre, Oyster Perpetual.
»Schöne Uhr«, sagte Söderstedt.
»Ich nenne sie Chronometer«, sagte der Mann mit einem schwachen Lächeln.
Die Dame fiel ein: »Um Viertel vor drei kommt ein Satz Besteck aus der Jahrhundertwende. Sie könnten ihn sich doch ansehen.«
»Gute Idee, danke«, sagte der Mann und verschwand in der Menge.
»Schön, dass wir den los sind«, sagte die dürre Dame.
»Wieso?«, fragte Söderstedt erstaunt.
»Großkotziger Typ«, sagte die Dame. »Chronometer.« Dann ergriff sie seinen Arm und sagte: »Jetzt geht es los. Mann gegen Mann.«
Der Auktionator zog mit dramatischer Geste eine Menge Wolldecken von einem Möbelstück. Gut, ein bisschen mitgenommen sah er aus – ein paar Beschädigungen, ein falsches Bein, mehrere fehlende Griffe und Knöpfe, einige deutliche Risse –, aber aufs Ganze gesehen, bot der Barockschreibtisch einen imponierenden Anblick.
Tatsache war, dass Arto Söderstedt Geld beiseitegelegt hatte. Ganz heimlich hatte er für diesen Schreibtisch ein Konto eingerichtet. Er hatte nicht vor, die alte Dame – oder sonst irgendjemanden in der weiten Welt – gewinnen zu lassen.
»Das Mindestgebot ist zweitausend Kronen«, rief der Auktionator.
Hmmm, dachte Arto Söderstedt misstrauisch.
Der Auktionator fuhr atemlos fort: »Und das ist natürlich ein Hohn angesichts dieses prachtvollen Stücks, das sehr gut nicht nur Goethe, sondern auch Beethoven gedient haben kann. Stellen Sie sich vor, dass der Faust oder die Neunte auf dieser Tischplatte geschrieben wurden, und bieten Sie dementsprechend.«
Die dürre Dame reckte mit einem verschmitzten Blick auf Söderstedt die Hand in die Höhe.
»Vornehme Gäste, wie ich sehe«, sagte der Auktionator und zeigte auf die Dame. »Zweitausend bietet die ehrwürdige Firma Lauras Antik auf Östermalm in Stockholm. Sie wissen selbst, Frau Laura, dass dieses Gebot einen Hohn auf die gesamte Branche darstellt.«
Verflixt und zugenäht, dachte Arto Söderstedt und blinzelte erbost auf die Dame hinunter. »Dreitausend«, sagte er möglichst unbeteiligt und hob die Hand.
»Dreitausend«, sagte der Auktionator und zeigte auf Söderstedt. »Danke. Wir wollen natürlich weiter.«
»Fünf«, rief Frau Laura mit ganz neuer Stimme. Professionell.
»Fünf fünf«, erklang eine Stimme weiter hinten. Söderstedt blickte sich um und sah einen Mann im Nadelstreifenanzug und mit karierter Fliege in der winterlichen Landschaft stehen. Er war von Profis umringt. Und er hatte nichts gemerkt.
Aber das machte ja wohl den Profi aus …
»Wollen Sie im Ernst halbe Tausender für dieses Meisterwerk bieten?«, rief der Auktionator gekränkt.
»Sechstausend«, sagte Söderstedt und fürchtete die nächsten Minuten.
»Sieben«, rief Frau Laura ungerührt.
»Acht«, sagte der Fliegenmann von hinten.
Herrgott, dachte Söderstedt und verfluchte seine Naivität. Wie hatte er glauben können, er bekäme den Schreibtisch unter fünfzehntausend? Das war alles, was er auf seinem Spezialkonto hatte. Und die Knete, die er sicherheitshalber vom Familienkonto abgehoben hatte, sollte er besser nicht anrühren.
»Neuntausend« sagte er, und seine Stimme gab ein wunderliches Echo auf dem großartigen Hofplatz. Bald würde sie verstummen, bald würde ihr Inhaber sich den höhnisch lächelnden Familien zuwenden und den ganzen Heimweg bis nach Södermalm ironische Kommentare hören.
Verflucht, in einer solchen Schicksalsstunde Angestellter im öffentlichen Dienst zu sein.
Verflucht auch, Polizist zu sein.
Er blickte zu seiner linken Achselhöhle hinab und wusste, was er von der absurden Frau Laura zu erwarten hatte.
Aber sie war nicht mehr da. Und ihre Stimme auch nicht.
Verwirrt blickte er sich in der Menschenmenge um, aber Frau Laura war nirgendwo zu sehen.
»Zehntausend Kronen«, hallte dagegen die hochtrabende Stimme des Fliegenmanns.
»Elf«, rief Söderstedt und fürchtete, dass seine Verzweiflung zu spüren war.
Ist es nicht das, was man ein Luxusproblem nannte? Dachte er und wartete auf die Antwort des Fliegenmanns.
Doch die blieb aus. Es war vollkommen still.
Nicht ein Laut störte den schönen Spätwinternachmittag. Die Zeit war angehalten. Der Hammer des Auktionators war in der Luft erstarrt. Der Mund des Auktionators stand weit offen, als wollte das quirlige Mundwerk nie wieder einen Ton hervorbringen. Und Arto Söderstedt war davon überzeugt, dass er gestorben war. Dass so der Tod aussah. Dass der gestorbene Mensch sich außerhalb der Zeit bewegt, zwischen den Augenblicken. Man wird in seinem Todesaugenblick angehalten und verharrt so auf ewig.
Der Tod als Standfoto.
Doch nein. Es war ein Glücksmoment. So sah es aus – jetzt, wo er sich der fünfzig näherte. Keine erotischen Visionen mehr, nichts von der Art. Es war kindisch. Wie sehr er es auch von sich wies, dies war ein materielles Glück, geradezu ein materialistisches. Die Freude über Gegenstände.
Es sollte zweischneidig sein, doch so war es nicht. Das Glück, als der Wortschwall aus dem quirligen Mundwerk erneut hervorbrach, war ungetrübt.
»Aber Freunde«, dröhnte es. »Wollen wir diesen prachtvollen Eichenschreibtisch wirklich für lächerliche elftausend gehen lassen? Ist das eines Auktionspublikums dieses Kalibers würdig?«
Ja, dachte Söderstedt, und es fehlte nicht viel, und er hätte es gerufen.
»Also dann«, rief der Auktionator. »Gestatten Sie, dass ich dem weißhaarigen Herrn in der siebten Reihe gratuliere. Zum Ersten … Zum Zweiten … und Dritten. Verkauft.«
Als Arto Söderstedt sich mit beflügeltem Schritt einen Weg durch die Menge bahnte, suchte sein Blick vergeblich seinen Kollegen. Er kam vorn an, bezahlte und suchte weiter. Verdammt, Viggo, dachte er. Alles, was ich von dir brauche, ist deine großzügig bemessene Muskelkraft. Den Rest können wir wie üblich vergessen.
Auf einmal war er da. Hinter ihm. Eine unverkennbare männliche Stimme sagte: »Du hast ihn also bekommen?«
Die Visage des Kollegen trug ein verschmitztes Lächeln, das Söderstedt nicht richtig kannte. Er zwinkerte kurz und nickte in Richtung des Schreibtischs, um den sich drei robuste Roslagsburschen versammelt hatten und sich die Hände rieben.
»Dann pack mal mit an«, sagte er nur.
Und Viggo Norlander packte an. Es waren die drei Träger und nicht zuletzt Arto Söderstedt selbst, die eindeutige Probleme hatten, das Möbel anzuheben.
»Pflegefall«, sagte Norlander und schleppte den Schreibtisch, die Roslagsträger im Kielwasser, davon. Die Menge teilte sich wie das Rote Meer vor Moses. Aus reinem Selbsterhaltungstrieb.
»Make a hole!«, brüllte er wie in einem amerikanischen U-Boot-Film.
Sie vereinigten sich mit den Familien an der Hausecke. Die Kinder waren ordentlich schneedurchweicht. Und die Mütter fuhren, ungestört von der Außenwelt, in ihrer Unterhaltung fort.
Auf der Verandatreppe saß ein Mann im Nadelstreifenanzug und mit karierter Fliege und massierte sich das Schienbein. Er blickte zu Söderstedt auf, hob die Hand und drohte mit dem Zeigefinger. »Beim nächsten Mal aber sauberes Spiel, meine Herren«, rief er.
Söderstedt hielt inne und betrachtete ihn voller Verwunderung. Schließlich brach er in schallendes Gelächter aus.
Viggo, ach Viggo.
Dieses verschmitzte Lächeln …
Vielleicht brauche ich doch nicht nur deine großzügig bemessene Muskelkraft.
Viggo Norlander selbst erschien total ungerührt und schleppte gemeinsam mit den Roslagsburschen den Schreibtisch zu dem alten Toyota. Söderstedt kam nicht rechtzeitig, um mit Hand anzulegen, als sie den Schreibtisch auf den Dachgepäckträger wuchteten. Dann sprang Norlander in den Wagen. Auf der Fahrerseite diesmal.
Arto Söderstedt dankte den Trägern mit je einem Zwanziger und forderte mit galanter Geste die Familienschar zum Einsteigen in den Minibus auf. Die Damen würdigten ihn keines Blicks. Einen Moment lang fragte er sich, ob sie überhaupt wussten, wo sie sich befanden.
Erreckte sich, um die Gummistrippenfestzuspannen. Von der anderen Seite stieg Norlander noch einmal aus und zog seine Enden fest. Die beiden Kriminalbeamten wechselten zwischen den in die Luft ragenden Beinen des Schreibtischs einen kurzen Blick.
»Danke«, sagte Arto Söderstedt aufrichtig.
Viggo Norlander lächelte verschmitzt und sagte: »Pflegefall.«
Der Mann sah auf seine Armbanduhr. Er besaß sie seit Jahrzehnten, und sie würde ihn auch diesmal nicht enttäuschen.
Das wichtigste Mal.
Er beugte sich übers Lenkrad vor und blickte die Skeppargatan hinauf und hinunter. Eine schicke blonde Frau um die vierzig ging mit einem blauen Paket in der Hand vorbei. Er folgte ihr mit dem Blick und dachte einen Moment lang an eine andere schicke blonde Frau. Sie hatte einen Tragegurt vor der Brust und blickte auf die blaue Meeresbucht hinaus, drehte sich zu ihm um und sah ihm in die Augen, sie strahlte etwas aus, was man als Glück bezeichnen konnte. Dann sah er sie mit blaulila verfärbtem Gesicht und mit Augen, die zur Hälfte aus dem Kopf getreten waren.
Nein. Weg.
Städtische Arbeiter in orangefarbenen Overalls schlurften durch den Schneematsch. Er wartete, bis sie vorbei waren.
Die ganze Planung, alles, was perfekt passen musste, jede Einzelheit – er ging das Szenario in Gedanken durch. Noch einmal. Ein letzter Sicherheitscheck. Die städtischen Arbeiter trödelten vorbei wie Relikte aus einer verschwundenen Zeit.
Als hätte er davon nicht genug.
Dann lag die Skeppargatan verlassen da.
Der Mann mit der Uhr stieg aus dem Wagen und ging die wenigen Schritte zum Haus. Er gab den Code ein und öffnete die Tür. Es war ein prächtiges Treppenhaus, Jugendstil mit dicken Teppichen und Originalglas in den Lampen. So hatte es beim letzten Mal nicht ausgesehen. Es war viel passiert, seit er in diesem Gebäude sein dubioses Leben geführt hatte.
Er konnte nicht umhin, diese eleganten Östermalmshäuser aus den Gründerjahren zu mögen. Was wäre Stockholm ohne sie. Trotz allem.
Doch er wusste, dass der Müllkeller nicht so elegant war. Der Raum, in den die Müllschächte mündeten, war kein Ort, an dem sich die Wohnungsinhaber jemals aufhalten mussten. Sie brauchten nicht einmal zu wissen, dass es ihn gab. Als ob der Müll sich in nichts auflöste, sobald er in den Schacht geworfen wurde. Ein dunkler, übel riechender Raum unter der Erde, um den sich nie jemand kümmerte. Solange alles reibungslos funktionierte. Solange Arbeiter da waren, die unbemerkt die Überreste des großbürgerlichen Lebens beseitigten.
»Da das Geld als der existierende und sich betätigende Begriff des Wertes alle Dinge verwechselt und vertauscht, so ist er die allgemeine Verwechselung und Vertauschung aller Dinge, also die verkehrte Welt, die Verwechselung und Vertauschung aller natürlichen und menschlichen Qualitäten.«
Der Mann mit der Uhr stieß ein kurzes Lachen aus; fast kam ein Ton über seine Lippen. Die Erinnerung spielt dem Menschen so manchen Streich. Karl Marx’ ökonomisch-philosophisches Manuskript aus Paris, 1844. Die Worte, die sich festsetzten, bevor alles zu Dogmen und zum Vorwand für Machtmissbrauch und Gewalt wurde.
Ein Anflug von Unbehagen, dann sah er sich wieder um. Er ging eine halbe Treppe abwärts, stellte die Tasche vor einer Tür auf den Boden, wühlte zwischen Laptops, Kuhfüßen, Brecheisen und Hämmern, angelte einen kleinen Apparat heraus und steckte die Spitze des Apparats ins Schloss. Ein kurzes, dumpfes Brummen ertönte, und dann klickte es. Er öffnete die Tür, glitt hinein und zog sie hinter sich zu. Als wäre er nie da gewesen.
Der Keller war einigermaßen stilgerecht, ein armer Vetter des Jugendstiltreppenhauses. Geruch nach Erde und ländlicher Vergangenheit. Im Hintergrund eine weitere Tür, äußerst schäbig. Der Mann mit der Uhr ging hin und wiederholte die Prozedur mit dem Apparat.
Er war im Müllraum. Nicht einmal hier roch es besonders unangenehm. Entweder wurden die Mülltonnen häufig geleert, oder selbst der Müll der Reichen roch besser als der anderer Leute.
Er duckte sich hinter eine Mülltonne und versetzte sich in den Wartezustand. Sein Puls sank, sein Atem wurde langsamer, die Gehirnaktivität näherte sich dem Minimum an, jede Bewegung hörte auf. In der guten alten Zeit hatte er diesen Zustand für eine Form des Vegetierens gehalten. Eine extreme Passivität, die eine extreme Aktivität ankündigte. Ein Sonnenblumensamen in der Wintererde.
Das war lange her. Die Zeiten waren andere.
Die Minuten vergingen. Der Mann mit der Uhr saß vollkommen still. Sein Körper erinnerte sich an alles. Hierfür war er geschaffen. Der Rest war Beiwerk. Der Rest war die Scheiße.
In seinem Körper tickte eine innere Uhr. Er hätte sich auf sie verlassen können. Sie ging immer richtig.
Aber das tat die Armbanduhr auch. Sie war das Einzige außerhalb von ihm, das nie trog.
In dieser trügerischsten aller Welten.
Er betrachtete das perlmuttweiße Zifferblatt. Der fadendünne Sekundenzeiger tickte langsam zwischen den Zahlensymbolen an der linken Seite nach oben.
Sieben, acht, neun, zehn.
Das Leben, dachte er. Was daraus wurde.
Er sah das Bild einer blonden Frau mit einem Tragegestell vor der Brust. Sie blickte über eine blaue Meeresbucht.
Eins, zwei, drei, vier.
Es war Donnerstag, der 20. März, und die Uhr zeigte exakt 10.40 Uhr.
Staffagefigur. Ein seltsames Wort.
Es kommt aus dem Deutschen und wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts ins Schwedische übernommen. Es bezog sich damals auf etwas sehr Spezifisches, nämlich auf die Barockmalerei. ›Staffage‹ sind kleinere Nebenfiguren in einem Landschaftsbild, die die künstlerische Darstellung beleben sollen.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Wort ›Staffagefigur‹ von ›Staffage‹ losgelöst und in übertragener Bedeutung für eine Person benutzt, die – in welchem Zusammenhang auch immer – eine untergeordnete Rolle spielt.
Das Wort hatte sich in ihr festgesetzt, sie hatte das Gefühl, zur Existenz einer Staffagefigur verdammt zu sein.
Aber Cilla Hjelm hatte es satt, sie hatte es gründlich satt, eine Nebenfigur zu sein, untergeordnet, ohne eigene Persönlichkeit.
Es hatte irgendwann in der Zeit begonnen, als die Kinder geboren wurden, Danne und Tova, vor fast zwanzig Jahren. Eine Art von Selbstverleugnung. Alle außer ihr im Mittelpunkt. Als ihr Mann Paul bei der Polizei Karriere machte und sie versuchte, verlorenen Boden zurückzugewinnen und der Mensch zu werden, der sie im Innersten war, musste etwas schiefgelaufen sein. Sie hatte versucht, wieder die zu werden, die sie vor zwanzig Jahren gewesen war, und das war natürlich unmöglich. Es kam zu einem Konflikt, dessen Ergebnis eine große existenzielle Verwirrung war.
Eines wusste sie auf jeden Fall: Von jetzt an würden sie selbst und ihre Wünsche im Mittelpunkt stehen. Nur was waren ihre Wünsche? Die Entfremdung zwischen ihr und Paul wurde immer größer. Er war so aufdringlich in seinem Wunsch nach Intimität, sie fühlte sich bedrängt, er ließ ihr keinen Raum zum Atmen. Schließlich bekam sie keine Luft mehr. Kontakte zu anderen Menschen wurden wichtiger als der zum Ehemann, und um etwas rekonstruieren zu können, musste sie alles verwerfen, was irgendwie Pauls Sphäre zugerechnet werden konnte. Und die Sexualität gehörte zu seiner Sphäre. Sie musste sich verweigern, um sich nicht ganz zu verlieren.
Paul Hjelm kam mit dem ihm aufgezwungenen Zölibat nicht zurecht. Plötzlich war er einfach verschwunden, hatte seine Siebensachen gepackt und war gegangen.
In der Tiefe ihres Herzens fühlte sie sich verraten.
Fast ein Jahr war inzwischen vergangen.
Ganz schuldlos war sie selbst wohl auch nicht.
Das war eine neue und nicht ungeteilt angenehme Einsicht.
Es war einfacher, wenn er an allem schuld war.
Cilla Hjelm hatte eine neue Arbeit gefunden und war jetzt Abteilungsleiterin in einer Klinik für plastische Chirurgie im Sophiaheim im Stockholmer Stadtteil Östermalm. Ein ruhigerer Job – denn war sie nicht einfach ausgebrannt gewesen?
Sie hatte die Ambulanz und die ständigen Überstunden hinter sich gelassen, ihr Lohn war höher, das Tempo ruhiger, die Stimmung angenehmer – aber war sie zuvor wenigstens ein kleines bisschen Florence Nightingale gewesen, mit einem hauchzarten Anstrich von Idealismus, so war sie jetzt eine krasse Realistin.
Entwicklung? Na ja. Zumindest Überleben.
Es war Donnerstagvormittag, und sie schlenderte auf dem Weg zur Arbeit die Skeppargatan hinauf. Es war einer ihrer beiden späten Arbeitstage; sie arbeitete Teilzeit und kam gut damit zurecht. Auf dem Weg vom U-Bahn-Aufgang am Östermalmstorg zum Sophiaheim am Valhallavägen wollte sie noch in die Bank und die Reste einiger abstürzender Fonds retten. Das Reihenhaus in Norsborg war bezahlt, ihre Lebenshaltungskosten waren niedrig. Sie hatte es nicht über sich gebracht, den Kontakt zum anderen Geschlecht wieder herzustellen. Sie fragte sich, ob sie je wieder Lust auf Sex haben würde.
Aber sie hatte ja Tova. Zumindest manchmal. Und morgen hatte sie Geburtstag, die Kleine. Achtzehn. Volljährig. Die meisten Teenagerkrisen waren überstanden. Cilla drückte das blaue Paket an sich. Gewagt, einer Achtzehnjährigen ein Kleid zu kaufen. Ein leichtes, dünnes Sommerkleid. Tova entwickelte sich zu einer richtig gut aussehenden Frau, das musste die Mutter einräumen, und gerade deshalb mussten die Ambitionen, ständig in die Welt hinauszuziehen, gebremst werden. Da war Paul wie üblich viel zu tolerant.
Paul, ja, Paul …
Hätten wir unsere Verschiedenheiten nicht für uns statt gegen uns sprechen lassen können? All die bitteren Worte. Die verbalen Misshandlungen. Seine wohlgesetzten Bosheiten.
Und all ihre Neins … Nein als Lösung für alles. Nein als das Passwort der Identität.
Sie bog aus der Skeppargatan in den Karlavägen ein, betrat die Bankfiliale und zog eine Nummer. Fünf waren vor ihr. Es würde nicht länger als zehn Minuten dauern, eine Viertelstunde, wenn es hoch kam. Zwei geöffnete Schalter. Und tatsächlich saßen fünf Personen auf den Sofas der gediegenen klimatisierten Östermalmsbank. Es fehlte nur noch ein wenig dezente Stimmungsmusik.
Wie in der Abteilung für plastische Chirurgie.
Ihre Gedanken machten sich selbstständig. Warum? Weil ihre Tochter morgen volljährig wurde? Weil es gewissermaßen ihr letzter Tag als Mutter war?
Aber war das nicht ausschließlich ihr eigener Fehler? Sie hatte Paul zum Sündenbock erkoren, hatte beschlossen, alles Ungute in ihrem Leben ihm anzulasten. Sie wollte nichts als arbeiten, schlafen und mit Freundinnen verkehren, die besser lebten als sie selbst und an deren Leben sie Anteil nehmen konnte.
Alle anderen hatten es sowieso besser.
Die roten Leuchtdioden blätterten zur nächsten Nummer vor, jetzt warteten nur noch vier auf den Sofas, und zwei standen an den Schaltern und ließen sich viel Zeit.
Sie dachte an Pauls affektierte Argumentation. Was passiert mit der weiblichen Sexualität, wenn die Frau beschließt, keine Kinder mehr zu bekommen? Sie – ermüdet.
Wenn das Geheimnisvolle verschwunden ist, ermüdet die Frau. Und wenn die Kinder geboren sind, auch. Die weibliche Sexualität existiert nur angesichts des Unbekannten. Unbekannter Mann, unbekannte Kinder. Sie hatte das natürlich abgestritten. Männlicher Chauvinismus, ganz einfach.
Seine Worte: »Ich kenne keine einzige länger andauernde Beziehung, in der der Mann nicht irgendwann sexuell frustriert gewesen ist.«
Es war ein Geschlechterkrieg.
Aber im Nachhinein musste sie sich eingestehen, dass sie ihre eigene Sexualität nicht richtig verstand. Es war so unglaublich kompliziert. Jede Erfahrung war wie ein Strang in einem Netz aus Hindernissen, Kindheit, Pubertät, Erwachsensein, Elternschaft. Für ihn war es so verdammt einfach. Er wurde geil, ganz klar.
Sigmund Freud widmete Jahrzehnte dem Bemühen, die weibliche Sexualität zu verstehen. Gegen Ende seines Lebens entrang sich ihm in einem Gespräch mit Marie Bonaparte die Frage: ›Was will das Weib?‹ Er hatte nichts verstanden.
Aber er war ja auch ein alter Chauvi.
Cilla griff nach ihrem Handy. Es war das denkbar jüngste Modell, komplett mit Kamera und Zoom. Sie blätterte im Adressbuch und stieß auf Paul. Wie durch Zufall. Seine Nummer bei der Arbeit, die neue Nummer bei der Sektion für Interne Ermittlungen; die Nummer seiner Wohnung auf Messer-Söder; ein Diensthandy und ein privates Handy.
Warum hatte sie vier Nummern von ihrem Exmann?
Und warum trug sie immer noch den Nachnamen Hjelm?
Es machte wieder Pling im Schalterraum. Noch drei Personen vor ihr.
Auf ihrem Handy, oberhalb von Paul Hjelms Diensthandynummer, zeigte die Uhr 10.39. Nein, sie sprang gerade um.
Auf 10.40 Uhr.
Was dann geschah, wollte nicht in sie hinein. Es kam ihr die ganze Zeit nicht wirklich vor.
Die zwei maskierten Männer. Die harten Worte auf Englisch. Die Tatsache, dass sie auf den Marmorfußboden gepresst dalag. Die Plastikpakete, die an die Wände geklebt wurden. Das Brüllen der Maschinenpistolen. Das zersplitterte Glas.
Aha, fuhr es ihr durch den Kopf. Deshalb waren die Gedanken so schnell abgerollt. Weil ich sterben soll.
Und Cilla Hjelm war keine Staffagefigur mehr.
In der Kampfleitzentrale stand ein Fernseher. Natürlich sollte dort kein Fernseher stehen. Der kleine Sitzungsraum, in dem die Spezialeinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter bei der Reichskriminalpolizei, besser bekannt unter dem Namen A-Gruppe, ihre Besprechungen abhielt, war kein Ort, an dem man fernsah.
Aber jetzt guckten alle.
Allerdings waren die Umstände außergewöhnlich.
Es war Krieg in der Welt.
Wieder einmal.
Am Dienstag, dem 18. März, hatte der Präsident der USA, George W. Bush, dem Diktator des Iraks, Saddam Hussein, ein Ultimatum gestellt. Saddam und seine Söhne hatten 48 Stunden Zeit, den Irak zu verlassen – andernfalls wartete Krieg. Bush behauptete, es bestünden keine Zweifel daran, dass der Irak noch immer über Massenvernichtungswaffen verfüge und dass der Irak Terroristen unterstützt, ausgebildet und geschützt habe. Die USA hatten während mehrmonatiger Vorbereitungen 235 000 Soldaten um den Irak zusammengezogen, Großbritannien 45 000 und Australien 2 000. Dutzende Kriegsschiffe und fast 600 Kampfflugzeuge befanden sich vor Ort.
Die 48 Stunden waren verstrichen. Bomben waren gefallen. Jetzt. Heute Morgen. Es war Donnerstag, der 20. März. Kurz vor dem Morgengrauen waren über Satellit gesteuerte Bomben auf eine Fernsehstation, ein Zollgebäude und andere öffentliche Gebäude in einem südlichen Vorort von Bagdad abgeschossen worden. Der Präsident verkündete im Fernsehen, dass dies der Auftakt zur ›Operation Iraqi Freedom‹ sei. Präsident George W. Bush, die merkwürdigste Lebensform, die es der amerikanischen Demokratie bisher hervorzubringen gelungen war.
»›Operation Iraqi Freedom‹«, wiederholte Arto Söderstedt sachlich, also in einem an diesem Ort häufig vorkommenden Tonfall, ein Erbe des pensionierten Chefs Jan-Olov Hultin.
Das waren die einzigen Worte, die im Laufe einer halben Stunde geäußert worden waren.
»Stellt euch vor, es ist so«, sagte eine Stimme, die in letzter Zeit eine Verwandlung durchgemacht hatte. Jon Anderson, das jüngste Mitglied der A-Gruppe, beteiligte sich inzwischen lebhaft an allen Diskussionen. Wenn er sie nicht selbst anstieß. Vor einem knappen Jahr war er, nach Atem ringend und mit mehreren Messerstichen im Körper, dem Tod nahe gewesen, und das in Poznan in Polen. Damals war etwas geschehen – es war eine brutale, aber für ihn notwendige Art des Coming-out gewesen. Jetzt war er offen homosexuell und zu seiner unverhohlenen Verblüffung keinerlei Repressalien ausgesetzt gewesen. Abgesehen von seiner Mutter in Uppsala, die nicht aufhören wollte zu weinen. Überraschenderweise hatte sein grundreaktionärer Vater die Nachricht besser aufgenommen. Vielleicht kam das Erbe ganz einfach von seiner Seite.
Söderstedt blinzelte Anderson an und sagte: »Stellt euch vor, es ist was?«
»Stellt euch vor, es bringt dem Irak die Freiheit«, sagte Jon Anderson.
Söderstedt zuckte die Schultern. »Bush ist ein waschechter Ölpräsident«, sagte er schleppend. »In den Händen texanischer Ölmilliardäre. Sie wissen, dass die Ölvorkommen auf der Welt noch höchstens fünfzig Jahre reichen, und sie wissen auch, dass alles restliche Öl schon weit früher in muslimischen Händen sein wird. Jetzt geht es darum, in möglichst vielen muslimischen Ländern Marionettenregime zu schaffen. Egal, mit welchen Mitteln. Vielleicht erinnert ihr euch an das, was ich vor ein paar Jahren hierüber gesagt habe, als die A-Gruppe noch jung war …«
»Diese Haltung wird zu einer Verteidigung für Unterdrückungsregime«, sagte Anderson. »Kein irakischer Schwuler, der jetzt nicht jubeln würde.«
»Vielleicht auch die eine oder andere Frau«, sagte Lena Lindberg, der jüngste Zuwachs der A-Gruppe.
»Ich frage mich, ob die Unterdrückung der Frau unter Saddam wirklich schlimmer ist als die, die im Krieg entsteht«, sagte Sara Svenhagen neben ihr.
Selbst natürlich neutral, blickte Kriminalkommissarin Kerstin Holm, Chefin der A-Gruppe, über das Auditorium und versuchte sich ein Bild über die Verteilung von Kriegsgegnern und Kriegsfürsprechern zu machen. Arto Söderstedt war eindeutig Kriegsgegner, Sara Svenhagen ebenso. Jon Anderson und Lena Lindberg waren relativ klare Fürsprecher. Und Viggo Norlander? Vermutlich Fürsprecher. Und Jorge Chavez? Wahrscheinlich Kriegsgegner, und sei es nur seiner Frau Sara zuliebe. Und was war mit Gunnar Nyberg? Politisch schwer einzuschätzen und noch dazu abwesend – auf einem ausgedehnten Urlaub am Mittelmeer, um in Griechenland und Italien nach einem Haus zu suchen. Hoffentlich nicht zu nah an Bagdad. Der aufgesparte Urlaub vieler Jahre.
Kerstin Holm hatte ihn schon nach den ersten zehn Minuten vermisst. Ungünstige Zeit, um einen langen Urlaub zu nehmen. März. Der grausamste Monat. Oder war es der April?
Anderseits war das Mittelmeer jetzt am schönsten.
Vielleicht spürte sie eher Neid als den Verlust …
Sie schob sich heimlich eine Portion Kautabak unter die Oberlippe und betrachtete ihr Rudel mit dem scharfen Blick des Leitwolfs, wenngleich mittlerweile eine Spur kurzsichtig. Wie war eigentlich die Lage bei der Spezialeinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter? Stabil, aber mehr auch nicht. Dass Jon Anderson aufgeblüht war, gab ihr zu besonderer Freude Anlass. Und dass aus Anderson und Chavez in Nybergs Abwesenheit ein gut funktionierendes Team geworden war. Jorge war nach dem Vaterschaftsurlaub mit ungebrochener Energie zurückgekommen – allerdings auch gezeichnet von den persönlichen Komplikationen des letzten Falls. Seinen E-Bass hatte er weggepackt. Nie wieder ›The Police‹ war alles, was er jemals zu der Angelegenheit geäußert hatte. Seine Tochter Isabel hatte jetzt einen Platz im Tagesheim, und ihre Mutter Sara Svenhagen hatte mit Lena Lindberg die Hoffnungen auf ein kompetentes weibliches Duo eingelöst, das den alten Füchsen Söderstedt-Norlander weder in puncto Cleverness noch in puncto Härte nachstand. Während eines kürzlich abgeschlossenen Falles mit zwei nordfinnischen Zuhältern, die baltische Prostituierte für mörderische Sexualrituale verkauften, hatte die dem äußeren Anschein nach süße Lena Lindberg derartig gewalttätige Tendenzen an den Tag gelegt, dass der König der Internermittler Paul Hjelm seine alten A-Gruppen-Korridore wieder einmal besuchte und dort herumschnüffelte. Als er hörte, worin die Rituale bestanden, legte er – nach einem längeren Gespräch mit Lena unter vier Augen, über das Stillschweigen bewahrt wurde – den Fall unverzüglich zu den Akten. Trotz der Geheimniskrämerei sah Kerstin Holm ein bisschen klarer, was Lena Lindberg während ihrer zehn Jahre bei der Einsatztruppe der City-Polizei getrieben hatte.
Tatsache war, dass der letzte große Fall während des vergangenen Mittsommerfests bei beiden Neulingen deutliche Spuren hinterlassen hatte. Beide waren zu Opfern gewaltsamer Angriffe geworden, Jon Anderson war niedergestochen und Lena Lindberg außer Gefecht gesetzt worden, wenn auch nur mit Schlafmittel. Beide waren ihren Trieben gefolgt, und beide hatten sich verändert. Andersons Veränderung war von der positiven Art, aber Lenas war schwerwiegender. Sie war von einem Mann, dem sie ihr Vertrauen und fast ihre Liebe geschenkt hatte, grob getäuscht worden – und sie war verbittert. Ihre gewalttätige Neigung wuchs.
Zumindest Männern gegenüber.
Und Gunnar Nyberg war ein Risiko eingegangen. Das war das Tragische in diesem Zusammenhang. Der große Fall vom Mittsommer letzten Jahres hatte bei allen Spuren hinterlassen, doch was Nyberg betraf, schien sein Interesse an polizeilicher Arbeit erloschen zu sein. Er sprach von vorzeitiger Pensionierung und plante mit seiner Ludmila tatsächlich ein Leben am Mittelmeer.
Wenn sie sich einigen konnten, wo dort …
Erst jetzt spürte Kerstin Holm ihre Rückenschmerzen. Sie saß vorn an dem alten Katheder, verdreht wie ein Scheuerlappen, um das Fernsehbild sehen zu können. Es gab zwei Lösungen des Problems: 1.) Sie konnte das Fernsehen abbrechen und die verspätete Morgenbesprechung beginnen. 2.) Sie konnte zwischen den Untergebenen Platz nehmen und mit geradem Rücken weitergucken.
Sie wählte: 3.) Sitzen bleiben und sich quälen.
Die laufenden Fälle waren nicht dringlich genug, um Bushs ständig wiederholte Tiraden zu unterbrechen.
Der Fall der nordfinnischen Zuhälter mit den mörderischen Sexualritualen war abgeschlossen, für einen von ihnen endete er im Rollstuhl, und von den übrigen Fällen – einer Blutfehde zwischen zwei italienischen Kneipenwirten auf Kungsholmen, einer traditionellen rassistischen Körperverletzung auf Söder und einer U-Bahn-Schlägerei zwischen Jugendbanden unterschiedlicher ethnischer Herkunft – war nur graue Alltagsroutine zu erledigen. Sie konnte sich nicht vom Fleck bewegen. Sie warf einen Blick auf die Gruppe, die sich zu Paaren angeordnet hatte – Jon und Jorge, Sara und Lena, Arto und Viggo –, wie in einem Kindergottesdienst in den Fünfzigerjahren. Mit der gleichen nach vorn gerichteten Aufmerksamkeit.
Die aber nicht ihr galt.
Also war Punkt 3 angesagt.
Ein paar Sekunden lang. Dann geschah Folgendes: 4.) Das Telefon klingelte.
Das Telefon in der sogenannten Kampfleitzentrale klingelte höchst selten. Zweimal war es vorgekommen, seit die A-Gruppe existierte, und beide Male war ein Mitglied der Gruppe dem Tod so nah gewesen, wie man ihm nur kommen kann. Zuerst Viggo Norlander in Tallinn, dann Jon Anderson in Poznan.
Kriminalkommissarin Kerstin Holm nahm den Hörer ab. Sie schloss die Augen, als sie sich meldete.
In dem gespannten Schweigen erklang Präsident Bushs wohlpräparierte Stimme: »Es ist zu spät für Saddam Hussein, er kann nicht an der Macht bleiben. Es ist nicht zu spät für das irakische Militär, ehrenvoll zu handeln und das Land zu schützen, indem es den friedlichen Einmarsch der Koalitionstruppen zulässt … Zerstören Sie keine Ölquellen, eine Quelle des Wohlstands, die dem irakischen Volk gehört. Gehorchen Sie keinem Befehl, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, gegen wen auch immer, das irakische Volk inbegriffen.«
Kerstin Holm sagte: »Ich verstehe.«
Das war alles. Sie saß noch einen Moment mit dem Hörer am Ohr da, und ihr Gesichtsausdruck verriet nichts.
Dann legte sie den Höher auf, griff nach der Fernbedienung und stellte den Ton leise. Sie klopfte einige Male nachdrücklich aufs Katheder.
»War es nicht Gunnar?«, sagte Jorge Chavez atemlos.
Kerstin Holm betrachtete ihn und nickte.
Sie spürte sofort, dass es die falsche Geste war. Nicken war falsch. Sie meinte: ›Genau, Jorge. Es war nicht Gunnar.‹ Aber es wurde falsch gedeutet. Eine Welle des Entsetzens ging durch den Raum.
Sie korrigierte sich schnell. »Nein. Nicht Gunnar. Vor zwei Minuten ist die Bankfiliale am Karlavägen überfallen worden. Zwei maskierte Räuber haben sich in der Bank verbarrikadiert und sie mit Sprengstoff gefüllt. Sie haben neun Geiseln genommen. Wir unterstützen die Reichspolizeiführung und die Nationale Einsatztruppe. Ich übernehme mit dem Chef des Reichskrim, mit Mörner und noch ein paar anderen die Einsatzleitung. Wir begeben uns zu einem Sammelpunkt am Karlavägen.«
»Mörner?«, platzte Arto Söderstedt heraus. »Wahrhaftig!«
»Was heißt, mit Sprengstoff gefüllt?«, fragte Sara Svenhagen.
»Offenbar genug«, gab Kerstin Holm zurück, »um halb Östermalm in die Luft zu jagen.«
George W. Bush sprach weiter.
Aber es kam kein Wort aus seinem Mund.
Niklas Grundström war Chef der Sektion für Interne Ermittlungen. Er war jetzt seit einem guten Jahr Paul Hjelms Chef, Paul Hjelms einziger Chef.
»Nur damit du es weißt«, sagte er.
Das bedeutete immer viel, viel mehr. Beispielsweise: ›Sei gefasst auf polizeiliche Fehltritte.‹ Oder: ›Wir müssen jetzt jede Sekunde ausrücken.‹ Oder sogar: ›Hoffentlich hast du dir am Wochenende nichts vorgenommen.‹
»Die A-Gruppe also?«, fragte Paul Hjelm, der sich an seinem wohlproportionierten Schreibtisch im Polizeipräsidium auf Kungsholmen wohlfühlte.
Doch, wohlfühlte.
Unverschämt wohl, wie kleingeistige Missgunst es formulieren würde.
Nicht einmal die Tatsache, dass die A-Gruppe wieder einmal in etwas verwickelt war, was die Sektion für Interne Ermittlungen tangierte, konnte seinem Wohlbefinden Abbruch tun. Erst waren es seine Kontroversen und Konflikte mit dem besten Kumpel Jorge Chavez letztes Jahr zu Mittsommer gewesen. Dann, erst vor Kurzem, Lena Lindbergs ungewöhnlich grobe Misshandlung eines nordfinnischen Zuhälters. Die er, gegen alle Vernunft und gegen alle Gesetze, hatte unter den Tisch fallen lassen. Nach einem Gespräch.
»Nicht direkt«, sagte Niklas Grundström und beugte sich über Hjelms Schreibtisch.
Paul Hjelm betrachtete ihn. Diese blonde, gesunde, gepflegte Straffheit, die er einst verachtet hatte, für die er aber inzwischen großen, wenn auch distanzierten Respekt empfand. Sie trugen an einer unaufgearbeiteten gemeinsamen Vergangenheit, die wie das unreinste Eisenerz angereichert werden musste, um glänzen zu können. »Nicht direkt?«, fragte Paul Hjelm misstrauisch.
Grundström setzte sein kleines Grinsen auf und legte sich die Worte zurecht. Eines nach dem anderen, bis die Formulierung perfekt geschliffen war.
Grundström & Hjelm waren mittlerweile ein respektiertes – und zeitweilig gefürchtetes – Warenzeichen innerhalb der Polizei. Die ›Internabteilung‹, diese Schreckensbezeichnung, hatte einen ganz anderen Klang bekommen. Einerseits war die Gefahr für einen Polizisten, dass ihm Unrecht widerfuhr, stark vermindert worden, anderseits hatte die Gefahr, dass er rechtmäßig belangt wurde, erheblich zugenommen. Polizeiintendent Niklas Grundström war Chef der Gesamtsektion für Interne Ermittlungen, während Kommissar Paul Hjelm der Stockholmsektion vorstand.
Und Hjelm musste einräumen, dass sie sehr gut zusammenarbeiteten, mit wenigen Worten und ohne unnötige Diskussionen. Das Gegenteil von seiner früheren Zusammenarbeit mit Kerstin Holm und Jorge Chavez. Dort hatte es viele unnötige Diskussionen gegeben.
»In erster Linie ist es die NE«, sagte Grundström.
Niklas Grundström. Verheiratet mit Elsa, einer tiefschwarzen Frau aus Orsa, die am Moderna Museet für Pressearbeit zuständig war und ein singendes Dalarna-Schwedisch sprach. Und Vater eines ganzen Schwarms kleiner brauner Kinder. Hjelm hätte nicht sagen können, wie viele es eigentlich waren. Das ließ Rückschlüsse auf ihre Beziehung zu. Dachte er. Heiter.
»Was hat die A-Gruppe mit der Nationalen Einsatztruppe zu tun?«, fragte er.
Am schlimmsten war, dass Grundström sich mit Hjelms altem Boss Jan-Olov Hultin angefreundet hatte, dem Gründer der A-Gruppe. Hjelm traf ihn sehr selten draußen in Norrviken in Sollentuna, nördlich von Stockholm. Doch Grundström war oft da. Und das Ehepaar Hultin war oft zu Besuch bei der Familie Grundström in der viel zu kleinen Wohnung in Fredhäll.
»Nicht das Geringste«, sagte Grundström. »Panik in der Einsatzleitung, würde ich tippen.«
Die beiden teilten das Misstrauen in die Polizeiführung. In der fast kein Polizist zu finden war.
»Waldemar Mörner«, sagte Paul Hjelm.
Er brachte Grundström inzwischen ziemlich oft zum Lachen. Vielleicht war das ein Schritt in die richtige Richtung. Und die erwähnte Wortkonstellation war ein bombensicherer Schlüssel zu Grundströms hellem Jungenlachen.
So auch diesmal.
»Ich glaube, sie haben die A-Gruppe einfach hinzugezogen, damit sie für sie denkt«, sagte Grundström.
»Zum Sprengstoff«, sagte Hjelm.
»Sie haben eine Einsatzzentrale auf der anderen Seite des Karlavägen eingerichtet.«
»Mörner und Kerstin?«
»Nur damit du es weißt«, wiederholte Grundström und verschwand.
Wie er immer verschwand. Mit einem Augenzwinkern.
Ende der Leseprobe