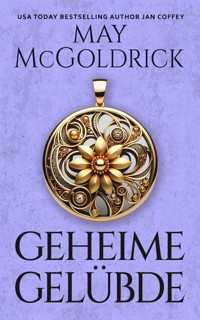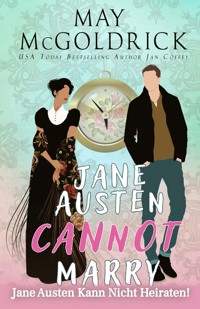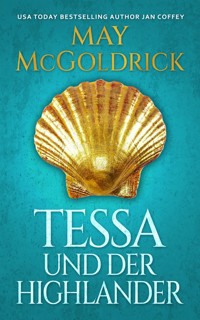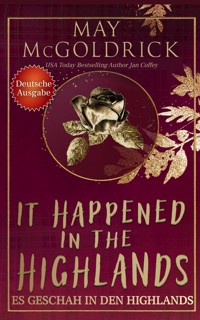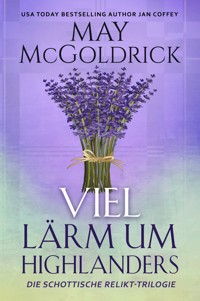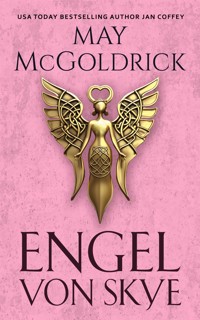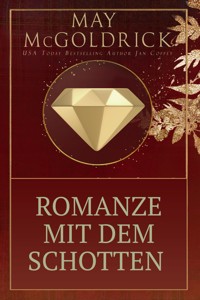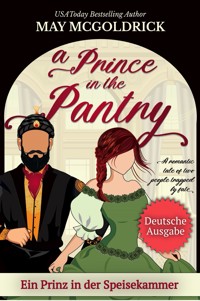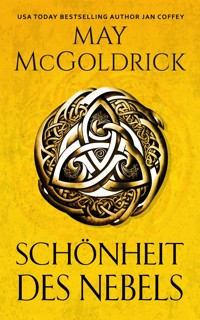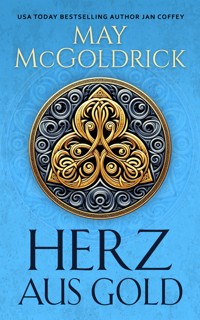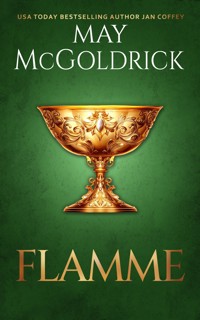Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: EIN ROMAN DES MACPHERSON-CLANS
- Sprache: Deutsch
Vom USA Today-Bestsellerautor... Leidenschaft...Verrat...gestohlene Liebe! Von den wilden Küsten der schottischen Westinseln über die blutigen Felder Frankreichs bis hin zu den glitzernden Höfen Europas verfolgt die Macpherson-Trilogie den Kampf einer Familie für die schottische Unabhängigkeit gegen den Tudor-König Heinrich VIII. Drei vollständige Romane, Engel Von Skye, Herz aus Gold, Schönheit des Nebels
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1811
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Macpherson Brothers Trilogy
Engel von Skye, Herz aus Gold, Schönheit des Nebels
2nd German Edition
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Urheberrecht
Falls Ihnen dieses Buch gefällt, sollten Sie es weiterempfehlen, indem Sie eine Rezension hinterlassen oder sich mit den Autoren in Verbindung setzen.
Macpherson Brothers Trilogy (Engel von Skye, Herz aus Gold, Schönheit des Nebels ) © 2017 von Nikoo K. und James A. McGoldrick
Deutsche Übersetzung ©2024 von Nikoo und James McGoldrick
Alle Rechte vorbehalten. Mit Ausnahme der Verwendung in einer Rezension ist die Vervielfältigung oder Verwertung dieses Werkes im Ganzen oder in Teilen in jeglicher Form durch jegliche elektronische, mechanische oder andere Mittel, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erfunden werden, einschließlich Xerographie, Fotokopie und Aufzeichnung, oder in jeglichem Informationsspeicher- oder -abrufsystem, ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt: Book Duo Creative.
Erstmals erschienen bei Topaz, einem Imprint von Dutton Signet, einer Abteilung von Penguin Books, USA, Inc. März 1997
Cover Art von Dar Albert. WickedSmartDesigns.com
Inhalt
Angel of Skye
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Editionshinweis
Anmerkung des Autors
Heart of Gold
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Editionshinweis
Anmerkung des Autors
Beauty of the Mist
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Anmerkung zur Ausgabe
Anmerkung des Autors
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Über den Autor
Angel of Skye
Engel von Skye
Für Cyrus und Samuel, unsere eigenen Hochlandschurken
Prolog
Drummond Castle, Oktober 1502
Seine eiskalten, blauen Augen starrten auf die Burg, die sich in der einsetzenden Abenddämmerung vor ihm in den Himmel erhob.
Schweigend wie der Tod kletterten er und seine Mörderbande den Hügel zur herabgelassenen Hängebrücke hinauf. Andrew würde sich das zurückholen, was ihm gehörte. Er würde Rache nehmen …
Als Fiona den Klang der Pferdehufe vernahm, die über die Hängebrücke donnerten, hüpfte sie aufgeregt über den Holzboden. Auf Zehenspitzen reckte sich die Fünfjährige zu dem Steinsims empor, das das kleine Fenster umgab und stützte ihr Kinn in die Hand, um einen Blick auf die Reiter zu werfen, die sich im düsteren Licht der Abenddämmerung näherten. Der nebelige Herbstwind fuhr durch den unverglasten Schlitz in der Burgwand und spielte mit ihrem feuerroten Haar. Sie konnte die Reiter nicht sehen, aber sie vernahm das Klirren der Stahlrüstungen, als sie in den Innenhof der Burg ritten.
Ihr Vater kam, um sie zu holen.
»Darf ich hinuntergehen, Nanna?« fragte sie zum x-ten Male. »Darf ich?«
»Du weißt, was deine Mama gesagt hat, Kind«, erwiderte die alte Frau, die über die offensichtliche Aufregung des kleinen Mädchens lächeln mußte. Heute war ein großer Tag für das Kind. Ein großer Tag für sie alle.
Fiona sprang vom Fenster weg, hob ihren kleinen Stuhl, der neben dem Kamin stand, in die Höhe, trug ihn schnell zu dem hohen Fenster hinüber und stellte sich darauf. Als sie ihr Gesicht in die Öffnung hielt, erfüllte sie die schottische Nachtluft, die ihr entgegenblies, mit einer bebenden Erwartung.
Aber ihre Mutter hatte strikte Anweisungen gegeben, daß sie so lange in ihrem Zimmer bleiben sollte, bis sie gerufen wurde.
Er mußte ein wichtiger Mann sein, dachte das kleine Mädchen aufgeregt und versuchte, ihn zwischen den anderen Reitern im Hof auszumachen. Im flackernden Licht der Fackeln beobachtete sie die Männer in den verschiedenen Schottenmustern, die von den Pferden abstiegen.
Obwohl Fiona nicht einmal mehr genau wußte, wann sie ihren Vater zum letzten Mal gesehen hatte, versuchte sie mit aller Macht, sich an sein Aussehen zu erinnern. Sie war damals noch sehr klein gewesen. Aber es gab einige Dinge, die ihr noch vage im Gedächtnis geblieben waren. Sein tiefes und unbeschwertes Lachen. Sein weicher, roter Bart. Die seltsame, gürtelartige Kette, die sie immer unter seinem Hemd gespürt hatte. Ihre Mutter hatte Fiona gesagt, daß ihr Vater sie immer trage, aber nicht erklärt, warum.
»Dein Vater ist ein sehr beschäftigter Mann, Fiona«, antwortete ihre Mutter für gewöhnlich, wenn sie sich nach ihm erkundigte. Ihr ganzes Leben lang hatte Fiona die Gespräche über die Kämpfe gegen die dreckigen Engländer mitangehört, die versuchten, schottisches Land zu stehlen. Und ihr ganzes Leben lang hatte sie die Erklärungen ihrer Mutter vernommen, daß Papa versuche, etwas dagegen zu unternehmen. Daß seine Arbeit darin bestehe, zu helfen, damit ihre Häuser und ihr Vaterland in Sicherheit seien.
Aber nun kam er, und es war ein ganz besonderer Besuch, denn er wollte sie und ihre Mutter und Nanna zu sich auf seine Burg holen, damit sie bei ihm sein konnten.
Die ganze letzte Woche war Fiona Nanna wie ein Schatten gefolgt, während sich diese um ihre Aufgaben kümmerte. Sie hatte sich sehr bemüht, eine Hilfe statt ein Hindernis zu sein. Schließlich hatte sie so viele Fragen zu dem bevorstehenden Besuch, und Nanna war die einzige, die überhaupt bereit war, mit ihr darüber zu reden.
Fiona wünschte sich sehnlichst, sie könne sich noch mehr Einzelheiten ins Gedächtnis rufen.
So weit sich das kleine Mädchen zurückerinnerte, wollte nie jemand mit ihr über ihren Vater reden. Es gab Momente, in denen ihre Mutter Fiona einen kleinen Blick auf die Zeiten werfen ließ, in denen er bei ihnen gewesen war. Während dieser Gespräche hörte Fiona dann von seinem Humor, seinem Mut und auch etwas darüber, was für ein Mann er eigentlich war. Aber ihre Mutter beantwortete ihr niemals irgendwelche Fragen, und so blieb er doch immer ein Rätsel für sie.
Manchmal fragte sich Fiona, ob ihr Vater sie wohl noch lieb hatte. Sie dachte darüber nach, ob er sie genau so vermißte, wie sie ihn. Manchmal träumte sie sogar von ihm. Dann war er ein Engel, der hoch über ihr schwebte und sie beschützte. Sie konnte ihn genau erkennen, mit seinem roten Haar und dem Bart, der um ihn herumwehte, als werde er von einer leichten Brise erfaßt.
Und nun mahnten alle Fiona, ihre Mutter nicht zu stören.
Das kleine Mädchen wußte, daß ihre Mutter zur Zeit nicht sie selbst war. Sie war in den letzten Tagen sehr still gewesen und hatte viele Stunden alleine in ihrem Gemach verbracht. Fiona hörte, wie sie weinte. Nanna erklärte Fiona, ihre Mutter sei einfach nicht imstande, daran zu glauben, daß das, wonach sie sich so lange gesehnt hatte, endlich Wirklichkeit werden sollte. Aber Fiona wußte, daß es noch einen anderen Grund geben mußte.
Schließlich hatte Nanna ihr gesagt, daß Fionas Eltern aus Gründen, die sie nicht beeinflussen konnten, bisher nicht hatten heiraten können, ihre Liebe aber stärker gewesen sei.
Ihr Vater habe seinen Leuten nun endlich mitgeteilt, daß Fiona seine Tochter sei, und daß er und ihre Mutter heiraten würden. Fiona war sich nicht sicher, was heiraten bedeutete, aber sie spürte, daß es etwas ganz besonderes sein mußte. Schließlich würde sie damit einen Vater bekommen, der immer da war. Doch viel wichtiger war, daß ihre Mutter nie wieder traurig sein mußte. Das hatte ihr Nanna auch gesagt.
Fiona begann, die Fackeln zu zählen, die im Hof angezündet wurden. Sie wußte, daß ihr Vater sich in der Begleitung von Kriegern befand. Nanna sagte, daß Fionas Vater viele Bedienstete hätte.
»Fiona, komm her, damit ich dir deine wilde Mähne flechten kann«, schalt Nanna sie mit sanfter Stimme und lächelte dem aufgeregten Kind geduldig zu. Das Gemach war warm und behaglich, und die alte Frau fühlte sich sicher und im Frieden mit der Welt.
Das kleine Mädchen wandte sich widerstrebend von ihrem Platz am Fenster ab. Sie hüpfte vom Stuhl, rannte durch den Raum und warf sich voller Zuneigung in den Schoß der alten Frau. Nanna legte den Arm um das Kind und erwiderte dessen Umarmung.
Nanna hatte die Mutter des Mädchens großgezogen und half nun dabei, auch Fiona zu erziehen. Mutter und Tochter waren so verschieden und sich doch so ähnlich. Margaret war immer ein gutes Kind gewesen, stets reserviert und zurückhaltend. Aber Fiona war anders. Sie behielt nichts für sich, versteckte nichts. Aber eins hatten sie gemeinsam, das wußte Nana: Sie vermochten beide mit einer unglaublichen Tiefe und Intensität zu lieben.
Fiona wand sich auf ihrem Schoß und durchbrach die Träume der Frau. Nanna nahm die Bürste und begann, sie durch das seidenweiche Haar des Kindes gleiten zu lassen.
»Nanna, hat mein Haar wirklich die gleiche Farbe wie Papas?« fragte sie und richtete ihre strahlenden Augen auf die Frau.
»Ja, mein Kind, das hat es.«
»Und meine Augen, Nanna?«
»Nein, Kind, du hast die haselnußbraunen Augen deiner Mutter. Die Augen deines Vaters gleichen der Farbe eines Märzmorgens. Deine verändern sich mit deiner Stimmung und mit der Farbe des Himmels.«
»Aber ich sehe ihm doch ähnlich, nicht wahr, Nanna?« erkundigte sie sich hoffnungsvoll. Ihre Mutter hatte ihr immer gesagt, sie gleiche ihrem Vater.
»Ja, Kind, du siehst ihm sehr ähnlich. Und du bist ebenso klug wie er. Und du besitzt seine Rastlosigkeit und auch seine Lebendigkeit. Du bist durch und durch seine Tochter, Fiona.«
Es hatte immer außer Frage gestanden, wessen Kind Margaret geboren hatte. Er war an ihrer Seite gewesen, hier in Drummond Castle, als Fiona ihren ersten Atemzug in dieser Welt tat. Nanna hatte die Freudentränen gesehen, die ihm über das hübsche Gesicht liefen. Und später hatte sie auch seine Kummertränen erblickt, als er gehen mußte.
Während die Frau die Locken des kleinen Mädchens zu Zöpfen flocht, dachte sie darüber nach, wie oft sie diese simplen Bewegungen schon am Haar ihrer Mutter ausgeführt hatte. Margaret Drummond, die älteste der drei Töchter von Lord John Drummond, war zu einer der schönsten und begehrtesten Jungfrauen des Königreiches herangewachsen. Als junge Dame bei Hofe hatten ihr Prinzen und Grafen und Gutsherren ebenso wie Ritter jeden Kalibers nachgestellt. Aber sie hatte sich von allen Partien, die ihr Sicherheit und Respekt garantiert hätten, abgewandt. Statt dessen hatte sich Margaret auf eine unmögliche Liebe eingelassen. Sie hatte ihr Herz an einen Mann verloren, der für sie unerreichbar war. Ein Mann, dessen Leben und Schicksal nicht in seinen Händen lag. Nanna war Zeugin gewesen, wie sie zur Frau heranwuchs und hatte gewußt, daß ihr Schützling niemals etwas anderes als die Verbindung zweier Seelen akzeptieren würde. Für Margaret war diese Liebe, so unmöglich sie auch sein mochte, eine Verbindung bis in die Ewigkeit.
Margaret war sich der Konsequenzen dieser Beziehung bewußt gewesen und hatte den Hof verlassen, als sie herausfand, daß sie schwanger war. Sie hatte sich auf Drummond Castle zurückgezogen, weg von den neugierigen Blicken der Klatschmäuler des Hofes. Sie hatte sich sogar vom größten Teil ihrer Familie zurückgezogen und war bereit gewesen, ihr Kind alleine aufzuziehen – und doch hatte sie die ganze Zeit über auf seine Rückkehr gewartet.
Und dann war er gekommen, um ihr während der Wehenschmerzen beizustehen, um die Tränen und später die Freude mit ihr zu teilen, und in einem Moment des Glücks zu baden, bevor ihn die Welt da draußen wieder fortzog – wie sie es immer und immer wieder tun würde. Aber er ging nie ohne das Versprechen, so bald wie nur eben möglich wiederzukommen.
Doch dann war er eines Tages im Sommer gegangen und nicht wiedergekommen. Dieses Mal war es anders gewesen.
Seine Welt hatte ihn festgehalten. Zwei lange Jahre waren verstrichen, bevor abermals die Neuigkeit über einen bevorstehenden Besuch Drummond Castle erreichte. Das Geplänkel, die Politik … all das hatte sich verschworen, ihn bis zu diesem Zeitpunkt von einer Rückkehr abzuhalten.
Nanna wußte, daß sich Margaret während dieser zwei Jahre an den Gedanken geklammert hatte, daß sie von dem Vater ihres Kindes geliebt wurde. Aber die Zeit war vergangen, und Nanna hatte sich oft gefragt, ob er sich verändert haben mochte.
Aber nun … nun stand er kurz davor, Margarets Träume wahr werden zu lassen. Ihrer aller Träume, dachte Nanna.
Das Geräusch des Türriegels ließ die alte Frau erschrocken aus ihren Gedanken hochfahren. Die Tür öffnete sich. Margaret eilte in das Gemach und schloß die schwere Eichentür hinter sich. Ihre Augen glitten auf der Suche nach ihrem Kind durch den Raum. Als sie es auf Nannas Schoß erblickte, zeichnete sich Erleichterung auf ihrem Gesicht ab. Fiona sprang auf und rannte in die Arme ihrer Mutter.
»Mama, ist es soweit?« erkundigte sich das kleine Mädchen zögernd. Sie spürte, daß etwas nicht in Ordnung war.
»Oh, mein armes Kind«, erwiderte ihre Mutter gequält und zog das Kind an sich. Einen Augenblick später wandten sich ihre besorgten Augen der alten Frau zu. »Nanna, uns bleibt nicht viel Zeit. Nimm die Hintertreppe zum Großen Saal, such Sir Allan und schicke ihn sofort hierher. Dann geh zu den Ställen und laß drei Pferde satteln.«
»Was ist denn geschehen, Mylady?« erkundigte sich die ältere Frau und eilte an die Seite ihrer Herrin.
Margarets strahlende Augen blickten zu ihrer Tochter hinüber. Einige blonde Strähnen hatten sich gelöst und fielen in ihr makelloses Gesicht, das ganz offensichtlich von Kummer erfüllt war. »Was ich in den letzten Wochen befürchtet hatte, ist eingetreten«, erwiderte sie und kämpfte gegen ihre Tränen an. Ihr Gesicht war von dem Versuch, ihre Emotionen zu unterdrücken, gerötet. »Du mußt Fiona von hier fortbringen. Aber zuerst tue das, was ich dir aufgetragen habe. Ich werde sie mit Allan hinunterschicken. Und bitte beeile dich.«
Die ältere Frau war zwischen dem Verlangen, mehr über den Kummer ihrer Herrin zu erfahren und dem Drang, ihrer mit dringlicher Stimme vorgebrachten Anordnung zu gehorchen, hin und her gerissen. Aber ein einziger Blick in Margarets ängstliche Augen ließ sie aufspringen und eilig durch die kleine Tür im hinteren Teil des Gemachs verschwinden.
Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, glitt Margarets Hand in die Tasche ihres Kleides, wo sie ihre Lederbörse aufbewahrte. Ihre Finger schlossen sich darum und sie konnte die eisige Kälte von Andrews Brosche spüren und den Ring, dessen Hitze sich durch das Leder in ihre Finger brannte. Sie mußte sie verstecken und das so schnell wie möglich. Ihre Augen irrten im Gemach umher.
Oh, Gott, dachte sie. Oh Gott! Aber wo?
Und dann erinnerte sie sich. Sie schrie auf und rannte durch das Zimmer auf den Kamin zu. Nachdem sie mehrere Steine über der Öffnung abgezählt hatte, zog sie einen aus der Wand. Fiona stand verwirrt in der Mitte des Raumes, aber tief in ihrem Herzen spürte sie, daß etwas Schreckliches vor sich ging. Sie erblickte das kleine, dunkle Rechteck hinter der Wand, und sie sah, wie ihre Mutter eine kleine Lederbörse aus der Tasche ihres Kleides riß und sie in das Versteck stopfte. Dann schob Margaret schnell wieder den Stein an die alte Stelle und wirbelte zu ihrer Tochter herum.
»Fiona, mein Liebling«, sagte sie. »Lauf und hol deinen dicken Mantel und die Lederbörse, die ich dir geschenkt habe.«
»Aber Mama«, protestierte das Mädchen. »Was ist denn nur los?«
»Geh, Kind! Schnell!« erwiderte die Mutter leise, bemüht, die Panik in ihrer Stimme unter Kontrolle zu halten. »Ich werde es dir gleich erklären.«
Fiona rannte zu den Haken neben der Tür und zog ihren Wintermantel herunter. Als sie sich wieder umdrehte, sah sie, wie ihre Mutter an dem kleinen Schreibtisch eilig etwas auf ein Papier kritzelte. Fiona trippelte zu der Truhe an ihrem Bett hinüber und nahm ihre Börse heraus. Als das kleine Mädchen wieder an der Seite ihrer Mutter angelangt war, hatte diese ihren Brief bereits gefaltet und Kerzenwachs auf das Papier tropfen lassen, um es mit ihrem Siegelring zu schließen.
»Gib mir die Börse, Fiona«, sagte Margaret und streckte die Hand aus. Sie stopfte den Brief hinein und nahm das mit Rubinen und Smaragden besetzte Kreuz, das sie an einer Goldkette um den Hals trug, ab. Margaret zog Fiona zu sich herüber, hängte ihr die Kette um den Hals und ließ das Kreuz vorne in ihr Kleid gleiten, wo man es nicht sehen konnte.
»Mama!« Fiona blickte ihre Mutter entgeistert an. So lange sie sich erinnern konnte, hatte ihre Mutter dieses Kreuz immer nahe an ihrem Herzen getragen. »Du hast doch gesagt, daß Papa es dir gegeben hat.«
»Ja, mein Liebling«, erwiderte Margaret, der nun die Tränen über die Wangen strömten. »Doch ich werde es nicht mehr brauchen. Du aber schon.«
»Aber Mama! Ich verstehe das alles nicht! Papa kommt doch!«
Margaret blickte ihre verwirrte Tochter an. Sie war doch noch ein Kind, wie sollte sie das hier nur überstehen?
»Hör mir zu, mein Kind. Wir haben nur noch einen Augenblick.« Margaret blickte sich verstohlen um. Die Zeit wurde knapp, wo blieben Nanna und Allan nur? Sie fuhr fort. »Ein böser Mann ist in die Burg gekommen. Er ist nicht dein Vater. Verstehst du? Dein Vater weiß nicht einmal etwas von dem Bösen, das ihn umgibt. Ihn trifft keine Schuld.«
Fiona bemühte sich, die Worte ihrer Mutter zu verstehen. Was meinte sie denn nur? Die Worte wirbelten ihr im Kopf herum. Papa kam nicht. Ihn traf keine Schuld. Woran traf ihn keine Schuld? Warum wollte ihre Mutter das Kreuz nicht mehr? Wer war dieser böse Mann?
Fiona begann zu weinen und zu schluchzen, als ihre Mutter ihr die Lederbörse in eine Tasche ihres Kleides stopfte. Dann schlang Margaret den dicken Mantel fest um Fionas Schultern und schloß die Lederbänder am Hals mit einer Schleife.
»Hör mir gut zu, Fiona«, wiederholte sie. Sie weinten nun beide, und Margaret wischte ihrer Tochter die Tränen aus dem geröteten Gesicht. Sie umfaßte das unschuldige, junge Gesicht des Kindes mit ihren zitternden Händen und blickte ihr tief in die bekümmerten Augen. »Du mußt jetzt sehr tapfer sein. Du wirst fortgehen … zu einem Ort, wo du in Sicherheit sein wirst. Und dort mußt du bleiben, bis dich dein Vater abholt.«
»Aber warum ist er nicht hier?« erwiderte Fiona schluchzend. »Wo ist Papa denn jetzt?«
»Ich wünschte, ich wüßte es, Fiona. Aber die bösen Männer sind schon da. Diese Männer wollen uns wehtun, mein Liebling. Es ist zu spät. Du mußt fliehen … Sie … Aber hör mir zu, das hier ist sehr, sehr wichtig.« Margaret kniete sich neben ihr Kind und hielt es mit einem Arm fest, während sie auf die Wand deutete, wo sie die Lederbörse versteckt hatte. »Wenn dein Papa dich hierher zurückbringt, mußt du ihm zeigen, was hinter dem Stein liegt. Er wird die bösen Männer, die heute Abend hierhergekommen sind, bestrafen! Das verspreche ich dir!«
Margaret umarmte Fiona heftig und Fiona klammerte sich an ihre Mutter. Sie zuckten beide zusammen, als sie das leise Klopfen an der kleinen Hintertür vernahmen.
Margaret hielt das schluchzende Kind an sich gedrückt und bat ihren Ritter einzutreten.
Sir Allan betrat das Gemach. Sein Gesicht hatte sich vor Sorge verdüstert.
»Mylady … solltet Ihr nicht … sollte ich nicht nach unten zu Lord Andrew gehen und –« begann er höflich.
»Nein!« unterbrach ihn Margaret. »Ihr müßt Fiona von ihm fernhalten … sie von hier fortschaffen. Er –«
Plötzlich wurde die schwere Eichentür mit einem lauten Knall aufgestoßen, und ein halbes Dutzend Soldaten mit gezückten Schwertern in den Händen drangen in den Raum ein. Allan zog instinktiv sein eigenes Schwert aus der Scheide und trat schützend vor seine Herrin.
Margaret packte Fionas Hand und begann, in Richtung der Hintertür des Raumes zurückzuweichen. Sie spürte das aufgeregte Pochen ihres Herzens in ihrer Brust, aber sie wußte, daß sie nicht um ihr eigenes Leben fürchtete, sondern um das ihres geliebten Kindes.
Heilige Mutter, Fiona ist unschuldig, betete sie. Bitte hilf ihr. Bitte rette sie.
»Was hat diese Ungeheuerlichkeit zu bedeuten?« kläffte der Ritter.
Statt einer Antwort griffen ihn vier Soldaten an.
Allan parierte tapfer die ersten Stöße des Angriffs, wobei es ihm gelang, einen der Angreifer quer durch den Raum zu schleudern. Während er auf die Soldaten zustürmte, stieß er einem seine Klinge zwischen Schulter und Hals, aber noch bevor er sein Schwert wieder aus dem sterbenden Mann ziehen konnte, erkannten die beiden anderen Soldaten ihre Chance und durchbohrten seine Brust und seinen Rücken. Die Klingen kreuzten sich irgendwo zwischen seinen Rippen.
Der tapfere Ritter war tot, bevor er zu Boden stürzte. Die Angreifer wandten sich Fiona und Margaret zu, die entsetzt zusahen, wie die Mörder auf sie zukamen.
Doch Margaret erholte sich schnell und schob Fiona hinter sich, während sie einen kleinen Dolch aus ihrem Gürtel zog. Langsam wichen sie zur Tür zurück.
»Bleib hinter mir«, befahl Margaret mit einer Stimme, die vor Aufregung zitterte. »Diese Tiere werden es nicht wagen –«
Fiona spürte, wie sie plötzlich in die Luft gehoben wurde. Sie drehte ihren Körper und versuchte verzweifelt, wieder zu ihrer Mutter zurückzukommen. Aber ein riesiger Mann, der größer war als Sir Allan, hielt sie mit einem schraubstockartigen Griff fest, so daß ihr der Schmerz durch den Arm schoß. Als sie ihren Kopf wandte, erwischte sie einen Blick auf das häßliche, vernarbte Gesicht und den wilden, zerzausten Bart des grinsenden Irren, der sie festhielt.
Aus dem Augenwinkel heraus sah sie, daß ein weiterer Mann die Arme ihrer Mutter packte und ihr das Messer aus der Hand wand.
Als sie die Schreie ihrer Mutter hörte, spürte Fiona, wie ihr Körper sich vor Wut versteifte. Plötzlich schnappte etwas in ihrem Inneren und all ihre Angst verschwand. Sie verwandelte sich in einen Wirbelwind von Bewegungen, und ihre Arme und Beine flogen in alle Richtungen gleichzeitig.
Fiona trat mit aller Kraft gegen den Bauch des Mannes und grub ihre Zähne in seine kräftige Hand. Er zog sie zurück und für einen Augenblick schwang sie fast frei in der Luft. Sie drehte ihren Arm und schlug ihn fest in die Körpermitte, was ihn veranlaßte, sie von sich wegzuschubsen.
»Was zum Teufel …«
Fiona landete auf Händen und Knien, rappelte sich aber schnell auf und blickte den häßlichen Mann herausfordernd an.
»Wollt Ihr Euch etwa von der Kleinen besiegen lassen, Mylord?« höhnte einer der Soldaten.
»Sie ist eine Teufelin«, brüllte der Goliath und trat einen Schritt auf das Mädchen zu.
Fiona blickte wild um sich. Beide Türen waren blockiert. Dort konnte sie nicht hinaus. Sie rannte auf das Fenster zu, packte ihren Stuhl und eilte zu den Männern hinüber, die ihre Mutter festhielten, welche sich nach Kräften wehrte. Sie schleuderte einem den Stuhl entgegen und biß in die Hand des anderen, bevor sie von hinten bei den Haaren gepackt wurde.
Der Mann riß ihren Kopf grob zurück und schleuderte sie herum. Seine Faust hing in der Luft, und seine Augen waren vor Zorn getrübt.
»Ich werde dir beibringen, wie man bei uns mit Teufelskindern umgeht.«
Fiona bedachte den Highlander mit einem verächtlichen Blick.
»Wenn du mir wehtust, wird mein Papa dich töten«, zischte sie.
Für einen Moment flackerte ein schockierter Ausdruck über das Gesicht des Mannes und seine Faust öffnete sich. Dann verengten sich seine dunklen Augen und die Härte seines Blicks ließ Fionas das Blut in den Adern gefrieren.
»Wo du hingehst, wird dich dein allmächtiger Papa niemals finden«, brummte er drohend.
Der Anführer zerrte sie zur Hintertür, an Margaret vorbei, die geknebelt worden war, und schubste das kleine Mädchen zu einem seiner Männer hinüber.
»Bring sie nach unten«, stieß er hervor. »Sofort!«
»Sollen wir im Hof auf Euch warten, Torquil?« erkundigte sich der Mann, der Fiona umklammert hielt. Fiona versuchte, ihre Hand freizubekommen, aber der Soldat drehte ihr den Arm auf den Rücken und packte ihr Haar mit brutaler Gewalt.
»Nein, ich werde euch einholen«, entgegnete der Mann barsch. Er wandte sich mit einem höhnischen Grinsen Margaret zu. »Es gibt noch eine traurige Angelegenheit, die ich hinter mich bringen muß.«
Margarets Augen weiteten sich vor Entsetzen, und sie warf einen letzten Blick auf ihre Tochter, die schreiend aus dem Gemach gezerrt wurde.
Lord Gray, Margaret Drummonds Onkel, war derjenige, der die Leiche seiner Nichte entdeckte. Die schockierende Nachricht verbreitete sich schnell im Land.
Man gelangte zu der Ansicht, daß eine Gruppe von Fremden Margarets Tochter, Fiona, am frühen Abend entführt haben mußte. Der Schock über den Verlust ihres Kindes war an einem Abend solch freudiger Erwartung, nachdem sie zwei lange Jahre auf die Rückkehr des Vaters ihres Kindes gewartet hatte, offenbar zuviel für Margaret gewesen – sie mußte den Verstand verloren haben. In ihrer Verzweiflung hatte sie sich das Leben genommen und sich im Gemach ihrer Tochter vergiftet. Man hatte einen Brief gefunden, in dem sie erklärte, daß ihr Leben ohne ihr Kind nichts wert sei.
Die Leute suchten überall nach Fiona. Aber als zwei Wochen später der schlimmste Sturm seit fünfzig Jahren über Schottland hinwegzog und Chaos und Vernichtung von den Äußeren Hebriden und der Isle of Skye bis zum Firth of Forth und Edinburgh hinterließ, wurden die fruchtlosen Versuche beendet.
Weder Fiona noch ihre Entführer wurden jemals gefunden, und diejenigen, die sie liebten, weinten, denn sie glaubten, sie sei tot.
KapitelEins
Die Nußschale, obwohl hart und kräftig,
umhüllt den süßen, köstlichen Kern.
- Robert Henryson, »The Fables«
Dunvegan Castle, Isle of Skye, Juni 1516
Er vermochte kaum zu atmen.
Die Körper der Menschen um ihn herum preßten sich so nahe an ihn, daß er nur schwerlich seine Arme heben konnte. Und da waren Gesichter – Gesichter, die so vertraut aussahen, denen sich aber keine Namen zuordnen ließen. Und hinter ihnen entdeckte er König James, der ihn mit flehendem Blick ansah.
»Was ist geschehen, Mylord?« hörte er sich fragen. Seine Stimme kam von weit her, als sei sie irgendwo in seinem Kopf. Er fragte sich, ob er die Worte wirklich ausgesprochen hatte.
Er versuchte, auf den König zuzugehen, aber die Körper preßten sich nun fester als zuvor gegen ihn. Und dann schoben und trugen sie ihn wie eine Meereswelle mit quälender Langsamkeit von seinem König fort.
Alec blickte den König weiterhin an, und folgte dessen Blick, als James sein Gesicht den düsteren Schatten hinter ihm zuwandte.
Als Alec an ihm vorbeisah, entdeckte er eine Tür, die sich öffnete. Eine Nebelwolke strömte durch die Öffnung und bildete einen Wirbel. Plötzlich war er von dem schimmernden Licht tausender Sonnen geblendet. Dann wurde diese Helligkeit von einem anderen Anblick verfinstert – eine engelsgleiche Gestalt trat durch die Tür. Ihr rotes Haar floß in endlosen Wellen herab und umrahmte ein makelloses Gesicht. Von dort aus, wo er stand, konnte Alec ihre kristallenen Augen sehen, aus denen alle Farben zu leuchten schienen. Die Augen fanden die seinen und zogen ihn mit ihrem Versprechen von Erfüllung in ihren Bann. Licht und Wärme ergossen sich über ihn. Er vermochte seinen Blick nicht mehr von diesem strahlend schönen Geschöpf abzuwenden.
Alec sah, wie der König auf die Engelsgestalt zuging, ihr mit einer Hand zuwinkte und seine andere nach dem Licht ausstreckte.
Aber er konnte sich nicht bewegen. Alec versuchte verzweifelt, gegen die Strömung, die ihn hinwegtrug, anzukämpfen, aber seine Mühe war vergeblich. Er entfernte sich immer weiter von dem Licht und der Vision. Sein Atem wurde ihm aus dem Leib gepreßt. Während er nach Luft rang, sah er, wie das Licht schwächer wurde und der Engel verschwand.
Er erstickte. Er mußte irgendwie wieder zu seinem König und dem Licht zurückgelangen.
Aber er konnte kaum atmen.
Alec Macpherson setzte sich abrupt im Bett auf und schnappte nach Luft. Der Schweiß lief ihm über Brust und Rücken.
Er hatte schon wieder den gleichen Traum gehabt.
Er warf die Bettdecke zur Seite, sprang aus dem Bett und blickte sich im dunklen Zimmer um. Es war so kalt. So groß und kalt und leer, dachte er. Die kühle Sommerbrise strich durch den offenen Fensterschlitz über seinen nackten Körper hinweg. Die Stille um ihn herum kam ihm greifbar vor und lastete wie ein Mühlstein auf ihm.
Er versuchte, den Traum abzuschütteln und ging zum Fenster hinüber, wo er sich streckte und tief die dunstige Salzluft einatmete. Ganz langsam ließ das Gefühl der Bedrücktheit nach. Sein Blick wurde von den beiden Zwillingsspitzen von Healaval auf der anderen Seite des nebelverhangenen Wassers von Loch Dunvegan angezogen. Egal, wie lange er auch auf Dunvegan blieb, es kam ihm nie wie sein Heim vor. Er vermißte das Treiben, das Leben, das auf Benmore Castle herrschte. Aber selbst der Aufenthalt in seinem Heim hatte nichts gebracht … war nicht hilfreich gewesen.
Während er in den Morgennebel hinausstarrte, sah er vor seinem inneren Auge immer noch die Bilder des Traumes. Zum ersten Mal hatte er das Gesicht der Engelsgestalt gesehen. Vorher war sie nie mehr als ein Licht gewesen. Aber dieses Mal hatte Alec sie gesehen. Sie war aus Fleisch und Blut. Aber wer war sie?
König James IV. war nun bereits seit drei Jahren tot, und Alec hatte an jenem verfluchten Tag auf Flodden Field an seiner Seite gekämpft – dem Tag, als der König alle Warnungen in den Wind geschlagen und die Engländer herausgefordert hatte. Der König war von einem englischen Pfeil und einem Schwarm blutrünstiger Fußsoldaten niedergestreckt worden, und das nur, weil Torquil MacLeod und andere ihre Truppen zurückgehalten hatten, als sie am dringensten benötigt wurden. Das war ein bitterer Tag für Schottland und für Alec gewesen.
Wie seltsam, dachte Alec, daß er in seinen Träumen nach so langer Zeit vom Geist seines Königs heimgesucht wurde … und von der seltsamen Vision einer Engelsgestalt. Alec Macpherson war vor vier Monaten auf Dunvegan Castle eingetroffen. Zu dieser Zeit hatten die Träume begonnen. Er war in der Überzeugung hierhergekommen, daß es genau das richtige für ihn sei, die Arbeit der Krone in diesem entlegenen Teil Schottland zu verrichten. Sein Leben und sein Kopf waren voller Ereignisse und Erinnerungen, die er einfach nicht abzuschütteln vermochte. Ein falsches Versprechen, eine gelöste Verlobung, eine untreue Frau. Alec rieb sich heftig über das Gesicht, als könne er damit all die Gedanken, all die Spuren, die Kathryn hinterlassen hatte, wegwischen.
Er zwang seine Gedanken wieder zu seinem Traum zurück und fragte sich, was der König ihm wohl mitzuteilen versuchte. Warum hatte er drei Jahre gewartet? Warum kam er gerade hier zu ihm?
Als der neue Herr über Skye und die Inseln der Äußeren Hebriden hatte Alec sich nachdrücklich bemüht, Ordnung in diesem wilden und mysteriösen Land zu schaffen, über das Torquil MacLeod auf so barbarische Art und Weise geherrscht hatte.
Der mörderische MacLeod hatte schließlich seine gerechte Strafe erhalten, aber seine Exekution wegen Verrats hatte eine große Lücke in der Machtstruktur der nordwestlichen Highlands hinterlassen. Alec Macpherson, der zukünftige Chief seines eigenen Highland-Clans, der ein furchtloser Krieger und berühmter Anführer war, hatte die Aufgabe erhalten, die Auswirkungen von dreißig Jahren brutalster Unterdrückung auszumerzen und die Region für den neuen König der Stuarts zu sichern.
Während er sich für seinen morgendlichen Ausritt ankleidete, dachte Alec über all das nach, was er sich vor vier Wochen vorgenommen hatte. Es schien ihm, als ob er Tag und Nacht gearbeitet habe, und es war immer noch ein wenig beängstigend für ihn, alles nun als vollbracht anzusehen. Er war mit seinen eigenen Männern hier eingetroffen und hatte Widerstand, sogar Blutvergießen erwartet. Schließlich war er von diesen Menschen nicht als Anführer gewählt worden. Die Edelmänner des Regentschaftsrates hatten ihn zum Herrn ernannt, und ihm die Macht gegeben, die Isle of Skye wie sein Eigentum zu regieren.
Daher war Alec vom Empfang der hiesigen Männer überrascht gewesen. Die Handvoll von Soldaten, die noch auf Dunvegan Castle verblieben waren, standen unter dem Befehl von Neil MacLeod, einem Krieger, der auf den Feldern von Flodden zum Krüppel geworden war – einer der wenigen seines Clans, der auf loyale Weise für seinen König gekämpft hatte. Er und seine Männer hatten sich friedlich Alecs Willen unterworfen und geschworen, ihn bei seinem königlichen Auftrag zu unterstützen. Und Sie hatten tatsächlich Wort gehalten.
Alec fand sehr schnell heraus, daß die Menschen auf Skye – der MacDonald- und der MacLeod-Clan – Besseres verdient hatten als das, was sie so viele Jahre unter Torquil erdulden mußten.
Sie waren ganz anders, als er erwartet hatte. Es stimmte wohl, daß es immer noch kleine Banden von herumziehenden, gesetzlosen Rebellen in den entlegenen Gebieten der Insel gab, aber von diesen abgesehen waren die Bauern und die Fischer von Skye zum überwiegenden Teil gute Leute.
Zuverlässige, einfache Menschen, die ein tiefer Glauben an die alten Traditionen verband – Menschen, denen es trotz ihres verräterischen Anführers irgendwie gelungen war, sich ihre Gastfreundlichkeit, ihre Anständigkeit und vor allem ihre Würde zu bewahren.
Und Alec hatte gesehen, daß diese Leute ihm zu vertrauen begannen, seine Befehle in dem Sinne, in dem sie ausgesprochen wurden, aufnahmen und einsahen, daß es ihm darum ging, das Los all derer zu verbessern, die von ihm abhängig waren.
Alec schnallte sein Schwert um und zog die dicke Eichentür auf, die aus seinem Turmzimmer hinausführte. Der moderige Geruch des inneren Treppenhauses stieg in seine Nasenlöcher.
Dieser alte Turm war angeblich dreihundert Jahre alt. Mit seinen wenigen, schmalen Schlitzen, die die dicken Steinwände durchbrachen, weckte er Erinnerungen an Kindheitsgeschichten von Feen und Kobolden, Wassergeistern und Hexen. Es überraschte Alec nicht, daß die Geschichte von Skye eine buntgewobene Mischung aus Tatsachen und Fantasieerzählungen war.
Aber die Burg besaß eine stolze und wohlbekannte Geschichte. Sie hatte den Angriffen der Wikinger und der keltischen Könige sowohl vom Wasser aus wie auch zu Land widerstanden. Außerdem war sie ein Außenposten der Zivilisation gewesen, als der christliche Glaube zum ersten Mal in diesem wilden Land der Feen und derer, die an sie glaubten, Fuß fassen konnte. Und sie hatte den Mittelpunkt der Rebellion gegen jeden der vier Stuart-Könige dargestellt, die den schottischen Thron in Besitz nahmen.
Aber dieser letzte Teil der Geschichte von Dunvegan war wohl vorüber, dachte Alec.
Er bemühte sich nach wie vor, die Eindrücke seines beunruhigenden Traumes abzuschütteln, während er die Treppe hinunterging. Die morgendlichen Jagden wurden langsam zur Gewohnheit, aber er wußte zumindest, daß er auf diese Weise den Kopf frei bekam. Als er den Großen Saal betrat, warf er einen Blick auf die Männer, die auf Bänken um die letzten glühenden Kohlen des Feuers in der Raummitte schliefen. Alles war ruhig und die Hunde rührten sich kaum, als er den Raum durchquerte.
»Geht Ihr auf die Jagd, Mylord?«
»Robert!« sagte Alec erschrocken. »Wie oft habe ich dir schon gesagt, daß du dich nicht so anschleichen sollst.«
»Ich übe mich in den Künsten der Krieger, Mylord«, erwiderte der Knappe flüsternd. »Eines Tages, Mylord, wenn Ihr der Ansicht seid, daß ich dafür bereit bin, mit den Kriegern zu üben, werde ich Euch beweisen, daß ich all das, was Ihr mir beigebracht habt, beherrsche. Erinnert Ihr Euch noch? Ihr selbst habt mir gesagt, daß ein Krieger allzeit bereit sein müsse. Ihr habt mir gesagt, daß Heimlichkeit –«
»Und ich habe dir auch gesagt, daß du die Dinge, die ich dir beibringe, nicht an mir ausprobieren sollst.«
Alec hatte Robert vor einem Jahr zu seinem persönlichen Knappen gemacht. Der Junge hatte sich als ein eifriger und hart arbeitender Schüler entpuppt und war im letzten Jahr wie eine Bohnenstange in die Höhe geschossen. Alec mußte unwillkürlich lächeln, als er sich daran erinnerte, wie oft er durch die verwirrenden und manchmal komischen Erkenntnisse des heranwachsenden Jungen von der harten Welt der schottischen Politik abgelenkt worden war. Obwohl er Alec so manches Mal das Leben schwer machte, war Robert ihm doch treu ergeben – und hatte nicht die geringste Angst vor dessen Launen.
»Ja, Mylord.« Der junge Mann nickte. »Aber Ihr habt mich auch gelehrt, mein Urteilsvermögen zu benutzen und Entscheidungen zu treffen. Besonders, wenn es sich um das Wohlergehen von Menschen handelt, die mir am Herzen liegen.«
»Das ist richtig, Robert.«
»Und daher muß ich einiges, was Ihr mir beigebracht habt, auch an Euch üben, denn wenn ich es nicht tue … dann wäret Ihr vielleicht bald nicht mehr in meiner Nähe, um mich mehr zu lehren. Und wenn Ihr nicht mehr in meiner Nähe wäret –«
»Genug, Robert!« brummte Alec und führte den jungen Mann durch den Großen Saal zu einer kleinen Tür auf der anderen Seite. »Es ist noch zu früh, um mich auf eine Diskussion mit dir einzulassen. Leg dich wieder schlafen.«
»Aber Mylord, Euer Frühstück steht bereit«, erwiderte Robert besorgt. »Ihr müßt doch etwas essen, bevor Ihr geht. Ihr eßt nie genug. Selbst der Koch sagt das. Und dann die Jagerei den ganzen Morgen. Euer Bruder, Sir Ambrose, findet, das sei nur ein Versuch, um –«
»Es geht mir gut, Robert«, unterbrach ihn Alec, der an dem Eisengitter stehen geblieben war, das einen offenen Schacht bedeckte. Er diente als Luftzufuhr für das unterirdische Gewölbe der Burg. »Es gibt keinen Grund, daß irgendjemand sich um mich Sorgen macht.«
Alec blickte in die Dunkelheit des Schachts hinab und dachte an die Greueltaten, die vor noch nicht so langer Zeit dort unten im Verlies stattgefunden hatten. Da nahm er eine Bewegung wahr. Als er schärfer in die Dunkelheit hinunterspähte, glaubte er, einen Schatten tief unten zu erblicken. Eine Ratte, dachte er angewidert.
»Aber Mylord«, fuhr der Knabe fort. »Sir Ambrose ist der Ansicht, daß Ihr, wo doch keine angemessenen Damen hier sind, um Euch die Zeit zu vertreiben, einfach –«
»Robert!« Alec richtete seinen wütenden Blick auf den schlaksigen Jungen neben ihm. Ambrose benötigte ganz offensichtlich etwas anderes, womit er sich beschäftigen konnte.
Wie sollte Alec ihm nur erklären, welch eine erfrischende Abwechslung es war, einmal ohne diese habgierigen Damen des Hofes zu sein? Ohne Katherine, seine treulose, einstige Verlobte. Alec war durchaus bereit, zumindest sich selbst gegenüber einzugestehen, daß in seinem Leben etwas fehlte, aber das war bestimmt nicht die Gesellschaft derer, denen er ganz bewußt den Rücken gekehrt hatte.
Nein, das konnte er Robert nicht erklären, aber er mußte dies seinem Bruder sehr deutlich machen, bevor Ambrose dafür sorgte, daß irgendwelche Überraschungsgäste auf der Türschwelle von Dunvegan auftauchten.
»Aber Mylord, ich wollte damit doch nichts weiter sagen, als –«
»Wirst du wohl endlich die Klappe halten?« brummte Alec drohend.
»Jawohl, Mylord.« Der junge Mann lief rot an, denn er erinnerte sich plötzlich an den Grund für die Empfindlichkeit seines Herrn in Bezug auf gewisse Themen. »übrigens habe ich Sir Ambrose versprochen, ihn zu wecken, damit er Euch heute Morgen begleiten kann. Er ist wirklich um Euch besorgt. Wie wir anderen auch. Gestern Abend noch habe ich mit dem Koch gesprochen, und er sagte, daß –«
»Robert«, polterte Alec endgültig los. »Ich warne dich. Ambrose wird bald nach Hause gehen. Wenn du auch nur noch ein einziges Wort sagst, werde ich dich mit ihm zurückschicken … und das Gleiche gilt für den Koch.«
»Ich werde nichts mehr sagen, Mylord. Kein einziges Wort. Versprochen. Und ich werde auch den Koch vom Reden abhalten. Ihr werdet keine Laut mehr von mir hören. Und wenn Ihr kein Frühstück zu Euch nehmen wollt, dann ist das Eure Sache … Mylord.« Robert verstummte, denn der drohende Blick seines Gutsherrn sagte ihm, daß er schon wieder den gleichen Fehler beging. Das Letzte, was er wollte, war, nach Benmore Castle zurückgeschickt zu werden. Der Knappe wand sich unbehaglich und dachte an Lord Alexander, und wie er in der Vergangenheit so oft die Geduld des alten Gutsherrn auf die Probe gestellt hatte. Und obwohl Robert Lady Elizabeth, die Mutter seines Herrn, mochte, wollte er doch eines Tages ein Krieger sein, nicht das Dienstmädchen einer Dame, Himmel noch mal. Er stand schweigend da, den Blick zu Boden gesenkt.
Alec schüttelte den Kopf und drehte sich zur Tür. Dieser Junge konnte wirklich reden. Sein Geplapper hatte inzwischen dafür gesorgt, daß alle im Saal wach geworden waren. Oh, dafür war er ihm etwas schuldig, dachte Alec mit einem grimmigen Lächeln.
»Ich werde schon nicht verhungern, Robert. Mach dir deshalb mal keine Sorgen«, rief Alec über seine Schulter zurück. »Ich werde etwas essen, wenn ich zurückkomme.«
Der Knappe eilte rasch zur Tür und öffnete sie, bevor Alec sie erreicht hatte. Ehe er hindurchtrat, verharrte der Kriegsherr kurz.
»Oh, und noch etwas, Robert«, sagte Alec und bedachte seinen Knappen mit einem düsteren Blick. »Neil hat mir gesagt, daß du deine Pflichten im Haushalt vernachläßigst, um dich auf den Übungsplätzen herumzudrücken.«
Robert erbleichte unter dem strafenden Blick seines Herrn. »Nein, Mylord. Ich … ich habe meine Pflichten nicht vernachläßigt … Ich … Das ist einfach nicht wahr! Also ich bin natürlich auf die Plätze gegangen, aber ich … ich …«
»Hör zu, Robert«, sagte Alec und packte den schlaksigen Jungen am Arm. »Von heute ab möchte ich, daß du die ganze Zeit mit den Kriegern trainierst. Richte dem Koch aus, daß er die Haushaltspflichten einem der Jüngeren übertragen soll.«
Robert stand sprachlos da und starrte seinem Herrn mit offenem Mund nach, während er zu begreifen versuchte, was er gerade vernommen hatte.
Alec schmunzelte in sich hinein, als er in das düstere Licht hinaustrat, das noch nicht von der Morgendämmerung erhellt wurde. Er hatte auf den richtigen Moment gewartet, um Robert für seinen Fleiß und seine Bemühungen zu belohnen. Trotz seiner jugendlichen Eigenarten und seiner geselligen Natur entwickelte er sich zu einem feinen, jungen Mann. Diese Veränderung seiner Stellung würde seiner Entwicklung zu einem guten Krieger nur förderlich sein. Einfallsreich. Kühl. Reserviert. Gelassen.
Als Robert vor Freude zu jaulen begann, lachte Alec laut über die zunehmenden Geräusche der aufwachenden Krieger im Saal, die den Jungen, der im Türrahmen Luftsprünge vollführte, mit unfreundlichen Flüchen bedachten.
Einige Augenblicke später nickte der Gutsherr dem Torwächter zu und zog den Kopf ein, als er sein schwarzes Schlachtroß an einer Stelle durch die drei Meter dicke Zwischenwand von Dunvegan Castle lenkte. Nachdem er die düstere Passage durchquert hatte und in das nur wenig hellere Licht der Vormorgendämmerung gelangt war, bog er mit seinem Pferd nach rechts und galoppierte entlang der kleinen, salzwasserhaltigen Bucht, die von den Festungswänden beherrscht wurde.
Auf seinem linken Handgelenk saß Alecs kostbarer, schneeweißer Wanderfalke, der den Namen Swift trug. Die Jagd mit dem seltenen, walisischen Albinovogel war inzwischen mehr als sein beliebtester Zeitvertreib, als eine Fluchtmöglichkeit des Kriegsherren geworden. Sie hatte sich zu einem morgendlichen Ritual entwickelt.
Alec ritt über das hügelige Heidemoor auf ein dicht bewaldetes Tal gut anderthalb Kilometer landeinwärts zu. Dieser Landstrich, der von wilden Hügeln und gezackten Felskämmen umgeben war, enthielt viel Rotwild und fette Fasane, die Swift auf so hervorragende Weise aus der Luft ausmachte und erbeutete.
Als er eine kleine Mulde im Gelände durchquerte, wurde er vom Morgennebel eingehüllt. Obwohl er nicht weit sehen konnte, wußte er doch, daß der Pfad nach wenigen Metern wieder ansteigen würde.
Das hier war eins der Dinge, die ihm an Skye am besten gefielen. Hier besaß er die Freiheit, auf seinem eigenen Land zwischen den unheimlichen Gesteinsformationen und den heidebedeckten Hügeln herumzureiten. Hier besaß er die Freiheit, die Einsamkeit der Morgenluft zu genießen, ohne unter der erstickenden Nähe des Hofes, seiner Parasiten und seiner Frauen leiden zu müssen.
Als sich das Land erhob und die dichte Dunstwolke zu Nebelschwaden aufbrach, gelangte Alec in den Wald. Er blickte sich ehrfürchtig um. Obwohl er diesen Pfad schon so oft geritten war, erstaunte es ihn immer wieder, wie sehr ihn diese Schönheit und Rätselhaftigkeit des Waldes berührte. Die Hunderte von Jahren alten Eichen verflochten ihre Zweige über ihm zu einem Baldachin. Er blickte auf, als sich die ersten Strahlen der Sonne bemühten, das Dickicht zu durchdringen.
Plötzlich erblickte Alec eine dunkle Gestalt vor sich auf dem Pfad. Als er den Kopf des Pferdes nach rechts riß, sah Alec, wie ein weißer Arm aus den Falten eines Umhangs hervorschoß. Swift kreischte und seine ausgebreiteten Flügel nahmen Alec für einen Augenblick die Sicht. Als sie zu der seltsamen Gestalt gelangten, riß er kräftig an den Zügeln des Pferdes, um das sich aufbäumende Tier unter Kontrolle zu halten. Er wandte seinen Kopf dem Wesen zu, das am Wegesrand lag.
»Was seid Ihr für ein Irrer?« ertönte die zornige Stimme einer Frau.
Er war schockiert, eine weibliche Stimme zu vernehmen, und überhörte die Titulierung, mit der sie ihn bedacht hatte, denn er wurde sich bewußt, daß er beinahe eine wehrlose Bäuerin umgeritten hätte.
»Es ist eine Sache, wenn Ihr Euch den Hals brechen wollt, aber wenn es dabei um meinen eigenen geht, sieht der Fall doch anders aus«, schalt ihn die Stimme und wurde schrill vor Wut. »Ihr hättet mich beinahe über den Haufen geritten!«
»Warte! Ich werde dir helfen«, erwiderte Alec. »Ganz ruhig, Ebon!«
Das Roß sträubte sich immer noch gegen Alecs Bemühungen, es zu beruhigen, und Alec konnte die Frau nicht genau erkennen, aber als sie sich aufraffte, um den Inhalt einer großen, braunen Tasche aufzuheben, der verstreut auf dem Boden lag, erwischte er einen Blick auf glänzendes, rotes Haar, das unter der dunklen Kapuze hervorströmte.
»Bist du verletzt, Frau –« Alec versuchte, über das Kreischen des Vogels hinwegzurufen. Aber sein Pferd bäumte sich erneut auf, und als sich der Krieger wieder zum Pfad umwandte, war die Gestalt in dem Umhang verschwunden. In der Nähe rührte sich kein Zweig. Es waren keine Schatten zu erkennen. Keine Spur von ihr. Gerade war sie noch dagewesen und im nächsten Moment schon verschwunden.
Fiona stand wenige Schritte vom Pfad entfernt und spähte durch den Nebel, um den Kampf zwischen Pferd und Reiter und dem seltsamen, weißen Falken zu beobachten. Drei echte Biester, dachte sie wütend und rieb sich ihre schmerzende Schulter. Drei wilde Tiere. Sie zog den Umhang schnell wieder fest um sich und schob ihr Haar unter den Schleier zurück, den sie unter der Kapuze des Umhangs trug. Ihr Herz pochte heftig gegen ihre Rippen. Sie versuchte, tief und ruhig zu atmen, um ihren Puls zu verlangsamen und ihre Wut zu zügeln.
Schließlich gelang es dem Krieger, den schnaufenden, schwarzen Hengst zu beruhigen, und auch die Schreie des Falken verstummten. Sie beobachtete, wie sich der Reiter suchend umblickte. Fiona wußte, daß er sie nicht sehen konnte, und daß sie, falls nötig, leicht durch den dicht bewachsenen Hain hinter ihr entkommen würde. Sie kannte diese Gegend wie ihre eigene Westentasche.
Der großgewachsene, goldblonde Krieger ließ sein Pferd zu der Stelle des Pfades zurücktrotten, wo er an ihr vobeigeritten war. Er blickte sich in alle Richtungen um, hielt das Pferd an und spitze die Ohren, ob er etwas vernahm. Er erhob sich aus dem Sattel und stand lange Zeit, ohne sich zu rühren, in seinen Steigbügeln. Offenbar gehorchten Pferd und Falke den Signalen ihres Herren, denn sie warteten ebenso wie er geduldig und bewegungslos.
Schließlich zog er sein Schwert und spießte die Schnur mit den hölzernen Gebetsperlen auf, die vor ihm im Gras lag. Nachdem er sein Schwert wieder in die Scheide gesteckt hatte, blickte er sie neugierig an und schloß dann seine Faust darum.
Von der Stelle aus, wo Fiona stand, konnte sie seinen Gesichtsausdruck nicht genau erkennen. Der Riese drehte sein Pferd in ihre Richtung. Nun standen Pferd und Reiter ihr zugewandt. Sie glitt so leise sie nur konnte hinter den Stamm einer dicken, knorrigen Eiche. Oh, Gott, hat er mich etwa gesehen? In ihrem Kopf begann alles wirr durcheinander zu gehen. Kann er mich hören? Sie hielt den Atem an und wünschte sich sehnlichst, das Pochen ihres Herzens stoppen zu können. Kurz darauf hätte sie angesichts der Entfernung zwischen ihnen am liebsten laut über ihre eigene Dummheit gelacht.
»Bist du verletzt?« rief der Reiter, und seine Stimme hallte durch den Wald. »Du mußt keine Angst vor mir haben.«
Er verstummte und lauschte, ob er eine Antwort erhielt.
»Wenn du verletzt bist, aber noch nach Dunvegan Castle gehen kannst, so tu es. Dort wird man sich um dich kümmern.«
Er verstummte wieder und lauschte. Fiona hörte, wie die Hufe des ungeduldigen Pferdes am Rande des Pfades aufstampften. Als der Krieger erneut seine Stimme hob, klang sie verärgert. »So antworte mir doch! Dieser Wald ist gefährlich, wenn du verletzt bist. Hier gibt es viele wilde Tiere.«
Die gibt es ganz gewiß, dachte Fiona und kicherte leise in sich hinein.
»Hör mir zu«, rief er, und der Zorn in seiner Stimme war nun deutlich erkennbar. »Ich versuche, dir zu helfen. Ich habe keine Ahnung, warum eine Frau um diese Zeit alleine hier im Wald herumläuft, aber sprich, um Gottes Willen.«
Fiona spähte erneut vorsichtig hinter dem Baumstamm hervor und sah zu, wie er auf eine Antwort wartete. Sie lächelte angesichts seiner offenkundigen Wut und Ohnmacht. Gut, dachte sie. Warum ritt er auch wie ein Verrückter über Pfade, die ehrliche Bauern benutzten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Der Kriegsherr verharrte noch einige Momente unschlüssig an derselben Stelle.
»Wenn du nicht antworten willst, dann … zum Teufel mit dir!« brüllte er schließlich, riß sein Pferd herum und galoppierte den Pfad zurück.
Fiona atmete erleichtert auf, als er im Nebel verschwand. Dann stampfte sie zornig mit dem Fuß auf. »Lord Macpherson, Ihr habt gewiß nichts daraus gelernt!«
Sie trat aus ihrem Versteck zwischen den Bäumen auf den Hirschpfad hinaus, den sie seit einigen Jahren jeden Morgen benutzte. Seit der Ankunft des neuen Gutsherrn hatte ihn Fiona an vielen Tagen beobachtet, wie er mit seinem weißen Vogel oder einem anderen Falken auf dem Arm durch die Gegend galoppierte. Er ritt immer wie ein Verrückter, trieb sein Pferd bis zur Erschöpfung an, als sei er auf der Flucht oder auf der Jagd nach jemandem. Warum auch immer, heute war er jedenfalls früher als sonst unterwegs gewesen und hatte sie überrumpelt.
Aber das war nicht ausschließlich seine Schuld, das mußte Fiona zugeben. Sie hatte sich später als geplant auf den Rückweg von der Ansammlung von Hütten tief im Wald gemacht, in denen ihr alter Freund Walter und seine Leidensgenossen vor vier Jahren Zuflucht vor den Grausamkeiten von Torquil MacLeod gesucht hatten. Vater Jack, der alte Einsiedler, war heute auch dort gewesen, und die Zeit war beim Vortrag seiner unglaublichen Geschichten wie im Fluge vergangen.
Das Kloster auf der abgeschiedenen Isle of Skye war seit sie es kannte, ein Zufluchtsort für Leprakranke gewesen. Sie lebten von Kirchenland und erhielten hier Schutz. Aber das alles hatte sich vor vier Jahren geändert, als Torquil zu der Ansicht kam, daß Skye nicht länger von Krankheit beherrscht sein sollte. Daher reiste Fiona seither zwischen dem Kloster und den Leuten, die sich wie gejagte Tiere versteckten, hin und her. Der blinde Haß eines Edelmannes, der sich am Leid anderer ergötzte, hielt sie dort gefangen. Der Befehl dieses mächtigen Anführers hatte zur Folge, daß ein Strom von Grausamkeiten gegen diese kranken Menschen ausgelöst wurde, die weder fliehen noch sich verteidigen konnten.
Bei dem Gedanken an diese Ungerechtigkeit wanderte Fionas Hand instinktiv zu der hölzernen Rassel an ihrem Gürtel. Sie war ihr jetzt sehr nützlich. Die meisten Leute machten einen weiten Bogen, wenn sie das hölzerne Warnzeichen der Aussätzigen vernahmen. Aber vor vier Monaten noch hätte das Tragen der Rassel ihre Reisen viel riskanter gemacht. Das heißt, bevor Lord Macpherson kam.
Wann immer es ihr gelang, unbemerkt fortzukommen, wanderte sie diesen Pfad entlang und brachte Nahrung, Medizin und was immer Walter und seine Genossen benötigten, zu ihnen. Vater Jack hatte die Kranken in seine Gemeinde aufgenommen, als sie nicht weit von seiner Steinhütte in den Wald gezogen waren. Aber Vater Jack wurde alt, und Fiona wollte ihm helfen. Sie mußte ihm einfach helfen.
Denn trotz aller Gefahren war Fiona nicht gewillt, Walter aufzugeben, den Mann, der sie vor so vielen Jahren gefunden hatte – ans Ufer geschwemmt und halbtot. Der Mann, der sie ins Kloster gebracht hatte, dem Ort, der seither ihr Zuhause war.
Plötzlich stieß Fionas Fuß gegen eine erhöhte Baumwurzel, und sie wäre beinahe der Länge nach auf den Boden geschlagen. Doch obwohl es ihr gelang, sich taumelnd zu fangen, durchfuhr sie ein Schock, als zu ihrer Rechten ein Rascheln im Unterholz explodierte und sich ein fetter Fasan in die Luft erhob. Der Krach und das überraschende Auftauchen des Vogels hatten sie aus der Fassung gebracht. Fiona erstarrte und ein Zittern lief durch ihren Körper. Sie blickte sich nervös um, und für einen Moment nahmen die Schatten im morgendlichen Wald bedrohliche Formen an. Fiona rückte die Kapuze zurecht, die ihr vom Kopf gerutscht war und zog den Umhang fester um sich, als könne der dicke Stoff das Frösteln nehmen, das ihren Körper erfaßte.
»Das hier ist dein Wald, Fiona«, sagte sie laut und durchbrach damit die Stille, die sich um sie ausgebreitet hatte. »Du bist diesen Pfad öfter als du zählen kannst entlangewandert. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen!«
Als seien ihre Worte nicht genug, griff sie nach einem kräftigen Ast, der neben dem Pfad lag. Doch während sie sich vorbeugte, vernahm sie das Klirren von Steingut in der Tasche, die sie bei sich trug. Sie hockte sich auf den Pfad, öffnete die Tasche und betrachtete traurig die drei leeren Krügen. Nur einer war noch intakt.
»Vielen Dank, Lord Macpherson!« sagte sie und betastete vorsichtig die Splitter der beiden anderen. »Nun habt Ihr auch noch dafür gesorgt, daß ich einiges zu erklären habe.«
Fiona hängte sich die Tasche wieder über die Schulter, packte das kräftige Stück Holz und machte sich wieder auf den Weg. Ihre Angst war vergessen.
Sie begann, darüber nachzudenken, was sie ihrer Herrin sagen würde. »Ja, Mutter Oberin«, nickte sie zustimmend und mußte angesichts einer solch unwahrscheinlichen Beichte lächeln. »Zwei weitere zerbrochene Krüge. Aber dieses Mal war es nicht meine Schuld. Ich hatte eine Begegnung mit diesem schlecht gelaunten Lord Macpherson. Oh, nein, Mutter Oberin, Ihr wißt doch, daß es mir im Traum nicht einfallen würde, ungehorsam zu sein und … wieder einmal … alleine ins Aussätzigenlager zu gehen.«
Fiona blieb stehen, als sie an eine Weggabelung gelangte. »Welchen Weg soll ich einschlagen?« flüsterte sie in sich hinein. »Den sicheren oder die Abkürzung? Den sicheren! Für heute habe ich schon genug Aufregung gehabt.« Sie wandte sich dem ausgetreteneren Pfad zu und spürte, wie sich ihre Laune besserte, während sie ihr Fantasiegespräch weiterspann.
»Wartet! Wo waren wir? Ach ja, Mutter Oberin! Lord Macpherson … Lord Macpherson? Nun, er galoppierte direkt durch die Wäscherei des Klosters, als ich gerade damit beschäftigt war, die Wäsche aufzuhängen. Was, Mutter? Es ist wohl wahr, daß ich mich seit einigen Jahren nicht mehr um die Wäsche gekümmert habe. Ich weiß, Mylady! Ich habe andere Pflichten. Aber versteht doch, es war solch ein wunderschöner Tag. Und ich habe versucht, den anderen Schwestern zu helfen. Besonders Schwester Beatrice. Sie hat eine Sommergrippe, die sie nicht los wird.
Ja, Ihr hättet ihn sehen sollen. Der Gutsherr ist eine recht imposante Gestalt, wie er da so auf seinem Pferd sitzt. Aber dieser unschuldige Vogel, der an seinem Handgelenk festgebunden ist! Die Krüge, Mutter Oberin? Oh, nein, sie waren gewiß nicht mit Kräutertee für die Aussätzigen gefüllt. Mit … Wasser … ja, mit Jasminwasser. Was, Mutter? Wir benutzen kein Jasminwasser, um die Wäsche zu parfümieren?«
»Hmmm!« Fiona verlangsamte ihren Schritt und dachte über diese Sache nach. »Kein Jasmin.« Aber dann begannen ihre Augen zu glänzen, und sie schritt wieder schneller voran.
»Ich bin sicher, daß Ihr recht habt, Mutter Oberin. Offenbar war ich derart in den spirituellen Aspekt meiner Aufgabe versunken – Ihr sagt mir doch ständig, daß Gott in den weltlichsten aller Arbeiten wohnt –, daß, nun ja, der Duft der glorreichen Natur in diesen Leinentüchern gefangen gewesen sein mußte. Ja, Mutter, ich hätte schwören können, daß sie nach Jasmin dufteten. Was, Priorin, Ihr fragt Euch, was Lord Macpherson in der Wäscherei zu schaffen hatte? Ja, Mutter, ich war die einzige, die ihn gesehen hat, aber ich darf Euch versichern, daß sein Pferd nicht einmal ein einziges Taschentuch beschmutzt hat. Nur die Krüge sind kaputtgegangen. Jawohl, völlig zerbrochen, Mutter Oberin.«
Fiona kicherte bei dem Gedanken an eine solche Unterhaltung – und über ein solch unwahrscheinliches Thema – in sich hinein. Lord Macpherson, der durch die Wäscherei prescht, während sie die Wäsche aufhängt! Aber dann verdüsterte sich ihr Ausdruck für einen Moment. Sie mußte sich einmal ernsthaft mit der Priorin darüber unterhalten, Schwester Beatrices Aufgaben vorübergehend einer anderen zu übertragen, bis es dieser wieder besser ging. Die ältere Nonne würde sich nie auch nur mit einem einzigen Wort beklagen und sich ganz gewiß nicht ihren Pflichten entziehen. Fiona wußte, daß die Priorin einschreiten und ihr erst befehlen müßte, sich auszuruhen.
Die Priorin hatte Fiona immer gedrängt, mehr Verantwortung in der Verwaltung des Klosters zu übernehmen. Und sie hatte die junge Frau bei ihren Entscheidungen immer unterstützt. Immer, dachte Fiona. Es war nicht etwa so, daß die Aufgaben, die einige der anderen Nonnen erfüllten, ihr zu niedrig waren. Nein, die Priorin war der Ansicht, daß es angemessener war, Fiona Aufgaben zu übertragen, die ihren Talenten mehr zu entsprechen schienen. Aber Fiona wurde den Eindruck nicht los, daß die Priorin glaubte, sie könne gut mit Zahlen umgehen, tauge aber wenig für alles andere.
Gott habe ihr diese besondere Fähigkeit geschenkt, hatte ihr die Mutter Oberin oft mit einem Lächeln auf dem faltigen Gesicht gesagt. Und es stimmte: Sie fühlte sich bei diesen Arbeiten so wohl wie ein Fisch im Wasser. Wozu die Priorin Stunden benötigte – besonders wenn es um Zahlen und Bücher ging – erledigte Fiona in einem Bruchteil der Zeit. Aber in der jüngsten Vergangenheit war die ältere Frau angesichts von Fionas Rastlosigkeit und ihren unbotmäßigen Handlungen dazu übergegangen, sie als ›Geduldsprobe Gottes‹ zu bezeichnen.
Fiona betrat eine Lichtung und schaute blinzelnd in die helle Morgensonne, die sich schnell durch den Nebel gebrannt hatte. Die Sonne, die sich in einem kleinen Teich in der Mitte der Wiese spiegelte, blendete sie. Sie war immer noch eine gute halbe Stunde vom klösterlichen Anwesen entfernt. Als Fiona ihre Schritte beschleunigte, fragte sie sich, was wohl ihr alter Freund, David, zu ihrem Abenteuer heute morgen sagen würde. Natürlich würde sie ihm die Wahrheit anvertrauen. Rückhaltlos. Er war der einzige, dem sie alles sagen konnte. Er geriet niemals in Panik und schalt sie auch nicht, wenn sie nur das kleinste Risiko auf sich nahm.
Gewiß gab es Zeiten, wo sie nicht einer Meinung waren, aber dann bemühten sie sich, diese Unstimmigkeiten zu klären. So war es schon immer zwischen ihnen gewesen. David versuchte nie, über sie zu richten oder sie einzuschüchtern. Er erzählte ihr von der wirklichen Welt, von den Orten außerhalb von Skye. Über die Schönheit des schottischen Festlandes. Er war dort schon gewesen. Er hatte ihr die Überlebenstricks, wie er sie nannte, beigebracht. Und er hatte sie gelehrt, all diese Künste für die Bedürfnisse wirklicher Menschen einzusetzen. Diese Lektionen waren eine wahrhaft erfrischende Abwechslung zu den Französisch-, Englisch-, und Lateinstunden der Priorin, die sie über sich ergehen lassen mußte.
Die Lektionen, auf die er immer den meisten Wert gelegt hatte – und das von Beginn ihrer Ankunft an – waren die gewesen, sich so weit wie möglich von Torquil MacLeod entfernt zu halten.
David, das Faktotum, war außerdem der Halbbruder der Priorin. Er war ein außerehelicher, jüngerer Sohn, aber nichtsdestotrotz ein Onkel Torquils, daher kannte er ihn gut. Seine Geschichten über die Brutalität des Gutsherrn fielen bei einem kleinen Mädchen, dessen Verstand all die Erinnerung an das, was brutale Männer tun konnten, sorgfältig weggeschlossen hatte, auf fruchtbaren Boden. Seit Fionas Kindheit hatte David sie unter seine Fittiche genommen, und dank seiner Güte schenkte sie ihm ihr Vertrauen. Er hatte ihr immer ein Gefühl von Sicherheit gegeben, und sie gleichzeitig doch ständig dazu getrieben, sich selbst zu beweisen. Er hatte ihren Drang nach Unabhängigkeit ermutigt. Anfangs hatte er sich als Vater des Waisenmädchens gesehen, aber letztendlich war er zu einem Freund geworden. Zu einem sehr lieben und teuren Freund.
»Es ist in Ordnung, Fehler zu machen, so lange du aus diesen Fehlern lernst.« Das hatte er ihr immer und immer wieder eingehämmert. Fiona war sich nicht so sicher, ob das Leben im Kloster ohne ihn so interessant wäre.
Und dann hatte man ihnen vor gut einem Jahr Malcolm wiedergebracht. Bei dem Gedanken an den kleinen Jungen beschleunigte Fiona ihre Schritte. Er würde schon auf sie warten.
Als sie an einem zackigen Felsen vorbeikam, der aus dem Boden neben einem Teich hervorragte, wechselte Fiona ihre Tasche auf die andere Schulter und ließ den Stock zu Boden fallen.
Sie schaute zu den wilden Spitzen der Cuillins weit im Süden hinüber und wurde plötzlich einer Gestalt gewahr, die im Schatten einer großen Eiche nur einen Steinwurf weit entfernt stand. Fiona blieb wie angewurzelt stehen, zog sich die Kapuze weiter ins Gesicht und griff in ihren Umhang nach der hölzernen Rassel.
Die Gestalt trat aus dem Schatten, und Fiona lief es kalt den Rücken hinunter.