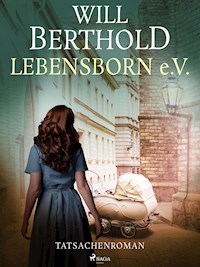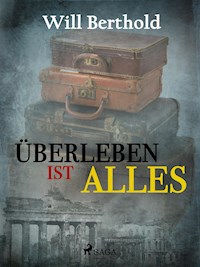
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
7. März 1945: Die Amerikaner fluten über die zufällig unzerstörte Rheinbrücke bei Remagen – die letzten 60 Tage des Zweiten Weltkriegs sind angebrochen; Hitler erteilt aus dem Führerbunker in Berlin den Befehl "Verbrannte Erde". So nahe am Ende des Dritten Reichs heißt es für Millionen von Deutschen jetzt nur noch:Überleben ist alles. Die Familie des Münchner Postrats Wamsler ist in alle Himmelsrichtungen versprengt. Sie spiegelt das Schicksal eines ganzen Volkes wider: Die Eltern werden in die Festung Alpenland evakuiert. Sepp, der Älteste, ist in den Kämpfen um das belagerte Berlin eingesetzt. Florian gerät in einen kopflosen Rückzug zwischen Rhein und Donau. Michael erlebt in Italien den letzten alliierten Ansturm. Und Stupsi, das Nesthäckchen, wird als Nachrichtenhelferin dienstverpflichtet.Will Berthold (1924–2000) war einer der kommerziell erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Sachbuchautoren der Nachkriegszeit. Seine über 50 Romane und Sachbücher wurden in 14 Sprachen übersetzt und erreichten eine Gesamtauflage von über 20 Millionen. Berthold wuchs in Bamberg auf und wurde mit 18 Jahren Soldat. 1945 kam er vorübergehend in Kriegsgefangenschaft. Von 1945 bis 1951 war er Volontär und Redakteur der "Süddeutschen Zeitung", u. a. berichtete er über die Nürnberger Prozesse. Nachdem er einige Fortsetzungsromane in Zeitschriften veröffentlicht hatte, wurde er freier Schriftsteller und schrieb sogenannte "Tatsachenromane" und populärwissenschaftliche Sachbücher. Bevorzugt behandelte er in seinen Werken die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg sowie Themen aus den Bereichen Kriminalität und Spionage.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Überleben ist alles
Die letzten 60 Tage des Dritten Reiches
Tatsachenroman
Originalausgabe
SAGA Egmont
Überleben ist alles
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1985 by Heyne Verlag, Germany
All rights reserved
ISBN: 9788711727331
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Wenn der Westwind die Dunstglocke von Brand, Tod und Pulverbeize über den Rhein treibt, liegt in der Luft auf einmal eine Ahnung von Vorfrühling, ein Hauch von Frieden. Es ist der 6. März 1945, und lange kann der Krieg nicht mehr dauern, aber bis er nach einem rasenden Amoklauf verendet, werden in den nächsten neun Wochen mehr Menschen umkommen als in den letzten fünf Jahren zusammen.
Dem Januar-Dammbruch im Osten folgte im Februar der Zusammenbruch im Westen. Rhein, Oder und Donau sind auf einmal Frontflüsse. Aachen, Trier, Mönchengladbach, Neuss und Venlo wurden von den westlichen Alliierten kassiert. Im Osten stehen die Russen schon bei Küstrin, Stettin und Frankfurt an der Oder.
In der Ferne wummern schwere Geschütze. Die Einschläge bringen das veraltete Gebäude im Bonner Universitätsgelände zum Erzittern, das als Heeresreservelazarett zweckentfremdet wurde. Ein paar Kilometer weiter nördlich rauschen Bombenteppiche auf die geschundene Erde. Sowie sich das dunkle Explosionsgewölk verzieht, haben die Jabos wieder Büchsenlicht und knallen im Tiefflug auf alles, was sich bewegt. In Köln am Rhein feiert der Tod nachträglich einen schauerlichen Karneval.
»Nun macht euch schon mal fertig für den Luftschutzkeller«, sagt der Gefreite Wamsler, der Stubenälteste, zu den anderen sieben Verwundeten im Krankenzimmer 18. Der Junge aus München – groß, dunkelblond, offene Augen, harte Lippen – sieht einen Moment lang durch das Fenster nach draußen. »Wenn das Lazarett nicht schleunigst verlegt wird, dann schnappen uns mit Sicherheit die Amis.«
»Schlimm«, spottet der Gefreite Elias, von den anderen nur ›der Prophet‹ genannt. »Mir kommen gleich die Tränen.«
»Mir auch«, schaltet sich Raschke – der Berliner mit dem Steckschuß in der Lunge – ein; er keucht, hustet und prustet. Einen Moment lang lauscht er dem Gefechtslärm nach: »Kommt aus dem Norden. Vermutlich ist heute in Köln der Teufel von der Kette.«
Die anderen nicken und rechnen die Entfernung nach.
»Köln«, greift Redde, das Stubenferkel, das Stichwort auf: »Mensch, da hab’ ich im letzten Urlaub ’ne Kellnerin aufgerissen, eine mit solchen Apparaten!« Mit den Händen modelliert er einen kolossalen Busen in die Luft: »Groß und fest wie Melonen; sag’ ich euch, aber keine Hängefrüchte.« Er merkt, daß er heute mit dem Thema eins nicht ankommt und läßt es vorläufig sein.
Bevor die Sirenen heulen, schaltet Wamsler das Radio ein: Statt der Luftlagemeldung wuchten schon zum dritten Mal markige Goebbels-Sätze über den Reichsrundfunk: »Ein Volk, das entschlossen ist, zur Verteidigung seines Lebens jedes Mittel, auch das kühnste und verwegenste, anzuwenden«, tönt der ehemalige Jesuitenzögling, »ist schlechterdings unschlagbar.«
»Mach den Rappelkasten aus«, giftet der sonst so bedächtige Adamsky aus Pommern; seine Heimat ist bereits von den T 34 überrollt: »Ich kann das doofe Gequassel nicht mehr hören. Die Russen stehen bereits im Vorfeld von Berlin, und da sabbert dieser Klumpfuß, als hätt’ er lauter Idioten vor sich.«
»Halt die Klappe!« fährt ihn Wamsler an. »Oder willst du als Defätist …«
»Nach dir, Flori«, schaltet sich der Obergefreite Elias ein, und ein ranziges Lächeln zuckt über sein zerklüftetes Gesicht.
»Paßt mal auf, Sportsfreunde«, warnt der Stubenälteste und sieht dabei aus wie der jüngere Bruder des Drachentöters Siegfried, dem Hagen den Speer von hinten in den Leib gerannt hat: »Ein Sani von unserem Lazarett hat gestern zu einer Frau auf der Straße gesagt, daß der Krieg verloren ist, und er wurde auf der Stelle verhaftet. Wenn er noch lebt, hat er Glück gehabt.«
»Oder auch Pech«, entgegnet Adamsky düster.
»Hier auf unserer Stube können wir uns doch wohl noch offen unterhalten … unter Kameraden …«, meint Elias ziemlich kleinlaut.
»Die Kameraden sind bei Stalingrad gefallen«, kontert Florian Wamsler.
»Sachte, sachte, Junge«, bremst der Berliner seinen Pessimismus: »Stramme Nazis war’n wir ja schließlich alle mal, aber das ist wie ’ne Kinderkrankheit. Wenn du die hinter dir jebracht hast, biste jeheilt, und zwar für immer.«
»Schon gut«, versucht Wamsler das heiße Thema abzuwürgen. Er geht zu dem Tisch, an dem Elias arbeitet. »Was bastelst du denn hier zusammen?« fragt er ihn und betrachtet ein Papiergebilde, das aussieht wie ein Adventskalender.
»Einen Friedensfahrplan«, erwidert der Prophet stolz. »Jeden Tag, den ich überlebe, mach’ ich ein Fenster auf wie ein Kind, das auf den Weihnachtsmann wartet.«
»Wie viele Fenster hast du denn vorgesehen?« fragt Raschke interessiert.
»So an die sechzig. Für jeden Tag eines. Die mußt du überstehen, so oder so. In jeder Gangart. Wenn du sechzigmal am Morgen so ein Fenster öffnen kannst, bist du fein raus, weil du dann nicht ins Gras gebissen hast.« Er führt seine Erfindung gleich vor: »Überleben ist alles.«
»Und zwar fressend, saufend und pimpernd«, nimmt Redde einen zweiten Anlauf zum Thema eins: »Diese Kölnerin hat mir vielleicht die Eier glattgezogen. Ich hab’ nicht mehr gewußt, ob ich ein Männchen oder Weibchen bin.«
»Schlappschwanz«, versetzt Adamsky, und sein Mund platzt dabei auf wie eine faulige Frucht. »Woher willst du eigentlich wissen, Prophet, daß sich der Krieg nur noch 60 Tage hinziehen wird?«
»Länger kann die Scheiße doch nicht mehr dauern«, antwortet der Prophet.
Sie glauben das auch, weil sie es glauben wollen.
»Und was kommt dann?« fragt Wamsler.
»Janz egal«, entgegnet Raschke, »schlimmer kann’s wohl nicht mehr werden.«
»Und wenn dir die Amis tatsächlich den Pimmel abschneiden?« fragt Redde.
»Das ist doch nur Propaganda«, hüstelt Raschke, »dieses Sterilisationsprogramm.«
»Und der Morgenthauplan?«, fragt Wamsler, »auch nur Propaganda?«
»Was weiß ich«, gesteht der Prophet ein. »Frag mich was Leichteres … Jedenfalls«, setzt er tröstend hinzu, »es wird alles halb so heiß gefressen wie’s gekocht wird.« Der Erfinder des Friedenskalenders gibt weitere Erläuterungen: »Ich geh’ davon aus, daß wir noch mindestens drei Wochen im Lazarett bleiben werden, das wären schon mal einundzwanzig Fenster. Anschließend steht uns ein Genesungsurlaub zu: üblicherweise noch mal einundzwanzig Tage, das macht nach Adam Riese zweiundvierzig. Dann kommst du zum Ersatzbataillon, und das sind sechs, sieben Tage. Anschließend gehst du an die Front – der Weg ist zwar nicht mehr weit, aber die Schienenstränge sind kaputt, macht noch mal drei, vier Tage. Bis du dann an den Feind gerätst, vergehen vielleicht noch einmal ein, zwei Tage, und bis dahin haste mindestens schon fünfzigmal durch das Fenster in den Frieden geschaut.«
»Oder in die Kloröhre«, blödelt Redde.
»Dann mußt du nur noch sehen, daß du das letzte Schlamassel durchstehst«, fährt Elias unbeirrt fort. »Vielleicht noch zehn Tage, elf oder zwölf. Aber das werden wir doch noch schaffen, Kumpels, das ham wa ja schließlich gelernt.«
Sie zählen ihre Frontjahre und ihre Verwundungen zusammen und kommen, im Vergleich zu ihrer Jugend, auf astronomische Zahlen.
»Bei mir sind es schon fünf Jahre«, sagt Adamsky. »Ich Arschloch war vom ersten Tag an dabei. Aber ab jetzt halte ich mich an die Bibel: ›Seid klug wie die Schlangen und listig wie die Tauben‹.«
»Verdünnisieren oder in die Erde kriechen, wie’n Regenwurm«, rät Raschke. »Wer’s jetzt noch nicht jefressen hat, der is’ selber dran schuld.«
Das Gemäuer erzittert wieder im Rhythmus der Granateinschläge. Vielleicht kommt der Panzeralarm früher als der Luftalarm, aber weder die Amis noch die Tommies erscheinen heute im aufgescheuchten Treibhaus, das sonst so schläfrig wirkt. Statt dessen setzt Oberfeldarzt Dr. Schlamm am frühen Nachmittag so überraschend eine Sondervisite an, daß die Männer der Stube 18 erst im letzten Moment ihr Bett erreichen.
»Achtung!« brüllt Florian Wamsler und legt selbst noch im Liegen die Hände an und macht Meldung.
Dem Sanitätsoffizier folgt der Spieß, ein Hauptfeldwebel wie aus dem Bilderbuch: geschniegelt und gebügelt, in Ausgehuniform, auf der Brust das Band des Kriegsverdienstkreuzes, gut im Futter, kerngesund. Aus einem verkrachten Medizinstudenten ist ein Zwölfender geworden, unabkömmlich im Heimatlazarett. Wenn der Mann einen scharfen Schuß hörte, dann höchstens auf der Latrine. Der Chefarzt geht langsam von Bett zu Bett; der Spieß folgt ihm wie ein schwanzwedelnder Hund. »Na, wie geht’s uns denn, Gefreiter Wamsler?« fragt der hohe Sanitätsoffizier jovial.
»Gut, Herr Oberfeldarzt«, antwortet der Stubenälteste mit dem komplizierten Schußbruch. »Nur meinem Arm geht’s noch nicht so gut, Herr Oberfeldarzt.«
»Dem rechten« korrigiert ihn der Rotgesichtige mit der dünnen Nase. »Versuchen Sie doch mal, ob Sie nicht auch mit Ihrem linken Arm ein Gewehr halten können.« Der Mediziner nickt dem Hauptfeldwebel zu, der sofort Wamslers Namen notiert. Er geht zu Raschke weiter, wirft einen flüchtigen Blick auf die Eintragungen der Fieberkurve: »Na ja, Raschke«, muntert er den Berliner auf: »Ich denke, die Kugel können wir Ihnen erst nach dem Krieg aus der Lunge operieren.« Wieder nickt er dem Spieß zu; der Spieß notiert, und der Oberfeldarzt ist schon bei Adamsky: »Was macht Ihr Fuß?« fragt er.
»Steif, Herr Oberfeldarzt.«
»Richtig«, erwidert der Mediziner und spielt weiter den leutseligen Heldenklau: »Dann müssen Sie halt humpeln. An der Front wird ja nicht exerziert. Notieren, den Mann«, sagt der Sanitätsoffizier im Weitergehen. Der Eid des Hippokrates, den Dr. Schlamm vor vielen Jahren geschworen hat, liegt in der Schublade, unter dem Mitgliedsbuch der NSDAP.
Der Rotgesichtige bleibt vor Redde, dem Verwundeten mit dem Oberschenkeldurchschuß, stehen.
»Die Wunde buttert noch heftig, Herr Oberfeldarzt«, erklärt das Stubenferkel ungefragt,
»Das weiß ich selbst«, erwidert Dr. Schlamm, alias Dr. Eisenbart, eine Spur ungehalten. »Wir teilen Sie einer Genesungskompanie zu. Da versteht man sich schon darauf, sie trockenzulegen.«
Der Spieß verliest die Namen: Fünf von acht wurden kassiert wie Fallobst. »Ihre Bettruhe ist aufgehoben«, stellt der Sanitäts-Hauptfeldwebel fest. »In einer halben Stunde stehen Sie feldmarschmäßig im Garten. Inzwischen lasse ich Ihnen die Marschpapiere ausstellen.«
»Achtung!« brüllt Wamsler noch einmal, als der Chefarzt die Stube verläßt.
»Du Armleuchter«, beschimpft Raschke den Gefreiten Elias und klettert hustend und spuckend aus dem Bett. Er geht an den Tisch und schnappt sich den Friedenskalender des Propheten. »Das ist nicht Adam Riese«, giftet er und wirft dem Propheten die Bastelarbeit vor die Füße: »Das ist Adam Scheiße.«
Fluchend und schimpfend steigen die Verwundeten in ihre Klamotten: 39 Mann stellt Dr. Schlamm ab für die Front. »Das letzte Aufgebot«, unkt Elias, »Krüppelspätlese zwo.« Sie sind keine heurigen Hasen mehr, aber doch noch sehr junge Veteranen. Alle tragen Orden und Ehrenzeichen, Jungsiegfried aus München die meisten.
»Mensch, Junge«, sagt Raschke, doch ziemlich beeindruckt: »Du hast ja ’nen janzen Klempnerladen auf der Heldenbrust – paß bloß auf, daß dir beim Jewitter nicht der Blitz trifft.«
»War schon mal Leutnant bei der Heeresflak gewesen«, gesteht der Gefreite mit dem Spiegelei, dem EK I und II, dem Silbernen Verwundetenabzeichen, der Silbernen Nahkampfspange. »Und ich hab’ etliche T 34 abgeschossen.«
»Und deswegen biste kein Leutnant mehr?« fragt Adamsky anzüglich.
»Eine Nebelkerze in so einer Kaschemme«, erwidert der Exoffizier. »Fünf, sechs Schnösel von der Kriegsschule, und ich war scharf auf die rote Rita. Blau war ich wie ein Veilchen, spitz wie Nachbars Lumpi. Da hab’ ich in meiner Not zwei von den Dingern gezündet und bin mit dem Mädchen abgezogen.«
»Hast du’s dann wenigstens bei ihr geschafft?« fragt Redde, auf einmal wieder in seinem Fach.
»Einmal schon«, erwidert der 22jährige Münchner. »Aber dann haben mich die Kettenhunde aus Ritas Bett geholt, und danach wurde ich zum Schützen Arsch degradiert.«
»Das ist doch nicht ehrenrührig, Flori«, sagt Adamsky.
»Kaum«, räumt Wamsler ein, »aber erklär’ das mal einem Vater, der’s vom Inspektor bis zum Postrat gebracht hat. Und mein großer Bruder, der Stolz der Familie, ist Hauptmann und hat sogar das Ritterkreuz.«
»Feine Familie«, entgegnet Adamsky mit Spott und Anerkennung in der Stimme. »Gibt’s noch mehr Wamslers von dieser Sorte?«
»Einen jüngeren Bruder und meine kleine Schwester Stupsi. Die ist unwahrscheinlich, das sag’ ich dir, eine Zuckerpuppe, bildhübsch und unnahbar!«
»Haste nicht ein Foto von ihr, Flori?« fragt Redde.
»Nicht für dich, du Schweinepriester«, wehrt Wamsler ab. »An Stupsi würdest du dir deine faulen Zähne ausbeißen. Sie war Zögling im St.-Anna-Kloster in München, falls du weißt, was das ist.«
»Eine Nonnenfabrik«, grinst Redde.
»Quatschkopf«, versetzt Wamsler. »Dort hat man meine Schwester zum braven Mädchen erzogen, und Sepp, Micha und ich haben auf Stupsi aufgepaßt, solange es ging.«
»Drei Ritter und das Burgfräulein«, erwidert der Prophet.
»Ganz recht. Und musikalisch ist die Kleine, schwärmt Florian, »tanzt wie eine Primaballerina, und wenn sie sich ans Klavier setzt und die Mondscheinsonate spielt, dann geht die Sonne auf.«
»Und den Westerwald, kann sie den auch klimpern?« fragt Redde.
»Banause«, entgegnet der Gefreite.
»Ist sie denn nicht beim Bund deutscher Mädchen gewesen?« fragt Adamsky.
»Beim BDM war sie natürlich auch.«
»Und jetzt ist sie bei Muttern?«
»Leider nicht«, antwortet der Exleutnant leicht betreten. »Vor kurzem hat sie sich freiwillig zum Einsatz als Luftwaffenhelferin gemeldet, sonst wär’ sie nämlich zum Volkssturm eingezogen worden, und dagegen waren wir alle im Familienrat.«
»Schöne Scheiße«, schaltet sich Raschke ein. »Aber wenn deine Stupsi so unantastbar ist, wie du sagst, wird sie schon keine Offiziersmatratze werden.«
»Halt’s Maul, du damischer Depp«, droht Jungsiegfried. Immer, wenn er zornig wird, schlägt bei ihm die bayerische Mundart deutlich durch: »Wenn’st no so an Schmarrn sagst, schmier’ i dir oane, daß dir Hörn und Sehn vergeht.«
»War doch nicht so gemeint«, entschuldigt sich der mit dem Lungensteckschuß erschrocken.
Rasch versöhnt präsentiert Wamsler nun doch das Familienfoto: In der Mitte der gestrenge Vater mit dem sorgfältig gepflegten Schnurrbart, auf den ersten Blick schon ein Pflichtmensch, der es zu etwas gebracht hat. Neben ihm, mit ondulierten Haaren und einem sanften Lächeln, Mutter Barbara, umgeben von ihren vier Kindern.
An ihrer Seite Sepp, der Älteste. »Der Erste beim Sport«, erklärt Florian, »Und der Primus in der Klasse. Der jüngste Hauptmann in seinem Regiment und der vierte Ritterkreuzträger seiner Panzerdivision. Wo der hintritt, wächst kein Gras mehr«, versichert der jüngere Bruder. »Und den kennt ihr ja: Das bin ich, und hier, neben mir, das ist Michael«, erläutert er. »Der ist ganz anders wie Sepp, der macht sich nichts aus Orden und Ordnung, der weiß, wo Gott wohnt, ein Meister im Organisieren. Hat klein angefangen, in Italien, mit Saccharin und Feuersteinen. Der kommt mit mindestens zwei Koffern in Urlaub nach Hause, und meine Eltern haben dann für drei Monate ausgesorgt.«
»Prima«, erwidert Raschke. »Wer ist dir nun lieber, der Sepp oder der Michael?«
»Der Große imponiert mir natürlich mehr«, versetzt der Exleutnant, »aber ich fürchte, den Kleinen werden wir bald nötiger haben.«
Elias, der Prophet, interessiert sich weniger für den geschäftstüchtigen Benjamin als für das Mädchen mit den großen Augen in dem klaren Gesicht: »Wirklich eine Wucht, dein Schwesterherz«, lobt er. »Aber die ist doch höchstens fünfzehn.«
»Achtzehn«, erwidert Wamsler. »Das Foto ist drei Jahre alt, wurde bei der Silberhochzeit unserer Eltern geschossen. Übrigens, Stupsi wurde ins Rheinland eingezogen, in irgendein Nest zwischen Koblenz und Andernach«, setzt er hinzu. »Vielleicht ist sie ganz in der Nähe.«
»Da hätt’ sie uns ja mal besuchen können«, sagt Raschke und atmet erregt.
»Stimmt«, entgegnet Wamsler; er hatte mit seiner kleinen Schwester angeben wollen, aber sie war noch in der Grundausbildung und hatte sicher keinen Ausgang erhalten.
»Jedenfalls«, kommt Adamsky zum Nächstliegenden, »wird’s für Stupsi genauso Zeit, über den Rhein zu kommen, wie für uns. Bonn wurde zur Festung erklärt, und wer weiß, ob wir das im Lazarett überstehen würden.«
In diesem Moment kommt der Spieß, begleitet vom Schreibbullen, aus dem Gebäude.
»Achtung!« ruft der Exleutnant, denn gelernt ist gelernt.
»Los! Antreten! Abzählen«, befiehlt der Geschniegelte mit dem doppelten Ärmelstreifen.
Sie stehen, mäßig ausgerichtet, in Linie zu drei Gliedern, als der Schreibstubenhengst ihre Namen einzeln aufruft. Der Mann hat ängstliche Kaninchenaugen und wackelt mit den Ohren. Er macht es besonders gründlich, solange sein Auftraggeber in der Nähe steht. Der Spieß hakt pedantisch jeden Namen ab und stellt fest, daß Unterscharführer Baldauf aus Aachen fehlt. Er wird im ganzen Haus gesucht und auf dem WC gefunden.
»Ach nee«, empfängt ihn der Spieß: »So einfach können Sie sich nicht drücken.«
»Ich wollte mich nicht drücken, Herr Hauptfeldwebel«, entgegnet der 25jährige, dessen Heimatort schon von den Amis besetzt ist, »aber ich hab’ Dünnschiß, wenn Sie’s genau wissen wollen.«
Der Spieß wartet, bis die Umstehenden ausgelacht haben. »Nun hört mal gut zu, Herrschaften«, kommt er dann vergleichsweise gemütlich zur Sache: »In Anbetracht der militärischen Lage muß dieses Lazarett heute noch auf die andere Seite des Rheins evakuiert werden. Von allen Verwundeten seid ihr nach Feststellung von Oberfeldarzt Dr. Schlamm noch in der besten Verfassung. Die Front braucht jetzt jeden Mann, folglich werdet ihr euch unverzüglich nach Remagen in Marsch setzen. Dort meldet ihr euch bei der Genesungskompanie.«
Aus dem Hintergrund erschallt ein lauter, provokanter Furz.
»Wer war die Sau?« unterbricht der Spieß seine Mitteilungen.
»Die neue deutsche Geheimwaffe«, murmelt einer aus dem dritten Glied mit dumpfer Stimme. Und alle lachen.
»Euch vergeht schon noch euer dreckiger Humor«, konstatiert der Spieß nicht unlogisch. Er läßt die Frechheit durchgehen, froh, diese renitenten Burschen endlich loszuwerden: »Dem Chefarzt ist die Entscheidung nicht leichtgefallen«, behauptet sein Vollstrecker. »Ihr seid noch nicht ganz ausgeheilt, und es stünde euch ein Genesungsurlaub zu. Aber der Heldenkampf unseres Volkes erlaubt das nicht. Bedankt euch dafür bei den Amis und Tommies. Bis die neuen Wunderwaffen zum Einsatz kommen, muß Großdeutschland auch noch den letzten Mann aufbieten.« Er mustert die wütenden, abweisenden Gesichter, die von dekorierten Soldaten, die sich nichts mehr vormachen lassen und nichts mehr fürchten, am wenigsten einen Drückeberger.
Die Artillerie schießt wieder. Zwischen den wummernden Einschlägen hört man das Brummen der Tiefflieger, näher, dann wieder ferner. Es ist Zeit, das Palaver zu beenden, aber irgendwie genießt der Sanitätshauptfeldwebel, daß ein solcher Sauhaufen auf sein Kommando hören und vor ihm strammstehen muß. Vielleicht kommt er sich in diesem Moment vor wie ein Eunuch, der alle Puppen tanzen läßt. Auf jeden Fall fehlt ihm die Erfahrung und der Instinkt der vor ihm stehenden Frontsoldaten, denn als die auseinanderspritzen und Deckung suchen, verliert der Spieß ein, zwei entscheidende Sekunden.
Die Bordkanonen einer doppelrümpfigen ›Lightening‹ erwischen ihn bereits mit dem ersten Feuerstoß. Die Zwei-Zentimeter-Geschosse zerfetzen den Hauptfeldwebel bei seinem versehentlichen Heldentod bis zur Unkenntlichkeit.
Und Dr. Schlamm, der Heldenklau mit der gepflegten Bonhomie, wird auch keine neununddreißig Patienten mehr an den Frontabschnitt Remagen abkommandieren, denn fünf, die nicht mehr rechtzeitig die schützenden Mauern erreichten, wurden getroffen, unter ihnen Redde, das Stubenferkel. Er liegt auf dem Rücken und preßt mit den Händen die herausquellenden Gedärme in seinen aufgerissenen Leib. Der Gefreite ist voll bei Bewußtsein: Er scheint keinen Schmerz zu spüren, denn er macht, als sich ein junger Feldunterarzt über ihn beugt, ein geradezu glückliches Gesicht.
»Auf den braucht ihr nicht neidisch zu sein«, sagt der Mediziner, als sie außer Hörweite des Schwerstverwundeten sind. »Der kratzt unter Garantie spätestens heute nacht ab.«
»Redde sich, wer kann«, erwidert Raschke.
»Ausgevögelt«, spricht Adamsky ein ordinäres Requiem. Zu mehr bleibt keine Zeit. Der Lastwagen mit dem Holzverr gaser, der sie an die neue Hauptkampflinie schaffen soll, ist schon eingetroffen. Sie rollen nach Süden, zunächst am linken Rheinufer entlang, durch eine wunderschöne Landschaft, eingehüllt in den Pesthauch der Vernichtung. Wenn sie von der Anhöhe der Weinberge aus in das Gelände starren, ist ein Bombentrichter neben dem anderen, als trüge die Erde eine Gänsehaut.
Schwere Bomberpulks überfliegen auf Südostkurs den Rhein; von ›Mustangs‹ geleitet, begegnen sie rückkehrenden Formationen. Kein deutsches Flugzeug ist zu sehen, dafür aber alliierte Verbände in drei Höhen gestaffelt. Am Himmel herrscht Platznot, als wollten die Amerikaner demonstrieren, daß sie allein im Jahr 1944 mit rund hunderttausend Kriegsflugzeugen von ihrer Rüstungsindustrie beliefert wurden.
Jabo-Angriff. Die Verwundeten hechten vom Lastwagen, hoffnungslos, aber die Tiefflieger entdecken jetzt einen Güterzug und visieren nun dieses Ziel an. Der Transport entkommt mit drei Toten und fünf Verletzten. Der Oberfeldwebel, der ihn führt, entschließt sich, die kurze Fahrt erst im Schutz der Dunkelheit fortzusetzen. Er versteckt den schweren Holzvergaser bis dahin in einer Feldscheune.
»Mensch, Junge«, sagt der Prophet. »Wer hätte gedacht, daß es einmal soweit kommt.«
»Was ist eigentlich aus dem Westwall geworden?« fragt Raschke mit rasselndem Atem.
»Mäusenester«, erwidert Adamsky. »Hoffnungslos veraltet, und dann nicht einmal genügend Besatzung für die Bunker.«
»Aber die meisten stehen doch noch«, sagt Wamsler.
»Fragt sich nur, wie lange«, keucht Raschke.
»Aber jetzt, am Rhein, werden sie abgefangen.« Über Adamskys Gesicht läuft der Hohn wie Säure. »Und zwar von uns.«
»Du machst dich ja«, sagt Wamsler.
»Über den Rhein kommen sie nicht«, höhnt der verbitterte Pommer weiter, »sowenig wie sie über den Kanal oder über das Mittelmeer, über die Wolga, über den Dnjepr oder die Weichsel gekommen sind.«
Erst spät nach Mitternacht erreicht der Transport aus Bonn – ein Oberfeldwebel und 27 Mann – Remagen.
Der 7. März ist längst angebrochen. An die Männer der Genesungskompanie, bei der sie sich melden, werden Gewehre aus dem Ersten Weltkrieg und ein halber Verpflegungssatz ausgegeben. Die Verwundeten – die meisten nicht einmal Rekonvaleszenten – sollen die Sicherung der zweigleisigen Eisenbahnbrücke bei Remagen übernehmen und mit 27 Schuß pro Kopf den zu erwartenden Ansturm der mächtigsten Armee der Welt aufhalten.
Zunächst einmal tut sich gar nichts. Sicher ist sicher, deshalb essen der Gefreite Wamsler und seine Kumpel die ganze Halbverpflegung schon zum Frühstück auf – Erfahrungswert. Von allen Seiten strömen Flüchtlinge, Zivilisten und Soldaten vom linken auf das rechte Rheinufer. Die Brücke ist so lange wie möglich offenzuhalten und dann zu sprengen. Vergeblich überlegt sich Florian Wamsler, was wohl Sepp, sein großer Bruder, Primus in jeder Lage, in dieser Situation machen würde.
Die Kampfgruppe des Hauptmanns Sepp Wamsler hetzt wie eine Geistereinheit durch die breite Frontlücke zwischen Westpreußen und Niederschlesien in Richtung Berlin. Militärisch gesehen kaum mehr als ein Störfaktor, wird sie doch zur Lebensretterin für zahlreiche, zwischen den Fronten herumirrende Flüchtlingstrecks. Der 28jährige Ritterkreuzträger – groß, erschreckend hager, eingefallenes Gesicht mit stark hervortretenden Backenknochen – hatte nach vier Frontjahren und fünf Verwundungen angenommen, daß es in diesem Krieg gar nicht mehr schlimmer kommen könnte, aber tagtäglich muß er jetzt diese Ansicht revidieren.
Der Panzeroffizier aus München weiß seit langem, daß der Krieg verloren ist und es nur vernünftig wäre, die Waffen zu vernichten und die Hände zu heben, aber das Ringen im deutschen Osten ist etwas anderes als der Kampf im Westen. Jeder Tag, den die Kampfgruppe mit einem Restbestand von fünf Panzerfahrzeugen unter unerträglichen Bedingungen durchsteht, rettet Hunderten, wenn nicht Tausenden von Flüchtlingen das Leben, und so hat der Wahnwitz doch noch einen Sinn.
Im März 45 rennen 5,3 Millionen Rotarmisten gegen 1,8 Millionen deutsche Verteidiger an. Die Sowjets brennen vor Kampfgeist und Rachedurst, Sie sind zahlenmäßig und auch von der Ausrüstung her den zu Verteidigern verkümmerten ehemaligen Angreifern haushoch überlegen. Der amerikanische Steuerzahler hat tief in die Tasche gegriffen, um die Russen mit Panzern, Flugzeugen, Lastwagen und Waffen aller Art auszustatten; von den 280 Milliarden Dollars, die die Yankees bis jetzt für den Sieg ausgegeben haben, schluckte die UdSSR einen erheblichen Brocken – und quittierte ihn mit Vorwürfen über mangelnde Unterstützung. Es fehlt nicht an Warnungen in Washington, aber der todkranke Präsident und vor allem das ihn beratende Küchenkabinett sind Stalin hörig, deshalb erhält ›Uncle Joe‹, was er fordert; auf der Konferenz von Jalta sogar noch die Beute in Polen, derentwegen er Schulter an Schulter mit Hitler das Nachbarland überfallen hatte – Rußland soll bis zur Curzon-Linie ausgedehnt werden.
Jetzt, beim Schlußkampf in Ostdeutschland, kommen auf einen Kampfwagen mit dem Balkenkreuz 4,7 sowjetische, auf ein deutsches Geschütz 6,9 russische. Ein deutscher Infanterist steht 7,7 Sowjet-Soldaten gegenüber, und auf einmal verfügt Stalins Armee auch über 16 000 Kriegsflugzeuge. Wenn ein deutsches am Himmel über Pommern oder Westpreußen auftaucht, muß es sich verflogen haben.
Das oberschlesische Industriegebiet ist den Sowjets unversehrt in die Hände gefallen, Ostpreußen ist abgeschnitten, Breslau belagert, Kolberg eingeschlossen. Hier ließ Dr. Goebbels vor kurzem einen Durchhaltefilm über den alten Nettelbeck aus napoleonischen Zeiten drehen, mit Heinrich George, Christina Söderbaum und Horst Caspar – womit sogar ein »Viertelarier« im Sinne der Nürnberger Gesetze für den Heroismus Modell stehen durfte. Gleich nach der Premiere in der noch immer sinnlos verteidigten Atlantikfestung La Rochelle wurde der Film von der Realität eingeholt. Die Wirklichkeit hielt sich nicht an die Zelluloid-Heldenschnulze, auch wenn Vizeadmiral Schirwitz an Dr. Goebbels telegrafiert hatte: »Tief beeindruckt von der heldenhaften Haltung der Festung Kolberg und ihrer künstlerisch unübertrefflichen Darstellung.«
Die Kampfgruppe Wamsler führt Krieg auf eigene Faust. Die Anweisungen kommen nicht aus dem Gefechtsstand der Armee; es sind Befehle des Gewissens. Das bedeutet: kein Sprit, keine Munition, keine Post und eine immer wieder abreißende Verbindung zum Hinterland und den eingeschlossenen Städten wie Graudenz und Greifenberg, die Hitler einfach zu Festungen erklärt hat. Wer sie verläßt, wird erschossen. Wer bleibt, wird von den Russen massakriert. »Führer befiehl, wir folgen dir.«
Der drahtige Offizier aus München versorgt sich aus Feindbeständen: Er raucht Machorkazigaretten, kaut Sonnenblumenkerne und tankt seine Fahrzeuge an russischen Zapfsäulen auf. Das Prachtstück seiner Einheit, bestehend aus drei verschlissenen Tigerpanzern und drei Kampfwagen IV, ist ein erbeuteter T 34. Um die Russen auszutricksen, fährt er meistens an der Spitze. Bis die Iwans den Bluff erkennen, sind die anderen deutschen Fahrzeuge heran und feuern aus allen Rohren – solange sie Munition haben. Ein paarmal hat es jedenfalls geklappt, aber nunmehr ist Sense.
»Wir haben höchstens noch für 30 Kilometer Sprit«, meldet Oberfeldwebel Briegler, »sehr optimistisch geschätzt.«
»Saugen Sie das Benzin aus den drei Panzern IV heraus und füllen Sie unsere Tiger damit auf«, trifft Wamsler unverzüglich eine Entscheidung, die ihn drei Kampfwagen kosten wird. »Leutnant Schneiderbang«, wendet sich der Hochdekorierte an seinen Adjutanten – »lassen Sie die Munition übernehmen und unsere Prachtstücke zur Sprengung fertigmachen.«
Im gleichen Moment meldet der Posten: »Fahrzeug von rechts.« Aus einer Schneewolke schält sich ein deutscher Krad-Melder, springt ab: »Bin schon seit drei Tagen hinter Ihnen her, Herr Hauptmann«, sagt der Obergefreite außer Atem. »Herr Hauptmann wurden vor einer Woche zum Major befördert.«
»Sprit wär’ mir lieber«, erwidert der hagere Offizier, und die Umstehenden lächeln etwas schief.
Der Melder bringt der Kampfgruppe den Befehl, bis zur Oder zurückzugehen und sich dort in die Verteidigungsstellung der Heeresgruppe Weichsel einzureihen.
»Wenn ich noch so weit komme«, sagt der frischgebackene Major. »Sie können uns nicht zufällig mit etwas Sprit aushelfen?«
»Darum wollte ich gerade Sie bitten, Herr Major«, entgegnet der Krad-Melder.
Als einer seiner Leute, die sofort über den Postsack hergefallen waren, mit einem Telegramm auf den Führer der Kampfgruppe zugeht, weiß Wamsler, daß es nichts Gutes bedeuten kann. Er reißt es auf, starrt aufs Datum. Es stammt vom 25. Februar, wurde also schon vor zehn Tagen aufgegeben. ›Bomben-Totalschaden‹, kabelte ihm sein Vater, der Postrat aus München, ›Mutter undich wohlauf. ‹
Er zerknüllt das Formular, wirft es in den Schnee. Wohlauf, das ist schierer Hohn: Sein Vater, seit dem Ersten Weltkrieg oberschenkelamputiert, ist schwer herzkrank, und Mutter hat er je kaum anders gesehen als mit Staubwedel und Mop. Sie hängt fast manisch an jedem Stück ihrer Einrichtung, und jetzt liegt alles in Schutt und Asche, auch das vom kärglichen Gehalt zusammengesparte Klavier für Stupsi, das Küken.
Hauptsache, die Alten leben, sagt sich der Major und fragt sich unbewußt: Wie lange noch?
»Die Iwans haben heute die Stadt Graudenz kassiert«, berichtet der Melder.
»Das war zu erwarten«, erwidert der Major. Während er überlegt, wie weit der Weg zurück zur Oder ist, wird er wieder einmal in die Gegenrichtung abgedrängt. Längst ist der näherkommende Treck ausgemacht: Wagen hinter Wagen, besetzt mit vermummten Gestalten. Der Frost schneidet in die Gesichter, an den Wimpern hängen Eisperlen. Die vereiste Chaussee ist glatt, spiegelglatt gescheuert von Tausenden von Rädern. Pferde ohne Stollen rutschen, stürzen, werden wieder hochgezogen, nicken erschöpft mit den Köpfen, höchstens noch eine Handyoll Hafer für sie im Wagen. Menschen, von den Russen gejagt, vom Frost bedrängt und jetzt schon vom Heimweh überwältigt, ziehen weiter nach Nirgendwohin – wenn’s nur im Westen liegt. Es ist ihnen schwindlig vor Hunger; eine fragliche Rettung narrt sie wie eine Fata Morgana. Es gibt keine Auffangstelle mehr; die NS-Volkswohlfahrt ist genauso beim Teufel wie die NS-Volksgemeinschaft.
Manche wollen umkehren, weil sie vergaßen, das Licht zu löschen. Andere hadern mit sich, daß sie nicht doch geblieben sind. Heimat gibt man nicht auf, Heimat ist da, wo man das erste Herz in die Rinde schnitt, wo die Oma begraben ist, wo man in Nachbars Garten die Äpfel geklaut hat, wo man liebte, sich verlobte, heiratete. Heimat ist, wo die Kirche steht mit dem engen Chorgestühl und der herrlichen Orgel, und – und – und vorbei, verloren, vertrieben.
Wagen schlittern, stellen sich quer, überschlagen sich. Sie sind die ganze Nacht hindurchgerollt, aber jetzt reißt gnadenloses Licht den Himmel auf. Plötzlich ein Schrei: Russische Panzer. Sie kommen von links und von rechts, nehmen den Treck in die Zange, bereit, ihn niederzuwalzen, auszuplündern, und sich dann lebende Beute zu greifen: »Frau, komm!«
Die Männer der Kampfgruppe Wamsler rennen zu ihren Fahrzeugen, ohne den Befehl des Majors abzuwarten. Der T 34 setzt sich wieder an die Spitze. Auf einmal sehen die entsetzten Flüchtlinge auch noch von vorne die Rotarmisten auf sich zukommen. Die Iwans müssen total betrunken sein, denn jetzt feuern sie auch noch aufeinander.
Der deutsche Gegenstoß ist kurz und erfolgreich: Zwei Sowjetpanzer werden sofort in Brand geschossen, einer bleibt beschädigt liegen, die anderen drehen bei, und die flüchtenden Infanteristen werden vom MG-Feuer der Kampfgruppe niedergemäht. Der Major schüttelt die Fragen der ihn umringenden Zivilisten ab. Ihn interessiert zunächst, mehr, in welchem Zustand der beschädigte Russenpanzer ist: Nicht mehr zu verwenden, aber fast vollgetankt. Sie saugen dem gestrandeten T 34 das Dieselöl aus dem Tank, filzen die toten Russen, dann nehmen sie den Treck in die Mitte, ein paar Kilometer wenigstens, dann müssen die Geretteten sehen, wie sie sich allein bis zur Küste durchschlagen.
Noch hält sich – schwer umkämpft – die Bucht von Danzig als Notausgang über die Ostsee. Hier explodiert der Selbsterhaltungstrieb. Die Szenen, die sich beim Beladen der Schiffe abspielen, lassen Dantes Hölle als eine vergleichsweise gemütliche Wärmestube erscheinen. Um einen Platz an Bord wird mit den Ellenbogen gekämpft, mit Tränen, dem Gewehrkolben und oft auch mit der gezogenen Pistole, Die Reichsten unter den Ärmsten nehmen Matrosen beiseite und bieten ihnen für einen Platz auf dem Schiff als blinde Passagiere 20000 Reichsmark, 30000 und noch mehr.
Männer schleichen sich in Frauenkleidern ein, kommen durch oder werden entdeckt und sofort gehängt. Kleine Kinder stehen höher im Kurs als Gold, Juwelen und Silberbesteck, sie haben Priorität und verschaffen ihren Müttern als Begleitpersonen Freiplätze auf den Schiffen. Sind die Mütter an Bord, reichen sie nicht selten die Kleinen Verwandten oder Bekannten, um auch ihnen eine Chance zu geben, oder verleihen sie an Fremde gegen Höchstgebot. Kinder werden im Durcheinander gestohlen, um mit ihnen an Bord zu kommen, und dann dort liegengelassen, um von den nächsten Findern wiederum als Passepartout verwendet zu werden – die Bestie Mensch als Kinderfreund.
Die Flüchtlinge, die an Bord drängen und sich mitunter unmenschlich benehmen, haben auf der Flucht selbst Unmenschliches erfahren: Zuerst Räumungsverbot. Wer es übertritt, wird aufgeknüpft. Selbst Pimpfe hängen an den Scheunen. Die Todesstrafe wird so häufig und selbstverständlich vollstreckt wie eine gebührenpflichtige Verwarnung. Von Elbing bis Küstrin markieren die Exekutierten mit aufgerissenen Augen und heraushängenden blauroten Zungen den Weg in die neue Heimat – die einzigen Wegweiser übrigens, denn alle anderen Wegschilder und Ortsnamen wurden entfernt. Nur mit verbrauchten Ölresten in kyrillischen Buchstaben beschriftete Hinweise stehen an der vormaligen Reichsgrenze: ›Rotarmisten, hier betretet ihr das verdammte Deutschland‹ – und so werden sowjetische Angreifer zu verfluchten Mordbrennern einer von Gott verlassenen Region. Sie plündern, töten, schänden Mütter neben ihren Kindern und Kinder neben ihren Müttern, Greisinnen vor ausgebrannten Hauswänden mit der Parole: ›Sieg oder bolschewistisches Chaos‹. Im Dorf Sommerfeld überrumpelt die Vorausabteilung der Kampfgruppe an die achtzig Russen in den Betten der von ihnen genotzüchtigten Frauen, zerren sie heraus und stellen sie an die Wand.
Die Soldaten der Kampfgruppe Wamsler stoßen häufig auf Spuren schauerlicher Verbrechen, die von den Sowjets an der Zivilbevölkerung verübt wurden. Die braune Propaganda spielt die roten Massaker noch hoch und treibt so die Panik zur Explosion. Massenverbrechen wie im ostpreußischen Ort Nemmerdorf oder später in der kleinen Gartensiedlung Metgethen bei Königsberg – die nach dem Krieg eine Dokumentation der Bundesregierung aufführt – werden Markenartikel des Grauens, stürzen die Flüchtenden in ein Entsetzen, das bis heute anhält.
»Die Sowjets überrennen in einem Blitzeinsatz die idyllische Gartenstadt und verwandeln sie in eine Totenstadt. Leichenberge am Weg, Ermordete in jeder Wohnung, nebeneinander Frauen und Kinder, erschlagen, erdrosselt, erstochen, erschossen. Ein Augenzeuge, Angehöriger einer Nachrichtenersatzabteilung: ›Bestialisch umgebrachten Frauen sind die Brüste abgeschnitten worden. Andere hängen an Bäumen in den Gärten. Sie sind, kaum bekleidet, von den Roten an den Füßen aufgeknüpft worden. Frauen, die noch leben, steht das Grauen in den Augen. Alle wurden mißbraucht, auch achtjährige Mädchen. Nach dem deutschen Gegenstoß wird in Metgethen auf dem Fußboden ihres Wohnraums eine 63jährige Frau gefunden, die weinend berichtet, daß sich fünfzehn Rotarmisten an ihr vergangen haben. Auf den Straßen von Metgethen klagen fünfzehn leere, umgestürzte Kinderwagen die an, welche die Säuglinge verschleppt haben. Nur wer sich von den Bewohnern Metgehtens vorsorglich im nahen Wald verborgen hatte, blieb verschont‹.« (Bundesarchiv Koblenz, Ostdokumentation 20/5 VI)
Die Rote Armee ist mit Haß munitioniert, und dazu hat sie jeden Grund. Sie ist über verbrannte Heimaterde vorwärtsgestürmt, vorbei an den Massengräbern deutscher Einsatzkommandos, über Auschwitz hinweg, über Majdanek in ein Land hinein, in dem ihre Kameraden als Kriegsgefangene zu Millionen umgekommen sind. Sie macht halt in Schnapsfabriken und Weinkellern, und sie hört die Hetztiraden der roten Propaganda. »Tötet, tötet«, fordert der sowjetische Schriftsteller Ilija Ehrenburg die russischen Eroberer auf: »Es gibt nichts, was an den Deutschen unschuldig ist, an den Lebenden nicht und nicht an den Ungeborenen! Folgt der Weisung des Genossen Stalin und zerstampft das faschistische Tier für immer in seiner Höhle. Brecht mit Gewalt den Rassehochmut der deutschen Frauen. Nehmt sie als rechtmäßige Beute! Tötet, ihr tapferen, vorwärtsstürmenden Rotarmisten!«
Der sowjetische Schriftsteller wird nach dem Krieg die Worte auf den Flugblättern abstreiten, aber das kann die Tausenden von Zerbrochenen und Gemordeten nicht mehr lebendig machen.
Der kommunistische Schriftsteller Milovan Djilas beschwert sich bei Stalin über die Untaten der Rotarmisten bei der Eroberung Ostdeutschlands. »Aber das ist doch ein Soldatenspaß«, erwidert der Rote Zar.
Nicht alle Russen benehmen sich so. Mitunter greifen ihre Generäle gegen eigene Truppen hart durch, doch meistens bleibt es den Einheitsführern überlassen, ihre Soldaten zu bändigen. Oft unterbleibt es, weniger aus Haß und Rachsucht, als wegen militärischer Zweckmäßigkeit: Das Millionenheer der Flüchtlinge zwischen den Fronten behindert ganz erheblich deutsche Truppenbewegungen und Gegenangriffe; die Sowjets aber brauchen darauf keine Rücksicht zu nehmen.
Es gibt auch disziplinierte Kampftruppen, die die deutsche Zivilbevölkerung mit kalter Verachtung doch korrekt behandeln, Kommandeure, die keine Blutorgien dulden und Greueltaten kriegsgerichtlich verfolgen lassen. Ein Oberleutnant der in den deutschen Osten vordringenden Roten Armee heißt Solschenizyn und wird viele Jahre später den Nobelpreis erhalten, aber die sowjetische Nachbareinheit ist vielleicht die Truppe, deren Soldateska, zehn, zwölf Mann hoch, ein junges Mädchen vergewaltigt und auf dem Körper der Geschändeten ihre Notdurft verrichtet und sie dann – ebenfalls festgehalten in einer Dokumentensammlung der Bundesregierung – halbtot liegenläßt.
Vae victis, 1945. Die Welt, ausgezogen, die Nazi-Barbarei niederzuwerfen, hat sich selbst mit dieser Tollwut infiziert, und so heißt es auch: Gnade Gott den Siegern!
Ais die Kampfgruppe Wamsler die vorgeschobenen Linien der Heeresgruppe Weichsel erreicht, verfügt sie über kein Fahrzeug mehr und zählt nur noch 47 Mann, einschließlich der 19 Versprengten, die sie unterwegs aufgelesen hat.
»Mensch, Wamsler«, begrüßt Oberst Steinert, der IA im Divisionsstab, den sich zurückmeldenden Major: »Ehrlich gesagt, Sie sehen aus wie ein Abruzzen-Räuber.« Er bietet ihm eine Zigarette an. »Auf Ihre Rückkehr hätte ich keinen Pfifferling mehr gesetzt.« Er betrachtet das verdreckte Pflaster an Wamslers Stirne, das die Wunde von einem Streifschuß bedeckt. »Mann, gehen Sie gleich zum Onkel Doktor. Das gibt sonst ’ne handfeste Infektion.« Wie viele Panzeroffiziere ist Steinert ehemaliger Kavallerist, ein Mann mit einem trainierten Körper, einem schmalen Gesicht und hartem Kinn nebst vielen Runzeln. »Waren Sie eigentlich der Held von Sommerfeld, Wamsler?«
Der Major zuckt die Schultern. »Ich fühle mich nicht als Held«, erwidert er. »Eher schon als Narr.«
»Aber das kommt doch fast auf das gleiche heraus«, entgegnet der I A mit einem verbitterten Lachen. »Und so geht es uns doch allen.« Ohne Übergang fragt er: »Zu Hause alles in Ordnung?«
»Totalschaden«, versetzt der Münchner. »Aber meine Eltern haben es überlebt.« Nach einer kurzen Pause setzt er hinzu: »Ich brauche frische Männer, entsprechende Ausrüstung, neue Kampfwagen und …«
»Lieber Freund«, erwidert der Generalstabsoffizier, »ob Sie es glauben oder nicht, wir sind fast genauso abgebrannt wie Sie.« Eine Handbewegung zeigt den Unwillen des Majors. »Aber jetzt sehen Sie mal zu, wie Sie an ein frisches Hemd kommen und vielleicht sogar irgendwo eine Badewanne finden, dann sage ich Ihnen, wo fabrikneue Königstiger oder Panther zu holen sind.«
»Das ist ein Wort, Herr Oberst«, entgegnet der Führer der dezimierten Kampfgruppe und spürt jetzt erst, wie schwer die Müdigkeit an ihm hängt.
Eine Stunde später meldet er sich wieder auf dem Gefechtsstand der 9. Armee, und diesmal ist auch der General anwesend. Er hat ein Exemplar der NS-Edelzeitschrift Das Reich in der Hand und liest einen Artikel über die Flüchtlingstrecks vor: »Wer hat je so schöne Pferde gesehen?« Der General tippt sich an die Stirn. »Da reiten sie vorneweg, ein alter graubärtiger Herr, mit etwas müden Augen, aber straff, aufrecht, mit kurzem Pelz und Nerzmütze, die Beine in gut gearbeiteten Reitstiefeln, neben ihm die Frau, eine weißhaarige, aber wohl gar nicht so alte Dame im Reitsitz der Frauen. Schließlich der Junge, der Enkel, wohlauf, munter vor sich hinplaudernd.« Der General unterbricht sich. »Sind Sie auch so einem Luxustransport begegnet, Major Wamsler?«
»Nein, Herr General.«
»Zum Kotzen«, erwidert der Kommandierende: »Ich bin bereit, mit meinen Männern hier hopszugehen, um vielleicht noch ein paar hunderttausend Zivilisten zu retten.« Er knallt wütend die ZeitungaufdenTisch: »Aberichlaßmichnichtauch noch verarschen!« Er atmet schwer: »Ich kann Ihnen verraten, wo Sie so einen Transport de luxe finden«, ruft er aufgebracht. »Den Luxuszug ›Steiermark‹ im Waldgebiet bei Prenzlau, auf der anderen Seite der Oder natürlich, da treffen Sie unseren Oberkommandierenden – hinten im Salonwagen …«
Der General knallt die Türe zu.
»Ein komischer Vogel, dieser Heinrich Himmler«, stellt Oberst Steinert fest. »Seit dem 20. Juli sieht Hitler lauter Verschwörer, und so machte er aus einem gelernten Landwirt einen ungelernten Feldherrn. Kommen Sie, Wamsler, vertreten wir uns die Beine.«
Ein paar Hitlerjungen auf Fahrrädern mit umgehängten Panzerfäusten grüßen stramm. »Unser Panzerjagdkommando«, erläutert der IA. »Man hat diesen Pimpfen für vier abgeschossene T 34 das Ritterkreuz versprochen, und jetzt sind sie nicht mehr zu bremsen beim Griff nach der Blechkrawatte.« Er spricht, als hätte er Sand zwischen den Zähnen: »Eine unserer Geheimwaffen – die beste noch.«
Überall hängen Plakate: Die Oder ist Hauptkampflinie – wer sie verlässt, wird auf der Stelle erschossen.
»Dabei hat der Iwan schon zwei Brückenköpfe auf dem westlichen Ufer«, erläutert Steinert. »Siebzig Kilometer noch bis zur Reichshauptstadt. Zwei Panzerstunden.« Er bleibt stehen. »Ist das nicht Wahnsinn? Hier stehen wir wie die letzten Goten und kämpfen bald mit den Fäusten, und in unserem Rücken treten sich die Feldgendarmen gegenseitig auf die Füße, um den Befehl dieses Reichsheinis auszuführen.« Er lacht konvulsivisch: »Sollen sie ihn doch aufhängen, er ist ja weit hinter der Oder-Linie, ein käsebleicher Feigling, der den Starken mimt. Leere Worthülsen, Wamsler, nichts weiter.«
Der Major war nie ein Freund Himmlers gewesen, aber gefürchtet hatte er ihn immer. Jetzt entnimmt er den zornigen Worten Steinerts, wie weit der Niedergang des Dritten Reiches schon fortgeschritten sein muß.
Der gradlinige, krummbeinige Reiteroffizier kommt wieder zur Sache: »Sie waren doch inzwischen beim Truppenarzt?«
»Jawohl, Herr Oberst«, entgegnet der Major. »Halb so schlimm. Sie wollten mir sagen, wo ich neue Königstiger …«
»Richtig«, erwidert der IA. »Passen Sie auf: Sie sind verwundet, Sie haben zu Hause einen Bombenschaden, und wir brauchen dringend neue Panzer. Unser General hat beste Beziehungen zum Stab Speer. Sie fahren also ins rückwärtige Reichsgebiet und greifen sich ›Tiger‹ und ›Panther‹ in den Rüstungsfabriken direkt vom Fertigungsband. Nehmen Sie ein paar zuverlässige Leute mit und lassen Sie sich nicht abwimmeln, Wamsler. Es sind uns mindestens 60 Kampfwagen zugesichert; keiner weniger, bitte. Wir stehen hier zwar auf verlorenem Posten, aber wehren möchten wir uns doch wenigstens. Bringen Sie Dampf in die Sache! Zwischendurch machen Sie einen Abstecher zu unserem Ersatztruppenteil und suchen sich dort erstklassige Besatzungen aus – Männer, keine grünen Jungens – für die Schlacht um Berlin.«
»Aber das wird wohl nicht so schnell zu machen sein.«
»Die Russen lassen sich ja auch Zeit mit ihrem letzten Angriff«, erklärt der I A und klopft dem Major auf die Schulter, und endlich begreift Sepp Wamsler, daß er eine Chance hat, in München bei seinen Eltern kurz nach dem Rechten zu sehen.
Der Morgen des 7. März wirkt seltsam lustlos. Gegen acht Uhr kommen Regenschauer auf. Dicke Tropfen laufen über die Stahlhelme der Brückenverteidiger von Remagen. Gleich danach spitzt ganz kurz die Sonne aus dem Gewölk wie eine Maus aus dem Loch, um gleich wieder zu verschwinden, als wittere sie die Katze.
An der zweigleisigen Ludendorff-Brücke, einem mächtigen, von vier Pfeilern getragenen Eisenmonster – erbaut im Ersten Weltkrieg, um den Nachschub nach Frankreich schneller an die Front zu bringen –, herrscht Nervosität; Panik fast. Befehle jagen sich und werden widerrufen. Die Nachrichtenverbindung ist abgerissen. Niemand weiß, wer eigentlich zuständig ist. Der Kampfkommandant Bratge, nicht mehr der Jüngste und im Zivilberuf ein Schullehrer, erweist sich als genauso unsicher wie das Wetter. Er hat längst einen Nachfolger, aber das weiß er noch nicht, denn Major Scheller, der Korpsadjutant des Generals Otto Maximilian Hitzfeld, sucht noch inmitten eines aufgelösten Rückzugs seinen Begleittrupp und seine Funkstelle, die unterwegs wegen Spritmangels liegengeblieben waren.
Hauptmann Friesenhahn, ebenfalls Reserveoffizier, ist die Brückensicherung und notfalls die Sprengung anvertraut; er hat die Orts- und Brückenverteidigung mit dafür untauglichen Soldaten bis zum Überdruß geübt, aber für diese Aufgabe steht ihm nur eine dezimierte Kompanie des Landespionierregiments 12 zur Verfügung. Der Reserveoffizier hatte dringend Verstärkung angefordert und erhalten: angeblich Genesende aus einem Heeresersatzlazarett in Bonn. Die einen können nicht gehen, die anderen kein Gewehr halten. Im Grunde ist es ein Verbrechen, solche Leute an die Front abzustellen, aber der Hauptmann ist noch froh um jeden Halbkrüppel.
Zunächst weiß er nicht, was er mit den Verwundeten anfangen soll. Dann schnappt er sich den Gefreiten, der auf ihn noch den besten Eindruck macht, einen, der seinen rechten Arm in der Schlinge trägt. Links hat er eine inzwischen organisierte Maschinenpistole geschultert.
»Wie heißen Sie?« fragt ihn Friesenhahn.
»Gefreiter Wamsler«, erwidert der breitschultrige Junge, der aussieht wie ein Behinderten-Siegfried.
»Sie sind ab sofort der Wachhabende auf der Brücke«, befiehlt der Hauptmann. »Suchen Sie sich ein paar Leute aus. Ich mache Sie verantwortlich dafür, daß Sie jeden zurückschicken, der keine Marschpapiere hat. Machen Sie rücksichtslos von der Schußwaffe Gebrauch. Sie lassen niemanden durch, auch keinen Offizier, nicht einmal einen General, und der Troß bleibt auf dem linken Ufer – und wenn er noch so gültige Papiere hat.«