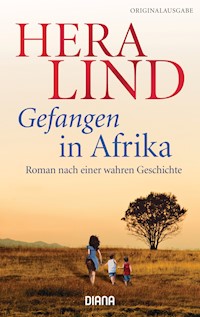9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Schicksal, das fast eine Million Russland-Deutsche teilten Nummer-1-Bestseller-Autorin Hera Lind erzählt die wahre Geschichte der Schwarzmeer-Deutschen Lydia, die erst 16 Jahre alt ist, als sie in einen sibirischen Gulag verschleppt wird. 1944 beginnt für die 16-jährige Lydia ein Alptraum, der nicht enden will: Als die Rote Armee auf ihr kleines Dorf bei Odessa in der Ukraine vorrückt, flieht die Familie. Sie schaffen es sogar bis nach Deutschland, doch sie werden zurückgeholt. Mit Mutter und vier Geschwistern wird Lydia bei minus 50 Grad nach Sibirien verschleppt. Zwölf unbarmherzige Jahre lang kämpft sie in einem Gulag ums Überleben und wird Mutter von acht Kindern, von denen sechs überleben. Als man sie endlich aus dem Lager entlässt, ist der eiserne Vorhang dicht. Weitere zwölf Jahre irrt sie mit den Kindern durch die Sowjetunion, immer nur ein Ziel von Augen: um jeden Preis mit ihnen nach Westdeutschland gelangen, auch wenn sie da noch nie war. Denn Deutschland ist ihre Heimat! Ein bewegender Tatsachenroman über ein Schicksal, das fast eine Million »Russland-Deutsche« geteilt haben Herzzerreißend, aber nie ohne Hoffnung: Bestseller-Autorin Hera Lind erzählt in ihrem Tatsachenroman »Um jeden Preis« eine wahre Geschichte, die aufrüttelt und tief erschüttert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hera Lind
Um jeden Preis
Roman nach einer wahren Geschichte
Knaur eBooks
Über dieses Buch
1944: die 16-jährige Lydia aus Odessa findet sich nach tagelanger Irrfahrt in einem verschlossenen Waggon in der unwirtlichen sibirischen Eiswüste bei minus 50 Grad wieder. Ihr einziges Gepäck: Die Kleider, die sie am Leib trägt. Keine Hütte, kein Schutz, nichts. Noch ahnt sie nicht, dass sie hier Mutter werden wird und das in ihr ungeahnte Kräfte freisetzen wird ...
SPIEGEL-Nr.1-Bestsellerautorin Hera Lind; ein berührendes Schicksal nach einer wahren Geschichte
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Salzburg
Einleitung
Bessarabien, heutige Republik Moldau
Auf dem Treck Richtung Polen
Im Lager Birnbaum
Steesow bei Lenzen an der Elbe, »Altreich«, Ostdeutschland
Sibirien, Barnaul, Region Altai, Osjorke
Bei Osjorke, Sibirien
Osjorke, Sibirien
Osjorke, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Osero-Petrowski, Sibirien
Im Krankenhaus Troizkoj
Kolchose Gartejewka, Sibirien
Kolchose Gartejewka, Sibirien
Kolchose Gartejewka, Sibirien
Kolchose Gartejewka, Sibirien
Kolchose Gartejewka, Sibirien
Kolchose Gartejewka, Sibirien
Kolchose Gartejewka, Sibirien
Karaganda, Kasachstan
Karaganda, Kasachstan
Karaganda, Kasachstan
Karaganda, Kasachstan
Karaganda, Kasachstan
Kasachstan
Kasachstan
Kasachstan
Karaganda, Kasachstan
Olini, Lettland
Lettland
Olini, Lettland
Olini, Lettland
Olini, Lettland
Olini, Lettland
Olini, Lettland
Riga, Lettland
Moskau, Russland
Von Moskau nach Warschau
Brest, Belarussische Sozialistische Sowjetrepublik
An der Grenze zur DDR
Nach Friedland bei Göttingen
Grenzdurchgangslager Friedland, Niedersachsen, Westdeutschland
Rastatt, Baden-Württemberg, Westdeutschland, zweites Durchgangslager
Westdeutschland
Deutschland
Ludwigsburg, Baden-Württemberg
Westdeutschland
Westdeutschland
Ludwigsburg, im Krankenhaus, auf der Station IG2
Der neunzigste Geburtstag von Mama
»Blumenstrauß« für Lydia
Nachwort der Autorin
Prolog
Salzburg
Ende Oktober 2021
Nebenan sitzt eine neunköpfige Familie. Bist du bereit?«
Mein Mann steht in der Küche und bereitet das Mittagessen für die Gäste vor. Es duftet nach frisch gebackenen Schnitzeln und lauwarmem Kartoffelsalat.
»Bereit.« Ich nicke. Bereit für eine außergewöhnliche, ganz wunderbare Geschichte.
Die mich so gepackt hat, dass sie mich nicht mehr loslässt. Die ich unbedingt schreiben will.
Und damit öffne ich die große Flügeltür zu meiner Romanwerkstatt, in der sonst die Schreibseminare stattfinden. Doch diesmal sind es keine Kursteilnehmerinnen, die mich erwartungsvoll anblicken, sondern es ist die Familie Judt.
»Herzlich willkommen!« Ich setze mein strahlendstes Lächeln auf und trete auf sie zu. Die Fremden umringen bereits den großen Konferenztisch, an dem wir normalerweise unsere Schreibübungen machen. Das Händeschütteln schenken wir uns und begrüßen uns wie die Thais mit vor dem Herzen gefalteten Händen und einer leichten Verbeugung. Das finde ich sowieso viel schöner und angemessener, drückt es doch Achtung und Herzlichkeit gleichermaßen aus. Und Respekt. Die Geschichte ihrer Mutter Lydia nötigt mir so viel Respekt ab, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann.
Auf dem Tisch türmen sich Tagebücher, Fotoalben, Gedichte, selbst gemalte Bilder und sogar Proben der Stick- und Nähkunst von Lydia Judt, um die es heute geht.
Lydia ist mitten unter uns, auch wenn sie vor zwei Jahren im Alter von knapp zweiundneunzig verstorben ist.
»So, und wer von euch ist denn jetzt Margarethe?« Die hat mir nämlich das Tagebuch ihrer Schwiegermutter geschickt. Und ich habe es in zwei Tagen verschlungen und mit großen Lettern »Volltreffer!« darauf geschrieben.
Eine blonde Dame am anderen Ende des Tisches hebt lächelnd die Hand. »Ich.«
»Und wer ist der dazugehörige Mann, Johannes, Sohn von Lydia?«
Margarethe zeigt auf einen Herrn, der ein paar Stühle weiter sitzt und nun ebenfalls die Hand hebt.
»Ihr beide habt also im Urlaub mit euren österreichischen Gastgebern beim Wein über eure Mutter beziehungsweise Schwiegermutter Lydia gesprochen.«
»Genau.« Margarethe und Johannes nicken. Alle nicken. Auch die, die ich noch gar nicht eingeordnet habe. Wer ist Sohn oder Schwiegersohn, Tochter oder Schwiegertochter unserer Heldin Lydia Judt? Diese bemerkenswerte Familie, über die ich unbedingt einen Roman schreiben möchte, hält zusammen wie Pech und Schwefel, und wenn man ihre Geschichte kennt, weiß man auch, warum.
»Das Vermieter-Ehepaar der Ferienwohnung hat gesagt: ›Das wäre doch eine Geschichte für Hera Lind!‹ Und daraufhin haben wir gesagt … weil wir ja nicht wussten …«
Margarethe unterbricht sich, nach einem dezenten Handzeichen ihres drei Stühle weiter sitzenden Mannes.
»… wer ist Hera Lind?«, helfe ich ihr scherzhaft auf die Sprünge.
Die Familie nickt und lacht.
»Na, jedenfalls«, nimmt Margarethe den Faden wieder auf, »waren wir total überrascht und erfreut, als von Ihnen … äh … von dir … nach so kurzer Zeit bereits eine Mail kam.«
»Genau«, nicken die andern im Takt. »Nur vier Tage später kam deine Zusage.«
»Und da haben wir sofort eine Familienkonferenz einberufen.«
»Wie schön.« Diese neun erwachsenen Personen, die sich so einig sind in allem, was sie tun und sagen, die hier so friedlich und respektvoll beieinandersitzen, und die einfach alle in einen Zug gestiegen sind, um zu mir zu kommen, habe ich schon jetzt ins Herz geschlossen.
Mein Mann stürmt mit einem Tablett herein, auf dem zehn Gläser Champagner stehen, und macht seinen üblichen Lockerungs-Scherz mit dem Teppich, über den er stolpert. Das macht er immer, um erste Beklemmungen zu lockern, und nach einem kurzen Schreckmoment lachen alle.
»Willkommen in der Romanwerkstatt!« Wir prosten uns zu.
»Auf unsere Mutter und Schwiegermutter Lydia!«
»Und auf meine Omi!«, ergänzt Dimi, der einzige Enkel, der mitgekommen ist.
»Und wer ist denn jetzt wer? Hast du sie schon alle auf dem Schirm?« Mein Mann lässt seinen österreichischen Charme spielen und sorgt für Skihütten-Gemütlichkeit.
»Also ich bin der Andreas«, fängt ein Weißhaariger an.
Andreas? Kommt in dem Tagebuch nicht vor. Das wird eine Herausforderung, sich alles zu merken!
»Ich gehöre zur Lisa.«
»Aha. Lisa ist die zweitälteste Tochter von Lydia.«
Eine groß gewachsene, schlanke sportliche Frau Mitte sechzig mit sehr pfiffigem Kurzhaarschnitt begrüßt mich vom anderen Ende des Tisches. Sofort empfinde ich große Sympathie für sie. Sie hat einen winzigen charmanten Akzent.
»Und ich bin die Rosa.« Eine ebenso attraktive, eher zierliche Frau, von der ich weiß, dass sie bald siebzig wird, hebt den Arm.
Rosa ist die älteste Tochter von Lydia. Sie wurde noch in sibirischer Kriegsgefangenschaft geboren und hat ihre ersten fünf Lebens-Winter bei minus fünfzig Grad erlebt. Sie hauste mit ihren Eltern, deutschen Zwangsarbeitern, in einer Baracke, in der ihre achtundzwanzigjährige Tante, auf der sie als Kleinkind herumkrabbelte, an Tuberkulose starb. Bevor sie mit ihrer hochschwangeren Mutter und ihrem anderthalbjährigen Brüderchen Viktor nach Kasachstan flüchtete, wo sie in Ermangelung einer Unterführung unter vier Zügen hindurchkrabbeln mussten und bei einem so heftig wütenden Steppen-Sandsturm ankamen, dass der Mutter die Kinder aus den Armen gerissen wurden. Ihre Gesichter waren schwarz vor Kohlestaub, als sie an einer einsamen Landstraße standen und schließlich von einem klapprigen Lieferwagen mitgenommen wurden, weil niemand sie abgeholt hatte.
Aber jetzt komme ich schon ins Erzählen, dabei will ich doch erst meine Helden und Heldinnen vorstellen.
Die zwei Töchter Rosa und Lisa wären identifiziert. Hübsche, moderne, lebensfrohe Frauen, die eine mit Mann, die andere mit erwachsenem Sohn, Dimi.
Fehlen noch …
»Jakob.« Ein Mann, der Johannes ähnlich sieht, hebt die Hand. »Ich bin der andere noch lebende Sohn. Und das ist meine Frau Lilli.«
Eine blonde, hübsche Frau, die mich gewinnend anlächelt, meldet sich.
Oh danke. Ich werde die Namen und Gesichter schon auf die Reihe kriegen.
Hier sitzen die vier noch lebenden Kinder von Lydia: Rosa, Lisa, Jakob und Johannes.
Je in Begleitung.
Doch da ist noch eine Dame …
»Heidi.« Eine zurückhaltende Dunkelhaarige am linken Ende des Tisches hebt verhalten den Arm. Sie hat schon die ganze Zeit leise geweint.
»Ich bin die Witwe von Viktor.«
Viktor war der zweite Sohn von Lydia, jener Anderthalbjährige, der damals bei der Flucht von Sibirien nach Kasachstan unter den Zügen durchgeschoben wurde. Und leider 1995 als Vierzigjähriger an einem Herzinfarkt starb. Längst in Sicherheit, in Westdeutschland. Er gehört unbedingt in diese Geschichte, spielt eine große Rolle darin. Dass seine Heidi erstens in dieser Familienrunde dabeisitzt und zweitens immer noch über seinen Tod weint, berührt mich tief. Sie wird liebevoll von ihren Schwägerinnen, die auf beiden Seiten neben ihr sitzen, getröstet.
»Ja, und dann war da noch Eduard, der jüngste Sohn von Lydia, der leider vor gut zwei Jahren an Krebs gestorben ist.« Das Foto eines sympathischen, lustigen und bildhübschen Mannes von Mitte fünfzig macht die Runde. »Der säße jetzt bestimmt gerne hier.«
»Und der Viktor natürlich auch.« Heidi nickt. »Die Brüder waren immer zu Späßen aufgelegt.«
»Eduard war es, der Mutter in ihren letzten Lebensjahren dabei geholfen hat, ihr Tagebuch auf dem Computer zu schreiben. Er hat auch sämtliche Fotos für sie entwickelt und in das Manuskript eingearbeitet.«
»Moment. Lydia hat mit neunzig noch ihr Tagebuch in den Computer eingetippt?«
»Ja. Sie hat sich das Computerschreiben selbst beigebracht. Wie oft hat sie mich angerufen, Junge, komm schnell, der Text ist verschwunden.« Johannes grinst verhalten.
»Die hat noch ganz andere Sachen gemacht.« Kinder und Schwiegerkinder kommen ins Plaudern und lachen stolz. »Sie konnte sticken und malen und aus den kleinsten Dingen etwas richtig Gutes zaubern …«
Das Stickzeug auf einem Kopfkissenbezug ist so fein und säuberlich, dass man eine Lupe braucht, um das wunderschöne Muster zu erkennen.
»Mutter hat acht Kinder geboren und sechs davon im Lauf von dreiundzwanzig Jahren durch die Gefangenschaft in Sibirien und dann zuerst nach Kasachstan, dann nach Lettland und schließlich nach Westdeutschland gebracht. Aus eigener Kraft und mit eigener Hände Arbeit. Sie durfte fast kein Geld mit ausführen und hat in Deutschland für uns alle eine neue Existenz aufgebaut.«
»Und nicht nur einmal.«
Kurzfristig wird es still. Es scheint verabredet zu sein, dass über Lydias Mann, den Vater der Kinder, nicht gesprochen wird. Nachher kommt doch einiges zutage.
Das gedruckte Tagebuch mitsamt den etwa dreißig Fotos liegt aufgeschlagen auf dem Tisch. Es macht die Runde, und jedem der hier Anwesenden fallen viele Geschichten zu Lydia ein.
Sie binden einen verbalen Blumenstrauß, der am Ende prächtig blüht und den man jetzt unbedingt genauer betrachten will.
Aus Respekt vor Lydia und den Geschehnissen bleibe ich in meinem Erzählstil anfangs sehr nah an ihrem Tagebuch, um später die Blüten meiner Fantasie mithilfe der Berichte der noch lebenden Kinder einzustreuen.
Und hier ist sie:
Lydias Geschichte
Geboren wurde ich am 26.06.1927 in einem deutschen, römisch-katholischen Dorf namens Hahnhofen, in der Nähe von Odessa am Schwarzen Meer. Das Dorf war sehr klein. Es hatte nur fünfzig Häuser und keine tausend Einwohner. Es gab in unserer Familie bereits ein älteres Kind, meine Schwester Katja, die war zweieinhalb Jahre alt, als ich das Licht der Welt erblickte. Meine Eltern waren fleißige Landwirte, die Tag und Nacht ihr kleines bisschen Grund bewirtschafteten.
Unsere Vorfahren waren schon vor zweihundert Jahren aufgrund von russischen Werbern, die ihnen fruchtbares Land und ein gutes Auskommen versichert hatten, in die Ukraine ausgewandert. Als sie im viel gepriesenen gelobten Land ankamen, standen sie kniehoch in tiefem sumpfigem Morast. Es gab nichts, nur Lehm und feuchten Boden. Aber unsere Vorfahren krempelten die Ärmel und Hosenbeine hoch und begannen, sich ihre neue Heimat urbar zu machen. Man nannte sie die Schwarzmeerdeutschen. Die Gesellschaft der Schwarzmeerdeutschen war agrarisch geprägt. Die Auswanderer wirtschafteten anfangs fast ausnahmslos als kleine Landwirte und Bauern auf jenem Boden, den ihnen der russische Staat zur Verfügung gestellt hatte.
Zur Haupteinnahmequelle wurde der Getreideanbau, da das Getreide vom Schwarzmeerhafen in Odessa im 19. Jahrhundert zollfrei ausgeführt werden konnte. Die günstigen Produktions- und Absatzbedingungen bei Getreide sorgten schließlich in weiterer Folge für wirtschaftlichen Wohlstand und führten zur Gründung von weiteren Siedlungen. Angebaut wurden auch Gemüse, Wein und Obst. In der Tierhaltung waren Bienen, Seidenraupen und Merinoschafe dominierend. In Odessa ließen sich viele ausgewanderte deutsche Handwerker nieder. Daraus gingen später Fabriken für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte hervor.
Meine Eltern waren wie alle Bewohner dieses kleinen Dorfes sehr fromm. Nach mir wurden noch drei weitere Kinder geboren, sodass wir eine kinderreiche, fromme und arbeitsame Familie waren.
Katharina (geboren 1925)
Ich, Lydia (geboren 1927)
Eduard (geboren 1928)
Elisabeth (geboren 1930)
Michael (geboren 1932)
Die Kirche bildete den Mittelpunkt des kulturellen Lebens der Schwarzmeerdeutschen. Praktisch trug der Gebrauch von Bibel und Gesangbuch dazu bei, dass die deutsche Sprache in der Fremde erhalten blieb. Der Schulunterricht für die Kinder war eng mit der Kirche verbunden, da es nur eine Kirchenschule gab. Im 20. Jahrhundert gründeten die deutschen Kolonisten auch höhere Schulen. Leider konnte ich nicht in die Schule gehen, denn als ich etwa fünf Jahre alt war, überfiel unser Land eine große Hungersnot.
Josef Stalin beschloss damals laut Geheimakten, die Bewohner der Ukraine aushungern zu lassen, aus Angst vor der Bauernrebellion gegen die Bolschewiken. Bereits 1930, als ich drei Jahre alt war, gab es vonseiten der ukrainischen Bauern eine Rebellion gegen die Verstaatlichung der hart erarbeiteten Ernten und erwirtschafteten Güter, gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft. Die Antwort Stalins darauf war eine geplante und durchorganisierte Nahrungsmittelentwendung. Er schickte Brigaden aufs Land, die die Dörfer durchkämmten und alles beschlagnahmten. Er nahm den Leuten das Essen weg. Jedes einzelne Korn. Meine Eltern leisteten daraufhin jahrelang Zwangsarbeit in der Kolchose, während wir vier Kinder im Bett lagen mit geschwollenen Hungerbäuchen. Katharina, acht Jahre alt, ich, Lydia, sechs, Lisa, drei Jahre, und der kleine Michael, ein halbes Jahr alt, wir waren auf uns selbst gestellt. Unsere Eltern waren auch sehr geschwächt, mussten aber raus auf das Feld, um die »Missernte« einzubringen, wie es hieß. Nach außen hin wurde kolportiert, dass es an den Hitzeperioden und der Dürre lag, dass unser Volk verhungern musste. Stalin wusste, dass die Leute in der Ukraine verhungerten. Er nahm es nicht nur in Kauf, sondern es war sein Plan, damit die Bauern nicht mehr gegen die Verstaatlichung rebellieren konnten.
Bei der großen Hitze brach auch unser Vater zusammen, lag ein paar Wochen im Bett und konnte nicht zur Arbeit gehen. Da schleppte sich unsere tapfere Mutter, inzwischen wieder schwanger, allein aufs Feld und war zwölf bis vierzehn Stunden dort auf den Beinen. Das war unser großes Glück, denn sie konnte ihren Hunger auf dem Feld stillen, mit Weizenkörnern. Es war streng verboten und wurde mit Gefängnis oder sogar dem Tode bestraft, wenn man etwas vom Felde mit nach Hause nahm. Es gehörte jetzt alles dem sowjetischen Staat, auch die Landwirtschaftsgeräte, das Vieh und die Pferde. Aber der Hunger zwang die Menschen dazu, etwas mitzunehmen, denn ein jeder hatte ein Haus voller Kinder, die zu Hause am Verhungern lagen. Meine Geschwister und ich hatten seit Monaten das Licht nicht mehr gesehen, wir lagen mit Hungerbäuchen in einem dunklen Raum und konnten nicht mehr aufstehen. So brachte unsere Mutter jeden Abend eine Handvoll Weizen, den sie etwas anröstete und mit der Kaffeemaschine zu Mehl mahlte, womit sie dann eine dünne Schleimsuppe kochte. Wir Kinder bekamen nur einen Teller Wassersuppe am Tag. Der Vater bekam zwei Teller, denn er sollte ja schnell wieder auf die Beine kommen. Sobald es dem Vater etwas besser ging, musste er wieder zur Arbeit gehen.
Die Männer arbeiteten mit den bereits verstaatlichten Pferden, die dringend bei der Ernte gebraucht wurden. Der Vater war noch so schwach, dass er nicht allein in den Leiterwagen hochsteigen konnte. So musste die Mutter ihm einen Stuhl hinausbringen und ihn stützen, damit er auf den Wagen steigen konnte. Nun kam auch der Vater abends vom Feld zurück und brachte eine Handvoll Weizenkörner. Die hatte er unter seiner Mütze im verklebten Haar versteckt. Die Mutter ließ ihre Handvoll Weizen in ihren Büstenhalter fallen, wo sie sofort am verschwitzten Körper haften blieben. So hatten unsere Eltern ihr Versteck und wurden nicht erwischt.
Am Abend, wenn die Eltern sich von den Körnern befreiten und jedes einzeln von ihrem Körper abklaubten, warf die Mutter sie in ein Sieb und hielt sie unter das Brunnenwasser, bevor sie sie in einer Pfanne röstete. Sie mahlte die Körner mit der Kurbel der Kaffeemühle und kochte damit eine Weizenschleimsuppe. Nun bekamen auch wir Kinder zweimal am Tag einen Teller Suppe. Das arme Vieh litt ebenso großen Hunger wie wir, denn die Viehweide war in diesem heißen Sommer braun verbrannt, sodass die Tiere nichts zum Fressen fanden. Das ausgeklügelte Drainage-System, das bereits unsere deutschen Vorfahren angelegt hatten, war von Stalins Brigaden zerstört worden. Die große Dürre trug dazu bei, dass die Kühe fast keine Milch mehr gaben. Der Staat verlangte mehr Milch von einer Kuh, als sie geben konnte. Mutter erzählte: Wenn man fünf Liter gute Milch abgeliefert hatte, bekam man drei Liter entrahmte Milch wieder zurück, die sie für die Schleimsuppe verwendete. Das war alles, was unsere Familie zu essen bekam, und das fast drei Jahre lang.
Es folgte das Jahr 1934 mit einem noch größeren Schrecken: Zu der großen Hungersnot kam eine Seuche mit Erbrechen und Blutdurchfall dazu. Dieser Krankheit fielen pro Haushalt zwei bis vier Kinder zum Opfer. In unserer Familie starben alle meine drei kleinen Geschwister: Eduard mit vier Jahren, Lisa mit drei Jahren und Michael mit einem halben Jahr, und kamen zusammen in ein Grab. Die Bäuche von uns beiden großen Schwestern, Katharina und mir, Lydia, waren so geschwollen, dass wir kaum laufen konnten. Wenig später kam die kleine Klementine zur Welt: Mutters sechstes Kind, das sie geboren hatte, aber das dritte, das überlebte.
Ganze Familien und ganze Ortschaften, deren Straßen für den Ein- und Ausgang gesperrt wurden und auf das »schwarze Brett« eingetragen wurden, starben aus. Auf solch einem »schwarzen Brett« landeten Dörfer, die Getreidebeschaffungspläne nicht erfüllten. Dies bedeutete die völlige Isolation von der Außenwelt. Sie wurden von Truppen umgeben, die für die Bewohnerinnen die Lebensmittellieferungen komplett abschnitten, bis alle Menschen innerhalb des Dorfes starben.
Die Brigaden holten alle Lebensmittel ab, und später kamen sie zurück: »Warum lebst du noch? Wo hast du das Essen her?« So mancher wurde daraufhin erschossen. Sie wollten sicherstellen, dass alles Essbare aus der Ukraine entfernt wurde und diese Nation nicht mehr gegen die Verstaatlichung ihres Eigentums rebellieren konnte.
Fast vier Millionen Ukrainer und damit auch die Deutschen, die dort seit Generationen lebten, verhungerten. Bei einer Umfrage, die 1937 durchgeführt wurde, erfuhr Stalin von dem entsetzlichen Ausmaß, doch er ließ die Leute, die die Befragung durchgeführt hatten, erschießen, und die Welt sollte nichts darüber erfahren. Es sollte heißen, die Hungersnot sei durch eine große Dürre und Missernte entstanden, und nicht durch Willkür. Es war eine bewusste politische Entscheidung Stalins, die Leute verhungern zu lassen, und ich, Lydia, bin eine der letzten Zeitzeuginnen, die davon berichten.
Wie durch ein Wunder überlebten wir: der Vater Josef und die Mutter, Marianna, mit uns drei verbliebenen Kindern Katja, Lydia und Klementine. 1937 erblickte unser kleiner Bruder Jakob das Licht der Welt, und gleichzeitig kamen wir großen Mädchen, zwölf und zehn Jahre alt, das erste Mal in die Schule.
Wegen der Hungersnot und der damit verbundenen Seuchen war der Unterricht über Jahre ausgefallen. 1936 wurden alle deutschen Schulen in der Ukraine geschlossen, Lehrkräfte wurden verhaftet, und Ukrainisch wurde als Unterrichtssprache eingeführt. Die Religionsverfolgungen unter Stalin hatten katastrophale Folgen für das kirchliche Leben der Schwarzmeerdeutschen. Kirchen und Gebetshäuser wurden geschlossen und teilweise abgerissen. Geistliche wurden verschleppt und erschossen.
Zwei Jahre später wurde unsere kleine Schwester Frederike geboren, Ende 1939. Nun waren wir wieder fünf Geschwister. Obwohl die Ernte seit 1935 im Durchschnitt wieder gut ausfiel, war nach Abgabe der Ernte an den Staat das Leben sehr hart, denn der kommunistische Staat hatte sich mittlerweile durchgesetzt. Es gab keinen Privatbesitz mehr. Kummer, Not und Sorgen wurden immer größer, denn der sowjetische Staat holte sich fast alles, was die wenigen Überlebenden unter größten Strapazen erarbeitet hatten, und am Ende des Tages standen meine Eltern da mit leeren Händen. So zogen sich die Jahre trostlos dahin, und man wusste in der großen Armut nicht, wohin.
1939 wurden unsere letzten deutschen Lehrer verschleppt. So kamen russische Lehrer in unser Dorf, die kein Deutsch konnten – und wir kein Russisch. Ich kam mit zwölf Jahren in die vierte Klasse, und nun ging der Kampf los, dass wir alle Russisch lernen mussten. Aber wie sollte das so plötzlich gehen? Unsere Eltern wehrten sich mit letzter Kraft dagegen und wollten, dass wir unsere Muttersprache beibehalten dürfen. Also ließen sie uns nicht in die Schule gehen, zumal jede helfende Hand auf dem Feld und im Haushalt gebraucht wurde. Meine große Schwester Katharina half der Mutter mit den drei kleinen Kindern und der Hausarbeit, ich selbst war die Robustere und half dem Vater auf dem Feld und im Stall. Schon als Zwölfjährige lernte ich, einer Kuh beim Kalben zu helfen, Pferde zu beschlagen und Schweine zu schlachten. Auch wenn wir das Fleisch nicht behalten durften. Denn wir arbeiteten ja für die Kolchose.
Doch die sowjetische Brigade ließ auch diesmal wieder nicht locker: Unter Schlägen und Drohungen zu Schlimmerem wurden unsere Eltern gezwungen, uns in die Schule gehen zu lassen. Und zwar, zur Strafe, in einem Russendorf, zwei Kilometer entfernt, wo wir die einzigen deutschsprachigen Kinder waren. Da saßen wir ein Jahr lang im Unterricht, wurden ausgelacht, bespuckt und beschimpft, weil wir nichts verstanden und nichts kapierten, und haben in diesem Jahr nichts gelernt. Dafür fehlten wir unseren Eltern als Arbeitskraft. Die russischen Kinder haben uns morgens mit Steinen empfangen und nachmittags mit Steinen nach Hause begleitet.
1940 kam der Zweite Weltkrieg in unser Dorf. Wir mussten Tag und Nacht in der Kolchose arbeiten. 1941 marschierten die deutschen Truppen bei uns ein, und sie fühlten sich bei uns gleich wie daheim. Über den Einmarsch der deutschen Truppen waren wir alle erst einmal froh, denn die neue Regierung Hitlers, des Großdeutschen Reiches, zu dem wir plötzlich alle gehörten, teilte das Land, das Vieh und das gesamte Inventar von der Kolchose wieder unter den ursprünglichen Eigentümern auf, soweit es ausreichte und möglich war. Das war eine Riesenfreude in unserem Dorf! Alle glaubten, dass nun das Elend vorbei sei, und mit großem Eifer und Lust stürzten sich die Bauern wieder in die Arbeit. Im Dorf wurde gleich ein deutscher Bürgermeister gewählt, und es war unser Onkel Eduard Groß, der deutlich ältere Bruder unseres Vaters Josef Groß. Ach, wie dieser Name zu ihnen passte, denn sie zeigten wahre Größe, meine aufrechten, fleißigen und ehrlichen Eltern und Verwandten. Wir haben gelernt zu arbeiten und nicht aufzugeben.
So war 1941 für meine Schwester und mich die Schulzeit zu Ende, weil wir den Eltern beim Wiederaufbau ihres Landes und des Haushaltes mit Freude halfen. Jetzt würde endlich wieder alles gut werden.
Es kam jedoch ganz anders, und wir ahnten nicht, dass es noch viel schrecklicher kommen würde.
Nach dem deutschen Angriff wurden deutsche Männer zur sowjetischen Armee einberufen, zum Glück noch nicht unser Vater, der damals bereits über vierzig war. Und dann wurde plötzlich die Deportation der gesamten noch verbliebenen deutschen Bevölkerung angeordnet. Von unserem deutschen Kommandanten kam ein schwerwiegender Befehl.
Es hieß, dass alle Dorfbewohner sofort ihre Häuser verlassen müssten, dass aber deutsche Soldaten auf die Besitztümer aufpassen würden. Es handele sich nur um einen vorübergehenden »Schutz und Betreuung volksdeutscher Siedlungen« mit dem Ziel einer gründlichen Aufbauarbeit. Alles solle stehen und liegen bleiben, es werde von deutschen Soldaten überwacht! In Abwesenheit der Bewohner würden die letzten Kolchosen aufgelöst werden. So hofften wir auf ein baldiges und friedliches Ende des grausamen Krieges.
Diese »Aufbauarbeit« dauerte jedoch nur so lange, bis den deutschen Siedlungsgebieten die Wiedereroberung durch die sowjetische Armee drohte. 1944 ging der Kampf der deutschen Truppen zurück, die Sowjets drangen wieder vor, und alles ging von vorne los. Doch diesmal würde kein deutscher Siedler mehr auf ukrainischem Boden überleben. So mussten wir die ukrainische Heimat für immer verlassen. Wir sollten sie niemals wiedersehen.
Die deutschen Bauern stellten Trecks zusammen. Mein Gott, war das ein Schreck und ein Geschrei! Wir durften nur eine Kuh mitnehmen, zwei alte Pferde für den Wagen, so viel wie möglich Futter für das Vieh, auch Lebensmittel für die Familie wie Fleisch, Kartoffeln, Öl, Zucker und so viel wie möglich Mehl für das Brot. Auch die Backbleche, Backschieber, Backhopfen für den Teig, auch die Backmulde sollten wir mitnehmen, die zugleich als Futterkrippe für die Pferde an dem Wagen angebracht war. Das Kochgeschirr zum Kochen, die Teller mit dem Besteck zum Essen, alles musste mit. So lautete der Befehl unseres deutschen Kommandanten. Als Schutz vor dem Wetter wurde der Wagen mit Kuhhaut beschlagen. Vater und ein alter Großonkel rackerten und schufteten, bis ihnen der Schweiß auf der Stirn stand. Die Großtante war schon vor Hunger gestorben, sodass sich der alte Mann unserer Familie anschloss.
»Los, Mädchen, schafft die Kinder auf den Wagen, helft Mutter beim Packen!«
»Die Russen sind auf dem Vormarsch, und ihr jungen Frauen seid in höchster Gefahr. Nun macht schon, macht schon, schneller, ihr wisst nicht, was euch sonst blüht!«
Das Wort »Vergewaltigung« fiel immer öfter hinter vorgehaltener Hand.
Katja und ich waren junge unerfahrene Mädchen, und wir wussten nicht, wovon die Rede war.
Es war in der Morgendämmerung und noch eiskalt, als wir für immer unser Dorf verlassen mussten. Die Hähne krähten, die Hunde bellten, die Kühe brüllten, denn sie mussten ja mit uns ziehen. Kleine Kälbchen, die es noch nicht schafften, wurden einfach überrannt und totgetreten. Die drei Kleinen saßen zusammengepfercht auf dem Wagen unter der Plane aus Kuhhaut, Mutter, Katja und ich schritten neben dem Wagen her; Vater hielt die Zügel.
Tag für Tag, immer weiter, über Berg und Tal, über Wiesen und Wälder, durch verschiedene Ortschaften und Länder, durch Bulgarien, Ungarn, Rumänien und durch die Karpaten. Wir hatten einen deutschen Kommandanten, der den Treck leitete. Die Schlange zog sich in die Länge, bis hundert Kilometer lang. Der Weg war hart und grausam, denn es war ja bei unserem Aufbruch erst März.
Die Straßen waren aufgewühlt von den vielen Wägen und den Regengüssen im Frühjahr. An manchen Tagen gab es kein Vorankommen, weil man nicht durchfahren konnte, denn der Weg war so aufgeweicht, dass die Pferde es nicht schafften.
»Alle Wagen müssen umkehren und zurückfahren!«
»Hier geht nichts mehr weiter!«
»Los, Wendemanöver!«
Mein Gott, war das ein Problem auf dem schwer beladenen Wagen auf dem sumpfigen Boden. Da brachen bei manchen Wägen die Räder, und man musste sie aus dem Lehm und Matsch herausziehen.
»Alle für einen, einer für alle, es bleibt keiner zurück!«
Mit weißen Atemwölkchen vor dem Mund schrien sich die Männer und Frauen diese Parolen zu, und selbst Katja und ich mussten mit anpacken, eingesunkene Räder freischaufeln, bei den scheuenden Pferden mit am Halfter anziehen oder schwere Ladungen von den Wägen herunterheben und weiterschleppen, bis sie wieder heraufgewuchtet werden konnten.
So standen wir manchmal zwei bis drei Tage, bis sich die Pferde erholt hatten und alle Wägen repariert waren.
Dann erst ging es weiter, und wir erreichten nach zwei Monaten Bessarabien, heutige Republik Moldau.
Es hatte den ganzen Morgen in einem eiskalten Regen gegossen; die Kinder saßen zähneklappernd und wimmernd auf dem Wagen, es regnete längst hinein, und unsere Mutter schaufelte mit einem Blechtopf das Wasser hinaus, während Katja und ich die geschwächten Pferde weiterzogen. Eines davon war hoch trächtig, die arme Stute schleppte sich mit Schaum vor dem Maul Schritt für Schritt durch den hart gefrorenen Boden, von dem die Nebelschwaden dampfend aufstiegen. Von Frühling war weit und breit keine Spur, es schien, als habe sich auch der Wettergott gegen uns verschworen. Ich kam mir vor, als watete ich seit Wochen durch die eiskalte Hölle.
Nicht ahnend, dass dies erst die Vorstufe zur Hölle war. Wie gut, dass ich es nicht wusste.
»Jetzt geht der Regen auch noch in Schneeregen über!« Katja stapfte in ihren völlig verdreckten Stiefeln durch kniehohen Morast und zerrte das Pferd am Halfter. Vater hatte die trächtige Stute abgeschirrt und führte sie neben der Kutsche her.
»Komm, Lotte, weiter, Fritz, wir können hier noch nicht rasten!«
Unser alter Fritz trottete ergeben, nun allein unsere Kutsche ziehend, hinter dem Vorderwagen her, von dem klägliches Gewimmer eines Babys seit Stunden nicht verebben wollte.
Nebelschwaden hüllten die feucht glänzenden Wagen und vom Regen durchnässten Fußgänger immer wieder ein, und ich stolperte müde und durchgefroren über Steine, Wurzeln und Geäst. Meine eiskalten Füße in den durchlöcherten nassen Strümpfen spürte ich schon längst nicht mehr. Aber ich war weiß Gott nicht die Einzige und hütete mich zu jammern.
»Wann können wir endlich unser Nachtlager aufschlagen?« Meine Hände waren übersät von blutigen aufgeplatzten Stellen, und meine Füße in den Schnürschuhen voller Blasen.
»Jetzt fängt es auch noch an zu schneien, man sieht die Hand vor Augen nicht!« Unser Hintermann, der Bauer Voss, fluchte laut. »Von wegen alles neu macht der Mai!«
»Vorsicht, der aufgeweichte Weg überfriert!« Vater saß mit dem alten Onkel auf dem Kutschbock, weißer Atem stand auch ihm vor dem Gesicht. Seine Bartstoppeln wurden mit jedem Tag weißer.
»Durchhalten, in einer Stunde werden wir in ein Dorf gelangen, so heißt es weiter vorn!«
Ein dick vermummter Begleiter kämpfte sich durch den dichten Schneefall zu uns zurück. »Da können wir unser Quartier aufschlagen!« Er schlug sich die Hände in den zerlöcherten Handschuhen aneinander warm.
»Frederike kann nicht mehr!« Unser siebenjähriger Bruder Jakob streckte den Kopf unter der Plane hervor. »Sie weint, und ich kann sie nicht mehr trösten!«
Mutter wankte hinter dem Wagen her und blies sich in die eiskalten Hände.
»Du musst aber! Hier wird nicht gejammert!«
Ich biss die Zähne aufeinander und trieb das Pferd weiter. »Erzähl ihr eine Geschichte oder singe ihr etwas vor!«
»Was soll ich ihr denn vorsingen!«
»Da nun der Tag vergangen ist«, stimmte Mutter an, und alle Flüchtlinge um mich herum sangen mit, in traurigem Moll, einen Schritt vor den anderen setzend:
»so bitten wir dich, Jesu Christ:
Sei, wenn es dunkelt, unser Licht,
dann schlafen wir voll Zuversicht.«
Auch die beherzte Sopranstimme unseres siebenjährigen Bruders Jakob war nun aus dem Inneren des Planwagens zu hören:
»Was wir verkehrt und falsch getan,
das rechne nicht als Sünde an.«
Die neunjährige Klementine hielt ihr fünfjähriges Schwesterchen Frederike im Arm und sang tapfer aus einem Spalt der Plane heraus:
»Lösch es in deinem Blute aus,
Herr, segne uns und dieses Haus.«
Unsere Eltern waren sehr fromm und hatten auch uns tief katholisch erzogen. All unser Elend und unsere Not legten wir dem lieben Gott in die fürsorglichen Hände, voller Überzeugung, dass er es gut mit uns meinte und uns aus dieser kalten Finsternis herausführen würde, in ein neues, gelobtes Land, in dem Milch und Honig flossen.
Auch wenn wir kein Haus mehr hatten; so zogen wir noch unsere letzte Kraft aus diesem Lied und unserem tiefen Glauben, bis wir schließlich in der Ferne ein paar fahle kleine Lichter flackern sahen.
»Da, seht ihr! Beten hilft immer!« Unsere Mutter wischte sich mit dem Handrücken verstohlen eine Träne von der Wange. »Dahinten können wir die Nacht verbringen. Es heißt, das Dorf ist leer, so können wir die Leute und das Vieh unterbringen. Danke, lieber Herrgott!«
»Warum ist das Dorf leer?« Jakob lugte unter der Plane hervor. »Wo sind die Leute, die da gewohnt haben?«
»Sie sind schon lange vor den Russen geflohen.« Vater versuchte, seinen einzigen Sohn zu beschwichtigen. »So, runter jetzt von dem Wagen. Die Pferde brauchen Ruhe, und die Lotte wird bald fohlen.«
Mit klammen Händen halfen wir unseren kleinen Geschwistern vom Wagen und reihten uns geduldig in die Schlange der Frierenden ein, die auf ein Quartier warteten und sich dabei feuchten Atem in die eiskalten Hände unter löchrigen Handschuhen bliesen.
»So, hier entlang, fünf Familien in einen Raum, wer seid ihr …?« Ein älterer deutscher Soldat in schwarzem Ledermantel stand mit einem Klemmbrett am Dorfeingang und hakte die Namen ab. »Los, die nächsten dreißig Personen!«
»Die Familie Groß plus die Familien …« Mutter nannte noch vier andere Namen. Die anderen Familien waren weitläufig mit uns verwandt.
»Also los, rein mit euch in den leeren Raum hier, Nächster …«
Wir pferchten uns mitsamt den durchgefrorenen Kindern in einen dunklen, eiskalten Raum, der seit Monaten verlassen war. Ein fauliger modriger Gestank hing zwischen den feuchten Steinen, unter dem Moos raschelte es verdächtig von Ratten und anderem Getier. Fledermäuse stoben aus Ritzen auf und flatterten knapp über unseren Köpfen davon. Vermodertes Holz, kaputte Stühle und ein wackeliger Tisch zeugten davon, dass hier einmal Menschen gelebt hatten.
Wir waren insgesamt neunundzwanzig Personen, davon zwanzig Kinder.
»Mädels, hier ist sogar eine Kochstelle!« Mutter kniete schon vor einem dunklen Feuerloch, und einer der alten Männer warf ein paar alte Holzscheite hinein. »Versorgt ihr die Tiere, die Ställe stehen ebenfalls leer, besorgt Heu und bringt danach Wasser vom Brunnen mit!«
Geschäftiges Treiben setzte ein, und jeder wusste, was er oder sie zu tun hatte. Die Kleinsten wurden auf ihren feuchten Windeln in die Ecke gesetzt, und die Mütter luden die notwendigen Lebensmittel von den Planwagen ab. Katja half Mutter, ich schaute mit Vater nach den Pferden, wischte sie mit Stroh trocken, schleppte Eimer mit Wasser herbei und streute frisches Heu aus.
Als wir gegen Mitternacht endlich auf dem steinernen Fußboden dicht aneinandergepresst saßen und die Kleinen notdürftig versorgt, getrocknet und abgefüttert schliefen, fühlten wir uns zum ersten Mal seit Langem wieder etwas geborgen. Wir hatten seit Wochen kein Dach über dem Kopf gehabt, keine vier Wände um uns herum, und keine Kochstelle. Der Blechnapf mit der heißen Suppe war fast leer, unsere Mägen hatten sich etwas gefüllt, wir hatten uns mit eiskaltem Wasser notdürftig gereinigt.
»Versucht, ein wenig zu schlafen!«
Mutter betete das Nachtgebet.
»Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein, über meinem Bette sein. Hab ich Unrecht heut getan, sieh’s mir, lieber Gott, nicht an …«
Ein Bett war allerdings weit und breit nicht zu sehen. Die Kinder schliefen auf dem nackten Steinboden. Zum Hinlegen war es für uns Größere viel zu eng, aber wir ließen unsere Köpfe an die Schulter des Nachbarn sinken. Die Glut des Feuers war erloschen, gnädige Schwärze umgab uns. Das Getier hatte aufgehört zu rascheln. Auch das Vieh in den Ställen gab keinen Laut mehr von sich, selbst die hoch trächtige Stute Lotte schlief im Stehen. Die Erschöpfung übermannte uns alle, und ich ließ mich in einen unruhigen Schlaf fallen, an die Schulter von Vater gelehnt. Der kalte Atem stand uns allen in gleichmäßigen weißen Rauchwölkchen vor den Gesichtern.
Plötzlich klopfte es ganz stürmisch an der Tür.
Wir zuckten aus dem Schlaf und saßen wie erstarrt, wagten kaum zu atmen.
»Die Russen?!«
»Haben sie uns eingeholt?! Oh Gott, die armen Mädchen! Katja, Lydia, kriecht ganz hinten an die Wand, deckt euch mit Pferdedecken zu!«
»Psst! Wir machen einfach nicht auf!«
Es polterte nun schon viel heftiger. Jemand schlug mit aller Gewalt gegen die Tür. Oder waren es mehrere Fäuste, die da gegen das Holz krachten?
Die Männer, die schon den Ersten Weltkrieg mitgemacht hatten, berieten sich leise flüsternd. »Das sind die Russen, die scheuen vor nichts zurück, auch nicht vor kleinen Kindern.«
Panisch waren Katja und ich auf allen vieren zur Wand gekrochen und hielten den Atem an.
»Weckt die Kinder auf.« Das war Vaters Stimme. »Bevor sie die Tür aufbrechen, macht euch bereit für eine große Gefahr.«
Als die drei Männer schließlich mit zitternden Fingern den Riegel von der Tür geschoben hatten und sie resignierend öffneten, standen da zwei junge Soldaten, mit vermummten Gesichtern und voller Eiszapfen in den Kleidern und an den Haaren.
»Oh Gott, es sind keine Russen!« Erleichtertes Aufseufzen ging durch den Raum. »Es sind Deutsche!«
»Ja, du lieber Himmel, was um alles in der Welt macht ihr denn hier …?« Helfende Hände zogen die beiden fast erfrorenen Gestalten herein. Sie hatten Frostbeulen im Gesicht, ihre Augenbrauen waren voller kleiner Eiskristalle, und konnten sich nicht mehr rühren. Völlig entkräftet fielen sie einfach auf den Steinfußboden. Einige Frauen befreiten sie hilfsbereit von ihren eisgefrorenen Uniformen, die schwer wie Blei auf den kalten Steinfußboden fielen.
»Hier, mach den Rest von der Suppe noch mal heiß!«
»Und das Wasser in der Waschschüssel!«
»Ich hole noch Vorräte vom Wagen!«
»Um Himmels willen, die Füße und Hände, Nase und Ohren sind ja schon abgefroren!«
Eine ältere Frau versuchte, durch Reiben und Blasen den armen Teufeln wieder Leben einzuhauchen, doch sie schrien und wimmerten vor Schmerzen.
»Was ist euch bloß passiert? Seid ihr allein?«
Als die beiden Soldaten etwas zu Kräften gekommen waren und Mutter ihnen Suppe eingeflößt hatte, konnten sie wieder sprechen. Unter Tränen stammelten sie: »Liebe Leute, es sind noch weitere sechs Kameraden da draußen auf dem Feld.«
»Um Gottes willen, bei der arktischen Kälte?«
»Die sind mit ihren Motorrädern nicht mehr weitergekommen, bitte helft ihnen, sonst müssen sie erfrieren!«
»Es ist zwei Uhr in der Nacht!«
»Los, wir holen Verstärkung. In welche Richtung müssen wir?« Die Männer aus unserem Treck waren schon auf den Beinen und in ihren dicken Stiefeln. Sie hämmerten an die anderen Häuser, in denen ahnungslos die anderen Flüchtlinge schliefen. Schließlich eilten sie mit sechs Mann davon, führten die Pferde aus dem Stall und ritten auf das finstere Feld hinaus, um die versprengten Soldaten zu retten. Von innen an das Fenster gelehnt, konnte ich hören, was sie sich in der Nacht zuriefen.
»Die eine Stute ist hoch trächtig, die können wir nicht mehr mitnehmen!«
»Nehmen wir den Hengst und die drei anderen Stuten!«
»Bleibt jemand bei der fohlenden Stute?«
»Schickt Lydia, die kennt sich aus.« Sofort eilte ich gehorsam in den dunklen Stall, während die anderen sich auf die Sättel schwangen und mit klappernden Hufen in der Dunkelheit verschwanden. Lotte trat unruhig wiehernd von einem Huf auf den anderen und schnaubte in der Eiseskälte vor sich hin. Ich sprach beruhigend auf sie ein, hielt ihren Kopf und rieb ihr mit Stroh den zitternden Körper ab. Oh Gott, lass meinen Vater zurückkommen, bevor die Lotte ihr Fohlen bekommt! In meiner Not flüchtete ich mich in die bekannten Gebete, die Mutter uns gelehrt hatte. So überkam mich bald eine zuversichtliche Ruhe, und ich lehnte mit dem Gesicht fast schlafend an dem warmen schwarzen Kopf des Pferdes.
Eine Stunde später kamen die Männer zurückgaloppiert. Jeder hatte einen zu Eis gefrorenen Soldaten vor sich auf dem Pferd festgeschnallt.
»Sie waren hilflos, konnten nicht mehr laufen, sie waren auf ihren Motorrädern im Eis festgefroren!«
»Die Motorräder sahen aus wie Eisklötze! Die konnten wir nicht mehr bergen!«
»Die holen wir morgen, damit die Russen keine Spuren finden!«
»Schnell, die Soldaten haben Frostbeulen im Gesicht, und ihre Gliedmaßen frieren ihnen ab!«
Inzwischen lag über einen halben Meter Schnee, und das in der Nacht zum ersten Mai!
Ich rieb mir verschlafen die Augen und stiefelte hinüber in das Gehöft, um mich nützlich zu machen, während Vater nach der Stute schaute. »Gut gemacht, Lydia. Deine Ruhe ist auf sie übergegangen.« In aller Eile tätschelte er mir die Schulter.
Wieder halfen alle Frauen, die armen Kerle aus ihren Sachen zu schälen, Mutter und Katja hatten Wasser in Schüsseln heiß gemacht, und unter großen Schmerzensschreien wurden die schon schwarz gefrorenen Stellen an Händen und Füßen warm gerieben und verbunden. Auch diesen armen jungen Männern wurde Suppe eingeflößt, und sie weinten vor Dankbarkeit und Erleichterung.
»Ihr seid für uns die rettenden Engel, wir wären sonst bei lebendigem Leibe an unseren Motorrädern festgefroren!«
»Lydia, kommst du, es ist so weit!«
Vater klopfte von außen an das Fenster. Aus dem benachbarten Stall ertönten schon die typischen nervösen Geräusche der fohlenden Stute. Sie schnaufte und stampfte und wieherte in den höchsten Tönen. Ich eilte hinüber durch den hüfthohen Schnee und half Vater, der mit geübten Griffen das Fohlen herauszog, indem ich Lotte die Hinterbeine zusammenband und ihren Schwanz festhielt, mit dem sie wild um sich schlug.
Beruhigend redete ich auf die vor Schweiß und Anstrengung zitternde Stute ein. »Brav, Lotte, das machst du ganz brav, bald ist es geschafft …«
Und wieder halfen meine Gebete.
»Es ist ein wunderschöner kleiner Hengst!« Vater stellte das zitternde Tierchen auf die Beine, und ich begann sofort, es mit Stroh abzureiben.
»Schau mal, Vater, er hat vier weiße Socken an und einen weißen Stern auf der Stirn!« Ganz verzückt starrte ich auf das kleine Wunder, das sich trotz der Kälte und des Elends einen Weg ins Leben gebahnt hatte. »Und sein Fell ist dunkelbraun, genau wie das seiner Mutter. Wie sollen wir den kleinen Hengst nennen?«
»Das spielt jetzt keine Rolle mehr, Lydia.«
Die Stute hatte sich bereits wieder aufgerichtet und versuchte, das Fohlen sauber zu lecken.
»Aber er ist so süß, schau doch nur, wie er sich freut!«
»Es hat trotzdem keinen Zweck. – Geh hinein, Lydia.«
»Was meinst du, Vater?«
»Ich muss es erschießen.«
»Oh bitte, lass es noch am Leben, Vater!« Den warmen Atem des dankbaren kleinen Tierchens und der Stute an meinen Händen, konnte ich nicht begreifen, was geschehen sollte. Flehentlich blickte ich ihn an. »Wie kannst du das übers Herz bringen!«
»Es muss sein, Lydia.« Vater griff schon nach seinem Gewehr. »Es kann die weite Reise nicht mitmachen, das weißt du doch. Geh hinein und hilf Mutter mit den Kindern.«
Schluchzend rannte ich hinüber in das Gehöft, das inzwischen unter strahlendem Himmel im prächtig glitzernden Schnee stand. Aus dem Schornstein stieg Rauch, es wirkte wie ein heimeliges unschuldiges Haus aus einem Wintermärchen.
Geschäftig schob Mutter mir die Waschschüssel hin, mit der sie gerade die drei Kleinen gewaschen hatte. »Wasch dir die Hände, Lydia.«
Und dann ertönte schon ein Schuss. Ich hielt den Atem an. Das unschuldige kleine Fohlen!
Doch zum Trauern blieb keine Zeit.
»Lydia, eil dich, wir wollen Brot backen. Die Soldaten haben auch Hunger.«
Die halb erfrorenen Männer lagen noch stöhnend und fiebernd in den Ecken, von den Kindern mit schreckgeweiteten Augen beäugt.
»Wie heißt du?« Mein Bruder Jakob war neugierig zu einem von ihnen gelaufen und bestaunte fasziniert dessen schwarz gefrorene Gliedmaßen.
»Ich bin Franz aus München. Und du?«
»Jakob Groß. Ich bin sieben. Und groß und stark, wie du siehst.« Er reckte sein kleines Ärmchen und machte eine Faust.
»Das ist mein Freund Ludwig. Aus Hamburg. Der ist achtzehn.«
»Meine Schwester Katja ist neunzehn, Lydia ist sechzehn, meine Schwester Klementine ist neun, und meine kleine Schwester Frederike ist viereinhalb.«
»Da bist du ja der einzige Junge unter deinen Geschwistern. Du musst gut auf deine Schwestern aufpassen.« Franz schenkte Katja und mir einen dankbaren Blick.
Jakob schaute verlegen drein, wuchs aber vor Stolz ein paar Zentimeter. »Ich hatte mal einen neun Jahre älteren und einen fünf Jahre älteren Bruder, und dazu noch eine sieben Jahre ältere Schwester, aber die sind alle verhungert. Wir schließen unsere toten Geschwister aber jeden Tag in unsere Gebete ein.«
Der Soldat schluckte schwer, und Mutter wischte sich verstohlen über die Augen. »Komm, Jakob, lass den Mann in Ruhe, hilf mir lieber, Mehl zu mahlen. Du hantierst doch so gern mit der Kaffeemühle, komm her.« Sie reichte dem Jungen das braune Mahlgerät, und Jakob drehte eifrig an der Kurbel. Denn er war ja der einzige Bub in der Familie, und sein Name war Programm.
Es hämmerte an die Tür. Wieder zuckten alle zusammen, in der Angst, es könnten Russen sein. Hatten sie die Motorräder schon gefunden? Vom Flugzeug aus konnte man die bestimmt gut sehen, wenn sie im Schnee blitzten.
Es war aber unser Treckbegleiter, ein hoher Offizier der Wehrmacht, der hier das Sagen hatte. In seinem schwarzen Ledermantel stiefelte er herein und sah sich prüfend um.
»Folgende Anordnung ergeht: Die sechs desertierten Soldaten haben sich beim medizinischen Personal zu melden. Wenn sie wirklich kampfuntauglich sind, können sie mit unserem Treck mitfahren. Jeder wird einem anderen Wagen zugeteilt. Sie …« Er zeigte auf Franz aus München. »… fahren auf dem Wagen der Familie Groß. Der andere …« Er wies auf Ludwig aus Hamburg. »… fährt auf einem anderen Wagen mit. Kommen Sie mit.«
»Ich kann nicht gehen, Herr Major!« Der arme Ludwig fing an zu weinen wie ein Kind. »Bitte lassen Sie mich mit meinem Freund Franz zusammen.«
»Heulen Sie hier nicht rum! Ein deutscher Soldat heult nicht! Schlimm genug, dass Sie desertiert sind, Mann!«
Der Arzt und die Sanitäter stellten schwere Erfrierungen bei den Soldaten fest, und es erging der Beschluss, dass wir einige Tage in diesem verlassenen Dorf bleiben würden, bis sie transportfähig sein würden. Jetzt weinte ich doch um unser kleines Fohlen. Es hätte noch einige Tage am Leben bleiben können!
Bessarabien, heutige Republik Moldau
5. Mai 1944
Schließlich setzte sich der kilometerlange Flüchtlingstreck wieder in Bewegung; Franz aus München durfte bei uns auf dem Wagen mitfahren, während Katja und ich wie gehabt laufen mussten. Auch für Mutter und die neunjährige Klementine war nun kein Platz mehr auf dem Wagen. Mutter zog stoisch das müde Kind hinter sich her, sang ihr Lieder vor oder betete mit ihr. So zogen wir Tag für Tag weiter, ergeben wie die alten müden Klepper, einem unbekannten Ziel entgegen, Richtung Westen. Wir waren Tausende von Flüchtlingen, ein Wagen reihte sich an den nächsten, und die öde Steppe dehnte sich zur endlosen Hölle. Weit und breit kein Baum und kein Strauch, nichts blühte oder spross, und kein Vögelchen war zu hören. Wir hätten auch auf dem Mond unterwegs sein können.
Immer wieder kam der junge Soldat Ludwig auf seinen Stock gestützt angehumpelt und fragte weinend, ob er nicht doch bei seinem Kameraden Franz mitfahren könnte. Er hatte so Heimweh, und die Leute, denen er zugeteilt worden war, waren nicht nett zu ihm. So rückten wir noch enger zusammen und ließen auch den Ludwig auf unseren Wagen.
Die beiden verletzten Soldaten fuhren einen ganzen Monat mit uns, bis in die Tschechei. Oft waren wir hungrig, müde und schlapp und konnten einfach nicht mehr. Doch wir teilten unser weniges Essen mit den verwundeten Soldaten.
»Katja, ich habe solche Bauchschmerzen!« Schmerzgepeinigt schleppte ich mich weiter. Es waren nicht nur die bekannten Krämpfe, die ich von der Hungersnot als Kind kannte. Es zog sich tiefer diesmal, und zu meinem grenzenlosen Entsetzen lief mir seit Tagen Blut an den Beinen herunter. Panisch hatte ich mich schon heimlich untersucht, wo ich mich verletzt haben könnte, aber es kam direkt aus … nein, das konnte ich nicht aussprechen. Es kam zwischen meinen Beinen heraus! Ich war dabei, innerlich zu verbluten!
»Ist es Hunger, oder bekommst du …« Verstohlen zog meine Schwester mich zur Seite.
»Katja, ich glaube, ich muss sterben! Das kann ich doch den Eltern nicht antun, sie brauchen mich doch …« Schluchzend hielt ich mich an ihrer Schulter fest.
»Nimm dies hier und stopf es dir in den Schlüpfer.« Katja zerrte einen dunklen Stofffetzen aus ihrem Rucksack. »Das brauche ich aber wieder, hörst du? Du musst es jeden Abend auswaschen und auf die Leine hängen! Hier hast du noch ein zweites, zum Wechseln.«
»Wann hört das auf?«
»Bald. Aber es kommt wieder. Ungefähr alle vier Wochen. Das hat der liebe Gott sich so für uns Frauen ausgedacht.«
»Ich kann nicht mehr, Katja! Nicht auch noch das! Warum tut der liebe Gott uns das an?«
»Du musst, Lydia! Reiß dich zusammen, denk doch nur an unsere arme Mutter, was würde sie mit den drei Kleinen ohne uns machen? – Und die hat das auch, stell dir vor. Nur wenn sie schwanger ist, hat sie das nicht. Jede Frau hat das. Also stell dich nicht so an.«
Und so biss ich die Zähne zusammen und setzte weiter einen Fuß vor den anderen, oft bis zu dreißig Kilometer am Tag, wenn kein geeigneter Platz gefunden wurde, bis in die dunkle Nacht hinein. Die Angst vor den Russen, die uns auf den Fersen waren, trieb uns weiter. Wir hörten die schlimmsten Geschichten, was sie mit den Frauen machen würden, egal wie alt, egal ob schwanger, egal ob sie kleine Kinder hatten. Auch wir, Katja und ich, würden von ihren Grausamkeiten nicht verschont werden! Und mein Schmerz in einer gewissen Körperregion gab mir schon eine Vorstellung davon! Schlimmer konnte es kaum noch werden, oder?
Abends hielt der Treck meistens an einem Fluss oder See, dann wurde das Vieh getränkt und gefüttert. Vater kümmerte sich um die vielen Witwen und Waisen, die der monatelangen Flucht noch hilfloser ausgeliefert waren als wir.
»Mädchen, helft mir, Brennholz zu sammeln.« Unsere Mutter war schon von der Kutsche geklettert und hantierte mit unserem kleinen Blechtopf, indem sie auf ebener Erde damit eine Kuhle aushob. »Na los, beeilt euch, es gibt genügend Tannenzapfen und trockene Sträucher im Wald! Die Kleinen weinen schon wieder vor Hunger!«
Mit dem gemahlenen Mehl und der Milch unserer einzigen Kuh, die wir noch hinter uns herzogen, bereitete sie den üblichen pappigen Brei.
Als das Essen fertig war, schmeckte es wie so oft nach Rauch, aber wir hatten wenigstens etwas Warmes im Bauch. Es gab keinen Stuhl, keinen Tisch, kein Licht, wir hockten völlig erschöpft und verdreckt am Boden und aßen alle mit je einem Löffel aus demselben Topf, unsere sechsköpfige Familie und die beiden Soldaten Franz und Ludwig, die nach und nach zu Kräften kamen und auch versuchten, uns ein wenig zu unterstützen. Im Notfall, so hofften wir, würden sie uns Mädchen auch beschützen. Die Wagen standen alle ganz dicht aneinander, die einzige Lichtquelle waren die kleinen Feuer an den Kochstellen.
»So, Kinder, macht das Feuer aus, nicht dass die Russen unseren Treck aus der Luft entdecken.« Mutter rappelte sich auf, wusch die Kleinen mit dem Wasser aus der Schüssel, scheuchte sie in den Wagen und deckte sie mit den Militärmänteln der beiden Soldaten zu. Katja und ich hängten im Dunkeln die Wäsche über die Räder, wobei mir mein blutiger Stofffetzen so peinlich war, dass ich ihn unter dem Wagen versteckte. Franz und Ludwig tränkten und striegelten derweil die Pferde. Um Mitternacht etwa krochen auch wir auf den Wagen, und nachdem die beiden Männer, die tagsüber auf dem Kutschbock saßen, Vater und der alte Großonkel, auch noch darin Platz finden mussten, waren wir elf Personen, die sich unter der Plane aneinanderdrängten. Liegen konnten nur die Kleinen, wir anderen saßen Schulter an Schulter auf den Holzplanken und versuchten, im Sitzen zu schlafen.
Doch mitten in der Nacht rumorte es plötzlich in dem Wagen, der dicht vor uns stand.
»Es geht los. Else hat ihre Wehen.«
Diesmal handelte es sich nicht um eine Stute, sondern um eine Frau.
Nach und nach wurden die schlaftrunkenen Kinder aus dem Wagen gereicht, unser Vater scheuchte uns aus unserer Kutsche: »Los, wacht auf, die Kleinen müssen auch noch hier rein. Der Wagen vor uns wird kurzerhand zu einem Krankenhaus umfunktioniert!«
Franz und Ludwig, Katja und ich, der Großonkel und Vater standen für den Rest der Nacht draußen neben unserer Kutsche, während Mutter der Nachbarin beim Entbinden half. Die Stunden zogen sich endlos hin. Die qualvollen Schreie der Frau und schließlich die kläglichen Schreie des Neugeborenen durchschnitten die Nacht.
Auf dem Treck Richtung Polen
Mai 1944
So, Leute! Alles anhalten! In einer Reihe aufstellen, ab hier geht nichts mehr weiter!«
Die berittenen Treckbegleiter scheuchten uns auf einen riesigen leeren Platz. »Dichter zusammen, nicht so viel Abstand, das ist Platzverschwendung! Da geht noch was! Noch dichter hier! Da kommen noch Hunderttausende!«
Enger und enger rangierten wir die Wagen aneinander. Mein Gott, war das ein Gedränge und ein Geschrei, die vielen Menschen und Tiere, sodass man kaum einen Platz für eine Gasse zum Laufen fand. Immerhin war es inzwischen sonnig und warm, und in dieser Gegend gab es auch Bäume und Sträucher. Doch wir hatten keine Zeit, um uns an ihnen zu erfreuen.
»Ab hier geht es mit dem Zug weiter!«
»Was, wohin? Was wird aus unseren Pferden und Kühen? Werden die auch verladen?«
»Alle Tiere samt Wagen müssen dem Militär abgegeben werden!«, knarrte es durch Lautsprecher. »Das Kriegsmaterial wird beschlagnahmt!«
Völlig erschöpft saßen wir auf dem sandigen Erdboden. »Da haben wir uns über tausend Kilometer mit unserer Karawane hierher gekämpft, um noch doch unsere Tiere und Kutschen abgeben zu müssen?«
»Seid ihr taub? Wagen und Pferde sind ab sofort im Dienst des deutschen Vaterlandes für unsere Soldaten bestimmt! Wer zuwiderhandelt, wird erschossen!«
Wehrmachtsoffiziere brüllten in ihre Megafone, und Soldaten marschierten mit eisernen Mienen durch unsere armseligen Reihen, um die Pferde auszuspannen und die Kühe wegzuführen.
»Aber das ist unsere einzige Kuh!« Mutter wurde der Melkschemel unter dem Hintern weggetreten, und sie kippte mitsamt ihrem Melkeimer in den Staub. »Womit soll ich meine Kinder ernähren?«
»Für euch wird gesorgt werden. Der Führer hat alles im Griff!« Der Soldat zerrte unsere alte Kuh weg, die stoisch mit ihrem Schwanz die Fliegen zu verscheuchen versuchte. Überall das gleiche Bild: Verzweifelte Familien, zermürbt und verdreckt, rangen flehentlich die Hände und versuchten, mit den Soldaten zu diskutieren.
Mit mahlenden Kiefern half Vater unserer Mutter wieder auf die Beine, die geistesgegenwärtig den Eimer mit unserer letzten Milch vor dem Umfallen gerettet hatte.
»Los jetzt, Abmarsch, zum Bahnhof! In einer Reihe aufstellen!«
In letzter Eile zogen wir an Habseligkeiten und Gepäck, was wir noch zu greifen bekamen, denn in diesem Moment wurden auch schon unsere Pferde samt Kutschen weggeführt. Die Peitschen knallten auf müde Pferderücken, wiehernd versuchten sich die treuen Tiere zu sträuben, manche gingen auf die Hinterhufe und fielen auf die Wagen, die sie zogen.
»Weiter! Weitermachen!« Schüsse knallten in die Luft, Pferde gingen zu Boden.
»Ach Gott, das ist alles so schade …« Mutter rang die Hände zum Himmel. »Unser ganzes Geschirr, die Mehlsäcke, die Kartoffeln, unser ganzer fahrbarer Haushalt, was bleibt uns denn jetzt noch?«
Mutter ließ jedes Kind noch schnell in der Eile aus dem Eimer trinken, sodass die gute Milch noch in unseren Mägen ankam. Das meiste landete auf dem staubigen Boden oder auf unseren ohnehin schon völlig verdreckten Kleidern.
»Abmarsch, los!« Ein dicker rotgesichtiger Soldat blies in seine Trillerpfeife, und der müde Zug setzte sich schlappfolgsam in Bewegung. Katja zerrte den weinenden Jakob hinter sich her, ich hatte Klementine an die Hand genommen. Vater stützte Mutter, die noch die kleine Frederike hinter sich herzog. Der alte Großonkel humpelte mit seinem Stock nach. Franz und Ludwig waren sofort wieder zum Dienst an der Front abkommandiert worden.
»Ihr habt hier lange genug Campingurlaub gemacht!« Sie konnten sich noch nicht mal mehr von uns verabschieden. Deshalb war Jakob auch in Tränen ausgebrochen, hatte er doch die beiden Soldaten in sein Herz geschlossen! Und wir Mädchen hatten uns beschützt gefühlt! In meinen heimlichen Träumen hatte ich mich sogar ein bisschen in Franz verguckt, und heimlich schon Katja und Ludwig als glückliches Paar gesehen.
»Dafür dürft ihr jetzt Zug fahren! Jetzt kann doch alles nur noch besser werden!« Katja versetzte den Kleinen einen aufmunternden Klaps. »Das Schlimmste haben wir hinter uns! Ihr müsst nicht mehr laufen, na, wie hört sich das an?«
In endlosen Reihen marschierten wir zum Bahnhof, mit Sack und Pack. Alles, was wir irgendwie tragen konnten, schleppten wir in Säcken mit uns. Sogar die Kleinen zogen noch ein Bündel hinter sich her. Dennoch fühlte ich mich plötzlich komplett ausgeliefert, unseres fahrbaren Untersatzes mit den gewohnten Gegenständen und Essensvorräten beraubt. Welche fremden Soldaten würden jetzt in unseren Decken schlafen, aus unseren Kartoffel- und Mehlvorräten essen, unsere Waschschüssel benutzen und sich mit unseren zwei alten müden Kleppern an die Front durchschlagen? Das war ein befremdliches Gefühl! Immer und immer wieder sah ich mich nach unserer Kutsche und den Pferden um, die bereits im Gewühl und Chaos in einer Staubwolke verschwunden waren.
»Kommt weiter, Kinder, nicht trödeln!«
Die Eltern schoben uns an den Schultern weiter. »Schneller, lasst euch nicht überholen, sonst werden wir auseinandergedrängt! Wir müssen unbedingt zusammenbleiben, hört ihr? Das ist das oberste Gebot!«
»Unbedingt zusammenbleiben«, echoten wir. Das würde noch unsere Lebensparole werden.
Unbedingt zusammenbleiben. Koste es, was es wolle. Einer für alle, alle für einen.
»In Viererreihen auf dem Bahnsteig aufstellen, jeder Waggon ist mit je fünfzig Personen zu besetzen!«
Der Lautsprecher schepperte uns knarrend seine Befehle entgegen, in endlosen Wiederholungen. Die Menge schob sich irritiert über den langen Bahnsteig. Es war eine Viehverladestation, kein richtiger Bahnhof.
»Das sind ja nur Viehwaggons!« Unserem Jakob stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
»Mit einem Personenzug konnte man wirklich nicht mehr dienen.« Ein Begleitoffizier drängte uns ganz ans Ende des Zuges. »Dahinten passen noch mindestens zehn Leute rein! Also los! Beeilung!«
»Zusammenbleiben! Unbedingt zusammenbleiben!«
Wir hielten uns krampfhaft an den Händen und krabbelten mithilfe helfender Hände in den Viehwaggon. »Geschafft. Alle da? Sind wir vollzählig? Jeder ist für sein jüngeres Geschwister verantwortlich!«
»Ja, Vater. Alle da.«
Noch ehe wir es ganz begreifen konnten, setzte sich der Zug quietschend in Bewegung. Wir standen dicht gedrängt mit anderen Familien in einem von außen verschlossenen Wagen, ohne Fenster, ohne Bänke. Mutter war ermattet auf eine alte Gemüsekiste gesunken, die jemand hier vergessen hatte. Ob Mutter gerade auch solche schrecklichen Krämpfe hatte und ihr das Blut von den Beinen rann? Sie sah so aus, als hätte sie gerade diese schrecklichen Tage. Ihr Gesicht war grau, ihre Augen lagen in tiefen Höhlen, und ihre Kieferknochen standen hervor. Ihr früher so schönes schwarzes Haar lag in grauen Strähnen um ihr kantiges Gesicht.
»Wohin fahren wir denn?« Mit bangen großen Augen sah Klementine unsere Eltern an.
»Das weiß nur der liebe Gott.« Vater schob sich die Mütze in den Nacken und wischte sich über die Stirn. Sein Gesicht war übersät von weißen Bartstoppeln, die aussahen wie viele kleine Läuse, und sein Hemdkragen starrte vor Dreck und Schweiß.
»Kinder, wir sollten beten.« Mutter hatte die beiden Kleinen auf ihren Schoß gezogen und begann mit dem freudenreichen Rosenkranz: »Heilige Maria, Mutter Gottes, den du, oh Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast …« Wir Kinder fielen Trost suchend ein: »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, amen.«
Mutter betete vor, einen Vers nach dem anderen, und wir murmelten den Refrain.
»… den du, oh Schmerzensreiche, im Tempel wiedergefunden hast …«
Wir lehnten an der wackelnden Eisenwand des Güterzuges und beteten andächtig mit. Das stundenlange Beten gab uns Halt und Sicherheit. Ein Vers folgte sicher auf den nächsten, und unser inneres Chaos wich einer inneren Ruhe.
So fuhren wir mehrere Tage dahin. Zwischendurch wurde auf freier Strecke angehalten, manchmal war Fliegeralarm, dann mussten wir uns unter dem Zug in Sicherheit bringen.
Manchmal standen auch Rote-Kreuz-Helferinnen an einem Bahnhof mit Decken und Suppenkesseln bereit, da konnten wir auch unsere Notdurft verrichten und uns etwas frisch machen. Oft hielt der Zug einfach auf freier Strecke, und wir schlugen uns rechts und links der Bahngleise in die Büsche. Nach einigen Tagen sahen wir alle aus wie lebendige Vogelscheuchen und stanken erbärmlich.
Endlich hielt der Zug quietschend auf einem Bahnhof, die Lok stieß fauchend Dampf aus, und dann knarrte es in den Lautsprechern: »Litzmannstadt, Polen. Alles zügig aussteigen, Papiere bereithalten, registrieren lassen!« Der Rest wurde auf Polnisch durchgesagt.
Mit eingerosteten Gliedern schälten wir uns aus dem Güterwaggon und nahmen die drei Kleinen samt den verbliebenen Bündeln entgegen. Alle Gesichter waren grau und leer, die Augen lagen in tiefen schwarzen Höhlen. So richtig geschlafen hatte keiner von uns, und der Hunger zerrte an unseren Mägen. Ich fühlte mich von innen ausgehöhlt, geschwächt und unendlich erschöpft. Aber wem von uns ging es nicht so? Tapfer biss ich die Zähne zusammen, wie wir es nicht anders gelernt hatten.
Vor dem Bahnhofsgebäude hatten sich bereits lange Schlangen gebildet, und geduldig wie die Schafe reihten wir uns ein. Im Zeitlupentempo schleppten wir uns Schritt für Schritt weiter, unsere Lumpenbündel mit den Füßen vor uns herschiebend, bis wir ins Innere des hässlichen grauen Gebäudes gelangt waren. Hier saßen uniformierte Männer und Frauen in polnischen Uniformen an langen Holztischen und verlangten mit ungeduldigen Handbewegungen die Papiere zu sehen. Vater beeilte sich, alle Ausweise bereitzuhalten.
Sie stellten ein paar unwirsche Fragen, die von einem Dolmetscher übersetzt wurden. Mit unfreundlichen Mienen knallten sie Stempel in unsere Dokumente und ließen uns außerhalb des Bahnhofsgebäudes wieder in Gruppen sammeln.
»Setzt euch in Marsch, immer zweihundert Leute in einer Gruppe!«
Weit und breit waren keine Gefährte zu sehen, die uns weitertransportiert hätten. Alle fahrbaren Untersätze waren für Kriegseinsätze beschlagnahmt worden.
»Vorwärts, Leute! Gesessen habt ihr jetzt lange genug!« Polnische Soldaten trieben uns zur Eile an.
»Sind wir jetzt in Polen eingebürgert?« Scheu stieß ich Katja in die Rippen, die an meiner Seite ging. »Wohnen wir jetzt hier?«
»Weiß ich doch nicht, Lydia! Einfach weitergehen!«
Ergeben trabten wir in dem langen Fußgängerzug mit, tagelang ins Landesinnere, vorbei an zerstörten Dörfern, verlassenen Städten und endlosen Feldern. Es war inzwischen Ende Mai, und die Sonne schien erbarmungslos auf uns herab.
»Hör nur, Katja, wie schön die Vögel singen!«
»Ja, die Glücklichen. Die haben immer noch nicht gemerkt, dass Krieg ist.«
Um den Kleinen das Gehen zu erleichtern, sangen wir Frühlingslieder mit ihnen. »Im Frühtau zu Berge, wir ziehn, fallera …«
Endlich war am Horizont eine Stadt zu erkennen. »Gehen wir dahin?« Klementine und Frederike schauten uns hoffnungsvoll an, während sie kaum noch ihre Füße heben konnten.