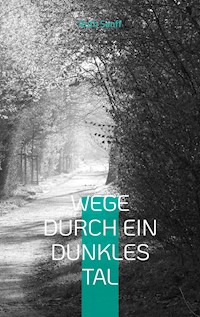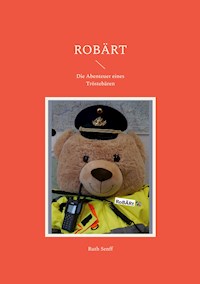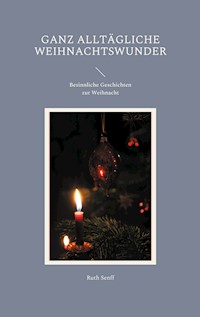Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten voller Mut, voller Hoffnung. Erzählungen, die Mut machen für den nächsten Schritt
Das E-Book Und im Rückspiegel das Licht wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Hoffnung, Mut, Schritt, Wege, jetzt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ina, Udo, Kerstin und Uwe… Für all diejenigen, die Hoffnung haben und auf Wünsche vertrauen! Mögen sie in Erfüllung gehen!
Inhaltsverzeichnis:
Besuch zur rechten Zeit
Das Wiedersehen
Der Bücherschatz
Ein letzter Gruß
Grüße in die Todeszelle
Gruß aus der Vergangenheit
Heimkehr
Jetzt erst Recht
Kuchen der Hoffnung
Im Rückspiegel die Morgenröte
Der Wunsch eines Vaters
Besuch zur rechten Zeit
Mit großen, kräftigen Schritten bahnte sich der Mann einen Weg durch die Ausläufer der Fußgängerzone. Es war kurz vor Weihnachten. Viele Menschen waren um diese Zeit auf den Beinen, um letzte Weihnachtsgeschenke, Geschenkpapier, Süßigkeiten und Naschereien zu besorgen. Er kam von einem Trauergespräch, die Beerdigung würde am Tag nach Weihnachten stattfinden. Er war tief in Gedanken; teilweise beschäftigte ihn das gerade geführte Gespräch: Im Geist formulierte er bereits die Predigt für die anstehende Beisetzung. Dann wieder sprang er in Gedanken zu Weihnachten: Zu den Feiertagsgottesdiensten, die er halten musste; zu der letzte Probe mit den Kindern des Kindergottesdienstes für das Krippenspiel am Heiligen Abend; zu der letzte Chorprobe für die Christmette; zu dem Besuch am Heiligabend im Altenheim, den Abstecher, den er am zweiten Feiertag zur Weihnachtsfeier der Senioren machen wollte; aber auch zu der Bescherung für seine Kinder zuhause, dem Essen mit den Schwiegereltern, dem Besuch bei seinen Eltern am ersten Weihnachtstag. Er hatte keine Ruhe, keinen Sinn dafür, die weihnachtlichen Auslagen in den Geschäften zu betrachten. Er spürte, dass er genervt war von den Strömen an Passanten, die sich aufmachten in Richtung der Geschäfte, die einander fast zu schieben schienen, überholten, sich anrempelten. Seine Gedanken wanderten weiter: Wann war aus dem magischen, wunderbaren Fest seiner Kindheit eigentlich ein stressreiches Event geworden? Wann hatte Weihnachten auch für ihn, den Pfarrer, aufgehört, das besondere Highlight des Jahres zu sein?
In einer Wohnung am Rande der Fußgängerzone stand ein Mann am Fenster und schaute geistesabwesend auf die weihnachtliche Lichterdekoration, bei der sich Sterne von einer Straßenseite auf die andere zogen. In der Mitte des kleinen Platzes, an dem er wohnte, stand ein Weihnachtsbaum, der geschmückt war mit großen, roten Schleifen und einer Lichterkette, die an echte Kerzen erinnern sollte. Er sah das kleine Kind, das mit seiner Mutter ehrfürchtig den Baum betrachtete und voller Vorfreude an der Hand der Mutter auf- und absprang. Er betrachtete die Menschen, die teils lachend und scherzend, teils mit gehetztem Blick in die Fußgängerzone gingen oder bereits, beladen mit Tüten und Taschen, in Richtung ihrer Autos oder ihres Zuhauses liefen. In der Hand hielt er einen Gürtel, den er gedankenverloren in seinen Händen drehte. Weihnachten. Weihnachten konnte ihm gestohlen bleiben. Er hatte noch nie etwas mit diesem Fest anfangen können. Er hatte noch nie verstanden, was für ein Aufhebens um zwei freie Tage gemacht wurde. Ihn verbanden auch keine sentimentalen oder nostalgischen Erinnerungen mit diesem Fest – das Fest der Liebe, das hatte schon in seiner Kindheit keine große Rolle gespielt. Betrunken waren die Eltern an jedem Tag gewesen, da hatte Weihnachten keine Ausnahme dargestellt. Und jetzt? Jetzt hatte Weihnachten das letzte bisschen Bedeutung, das es für ihn noch gehabt haben mochte, verloren. Weihnachten war für ihn gestorben. Und bald, heute, würde auch er sterben und diese unschöne, kalte Welt verlassen. Er hatte alles geplant. Der Gürtel würde ihm den Weg aus diesem freudlosen Dasein ebnen.
Der Pfarrer hielt inne. Auf dem kleinen Platz, den er gerade überquerte, stand ein Weihnachtsbaum. Große rote Schleifen aus Plastik schmückten den Baum. Er schaute sich um. Gerade war ihm gewesen, als ob ihn etwas oder jemand aus seinen Gedanken gerissen und zum Innehalten gerufen hätte. Er schaute sich um. Er sah eine Mutter, die ein hüpfendes Kind an der Hand hielt und versuchte, es möglichst unversehrt durch die Menschenmenge zu führen. Er sah ein altes Ehepaar, das beschwerlich und langsam, Hand in Hand in Richtung des Stadtzentrums gingen. Am anderen Ende des Platzes sah er eine Bäckerei. Vielleicht sollte er tatsächlich innehalten, sich einen Kaffee gönnen, durchatmen, bevor er sich dem weihnachtlichen Stress und den anstehenden Aufgaben widmete. Er betrachtete den Weihnachtsbaum. Wann hatte man als Erwachsener den Blick für das Magische, Aufregende von Weihnachten verloren? Langsam ging er in den Bäckerladen und bestellte sich einen Milchkaffee.
Ob Sterben weh tat? Ob man spürte, wenn man starb? Der Mann am Fenster seufzte. Egal, es würde nicht lange dauern, dann wäre es vorbei. Dann wären die immerwährenden Demütigungen vorbei: Seit Monaten suchte er eine neue Arbeitsstelle, wurde jedoch immer abgewiesen. Er hatte keinen Schulabschluss, hatte immer nur Hilfsarbeiterjobs übernommen. Er war nicht dumm, er war geschickt mit den Händen, er war fleißig. Aber es fehlte ihm das Papier, das genau dies dem neuen Arbeitgeber versichern würde. Seine Sachbearbeiterin im Jobcenter schickte ihn von einem Vorstellungsgespräch zum anderen; er ging hin, motiviert, voller Hoffnung, nur um am Ende doch wieder eine Absage zu erhalten. Seine Hände krampften sich um den Gürtel, die Knöchel seiner rechten Hand traten weiß hervor. Nein, er würde dann sein Kind nicht weiter aufwachsen sehen. Er lachte verbittert auf. Einmal hatte er seinen Sohn gesehen, seitdem seine Frau mit dem gemeinsamen Kind ausgezogen war. Sie hatte einen neuen Freund, einen, der einen guten Job bei der Müllabfuhr hatte, gutes Geld verdiente, nicht auf das Geld vom Amt angewiesen war. Er war ihr nicht mehr gut genug gewesen; und jetzt sorgte sie dafür, dass er auch seinen Sohn nicht mehr sah.
„Die weite Fahrt, du weißt schon, das klappt nach der Schule nicht.“
„Am Wochenende gehen wir alle zusammen ins Schwimmbad/ zum Eislaufen/ in den Zoo, da passt es leider nicht.“
Seit Monaten hörte er diese Ausreden, seit Monaten bettelte er vergeblich, sein Kind wenigstens für ein paar Stunden zu sehen. In den letzten Wochen hatte die Kindesmutter noch nicht einmal mehr auf seine Nachrichten und Anrufe reagiert. Das einzige, was er von ihr gehört hatte, war, dass sie das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn beantragt hatte. Der Gerichtstermin stand im neuen Jahr an. Nun gut, sie würde darum nicht mehr kämpfen müssen; ab heute Abend würde sie automatisch das alleinige Sorgerecht haben. Hoffentlich war sie dann glücklich.
Nein, es gab nichts mehr, das ihn hier am Leben hielt. Zigaretten und Bier waren in den letzten Wochen seine konstanten Begleiter gewesen. Doch dies war kein Leben, für das es sich zu leben lohnte. Nein, heute wäre Schluss damit.
Wieder hatte der Pfarrer das Gefühl, als würde ihn jemand rufen, ansprechen, ihn aus seinen Gedanken reißen. Suchend blickte er sich um. Außer ein paar Rentnern und einer jungen Mutter mit einem Kind im Kinderwagen, war niemand in dem Café. Die Rentner waren emsig ins Gespräch vertieft, die junge Mutter schaukelte den Kinderwagen, während sie ihren Kaffee trank und angestrengt auf ihr Smartphone schaute. Hatte er vielleicht einen Termin vergessen? War es das, was ihn unruhig machte? Er zog seinen Terminkalender aus der Innentasche seines Sakkos. Nein, das Trauergespräch hatte er hinter sich; das nächste, was anstand, war heute Nachmittag die Probe mit den Kindern des Kindergottesdienstes. „Du bist überarbeitet“, dachte er sich. „Es wird Zeit, dass die Weihnachtszeit vorbei ist und wieder Ruhe einkehrt.“ Er nahm einen Schluck Kaffee, öffnete dann ein Tütchen mit Zucker und ließ diesen langsam in die Tasse rieseln. Seine Kinder würde er jetzt ermahnen, nicht mit Lebensmitteln zu spielen. Er seufzte und rührte langsam seinen Kaffee um.
Der Mann wandte sich vom Fenster ab. Mit festem und entschlossenen Schritt, den Gürtel noch immer fest in der rechten Hand, ging er in die Küche und nahm einen der Stühle, die um den Esstisch standen. Er hielt inne und schaute sich in der Küche um. Der Wasserkocher war aus, der Herd sowieso, denn er hatte sich seit Wochen nichts mehr zum Essen gekocht. Lebensmittel hatte er auch so gut wie keine mehr im Kühlschrank. Es würde also nicht so schnell anfangen zu stinken, je nachdem, wann sie ihn finden würden. Er nahm den Stuhl und trug ihn ins Wohnzimmer. Auch dort blickte er sich um. Sein Blick blieb an den Fotos hängen, die an der Wand über dem alten, durchgesessenen Sofa hingen. Erinnerungen an bessere Zeiten; Andenken an eine längst vergangene Zeit. Zärtlich strich er mit dem Finger über das Bild seines Sohnes. Vielleicht stimmte es und diejenigen, die starben, würden ihre Liebsten aus der Ferne beobachten können. Vielleicht würde er so seinen Sohn aufwachsen sehen. Er hoffte es. Er hatte aufgeräumt. Nichts lag mehr herum. Trotzdem fiel ihm auf, wie schäbig und ranzig es in der Wohnung aussah. Vielleicht hatte die Mutter seines Kindes doch einen guten Grund gehabt, ihn zu verlassen. Papiere, die es zu sortieren gab, hatte er keine. Geld, das er vererben konnte, hatte er ebenfalls nicht. Es gab nichts, was es für ihn noch zu organisieren gab. Seinen Personalausweis legte er auf den Wohnzimmertisch, zusammen mit der Karte für seine Krankenkasse und seine Bankkarte. Nicht, dass diese ihm oder irgendjemandem noch nützen würden, aber zumindest würden diejenigen, die ihn fanden, gleich alles beisammenhaben. Er rückte den Stuhl an die Wohnwand heran. Eiche rusikal, massiv und standfest. Noch einmal blickte er sich in dem kleinen Wohnzimmer um, schaute dann auf den Gürtel in seiner Hand. Das war es dann wohl.
Eine Unruhe überkam den Pfarrer. Er hatte das Bedürfnis aufzustehen, obwohl er seinen Kaffee noch nicht ausgetrunken hatte. Er warf der Bedienung einen Zehn-Euro-Schein auf den Tresen und winkte ab, als sie ihm Wechselgeld geben wollte. Er eilte auf den Platz, blickte zum Weihnachtsbaum empor, lauschte. Es gab niemanden, der ihn rief. Und doch spürte er, dass er, wie von unsichtbarer Hand, geschoben wurde in die Richtung des schmalen Hauses am Rande des Platzes. Er konnte es sich nicht erklären, er spürte nur, dass er dort hingehen sollte. Er blickte an der Fassade hinauf. Es war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Und doch wurde seine Unruhe stärker, sein Drang, in dieses Haus zu gehen nahm zu. Gerade, als er prüfen wollte, ob die Eingangstür vielleicht offenstand, und als er sich überlegte, wo er mit welcher Begründung klingeln sollte, ging die Tür auf und eine junge Frau stürmte an ihm vorbei. Er schaute ihr hinterher, spürte aber nichts. Vielmehr hatte er das dringende Bedürfnis, das Haus zu betreten und die steile, hölzerne Treppe mit den ausgetretenen Treppenstufen hinaufzugehen. Langsam, unsicher, dann immer schnell, getrieben von einem Gefühl, dass er hier gebraucht wurde, dass jemand ihn rief.
Der Mann stieg auf den Küchenstuhl. Unwirsch wischte er sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Was fing er jetzt an zu heulen wie ein Kind? Er war seines Lebens so überdrüssig geworden in den letzten Monaten. Er wusste, dass er nichts mehr hatte, wofür es sich zu leben lohnte. Er war es leid, gedemütigt und abgewiesen, gekränkt und bemitleidet zu werden. Nein, damit war jetzt Schluss, für immer. Er fing an, den Gürtel an der Schrankwand zu befestigen.
Der Pfarrer eilte die Treppen hinauf. Er lauschte, als er im ersten Stock angekommen war. Doch eine unsichtbare Kraft trieb ihn weiter nach oben, auch am zweiten Stock vorbei. Im dritten Stock hielt er an, schaute sich um. Zwei Türen gab es, doch er wurde magisch angezogen von der linken. Ohne weiter zu überlegen, klingelte er. Klingelte noch einmal, klopfte.
Wer wollte ausgerechnet jetzt etwas von ihm? Jetzt, da sein Leben doch so gut wie vorbei war? Jetzt, da er den finalen Entschluss gefasst hatte und kurz davor war, aus seinem Leben zu scheiden? Wer konnte heute von ihm noch etwas wollen? Und warum war dieser Besucher so hartnäckig? Genervt kletterte der Mann von dem Stuhl, den Gürtel immer noch in seiner Hand. Mit langsamen Schritten ging er zur Wohnungstür und öffnete.
„Geht es Ihnen gut? Ist bei Ihnen alles in Ordnung?“ Der Pfarrer schaute in das verdutzte Gesicht eines Mannes, der ihm ungepflegt gegenüberstand, in der Hand einen Gürtel. Unendliche Traurigkeit und große Verzweiflung strahlte sein Gegenüber aus. Der Pfarrer streckte seine Hand aus und legte sie dem Mann auf die Schulter: „Ist alles in Ordnung?“
Eine Träne lief über die Wange des Mannes. Ärgerlich wischte er sie weg, doch es folgte eine zweite Träne. Er schüttelte unwirsch den Kopf: „Gar nichts ist gut: Ich wollte mich gerade umbringen; wollte Schluss mit diesem verdammten Leben machen. Und jetzt haben Sie mich dabei gestört!“
„Kommen Sie, lassen Sie uns reden.“ Sanft bugsierte der Pfarrer den Mann in das kärgliche Wohnzimmer, bemerkte den Stuhl, der vor der Wohnzimmerwand stand. Die Hand immer noch auf der Schulter des Mannes leitete er ihn zu dem durchgesessenen Sofa, das schon bessere Tage gesehen hatte. Sie setzten sich. „Erzählen Sie, was ist passiert, dass Sie zu diesem Schritt bereit waren?“
Und der Mann erzählte, zögernd zuerst, stockend, immer wieder innehaltend, wie um sich zu vergewissern, ob sein Gegenüber ihm tatsächlich zuhörte. Dann immer schneller; es brach aus ihm heraus: Seine gescheiterte Beziehung; das Kind, das er nicht mehr sehen konnte; die Arbeitslosigkeit, die Abhängigkeit vom Amt; die Chancenlosigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Nichts ließ er aus. Der Pfarrer saß da und hörte ihm zu. Dachte nicht an die nächsten Termine, nicht an den Weihnachtsstress und die Vorbereitungen, die er noch zu erledigen hatte. Er hörte zu, ermunterte mit freundlichem Blick, wenn sein Gegenüber ins Stocken kam. Er verurteilte nicht, sondern nahm Anteil, war aufmerksam, fühlte mit. Gleichzeitig überschlugen sich seine Gedanken: An ihrem Esstisch war noch ein Platz frei, seine Frau würde es verstehen, wenn er zum Heiligen Abend einen Gast einlüde. Er war Pfarrer in einer großen Gemeinde, unter den Mitgliedern seiner Gemeinde waren viele Selbständige. Vielleicht hatte der ein oder andere Bedarf an einem fleißigen Arbeiter? Vielleicht gab es dort neue Perspektiven für sein Gegenüber? Er würde ein bisschen anders sein als die Mitglieder des Männerkreises, aber wie der Pfarrer den Männerkreis einschätzte, würden sie diesen Mann freundlich aufnehmen, ihm einen Anlaufpunkt bieten. Und vielleicht konnte der Küster über die Weihnachtsfeiertage bei den vielen Gottesdiensten eine helfende Hand brauchen, und sei es nur, um die Kirch auszukehren oder die Kerzen anzuzünden; er würde mit ihm sprechen.
Spät, viel zu spät, machte er sich auf, um an der Probe der Kinder des Kindergottesdienstes teilzunehmen für das Krippenspiel am Heiligen Abend. Die Mitarbeiter würden es verstehen und kämen auch ohne ihn klar. Er verließ die Wohnung des Mannes, nicht ohne ihn zu Heilig Abend zum Essen bei sich und seiner Familie einzuladen und nicht ohne ihm das Versprechen abzunehmen, zumindest einen der Weihnachtsgottesdienste zu besuchen.
An Heilig Abend war die Kirch gefüllt wie sonst an keinem anderen Tag des Jahres. Freudige, erwartungsvolle Gesichter blickten auf den Pfarrer, als er die Kanzel bestieg. Er blickte auf seine Gemeinde; er sah altvertraute Gesichter, meist ältere Gemeindemitglieder, die fast an jedem Sonntag da waren; er sah Kinder, die aufgeregt und unruhig neben ihren Eltern saßen und auf das Ende des Gottesdienstes und den Beginn der Bescherung hin fieberten. Er sah Menschen, die er nur zu Festtagen sah. Und unter ihnen sah er einen Mann in einem abgewetzten blauen Anzug, die Krawatte schief gebunden. Ihre Blicke kreuzten sich. Sie lächelten einander zu, der Pfarrer nickte dem Mann freundlich zu.
Das Wiedersehen
Einmal im Jahr, manchmal auch zweimal, zieht es mich an den Sehnsuchtsort meiner Kindheit zurück; an den Ort, den ich fast mein ganzes Leben als zweites Zuhause, als „home away from home“ bezeichnet habe. Dann besuche ich den Ort, an dem ich wahrscheinlich die glücklichsten Sommer meines Lebens verbracht habe. Den Ort, an dem ich mich unbeschwert und frei, geliebt und angenommen, glücklich und – ja, zuhause gefühlt habe. Ich besuche dort niemanden, zumindest niemanden, der noch lebt.