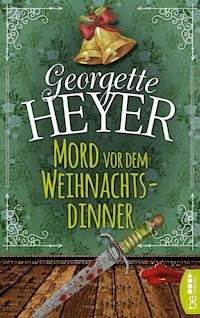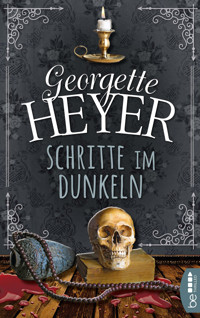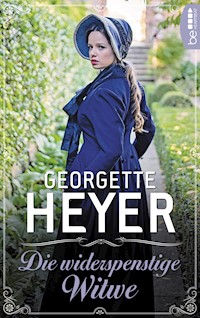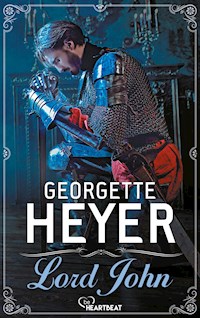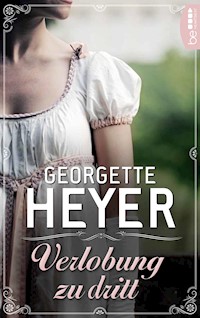
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sussex, 1793: Auf Wunsch ihres Großvaters soll die junge Eustacie de Vauban den sehr viel älteren Sir Tristam heiraten. Aber die temperamentvolle Enkelin widersetzt sich der Vernunftehe und ergreift kurzerhand die Flucht nach London. Durch Zufall begegnet sie Ludovic Laverham - ein Adliger auf Abwegen und verwegener Anführer einer Schmugglerbande. Der hitzköpfige Ludovic wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Doch Eustacie verliebt sich Hals über Kopf in den jungen Mann und setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen ...
"Verlobung zu Dritt" (im Original: The Talisman Ring) ist ein spannender Liebesroman über verlorene Erbstücke, verwegene Helden und abenteuerlustige junge Damen auf der Suche nach der großen Liebe. Georgette Heyer, die Königin des Regency Romans, jetzt als eBook bei beHEARTBEAT.
»Amüsant, mitunter witzig oder auch boshaft-spöttisch, aber immer voller Charme.« Westdeutsche Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Über dieses Buch
Sussex, 1793: Auf Wunsch ihres Großvaters soll die junge Eustacie de Vauban den sehr viel älteren Sir Tristam heiraten. Aber die temperamentvolle Enkelin widersetzt sich der Vernunftehe und ergreift kurzerhand die Flucht nach London. Durch Zufall begegnet sie Ludovic Laverham – ein Adliger auf Abwegen und verwegener Anführer einer Schmugglerbande. Der hitzköpfige Ludovic wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Doch Eustacie verliebt sich Hals über Kopf in den jungen Mann und setzt alles daran, seine Unschuld zu beweisen …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Verlobung zu dritt
Aus dem Englischen von Emi Ehm
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1936
Die Originalausgabe The Talisman Ring erschien 1960 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1968.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung eines Motives © Richard Jenkins Photography, London
Illustration: © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-4890-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Als Sir Tristram Shield in der Winterdämmerung in Lavenham Court eintraf, unterrichtete man ihn schon an der Haustür davon, dass sein Großonkel sehr schwach sei und wohl kaum mehr lange leben würde. Sir Tristram nahm diese Nachricht schweigend auf. Als ihm der Butler aus dem Kutschiermantel mit den vielen Schulterkragen half, erkundigte er sich jedoch mit unbewegter Stimme: »Ist Mr. Lavenham hier?«
»Im Dower House drüben, Sir«, erwiderte der Butler und übergab den Mantel und den hohen Biberhut einem Lakaien. Er bedeutete diesem Untergebenen mit einem strengen Kopfnicken, sich zu entfernen, und fügte mit einem leichten Hüsteln hinzu: »Seine Lordschaft ist etwas schwierig, Sir. Bisher hat Seine Lordschaft Mr. Lavenham noch nicht empfangen.«
Er schwieg und erwartete, dass sich Sir Tristram nach Mademoiselle de Vauban erkundigen würde. Sir Tristram verlangte jedoch nur, in sein Schlafzimmer geführt zu werden, damit er sich umkleiden konnte, bevor er bei seinem Großonkel vorgelassen würde.
Den Butler, dem ebenso wie jedermann sonst auf dem Herrensitz der Grund für die plötzliche Ankunft Sir Tristrams bekannt war, enttäuschte dieser Mangel an Interesse; er überlegte jedoch, dass Sir Tristram schließlich nie verraten hatte, was er dachte. Er ging ihm durch die Halle zu der Eichentreppe voran und oben dann neben ihm die Lange Galerie entlang, auf deren einer Seite die Porträts verstorbener Lavenhams hingen; auf der anderen gewährten hohe zweiteilige Fenster den Blick südwärts über den gepflegten Park bis zu den Downs. Die Stille des Hauses wurde durch das Rascheln eines Rocks und das hastige Schließen einer Tür am Ende der Galerie unterbrochen. Der Butler vermutete scharfsinnig, dass Mademoiselle de Vauban, neugieriger als Sir Tristram, in der Galerie gewartet hatte, um einen Blick auf den Gast zu erhaschen. Als der Butler die Tür eines der Gästezimmer öffnete, warf er Shield einen Blick zu und sagte: »Seine Lordschaft hat niemanden empfangen außer dem Arzt – und den nur einmal; und natürlich Mamsell Eustacie.«
Dieses dunkle, herbe Gesicht verriet nichts. »So?«, sagte Shield.
Dem Butler kam der Gedanke, dass Sir Tristram vielleicht nicht wusste, warum man ihn nach Sussex gerufen hatte. Falls das der Fall war, dann konnte man nicht wissen, wie er es aufnehmen würde. Er war kein leicht zu lenkender Mann, wie sein Großonkel schon früher mehr als einmal bemerkt hatte. Zehn zu eins gewettet würde es Schwierigkeiten geben.
Sir Tristrams Stimme unterbrach diese Überlegungen. »Schicken Sie mir meinen Kammerdiener herauf, Porson, und melden Sie Seiner Lordschaft, dass ich eingetroffen bin«, sagte er.
Der Butler verneigte sich und zog sich zurück. Sir Tristram ging zum Fenster und sah über die Gartenanlagen zu den Wäldern hinüber, die trotz der zunehmenden Dämmerung noch undeutlich zu sehen waren. In seinen Augen stand ein düsterer Ausdruck, und seine Lippen waren so fest zusammengepresst, dass der Mund noch grimmiger als sonst erschien. Sir Tristram drehte sich nicht um, als sich die Tür öffnete und sein Kammerdiener eintrat, begleitet von einem Lakaien, der den Mantelsack Shields trug, und einem zweiten mit zwei vergoldeten Armleuchtern, die er auf den Toilettentisch stellte. Das plötzliche Kerzenlicht ließ die Landschaft draußen noch dunkler erscheinen. Einen Augenblick später ging Shield vom Fenster zum Kamin, legte den Arm auf den hohen Sims und blickte auf die glimmenden Scheite hinunter. Der Lakai zog die Vorhänge zu und ging leise hinaus. Jupp, der Kammerdiener, begann auszupacken und legte eine Abendjacke und eine Kniehose aus maulbeerfarbenem Samt sowie eine Florentiner Weste auf das Bett. Sir Tristram rückte mit dem Fuß im Stulpenstiefel die Scheite auf dem Rost zurecht. Jupp blickte ihn von der Seite an und fragte sich, was wohl in der Luft liege, dass sein Herr so unzugänglich dreinsah. »Werden Sie das Haar pudern, Sir?«, sagte er im Ton eines Vorschlags und stellte Streubüchse und Pomade auf den Toilettentisch.
»Nein.«
Jupp seufzte. Er hatte bereits erfahren, dass Mr. Lavenham in dem zum Herrenhaus gehörenden Witwensitz, dem Dower House, anwesend war. Sehr wahrscheinlich würde der Beau ins Herrenhaus heraufkommen, um seinen Vetter zu besuchen, und Jupp, der wusste, wie geschickt der Kammerdiener Mr. Lavenhams darin war, die Locken seines Herrn anzuordnen, hätte seinem Selbstgefühl zuliebe gern seinen Herrn entsprechend gelockt und gepudert zum Abendessen hinuntergeschickt. Er sagte jedoch nichts, sondern kniete nieder, um Sir Tristram die Stiefel auszuziehen.
Eine halbe Stunde später ging Shield, von Lord Lavenhams Kammerdiener geleitet, durch die Galerie zum Großen Zimmer und trat unangemeldet ein.
Der eichengetäfelte Raum mit seinen karmesinroten Vorhängen wurde von einem lodernden Feuer erwärmt und von nicht weniger als fünfzig Kerzen in vielarmigen Leuchtern erhellt. Am gegenüberliegenden Ende des Zimmers stand auf einer niedrigen Estrade ein riesiges Himmelbett. Darin lag, von Kissen gestützt, unter einer Decke aus prunkvollem Brokat, in einem exotischen Schlafanzug und mit Puderperücke – außer seinem Kammerdiener konnte sich niemand erinnern, ihn je ohne sie gesehen zu haben – der alte Sylvester, der Neunte Baron Lavenham.
Sir Tristram blieb, von der unerwarteten Lichtfülle geblendet, einen Augenblick auf der Schwelle stehen. Als seine Augen die Pracht und Farbe um sich herum aufgenommen hatten, milderte ein leicht sarkastisches Lächeln seinen grimmigen Ausdruck: »Ihr Sterbebett, Sir?«
Vom Himmelbett her kam ein dünnes Kichern. »Mein Sterbebett«, bestätigte Sylvester mit einem Zwinkern.
Sir Tristram ging zu der Estrade. Eine ausgezehrte Hand, an der ein großer Rubinring glühte, wurde ihm hingestreckt. Er hielt sie fest und blickte auf das pergamentfarbene Gesicht seines Großonkels mit der Adlernase, den blutleeren Lippen und den tiefliegenden glänzenden Augen hinunter. Sylvester war achtzig und lag im Sterben, trug aber noch immer seine Perücke und seine Schönheitspflästerchen und hielt in der linken Hand seine Schnupftabaksdose und das spitzenbesetzte Taschentuch.
Sylvester erwiderte den ruhigen Blick seines Großneffen mit boshafter Genugtuung. »Ich wusste, dass du kommen würdest«, bemerkte er. Er entzog seine Hand dem leichten Griff Shields und deutete auf einen Stuhl, der auf die Estrade gestellt worden war. »Setz dich.« Er öffnete die Tabaksdose und tauchte Zeigefinger und Daumen hinein. »Wann habe ich dich das letzte Mal gesehen?«, fragte er, während er den überflüssigen Tabak von der winzigen Prise abschüttelte und sie an das Nasenloch führte.
Sir Tristram setzte sich nieder, voll sichtbar in dem grellen Licht des Kerzenbündels auf einem Kandelaber. In dem goldenen Licht hob sich sein Profil in scharf umrissenem Relief von den karmesinroten Vorhängen des Bettes ab. »Ich glaube, es muss vor ungefähr zwei Jahren gewesen sein«, antwortete er.
Wieder kicherte Sylvester. »Eine liebevolle Familie, wir – nicht?« Er ließ die Dose zuschnappen und fuhr mit dem Taschentuch über seine Finger. »Dieser zweite Großneffe von mir ist auch da«, bemerkte er unvermittelt.
»Ich habe es gehört.«
»Ihn schon gesehen?«
»Nein.«
»Wirst du«, sagte Sylvester. »Ich nicht.«
»Warum nicht?«, fragte Shield und sah ihn unter den schwarzen Brauen hervor an.
»Weil ich nicht will«, erwiderte Sylvester freimütig. »Der Beau Lavenham! Zu meiner Zeit war ich der Beau Lavenham, aber glaubst du, dass ich mich je mit einer grünen Jacke zu gelben Pantalons ausstaffiert hätte?«
»Kaum«, sagte Shield.
»Ein verdammt glattzüngiger Kerl!«, sagte Sylvester. »Mochte ihn nie. Mochte auch seinen Vater nicht. Seine Mutter pflegte unter Krämpfen zu leiden. Sie litt auch an diesen Krämpfen – gleich serienweise! -, als sie wollte, dass ich ihr das Dower House überlasse.«
»Nun, sie bekam das Dower House«, sagte Shield trocken.
»Natürlich!«, fuhr ihn Sylvester an und verfiel in das vergessliche Schweigen sehr alter Menschen. Ein Holzscheit, das aus dem Kamin fiel, rief ihn wieder in die Gegenwart zurück. Er öffnete die Augen und sagte: »Habe ich dir gesagt, warum ich dich hier haben wollte?«
Sir Tristram war aufgestanden und zum Kamin gegangen, um das rauchende Scheit zurückzuschieben. Er antwortete erst, als er das getan hatte, und sagte dann mit seiner kühlen, unbeteiligten Stimme: »Du hast mir geschrieben, dass du eine Heirat mit deiner Enkelin für mich arrangiert hast.«
Die durchdringenden Augen glitzerten. »Hat dir nicht sehr geschmeckt, he?«
»Nicht sehr«, gab Shield zu und kehrte auf die Estrade zurück.
»Es ist eine gute Partie«, bemerkte Sylvester. »Ich habe ihr den größten Teil des Besitzes vermacht, soweit er nicht Fideikommiss ist, und wie du weißt, ist sie Halbfranzösin – hat also Verständnis für solche Übereinkommen. Du kannst deine eigenen Wege gehen. Sie ist ganz anders als ihre Mutter.«
»Ich habe ihre Mutter nicht gekannt«, sagte Shield entmutigend.
»Sie war eine Närrin!«, sagte Sylvester. »Hätte nicht geglaubt, dass das eine Tochter von mir sein konnte. Sie brannte mit einem windigen Franzosen durch: Das sagt alles. Wie war doch gleich sein verdammter Name?«
»De Vauban.«
»Richtig. Vidame de Vauban. Ich habe vergessen, wann er gestorben ist. Marie starb vor drei Jahren, und ich fuhr nach Paris hinüber – ich glaube, ein Jahr später, aber mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das, was es war.«
»Etwas mehr als ein Jahr später, Sir.«
»Vermutlich. Es war nach –« Er schwieg einen Augenblick und fügte dann herb hinzu: »– nach Ludovics Affäre. Ich war der Meinung, Frankreichs Boden werde allmählich zu heiß für eines meiner Enkelkinder, und recht hatte ich, bei Gott! Wie lange ist es her, dass sie den König zur Guillotine schickten? Vor etwas über einem Monat, eh? Merk dir, was ich sage, Tristram, bevor noch das Jahr herum ist, wird die Königin den gleichen Weg gehen! Ich bin froh, wenn ich daran denke, dass ich dann nicht mehr da bin, um es zu erleben. Reizend war sie, reizend! Aber du dürftest dich nicht mehr an sie erinnern. Vor zwanzig Jahren pflegten wir ihre Farbe zu tragen. Alles war ‹Königinnenhaar›: Seiden, Bänder, Schuhe ... Und jetzt« – er verzog die Lippen zu einem höhnischen Lachen –, »jetzt habe ich einen Großneffen, der eine grüne Jacke zu gelben Pantalons und einen verdammt absurden Zuckerhut auf dem Kopf trägt!« Plötzlich hob er die schweren Lider und fügte hinzu: »Aber trotzdem ist der Junge mein Erbe!«
Sir Tristram erwiderte nichts auf diese Bemerkung, die ihm fast wie eine Herausforderung zugeworfen worden war. Sylvester nahm wieder eine Prise, und als er dann sprach, tat er es mit seinem leicht spöttischen Näseln. »Er würde Eustacie heiraten, wenn er könnte, aber sie mag ihn nicht.« Er schloss die Tabaksdose mit einer geschickten Bewegung des Fingers. »Kurz und gut, ich hatte Lust, sie mit dir verheiratet zu sehen, bevor ich sterbe, Tristram.«
»Warum?«, fragte Shield.
»Weil sonst niemand da ist«, erwiderte Sylvester barsch. »Natürlich meine Schuld. Ich hätte für sie vorsorgen – sie nach London mitnehmen sollen. Aber ich bin alt und habe nie jemandem etwas zuliebe getan, außer mir selbst. Zu spät, jetzt darüber nachzudenken. Ich liege im Sterben, und verdammich, das junge Ding ist meine Enkelin! Ich will sie gut aufgehoben hinterlassen. Es ist an der Zeit, dass du ans Heiraten denkst.«
»Ich habe daran gedacht.«
Sylvester sah ihn scharf an. »Doch nicht verliebt – oder?«
Shields Gesicht wurde hart. »Nein.«
»Falls du noch immer eine verfluchte dumme Jugendliebe an dir herumnagen lässt, bist du ein Narr!«, sagte Sylvester. »Ich habe vergessen, wie das damals eigentlich zugegangen ist, falls ich es je gewusst habe, aber es interessiert mich nicht. Die meisten Frauen treiben ein falsches Spiel, und ich habe noch nie eine kennen gelernt, die im Grunde genommen keine Närrin ist. Ich biete dir eine Vernunftheirat.«
»Ist ihr das klar?«, fragte Shield.
»Etwas anderes wäre ihr gar nicht klar«, erwiderte Sylvester. »Sie ist Französin.«
Sir Tristram stieg von der Estrade hinunter und ging zum Kamin hinüber. Sylvester beobachtete ihn schweigend. Nach einer Weile sagte Shield: »Es könnte vielleicht entsprechen.«
»Du bist der Letzte deines Namens«, erinnerte ihn Sylvester.
»Das weiß ich. Ich habe die Absicht, zu heiraten.«
»Niemanden im Auge?«
»Nein.«
»Dann wirst du Eustacie heiraten«, sagte Sylvester. »Läute!«
Sir Tristram gehorchte, sagte jedoch mit einem amüsierten Blick: »Dein letzter Wunsch, Sylvester?«
»Ich werde die Woche nicht überleben«, erwiderte Sylvester heiter. »Das Herz und ein tolles Leben, Tristram. Zieh bei meinem Begräbnis kein langes Gesicht! Achtzig Jahre sind genug für jeden Menschen, und zwanzig davon habe ich die Gicht gehabt.« Als sein Kammerdiener hereinkam, sagte er: »Schicke Er Mademoiselle zu mir.«
»Du nimmst viel für verbürgt, Sylvester«, bemerkte Sir Tristram, als der Kammerdiener gegangen war.
Sylvester hatte den Kopf in die Kissen zurückgelegt und die Augen geschlossen. In seiner Haltung lag eine Spur Erschöpfung, als er jedoch die Augen wieder öffnete, sahen sie sehr lebendig und mit verschmitzter Klugheit drein. »Du wärst nicht hergekommen, mein lieber Tristram, wenn du nicht bereits mit dir ins Reine gekommen wärst.«
Sir Tristram lächelte etwas zögernd und widmete seine Aufmerksamkeit dem Feuer.
Es dauerte nicht lange, bis sich die Tür wieder öffnete. Sir Tristram wandte sich um, als Mademoiselle de Vauban eintrat, und sah sie unter zusammengezogenen Brauen an.
Sein erster Gedanke war, dass sie unverkennbar Französin war und durchaus nicht von dem Frauentyp, den er bewunderte. Sie hatte nach der neuesten Mode frisiertes glänzendes schwarzes Haar, und ihre Augen waren so dunkel, dass schwer zu erkennen war, ob sie braun oder schwarz waren. Sie war sehr klein, hatte aber eine äußerst gute Figur und eine vornehme Haltung. Sie blieb an der Tür stehen, erblickte Sir Tristram sofort und erwiderte sein Anstarren mit einem genauso prüfenden, aber viel nachdenklicheren Blick.
Sylvester ließ ihnen eine Weile Zeit, einander abzuschätzen, und sagte dann: »Komm her, mein Kind. Und du auch, Tristram.«
Die Promptheit, mit der seine Enkelin dieser Aufforderung gehorchte, deutete auf eine Gefügigkeit, welche der energische, um nicht zu sagen eigenwillige hübsche Mund Lügen strafte. Sie schritt graziös durch das Zimmer und knickste vor Sylvester, bevor sie auf die Estrade stieg. Sir Tristram ging langsamer zu dem Bett, und es entging Eustacie nicht, dass er sie anscheinend gründlich angesehen hatte. Seine Augen, noch immer düster und mit einem etwas finsteren Blick, ruhten jetzt auf Sylvester.
Sylvester streckte Eustacie die linke Hand hin. »Darf ich dir deinen Vetter Tristram vorstellen.«
»Ihr gehorsamster Cousin«, sagte Shield mit einer Verneigung.
»Es ist ein großes Glück für mich, meinen Vetter kennen zu lernen«, sagte Eustacie mit steifer Höflichkeit und einem leichten, nicht ungefälligen französischen Akzent.
»Ich bin etwas müde«, sagte Sylvester. »Wenn ich es nicht wäre, würde ich euch Zeit lassen, einander besser kennen zu lernen. Und doch – ich weiß nicht; vermutlich ist es ganz gut so, wie es ist«, fügte er zynisch hinzu. »Wenn du einen formellen Heiratsantrag bekommen möchtest, Eustacie, wird dir Tristram zweifellos einen machen – nach dem Abendessen.«
»Ich will keinen formellen Heiratsantrag«, erwiderte Mademoiselle de Vauban. »Das ist etwas ganz Unwesentliches für mich, aber ich heiße ‹Östasii›, was, enfin, ein sehr guter Name ist, und es heißt nicht ‹Justejscha›, was ich überhaupt nicht aussprechen kann und was ich außergewöhnlich hässlich finde.«
Diese Rede, die mit fester Stimme und völlig selbstbewusst vorgebracht wurde, hatte die Wirkung, dass Sir Tristram einen weiteren prüfenden Blick auf die Dame warf. Mit einem leichten Lächeln sagte er: »Ich hoffe, es ist mir erlaubt, Sie mit ‹Eustacie› anzusprechen, Base?«
»Sicher; es ist durchaus convenable«, erwiderte Eustacie und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln.
»Sie ist achtzehn«, sagte Sylvester unvermittelt. »Wie alt bist du?«
»Einunddreißig«, antwortete Sir Tristram mit Entschiedenheit.
»Hm«, sagte Sylvester. »Ein ganz vortreffliches Alter.«
»Wofür?«, fragte Eustacie.
»Zum Heiraten, Fräulein!«
Eustacie sah ihn nachdenklich an, brachte jedoch keine weitere Bemerkung vor.
»Ihr könnt jetzt zum Abendessen hinuntergehen«, sagte Sylvester. »Es tut mir leid, dass ich nicht imstande bin, euch Gesellschaft zu leisten, aber ich bin überzeugt, dass der Nuits, den euch Porson über meinen Auftrag servieren soll, euch helfen wird, ein eventuelles Gefühl der gêne, das euch immerhin überkommen könnte, zu überwinden.«
»Sie sind die Rücksicht in Person, Sir«, sagte Shield. »Gehen wir, Base?«
Eustacie, die anscheinend nicht an gêne litt, stimmte zu, knickste wieder vor ihrem Großvater und ging mit Sir Tristram ins Speisezimmer hinunter.
Der Butler hatte für sie an den entgegengesetzten Enden des langen Tisches gedeckt, eine Anordnung, der sich beide schweigend fügten, obwohl sie das Gespräch etwas mühsam machte. Das Abendessen, in großem Stil serviert, war gut zusammengestellt, gut zubereitet und dauerte lange. Sir Tristram bemerkte, dass seine zukünftige Frau über einen gesunden Appetit verfügte, und entdeckte schon nach fünf Minuten, dass sie es verstand, ein Gespräch von einer Natürlichkeit zu führen, die sich völlig von der Art Konversation unterschied, an die er in den Londoner Salons gewöhnt war. Er war darauf vorbereitet gewesen, sie von einer Situation verwirrt zu finden, die ihm persönlich als phantastisch erschien, und er war etwas erschrocken, als sie bemerkte: »Schade, dass Sie ein so dunkler Typ sind, weil ich im Allgemeinen dunkle Männer nicht mag. Aber man muss sich eben daran gewöhnen.«
»Danke«, sagte Shield.
»Hätte mich Großpapa in Frankreich gelassen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Herzog geheiratet«, sagte Eustacie. »Mein Onkel – der derzeitige Vidame de Vauban, verstehen Sie – hatte das wirklich vor.«
»Sehr wahrscheinlich wären Sie eher zur Guillotine gegangen«, erwiderte Sir Tristram deprimierend sachlich.
»Ja, das ist wirklich wahr«, stimmte ihm Eustacie zu. »Wir pflegten uns darüber zu unterhalten, Kusine Henriette und ich. Wir hatten beschlossen, ganz tapfer zu sein, selbstverständlich nicht zu weinen, aber vielleicht so ein bisschen blass zu sein, sozusagen stolz. Henriette wollte en grande tenue zur Guillotine gehen, aber das war nur, weil sie eine Hofrobe aus gelbem Satin besaß, von der sie annahm, sie stünde ihr viel besser, als das wirklich der Fall war. Was mich betrifft, so glaube ich, man sollte, wenn man sehr jung ist, zur Guillotine Weiß tragen und sonst nichts, außer vielleicht ein Taschentuch. Meinen Sie nicht auch?«
»Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, was man auf seinem Weg zum Schafott trägt«, erwiderte Sir Tristram ohne die geringste Würdigung des Bildes, bei dem seine Base mit so sichtlicher Bewunderung verweilte.
Sie sah ihn überrascht an. »Nein?! Aber bedenken Sie doch! Es täte Ihnen bestimmt leid, ein so junges Mädchen auf einem Schinderkarren, ganz in Weiß, blass, aber wirklich völlig unerschrocken, das sich überhaupt nicht um die canaille kümmert, sondern –«
»Mir täte jedermann auf einem Schinderkarren leid, wie alt, welchen Geschlechts, in welchem Aufzug auch immer«, unterbrach sie Sir Tristram.
»Ein junges Mädchen täte Ihnen aber noch mehr leid – ganz allein, und vielleicht in Ketten«, sagte Eustacie überzeugt.
»Sie wären gar nicht ganz allein. In dem Schinderkarren wären sehr viele Leute mit Ihnen zusammen«, sagte Sir Tristram.
Eustacie beäugte ihn missvergnügt. »In meinem Schinderkarren wären bestimmt nicht sehr viele andere Leute gewesen«, sagte sie.
Da Sir Tristram merkte, dass ein Streit über diesen Punkt fruchtlos wäre, zog er nur eine skeptische Miene und enthielt sich einer Antwort.
»Ein Franzose«, sagte Eustacie, »würde das sofort verstehen.«
»Ich bin kein Franzose«, sagte Sir Tristram.
»Ça se voit!«, erwiderte Eustacie scharf.
Sir Tristram bediente sich von einer Platte Hammelkoteletts mit Gurken.
»Die Leute, die ich in England kennen gelernt habe«, sagte Eustacie nach kurzem Schweigen, »halten es für sehr romantisch, dass ich vor dem Terror gerettet wurde.«
Ihr Tonfall legte nahe, dass auch er es für romantisch halten sollte; da er jedoch genau wusste, dass Sylvester kurz vor dem Beginn des Terrors nach Paris gereist war und seine Enkelin auf die denkbar reibungsloseste Weise gerettet hatte, erwiderte er nur: »Vermutlich.«
»Ich kannte eine Familie, die in einem Karren voller Rüben aus Paris geflohen ist«, sagte Eustacie. »Außerdem stachen die Soldaten mit ihren Bajonetten in die Rüben.«
»Hoffentlich haben sie nicht auch in die Familie hineingestochen?«
»Nein, aber es hätte leicht geschehen können. Es ist Ihnen überhaupt nicht klar, wie das jetzt in Paris ist. Man lebt in ständiger Angst. Es ist sogar gefährlich, auch nur aus dem Haus zu treten.«
»Es muss eine große Erleichterung für Sie sein, dass Sie sich jetzt in Sussex befinden.«
Sie sah ihn mit großen Augen an und sagte: »Ja – aber – mögen Sie Aufregendes nicht, mon cousin?«
»Ich mag Revolutionen nicht, wenn Sie das meinen sollten.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ah nein, aber Romantik und – und Abenteuer!«
Er lächelte. »Als ich achtzehn war, vermutlich schon.«
Ein bedrückendes Schweigen entstand. »Grandpère sagt, dass Sie mir ein guter Ehemann sein werden«, sagte Eustacie kurz darauf.
Überrascht erwiderte Shield steif: »Ich werde mich bemühen, es zu werden, Base.«
»Und ich vermute«, sagte Eustacie und inspizierte mutlos eine Schüssel Pflaumentorteletten, »dass er ganz recht hat. Sie sehen mir nach einem guten Ehemann aus.«
»Nein, wirklich?«, sagte Sir Tristram, unerklärlicherweise von dieser Bemerkung verärgert. »Es tut mir leid, dass ich das Kompliment nicht erwidern und Ihnen sagen kann, dass Sie nach einer guten Ehefrau aussehen.«
Die sanfte Melancholie, die Eustacie überfallen hatte, verschwand. Sie lächelte mit entzückenden Grübchen und sagte: »Nein, wirklich nicht, oder? Aber meinen Sie, dass ich hübsch bin?«
»Sehr«, antwortete Shield in dämpfendem Ton.
»Ja, ich auch«, stimmte ihm Eustacie zu. »Ich glaube, in London wäre ich wahrscheinlich ein großer Erfolg geworden, weil ich nicht wie eine Engländerin aussehe, und ich habe bemerkt, dass die Engländer Ausländerinnen für sehr épatantes halten.«
»Unglücklicherweise«, sagte Sir Tristram, »wird London allmählich derart voll von französischen emigrés, dass ich zweifle, ob Sie sich in irgendeiner Hinsicht für bemerkenswert gehalten hätten.«
»Jetzt fällt es mir wieder ein«, sagte Eustacie, »Sie mögen ja Frauen nicht.«
Sir Tristram, der sich unbehaglich des Lakaien hinter seinem Stuhl bewusst war, warf einen Blick auf den leeren Teller seiner Kusine und stand auf. »Gehen wir in den Salon«, sagte er. »Das hier ist wohl kaum der Ort, so – äh – intime Angelegenheiten zu erörtern!«
Eustacie, für die Diener anscheinend nichts anderes als Möbelstücke waren, blickte sich verblüfft um, hatte jedoch nichts dagegen, den Tisch zu verlassen. Sie ging mit Sir Tristram in den Salon und sagte, kaum dass er die Tür geschlossen hatte: »Sagen Sie, tut es Ihnen sehr leid, dass Sie mich heiraten sollen?«
Verärgert antwortete er: »Meine liebe Base, ich weiß nicht, wer Ihnen erzählt hat, dass ich Frauen nicht mag, aber es ist eine krasse Übertreibung.«
»Schön, aber tut es Ihnen leid?«
»Ich wäre nicht hier, wenn es mir leidtäte.«
»Wirklich? Aber jeder Mensch muss doch tun, was Grandpère ihm sagt.«
»Nicht unbedingt jeder«, sagte Shield. »Sylvester weiß jedoch, dass –«
»Sie sollten Ihren Großonkel nicht Sylvester nennen!«, unterbrach ihn Eustacie. »Das ist gar nicht respektvoll.«
»Mein gutes Kind, in den letzten vierzig Jahren hat ihn alle Welt Sylvester genannt!«
»Oh!«, sagte Eustacie zweifelnd. Sie setzte sich auf ein blau-gold gestreiftes Seidensofa, faltete die Hände und sah ihren Freier erwartungsvoll an.
Er fand diesen großen, unschuldigen Blick etwas verwirrend, sagte jedoch nach einem Augenblick mit einem Schimmer von Belustigung: »Dieser Situation, Base, haftet eine gewisse Peinlichkeit an, die zu überwinden ich leider anscheinend nicht geeignet bin. Sie müssen mir verzeihen, wenn es Ihnen so erscheint, als mangle es mir an Empfindsamkeit. Sylvester hat für uns eine Vernunftheirat arrangiert und uns keine Zeit zugestanden, einander auch nur im Geringsten kennen zu lernen, bevor wir zum Altar gehen.«
»In Frankreich«, erwiderte Eustacie, »kennt man seinen Verlobten auch nicht, weil es nicht erlaubt ist, mit ihm allein zu sprechen, bevor man verheiratet ist.«
Diese Bemerkung schien Sylvesters Versicherung zu bestätigen, seine Enkelin verstünde sein Arrangement. Sir Tristram sagte: »Es wäre albern, so zu tun, als könne einer von uns beiden für den anderen jene Leidenschaften empfinden, die man gewöhnlich bei Verlobten sucht, aber –«
»Oh ja, das wäre wirklich albern!«, stimmte ihm Eustacie herzlich zu.
»Dennoch glaube ich«, fuhr Sir Tristram fort, »dass Ehen wie die unsere sich häufig zum Guten wenden. Sie haben mich beschuldigt, dass ich Frauenzimmer nicht mag, aber glauben Sie mir –«
»Ich kann sehr gut sehen, dass Sie Frauenzimmer nicht mögen«, unterbrach ihn Eustacie. »Ich frage mich, warum Sie eigentlich heiraten wollen.«
Er zögerte und antwortete dann schroff: »Vielleicht würde ich es nicht wollen, wenn ich einen Bruder hätte, aber ich bin der Letzte meines Namens und darf ihn nicht mit mir aussterben lassen. Ich werde mich glücklich schätzen, wenn Sie einwilligen, meine Frau zu werden, und ich verspreche, dass Sie, soweit es in meiner Macht liegt, keine Ursache haben sollen, es zu bedauern. Darf ich Sylvester mitteilen, dass wir übereingekommen sind, einander die Hand zu reichen?«
»Qu’importe? Es ist sein Befehl, und natürlich weiß er, dass wir heiraten werden. Glauben Sie, dass wir glücklich werden?«
»Ich hoffe es, Base.«
»Ja, aber ich muss Ihnen sagen, dass Sie überhaupt nicht die Sorte Mann sind, den ich zu heiraten gedachte. Es ist sehr entmutigend. Ich nahm an, in England sei es einem erlaubt, sich zu verlieben und einen Mann eigener Wahl zu heiraten. Jetzt sehe ich, dass es hier genauso wie in Frankreich ist.«
Er sagte mit einer Spur Mitleid: »Sie sind wirklich noch sehr jung für eine Ehe, aber wenn Sylvester stirbt, werden Sie allein sein, und Ihre Lage wäre keineswegs angenehm.«
»Das ist sehr wahr«, sagte Eustacie mit einem Kopfnicken. »Ich habe es mir gut überlegt und vermute, sie wird nicht so sehr schlimm werden, unsere Ehe, wenn ich ein Haus in London haben kann, und vielleicht einen Liebhaber.«
»Und vielleicht – was?!«, fragte Shield mit einer Stimme, die sie zusammenzucken ließ.
»Nun, in Frankreich ist das ganz comme il faut – ja, sogar à la mode –, einen Liebhaber zu haben, wenn man verheiratet ist«, erklärte sie, nicht im Geringsten aus der Fassung gebracht.
»In England«, sagte Sir Tristram, »ist das weder comme il faut noch à la mode.«
»Vraiment? Ich weiß noch nicht, was in England Sitte ist, aber wenn Sie mir versichern, dass es nicht à la mode ist, werde ich natürlich keinen Liebhaber haben. Kann ich ein Haus in London bekommen?«
»Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wovon Sie reden«, sagte Sir Tristram erleichtert. »Mein Heim liegt in Berkshire, und ich hoffe, Sie werden es allmählich so lieb gewinnen, wie ich es habe, aber wenn Ihr Herz daran hängt, kann ich in London ein Haus für die Saison mieten.«
Eustacie wollte ihn eben davon unterrichten, dass ihr Herz unwiderruflich daran hing, als der Butler die Tür öffnete und die Ankunft Mr. Lavenhams meldete. Eustacie unterbrach sich mitten im Satz und flüsterte: »Nun, jedenfalls wäre ich viel lieber mit Ihnen als mit ihm verheiratet!«
Ihr Ausdruck verführte Sir Tristram nicht dazu, diesem edelmütigen Zugeständnis allzu viel Gewicht beizumessen. Er sah sie tadelnd an und ging seinem Vetter zur Begrüßung entgegen.
Der Beau Lavenham, zwei Jahre jünger als Shield, sah ihm nicht im Geringsten ähnlich. Sir Tristram war ein großer, magerer Mann, sehr dunkel, mit herben Gesichtszügen und keineswegs geziertem Benehmen; der Beau war nur mittelgroß, eher schmächtig als mager, hatte einen hellen Teint, zart gemeißelte Züge und verfügte über sehr viele gesellschaftliche Tugenden. Es gab nichts Köstlicheres als die Anordnung seiner gepuderten Locken oder den Schnitt seiner braun gefleckten Seidenjacke und Kniehose. Er trug eine gold- und silbergestickte Weste und Strümpfe von blassestem Rosa, einen Edelstein in den schneeweißen Falten seiner Krawatte, Bandrosetten am Knie und Ringe an den schlanken weißen Fingern. In einer Hand trug er die Schnupftabaksdose und ein parfümiertes Taschentuch; in der anderen hielt er ein verziertes Einglas, dessen Griff an einem Band befestigt war, das er um den Hals trug. Durch dieses Glas betrachtete er nun seine beiden Geschwisterkinder mit einem einschmeichelnden Lächeln, aber durchaus ungeniert. »Ah, Tristram!«, sagte er mit einer sanften, schleppenden Stimme, ließ sein Einglas fallen und streckte die Hand aus. »Wie geht’s, mein guter Junge?«
Sir Tristram drückte ihm die Hand. »Und wie geht’s dir, Basil? Es ist einige Zeit her, seit wir uns das letzte Mal trafen.«
Der Beau machte eine missbilligende Geste. »Aber, mein lieber Tristram, wenn du dich unbedingt in Berkshire vergraben willst, was soll man da machen? Eustacie –!« Er ging auf sie zu und beugte sich mit unvergleichlicher Anmut über ihre Hand. »So hast du also Tristram kennen gelernt?«
»Ja«, sagte Eustacie. »Wir sind verlobt.«
Der Beau hob lächelnd die Brauen. »Oh, là, là! So schnell? Hat da Sylvester den Marsch dazu geblasen? Nun, ihr seid ja beide sehr gehorsam; aber seid ihr auch ganz, ganz sicher, dass ihr gut miteinander auskommen werdet?«
»Oh, das hoffe ich!«, erwiderte Sir Tristram betont munter.
»Wenn du dazu entschlossen bist – und ich muss dich warnen, Eustacie, er ist der denkbar entschlossenste Bursche –, muss auch ich es hoffen. Aber ich habe es eigentlich von keinem von euch beiden erwartet, wirklich ganz so gehorsam zu sein. Sylvester ist erstaunlich – ganz erstaunlich! Es ist nicht zu glauben, dass er wirklich im Sterben liegt. Eine Welt ohne Sylvester! Das ist doch einfach unmöglich!«
»Es wird tatsächlich seltsam erscheinen«, sagte Shield ruhig.
Eustacie sah den Beau geringschätzig an. »Und mir wird es seltsam erscheinen, wenn Sie Lord Lavenham sein werden – sehr seltsam!«
Einen Augenblick herrschte Schweigen. Der Beau sah Sir Tristram an und sagte dann: »Ah ja, aber sehen Sie, ich werde gar nicht Lord Lavenham sein. Mein lieber Tristram, versuche doch bitte diesen meinen Schnupftabak und sage mir deine Meinung über ihn. Ich habe meiner alten Mischung gerade nur eine Spur Makuba hinzugefügt; nun – habe ich recht daran getan?«
»Ich bin nicht der geeignete Richter«, sagte Shield und bediente sich mit einer Prise. »Anscheinend recht gut.«
Eustacie runzelte die Stirn. »Aber ich verstehe nicht – wieso werden Sie nicht Lord Lavenham sein?«
Der Beau wandte sich ihr höflich zu. »Nun, Eustacie, ich bin ja nicht Sylvesters Enkel, sondern nur sein Großneffe.«
»Aber wenn kein Enkel vorhanden ist, dann müssen doch bestimmt Sie der Erbe sein?«
»Stimmt, aber es gibt einen Enkel, liebe Kusine. Wussten Sie das nicht?«
»Sicher weiß ich, dass es Ludovic gab, aber der ist doch schließlich tot.«
»Wer hat Ihnen gesagt, dass Ludovic tot sei?«, fragte Shield und sah sie unter zusammengezogenen Brauen an.
Sie breitete die Hände aus. »Aber Grandpère, natürlich! Und ich wollte schon oft erfahren, was er eigentlich getan hat, das so schlecht war, dass niemand von ihm sprechen durfte. Es ist ein Geheimnis, und ich glaube, sehr romantisch.«
»Es gibt kein Geheimnis daran«, sagte Shield, »und es ist auch nicht im Geringsten romantisch. Ludovic war ein wilder junger Mann, der eine Reihe von Torheiten mit Mord krönte und daher aus dem Land fliehen musste.«
»Mord!«, rief Eustacie aus. »Voyons, meinen Sie damit, dass er jemanden im Duell tötete?«
»Nein. Nicht in einem Duell.«
»Aber Tristram«, sagte der Beau sanft, »du darfst nicht vergessen, dass es nie bewiesen wurde, ob Ludovic derjenige war, der Matthew Plunkett erschoss. Ich meinerseits hielt es damals nicht für möglich, und ich tue es auch heute noch nicht.«
»Sehr schön von dir, aber die Umstände waren zu belastend«, erwiderte Shield. »Erinnere dich, dass ich persönlich den Schuss hörte, der Plunkett getötet haben muss, keine zehn Minuten nachdem ich mich von Ludovic getrennt hatte.«
»Ich aber«, sagte der Beau und polierte träge sein Einglas, »ziehe es vor, Ludovics eigene Version zu glauben: dass es eine Eule war, auf die er schoss.«
»Schoss – und sie verfehlte!«, sagte Shield. »Dennoch habe ich zugesehen, wie Ludovic auf zwanzig Meter Entfernung die Augen aus einer Spielkarte herausschoss.«
»Oh, zugegeben, Tristram, zugegeben, aber in jener bewussten Nacht war Ludovic, wie ich glaube, nicht ganz nüchtern, oder?«
Eustacie schlug ungeduldig die Hände zusammen. »Aber so sage mir doch einer von euch, was hat er wirklich getan, mein Vetter Ludovic?«
Der Beau schüttelte die Spitzenmanschette von seiner Hand zurück und tauchte Finger und Daumen in seine Schnupftabaksdose. »Na, Tristram«, sagte er mit seinem glitzernden Lächeln, »du weißt mehr darüber als ich. Wirst du es ihr erzählen?«
»Es ist keine erbauliche Geschichte«, sagte Shield. »Warum wollen Sie sie hören?«
»Weil ich glaube, dass vielleicht mein Vetter Ludovic die romantischste Person dieser ganzen Familie ist«, erwiderte Eustacie.
»Oh, romantisch!«, sagte Sir Tristram und wandte sich achselzuckend ab.
Der Beau ließ seine Tabaksdose zuschnappen. »Romantisch?«, sagte er nachdenklich. »Nein, ich glaube nicht, dass Ludovic romantisch war. Ein bisschen ungestüm, vielleicht. Er war ein Spieler – daher ja die Katastrophen, die ihm zustießen. Eines Nachts verlor er im Cocoa-Tree eine sehr hohe Summe an einen Mann, der auf dem Stechginster-Gut lebte, keine zwei Meilen von hier.«
»Auf dem Stechginster-Gut wohnt niemand«, unterbrach ihn Eustacie.
»Heute nicht mehr«, stimmte ihr der Beau zu. »Vor drei Jahren wohnte Sir Matthew Plunkett dort. Aber Sir Matthew wurde – vor drei Jahren – im Longshaw-Wäldchen erschossen, und seine Witwe zog aus der Gegend fort.«
»Hat ihn mein Vetter Ludovic erschossen?«
»Das, meine liebe Eustacie, ist Ansichtssache. Von Tristram werden Sie die eine und von mir eine andere Antwort erhalten.«
»Aber warum hat er ihn erschossen?«, fragte sie. »Doch nicht, weil er Geld an ihn verloren hatte! Das ist doch schließlich keine so große Sache – falls er nicht vielleicht ganz zugrunde gerichtet war?«
»Oh, keineswegs! Er verlor jedoch wirklich eine hohe Summe an ihn, und da Sir Matthew eine Persönlichkeit von – sagen wir mittelmäßiger Erziehung war, benahm er sich schlecht genug, ein Sicherheitspfand zu verlangen, bevor er weiterspielen wollte. Man sollte natürlich nie mit Pöbel spielen, aber der arme liebe Ludovic war ja immer so starrköpfig. Bei dem Spiel handelte es sich um Piquet, und beide waren betrunken. Ludovic zog einen gewissen Ring vom Finger und gab ihn Sir Matthew als Pfand – das natürlich eingelöst werden sollte. Es war ein uralter Talismanring, der durch die Mutter an Ludovic gekommen war, die Letzte eines viel älteren Hauses als des unseren.«
Eustacie unterbrach ihn: »Bitte, ich weiß nicht, was ein Talismanring ist.«
»Nur ein Goldring mit eingravierten Figuren. Ludovics Ring war, wie ich schon sagte, uralt. Die Zeichen auf ihm hielt man für magisch. Er sollte ihn nach altem Glauben vor jedem Schaden bewahren. Aber noch wichtiger – es war ein Erbstück. Ich kenne seinen genauen Wert nicht. Tristram, du bist ein Kenner solcher Dinge – Sie müssen ihn dazu bewegen, Eustacie, dass er Ihnen seine Sammlung zeigt –, wie hoch war der Wert des Ringes?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Shield kurz. »Er war sehr alt – vielleicht unbezahlbar.«
»Ein so ungestümes Geschöpf, dieser arme Ludovic!«, seufzte der Beau. »Ich glaube, er war nicht aufzuhalten – oder, Tristram?«
»Nein.«
Eustacie wandte sich an Shield. »Und Sie waren also dabei?«
»Ja, ich war dabei.«
»Aber niemand, nicht einmal Tristram, vermochte Ludovic zu bändigen, wenn er in einer seiner übermütigen Stimmungen war«, erklärte ihr der Beau. »Er verpfändete den Ring und verlor weiter. Sir Matthew verließ den Cocoa-Tree mit einem, wie man nicht umhinkann zu empfinden, bedauerlichen Mangel an Geschmack – mit dem Ring an seinem Finger ... Um ihn einzulösen, war Ludovic gezwungen, zu den Juden zu gehen – äh, das heißt, zu Geldverleihern, meine Liebe!«
»Das war nichts Neues«, sagte Shield. »Ludovic war in den Händen der Juden, seit er von Oxford abging – und auch vorher schon.«
»Wie so viele von uns«, murmelte der Beau.
»Und hat er das Geld von den Juden bekommen?«, fragte Eustacie.
»Oh ja«, erwiderte der Beau, »aber die Sache war nicht so leicht in Ordnung zu bringen. Als Ludovic bei Plunkett vorsprach, um den Ring einzulösen, tat unser einfallsreicher Freund so, als sei der Handel völlig missverstanden worden, und er habe in Wirklichkeit eine Guinee gegen den Ring gesetzt und ihn richtiggehend gewonnen. Er wollte ihn nicht hergeben, und es fand sich auch niemand außer Tristram, der nüchtern genug gewesen war, sich für die Wahrheit von Ludovics Version der Affäre zu verbürgen.«
Eustacies Augen blitzten. »Es überrascht mich gar nicht, dass Ludovic diese canaille tötete! Es war ein ehrloser Kerl!«
Der Beau spielte mit seinem Einglas. »Meine liebe Eustacie, Leute, die Raritäten sammeln, gehen meiner Meinung nach unerhört weit, um die Beute zu erlangen, nach der sie trachten.«
»Aber Sie!«, sagte Eustacie und sah Sir Tristram wütend an. »Ihnen war die Wahrheit bekannt!«
»Leider Gottes«, erwiderte Sir Tristram, »wartete Plunkett meinen Schiedsspruch nicht ab. Er zog sich aufs Land zurück – nämlich auf das Stechginster-Gut – und weigerte sich unklugerweise, Ludovic zu empfangen.«
»Wusste Grandpère von alledem?«, fragte Eustacie.
»Himmel, nein«, sagte der Beau. »Sylvester und Ludovic standen selten auf freundschaftlichem Fuß. Und dann war da die Kleinigkeit mit Ludovics Schulden bei den Juden. Man kann es Ludovic kaum verübeln, dass er Sylvester nicht ins Vertrauen zog. Aber Ludovic kam in dieses Haus hier zurück und brachte Tristram mit, in der Absicht, Plunkett den einzigen – äh – verlässlichen Zeugen der Sache gegenüberzustellen. Plunkett war jedoch eigenartig ausweichend – aber das ist ja verständlich. Wenn Ludovic im Stechginster-Gut vorsprach, war er nie daheim. Man muss zugeben, dass Ludovic nicht gerade der Mann war, eine solche Behandlung geduldig hinzunehmen. Und außerdem trank er zu jener Zeit ziemlich viel. Als er entdeckte, dass Plunkett gerade an dem Tag, als man sich im Stechginster-Gut zum dritten Mal weigerte, ihn zu empfangen, in einem Haus in Slaugham zu Abend aß, fasste er den Plan, Plunkett auf dessen Heimweg aufzulauern und ihn zu zwingen, Wechsel im Tausch gegen den Ring anzunehmen. Nur Tristram erriet, was Ludovic vorhatte, als er bemerkte, dass Ludovic das Haus verlassen hatte. Er ging ihm nach.«
»Der Junge war fast volltrunken!«, warf Sir Tristram über die Schulter ein.
»Ich zweifle nicht daran, dass er in einer sehr gefährlichen Stimmung war«, sagte der Beau zustimmend. »Es war für mich immer eine Quelle der Verwunderung, wie du ihn überredet hast, sein Vorhaben aufzugeben und heimzukehren.«
»Ich versprach, Plunkett an Ludovics statt aufzusuchen«, erwiderte Shield. »Narr, der ich war, ließ ich ihn den Weg durch das Wäldchen einschlagen.«
»Mein lieber Junge, es konnte kein Mensch von dir erwarten, dass du voraussiehst, Plunkett würde auf diesem Weg heimkehren«, sagte der Beau sanft.
»Im Gegenteil, wenn er von Slaugham kam, war es für ihn der natürlichste Weg«, erwiderte Shield. »Und wir wussten, dass er zu Pferd war und nicht im Wagen fuhr.«
»Und was geschah?«, hauchte Eustacie.
Es war Shield, der ihr antwortete. »Ludovic ritt durch das Longshaw-Wäldchen zurück, während ich zum Stechginster-Gut ritt. Keine zehn Minuten, nachdem wir uns getrennt hatten, hörte ich in der Ferne einen Schuss. Damals dachte ich mir nichts dabei – es hätte ein Wilddieb sein können. Am nächsten Morgen entdeckte man Plunketts Leiche im Wäldchen, mit einem Herzschuss. Neben ihm lag ein verknittertes Taschentuch Ludovics.«
»Und der Ring?«, fragte Eustacie schnell.
»Der Ring war weg«, sagte Shield. »In Plunketts Taschen war Geld und eine Diamantnadel in seiner Krawatte, aber vom Talismanring keine Spur.«
»Und seither ist der Ring nie wieder gesehen worden«, fügte der Beau hinzu.
»Jedenfalls nicht von uns!«, sagte Sir Tristram.
»Ja, ja, ich weiß, du glaubst, dass Ludovic ihn hat«, sagte der Beau, »aber Ludovic schwor, dass er an jenem Abend Plunkett nicht traf, und ich jedenfalls glaube nicht, dass Ludovic gelogen hat. Er gab offen zu, dass er eine Pistole in der Tasche trug, er gestand sogar, dass er mit ihr geschossen hatte, auf eine Eule.«
»Warum hätte er diesen Plunkett nicht erschießen sollen?«, fragte Eustacie. »Der verdiente es doch, erschossen zu werden! Ich bin sehr froh, dass er erschossen wurde.«
»Möglich«, sagte Sir Tristram in seinem trockensten Ton, »aber in England ist, wie immer das in Frankreich sein mag, Mord ein Kapitalverbrechen.«
»Aber sie haben ihn doch nicht gehängt, nur weil er so einen Kerl wie diesen Plunkett erschossen hat?«, fragte Eustacie entsetzt.
»Nein, weil wir ihn außer Landes brachten, bevor er verhaftet werden konnte«, antwortete Shield.
Der Beau hob die Hand. »Sylvester und du, ihr habt ihn außer Landes gebracht«, berichtigte er. »Ich hatte dabei nicht die Hand im Spiel, bitte sehr.«
»Wäre er hier geblieben, um sich dem Prozess zu stellen, dann hätte ihm nichts den Kopf retten können.«
»Hier bin ich anderer Meinung, wenn du gestattest, mein lieber Tristram«, sagte der Beau ruhig. »Hätte man zugelassen, dass er sich seinem Prozess stellt, dann wäre die Wahrheit vielleicht eher herausgefunden worden. Als du – und natürlich Sylvester – ihn außer Landes brachtet, habt ihr ihn als einen geständigen Mörder erscheinen lassen.«
Sir Tristram blieb die Notwendigkeit einer Antwort erspart, da der Kammerdiener Sylvesters eintrat, um Tristram wieder zu seinem Großonkel zu holen. Er ging sofort, ein Umstand, der den Beau, als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, zu der gemurmelten Bemerkung veranlasste: »Es ist wirklich höchst befriedigend, Tristram so gefällig zu erleben.«
Eustacie beachtete das nicht, sondern sagte: »Wo ist mein Vetter Ludovic jetzt?«
»Das weiß niemand, meine Liebe. Er ist verschwunden.«
»Und ihr tut nichts, um ihm zu helfen, keiner von euch!«, sagte sie empört.
»Nun, liebe Kusine, das ist ein bisschen schwer, nicht?«, erwiderte der Beau. »Nach jener wohlmeinenden, aber fatalen Einmischung – was hätte man tun können?«
»Ich glaube«, sagte Eustacie mit umwölkter Stirn, »dass Tristram meinen Vetter Ludovic nicht mochte.«
Der Beau lachte. »Wie klug von Ihnen, meine Liebe!«
Sie sah ihn an. »Was haben Sie damit gemeint, als Sie sagten, er müsse mir seine Sammlung zeigen?«, fragte sie rundheraus.
Er hob die Brauen in übertriebener Überraschung. »Aber was sollte ich denn damit meinen? Bloß, dass er eine ziemlich bemerkenswerte Sammlung besitzt. Ich bin kein Kenner, aber ich habe mitunter das Gefühl, dass ich selbst die Sammlung gern sehen möchte.«
»Er zeigt sie Ihnen also nicht?«
»Oh, aber mit der allergrößten Zuvorkommenheit!«, sagte der Beau lächelnd. »Nur muss man bedenken, dass Sammler einem nicht immer wirklich alle ihre Schätze zeigen.«
Kapitel 2
Sir Tristram, der wieder am Bett Sylvesters stand, war etwas entsetzt, als er bereits eine Veränderung an ihm bemerkte. Sylvester wurde zwar noch immer von einigen Kissen gestützt, und er trug noch immer seine Perücke, schien jedoch plötzlich gebrechlicher geworden und ferner gerückt zu sein. Nur seine Augen waren sehr lebendig und standen erschreckend dunkel in seinem wächsernen Gesicht.
Sir Tristram sagte mit seiner tiefen Stimme: »Es tut mir leid, Sir, ich glaube, mein Besuch hat Sie zu sehr erschöpft.«
»Danke, aber ich kann am besten selbst beurteilen, was mich erschöpft«, erwiderte Sylvester. »Ich gebe zu, es wird nicht mehr sehr lange mit mir dauern, aber bei Gott, ich werde es lange genug aushalten, um meine Angelegenheiten zu ordnen! Wirst du die Kleine heiraten?«
»Ja, ich werde sie heiraten«, sagte Shield. »Bist du zufrieden?«
»Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, den Knoten fest geknüpft zu sehen«, sagte Sylvester. »Zum Glück ist sie keine Papistin. Was hältst du von ihr?«
Sir Tristram zögerte. »Ich kann es kaum sagen. Sie ist sehr jung.«
»Umso besser, wenn ihr Gatte sie noch formen kann.«
»Vielleicht hast du recht, aber ich wollte, du hättest die Sache früher zur Sprache gebracht.«
»Ich habe immer recht. Was hättest du denn gern getan? Herkommen und um sie werben?«, höhnte Sylvester. »Das arme Mädchen!«
»Du zwingst sie zu einer Heirat, die sie leicht bedauern könnte. Sie ist romantisch.«
»Dummes Zeug!«, sagte Sylvester. »Das sind die meisten Frauenzimmer, aber mit der Zeit kommen sie darüber hinweg. Ist dieser verdammte Zieraffe unten?«
»Ja«, sagte Shield.
»Er wird dich in den Schatten stellen, wenn er kann«, sagte Sylvester warnend.
Sir Tristram sah verächtlich drein. »Nun, wenn du erwartest, dass ich mit ihm in Wettbewerb trete, wirst du dich täuschen.«
»Ich erwarte von jedem meiner Familie nichts als Torheit!«, fuhr ihn Sylvester an.
Sir Tristram nahm ein Riechfläschchen vom Nachttisch und hielt es seinem Großonkel unter die Nase. »Du ermüdest dich.«
»Hol dich der Teufel!«, sagte Sylvester schwach. Er hob mit sichtlicher Anstrengung die Hand, nahm das Fläschchen, lag eine Zeitlang schweigend da und atmete die aromatischen Dämpfe ein. Nach ein, zwei Minuten zuckten seine Lippen in einem verzerrten Lächeln, und er murmelte: »Ich würde viel dafür geben, wenn ich euch drei beisammen gesehen hätte. Worüber habt ihr gesprochen?«
»Über Ludovic«, erwiderte Shield mit einer gewissen kühlen Überlegung.
Sylvester ballte plötzlich die Faust; das Lächeln verschwand. Er sagte, und es war kaum lauter als ein Flüstern: »Ich dachte, du wüsstest, dass sein Name in diesem Haus nie erwähnt werden darf! Hältst du mich bereits für tot, dass du es wagst?«
»Auch auf deinem Sterbebett beweise ich dir keine größere Ehrfurcht als sonst«, sagte Shield.
Sylvesters Augen blitzten einen Augenblick auf, aber seine plötzliche Wut löste sich in einem Kichern auf. »Du bist ein unverschämter Hund, Tristram. Hast du dich je um etwas gekümmert, das ich sagte?«
»Sehr selten«, sagte Shield.
»Stimmt durchaus«, sagte Sylvester beifällig. »Verdammich, deshalb konnte ich dich ja immer gut leiden! Was habt ihr über den Jungen gesprochen?«
»Eustacie wollte die Geschichte hören. Anscheinend hast du ihr erzählt, er sei tot.«
»Für mich ist er tot«, sagte Sylvester barsch. »Wozu wäre es schon gut, wenn sie einen Helden aus ihm machte? Verlass dich darauf, das hätte sie getan. Hast du es ihr erzählt?«
»Basil erzählte es ihr.«
»Du hättest ihn daran hindern sollen.« Sylvester lag stirnrunzelnd da, seine Finger zupften leicht an der prunkvollen Decke. »Basil glaubte, was der Junge erzählte«, sagte er unvermittelt.
»Mir war nie klar, warum eigentlich.«
Sylvester warf ihm blitzschnell einen Blick zu. »Du aber nicht – wie?«
»Hat das je einer von uns getan, mit Ausnahme Basils?«
»Er sagte, wir hätten es zulassen sollen, dass er sich seinem Prozess stellt. Ich weiß nicht – ich weiß nicht ...«
»Er hatte nicht recht. Wir taten für Ludovic, was wir nur konnten, als wir ihn nach Frankreich einschifften. Warum quälst du dich jetzt damit?«
»Du hast Ludovic nie gemocht, oder?«
»Du brauchst nur noch hinzuzufügen, dass ich so etwas wie ein Sammler antiken Schmucks bin, Sylvester, und wirst damit so ziemlich das gesagt haben, was Basil unten, bei weitem eleganter, formulierte.«
»Sei kein Narr!«, sagte Sylvester gereizt. »Ich habe dir gesagt, dass er alles nur Mögliche täte, um deine Aussichten zu verderben. Schmeiß ihn hinaus!«
»Da wirst du mich entschuldigen müssen. Es ist nicht mein Haus.«
»Nein, aber bei Gott, auch das seine nicht!«, sagte Sylvester, von einem Wutanfall geschüttelt. »Wenn ich sterbe, wird der Nachlass unter Vormundschaft stehen. Und ihn habe ich nicht zu einem der Treuhänder ernannt.«
»Dann hast du ihm eine Ungerechtigkeit angetan. Wer sind deine Treuhänder?«
»Mein Anwalt Pickering und du«, antwortete Sylvester.
»Guter Gott, was hat dich dazu bewogen, mich zu ernennen?«, sagte Shield. »Ich habe nicht den leisesten Wunsch, deine Angelegenheiten zu verwalten!«
»Dir traue ich, ihm aber nicht«, sagte Sylvester. »Außerdem«, fügte er mit einem Funken Bosheit hinzu, »habe ich Lust, dich in meinem Geschirr laufen zu lassen, selbst wenn ich es nur tun kann, indem ich sterbe. Gieße mir etwas von dem Herzstärkungsmittel dort ein.«
Sir Tristram gehorchte seinem Befehl und hielt Sylvester das Glas an die Lippen. Launischerweise beliebte es Sylvester, es selbst zu halten, aber es war zu sehen, dass selbst diese geringe Anstrengung eine fast zu große Belastung für seine Kraft war.
»Schwach wie eine Katze«, sagte er klagend und ließ Shield das Glas wieder nehmen. »Geh lieber wieder hinunter, bevor dieser Kerl Zeit gehabt hat, Eustacies Gemüt zu vergiften. Ich will, dass ihr in diesem Zimmer heiratet, sobald ich den Pastor herbekommen kann. Schick mir Jarvis herein; ich bin müde.«
Als Sir Tristram wieder in den Salon kam, war der Teetisch hereingebracht worden. Beau Lavenham erkundigte sich nach seinem Großonkel, und als Sir Tristram sagte, er habe ihn viel schwächer vorgefunden, zuckte er leicht die Schulter und sagte: »Ich glaube erst, dass Sylvester tot ist, wenn ich ihn in seinem Sarg sehe. Du hast hoffentlich nicht vergessen, ihm zu erzählen, dass ich pflichtgetreu anwesend bin?«
»Er weiß, dass du hier bist«, sagte Shield, als er die Tasse von Eustacie entgegennahm, »aber ich bezweifle, dass er genügend Kraft hat, heute Abend noch weitere Besucher zu empfangen.«
»Mein lieber Tristram, versuchst du, taktvoll zu sein?«, fragte der Beau amüsiert. »Ich bin völlig überzeugt, dass Sylvester sagte, er wolle verdammt sein, wenn er diesen windigen Kerl Basil sehen wolle.«
Shield lächelte. »So ähnlich. Du solltest eben keinen spitzen Hut tragen.«
»Nein, nein, es kann nicht mein Geschmack in der Kleidung sein, weswegen er eine derartige Abneigung gegen mich hat, denn der ist fast unfehlbar«, sagte der Beau und glättete liebevoll eine Falte an seinem Satinärmel. »Es kann nur daher kommen, dass ich nach dem armen Ludovic der Nächste in der Erbfolge bin, und das ist ja wirklich nicht meine Schuld.«
»Nach menschlichem Ermessen bist du vielleicht gar nicht der Nächste«, sagte Tristram. »Ludovic kann jetzt schon verheiratet sein.«
»Sehr richtig«, stimmte ihm der Beau zu und schlürfte seinen Tee. »Und in gewisser Beziehung könnte vielleicht ein Sohn Ludovics die vielumstrittene Frage, wer an Sylvesters statt regiert, am besten lösen.«
»Der Nachlass ist in Treuhandverwaltung.«
»Deinem düsteren Ausdruck nach zu schließen, Tristram, bist wohl du einer der Treuhänder«, bemerkte der Beau. »Stimmt’s?«
»Ja, du hast recht. Pickering ist mir beigegeben. Ich habe Sylvester gesagt, er hätte dich ernennen sollen.«
»Du bist zu bescheiden, mein lieber Junge. Er hätte keine bessere Wahl treffen können.«
»Ich bin nicht zu bescheiden«, erwiderte Shield. »Ich mag nur die Last des Nachlasses eines anderen Menschen nicht, das ist alles.«
Der Beau lachte, stellte die Teetasse hin und wandte sich an Eustacie. »Es ist mir eingefallen, dass ich hier bloß die Rolle eines Anstandswauwaus zweier Verlobter spiele«, sagte er. »Ich habe jedoch nicht das Gefühl, dass ich für eine solche Rolle geschaffen bin, daher gehe ich jetzt. Liebe Kusine –« Er hob ihre Hand an die Lippen. »Tristram, meine Glückwünsche. Sollten wir uns nicht mehr vorher treffen, dann bestimmt bei Sylvesters Begräbnis.«
Nachdem er gegangen war, herrschte kurzes Schweigen. Sir Tristram blickte zu Eustacie, die still und nachdenklich am Kamin saß. Als hätte sie seinen Blick gespürt, hob sie die Augen und sah ihn in der eindringlichen, nachdenklich abwägenden Art an, die ihr so besonders eigen war.
»Sylvester will uns verheiratet sehen, bevor er stirbt«, sagte Shield.
»Basil glaubt nicht, dass er stirbt.«
»Ich glaube, er ist näher daran, als wir ahnen. Was hat der Arzt gesagt?«
»Er sagte, Sylvester sei sehr unreligiös und insgesamt unerträglich«, zitierte Eustacie wörtlich.
Sir Tristram lachte und überraschte damit seine Base, die sich nicht hatte vorstellen können, dass sich sein Gesicht so plötzlich erhellen konnte. »Das dürfte er bestimmt gesagt haben, aber war das alles?«
»Nein, er sagte noch, es sei nutzlos, dass er weiter herkomme, um Grandpère zu sehen, denn wenn er sagt, Grandpère solle Haferschleim bekommen, schicke Grandpère sofort um eine junge Gans und eine Flasche Burgunder. Der Doktor sagte, das würde ihn umbringen, und du vrai, ich glaube, er ist beleidigt, weil es Grandpère durchaus nicht umbrachte. Also wird Grandpère vielleicht nicht sterben, sondern im Gegenteil wieder ganz gesund werden.«
»Ich fürchte, es ist nur sein Wille, der ihn am Leben erhält.« Shield ging zum Kamin, sah neugierig auf Eustacie hinunter und fragte: »Haben Sie ihn gern? Werden Sie unglücklich sein, wenn er stirbt?«
»Nein«, erwiderte sie freimütig. »Ich habe ihn ein bisschen gern, aber nicht sehr, weil er – er überhaupt niemanden gern hat. Er wünscht gar nicht, dass man ihn gern hat.«
»Er hat Sie aus Frankreich herausgeholt«, erinnerte sie Shield.
»Ja, aber ich wollte gar nicht aus Frankreich herausgeholt werden«, sagte Eustacie bitter.
»Vielleicht damals nicht, aber jetzt sind Sie doch bestimmt froh, dass Sie in England sind?«
»Ich bin gar nicht froh, im Gegenteil, es tut mir sehr leid«, sagte Eustacie. »Hätte er mich bei meinem Onkel gelassen, dann wäre ich nach Wien gegangen, was nicht nur sehr lustig, sondern auch romantisch gewesen wäre, denn mein Onkel ist mit seiner ganzen Familie in einer Berline geflohen, genau wie der König und die Königin.«
»Nicht ganz so wie der König und die Königin, wenn es ihm gelang, die Grenze zu überschreiten«, sagte Shield.
»Ich will Ihnen etwas sagen«, sagte Eustacie erzürnt. »Immer, wenn ich Ihnen eine interessante Geschichte erzähle, geben Sie mir eine Antwort, die wie – die wie diese Lichtputzschere ist – enfin!«
»Es tut mir leid!«, sagte Shield ziemlich erschrocken.
»Nun, mir tut es auch leid«, sagte Eustacie und erhob sich von dem Sofa, »weil es die Konversation sehr erschwert. Ich werde Ihnen jetzt gute Nacht wünschen, mon cousin.«
Wenn sie erwartet hatte, dass er versuchen würde, sie zurückzuhalten, wurde sie enttäuscht. Er verneigte sich nur förmlich und hielt ihr die Tür auf, als sie aus dem Zimmer ging.
Fünf Minuten später kam ihr Mädchen auf einen etwas vehementen Zug an der Klingelschnur hin. Eustacie saß vor dem Spiegel und betrachtete sich in stürmischer Erregung.
»Ich will mich ausziehen, und ich will zu Bett gehen«, verkündete Eustacie.
»Ja, Miss.«
»Und außerdem wünsche ich, ich wäre doch in einem Schinderkarren und allein zu Madame Guillotine gegangen!«
Lucy, auf dem Land aufgewachsen, war eine viel empfänglichere Zuhörerin als Sir Tristram; sie erschauerte und sagte: »Oh Miss, sprechen Sie doch nicht von so etwas! Zu denken, dass man Ihnen den Kopf abgeschnitten hätte – und Sie dabei so jung und schön!«
Eustacie stieg aus ihrem Musselinkleid und fuhr mit den Armen in den Umhang, den Lucy für sie hinhielt. »Und ich hätte doch ein weißes Kleid getragen, und selbst den sansculottes hätte es leidgetan, mich in einem Schinderkarren zu sehen!«
Lucy hatte keine sehr klare Vorstellung davon, wer eigentlich die sansculottes waren, stimmte jedoch bereitwillig zu und fügte in aller Aufrichtigkeit hinzu, dass ihre Herrin reizend ausgesehen hätte.
»Nun, ich glaube, ich hätte wirklich nett ausgesehen«, sagte Eustacie aufrichtig. »Nur nützt es nichts, daran zu denken, denn stattdessen werde ich heiraten.«