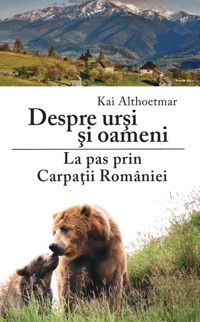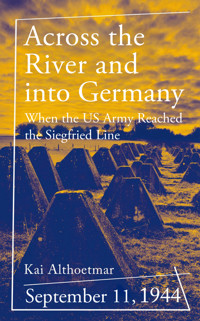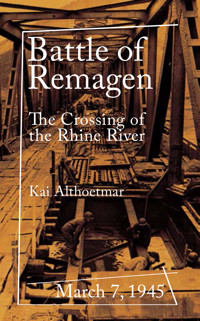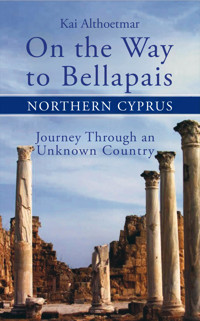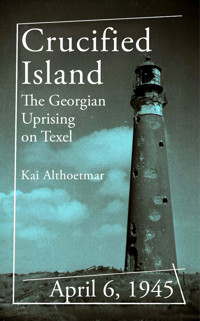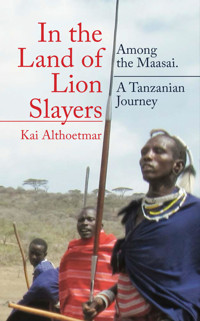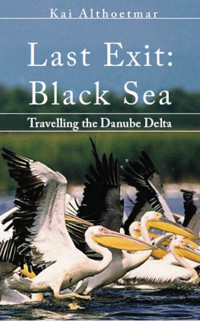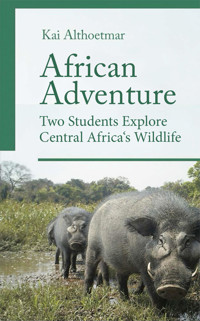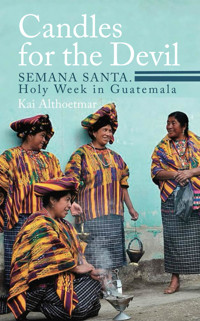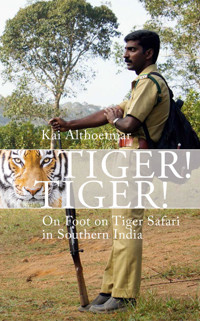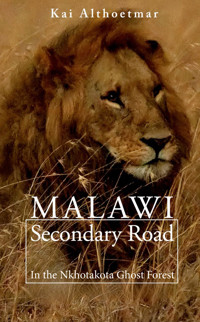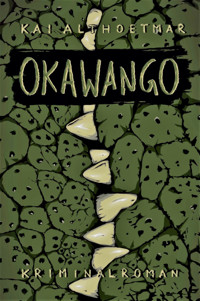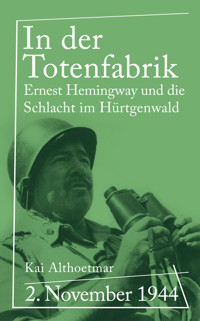5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Zeitpunkte
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Dezember 1944 hat die Rote Armee halb Ungarn überrannt, Budapest steht vor der Einkesselung. Adolf Hitler befiehlt die 6. Panzer-Division der Wehrmacht von Polen nach Ungarn. Ohne das Öl und Bauxit seines letzten Verbündeten kann das Deutsche Reich den Krieg nicht fortsetzen. Unter den Panzergrenadieren ist der 18jährige Landwirtsohn Bernhard Althoetmar aus dem westfälischen Warendorf. Auszüge aus dessen Feldpostbriefen geben authentisch Zeugnis vom Leben und Sterben an der Ostfront, erst am Narew-Brückenkopf in Polen im Herbst 1944, dann im Dezember 1944 in Ungarn am Donauknie. Kurz vor Weihnachten 1944 kommt es im Dorf Kistompa im Süden der heutigen Slowakei zu verlustreichen Kämpfen gegen die vorrückende Rote Armee. Nach den Gefechten ist Bernhard vermißt. 72 Jahre später macht sich sein Neffe - Autor Kai Althoetmar - auf, sein Schicksal aufzuklären. Parallel dazu erzählt der Autor das Kriegsschicksal des jüdischen Viehhändlers Hugo Spiegel, der vor dem Krieg auf dem Hof der Althoetmars häufig zu Besuch war. Hugo Spiegel war der Vater von Paul Spiegel, dem späteren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die vierköpfige Familie durchlebte die "Kristallnacht" in Warendorf, die abenteuerliche Flucht nach Brüssel, Asyl, Krieg und Besatzung, Deportation und am Ende die Rückkehr von drei Familienmitgliedern in die alte Heimat - während Pauls Schwester vermißt blieb... - Für die Recherchen zu diesem Buch ist der Autor nach Ungarn und in die Slowakei gereist und hat die Kriegsschauplätze von damals besucht. - Illustriertes eBook mit zahlreichen Fotos, Karten und Zeitdokumenten. Auch als Taschenbuch und Hardcoverausgabe erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vermißt
Kai Bernhard Althoetmar
Vermißt
23. Dezember 1944. Der Kampf um Ungarn. Eine Spurensuche
Impressum:
Titel des Buches: „Vermißt. 23. Dezember 1944. Der Kampf um Ungarn. Eine Spurensuche“.
Erhältlich als Taschenbuch, Hardcover und eBook.
Verlag und Autor folgen der bis 1996 allgemeingültigen und bewährten deutschen Rechtschreibung.
Die Recherchen zu diesem Buch erfolgten eigenfinanziert und ohne Zuwendungen oder Vergünstigungen Dritter.
Erscheinungsjahr: 2020.
Inhaltlich Verantwortlich:
Edition Zeitpunkte
Kai Bernhard Althoetmar
Am Heiden Weyher 2
53902 Bad Münstereifel
Deutschland
Text: © Kai Bernhard Althoetmar.
Titelfoto: Gedenktafel Soldatenfriedhof Budaörs, Ungarn.
Foto: Kai Bernhard Althoetmar.
„Viele der Länder und viele der Meere habe ich durchfahren,
Ziel meiner Reise ist dies, mein Bruder: der traurige Kult;
daß ich dich zuallerletzt mit der Totengabe beschenke
und die stille Asche vergeblich anspreche,
da ja das Schicksal dich selbst mir weggenommen hat.
Einstweilen aber nun dies, was nach alter Sitte der Väter
uns überlassen bleibt, trauriges Totengeschenk.
Nimm du es an, ganz feucht ist es schon von den Tränen des Bruders. Und in Ewigkeit sei gegrüßt und leb wohl, mein Bruder.“
Gaius Valerius Catull (röm. Dichter, 1. Jh. v. Chr.), am Grab seines früh verstorbenen Bruders in Bithynien am Schwarzen Meer. Aus: „Carmen 101“.
Kapitel 1: Heimat Warendorf
Gleich zwei Schilder sagen dem Fremden die Ortschaft an. Wie die meisten Flecken in diesem Landstrich, in dem die Hunde immerzu bellen und die Toten nicht zur Ruhe kommen, hat das Dorf zwei Namen, einen slowakischen und einen ungarischen: Tupá und Tompa. Am Ortsrand rauscht die Štiavnica, das Flüßchen Schemnitz, munter Richtung Eipel, slowakisch Ipel', ungarisch Ipoly. Alles hat hier mindestens zwei Namen. Und so hockt im Gebüsch, gegenüber der alten verrosteten Brücke, ein kakophoner Schwarm Spatzen, während von irgendwo ein Hahn kräht. Nur aus den Storchennestern auf der Dorfstraße dringt noch kein Laut.
Tupá, Tompa, Kistompa, ein 600-Seelen-Dorf im Gran-Tal im Süden der Slowakei, Heimat von gut 400 Slowaken und knapp halb so vielen Ungarn. Vorletzte Ruhestätte von ein paar Dutzend Deutschen. Bis man sie wieder ausgegraben hat.
Der Dorffriedhof im Schatten der kleinen Kirche. Ein paar morsche Grabkreuze sind umgekippt. Ich will sie mir genauer anschauen, denn ich bin auf der Suche. Eine Frau, Mitte 50, rote Plastikwinterjacke, kurzes schwarzes Haar, vielleicht die Küstersfrau oder die Friedhofsgärtnerin, kommt auf mich zu. Ich frage sie auf Russisch, ob auf dem Friedhof deutsche Soldaten liegen. Sie zeigt mir eine große Grabstätte am Ende des Totenackers, abseits der Gräber der Einheimischen. Der helle Schotter und der Streifen weinroten Mulchs sind offenbar erst vor ein paar Jahren aufgetragen worden. Auf dem grauen Gedenkstein, einem zentnerschweren Findling, steht auf Slowakisch: „Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs“.
Ihrem Redefluß entnehme ich, daß hier deutsche Soldaten begraben waren, die Toten aber inzwischen exhumiert worden sind. Ob hier auch Russen bestattet sind? „Nie“, antwortet sie auf Slowakisch, nein. Auch im Nachbargarten, der an den Friedhof grenzt, seien Tote geborgen worden. Sie zeigt über den Sichtschutz. Eine Grillhütte steht jetzt dort. Ein leichter Wind streicht über die Gräber, die Kirchglocken schlagen Mittag, den Mittag des 27. Februar 2017. Es ist 72 Jahre, zwei Monate und fünf Tage her, daß alles geschah.
Friedhof Tupá. Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Fotos: Kai Althoetmar.
Es ist Sonntag, der 16. Juli 1944, ein kühler, trockener Sommertag mit kaum mehr als 15 Grad im Münsterland, als Bernhard dem Gestellungsbefehl nach Kassel Folge leistet. Der Vater spannt zwei Pferde vor die Kutsche, „Jolante“ und „Sylke“. Die Eltern fahren den Sohn zum Warendorfer Bahnhof. Theodor Althoetmar ist 62, seine Frau Anna 50, als sie ihren Sohn bei der Wehrmacht abliefern. Es ist bereits der zweite.
Die Kutsche kollert die Schotterstraße hinunter, entlang der Getreidefelder und Rübenäcker, vorbei an den Höfen der Nachbarn Freye, Kunstleve, Oertger, Jungemann, zur Freckenhorster Straße, zwei Kilometer nach Norden, bis zur Kreuzung an der Beelener Straße, den gleichen Weg, den die Familie sonntags mit der Kutsche zur Kirche nimmt.
„Die Kutsche war für die Fahrten zur Kirche“, sagt Heinz. Für alles andere tat es der Pferdewagen. „Manchmal, wenn sie Autos sahen, gingen die Pferde auch durch.“ Heinz ist der dritte Sohn. Es ist Sonntag, der 27. November 2016. Mein Vater, Heinz Althoetmar, meine Mutter Annemarie und ich sitzen am Eßtisch meines Elternhauses in Köln-Pesch. Ich möchte die Geschichte meines Onkels Bernhard erfahren. Sie liegt im Dunkel der Zeit, wie ein versunkenens Schiff, das vergessen auf dem Meeresgrund ruht.
Die Pferde gehen nicht durch. Allzuviele Autos sind im fünften Kriegsjahr in Warendorf nicht unterwegs. An der Beelener Straße, der heutigen B64, biegt Theodor Althoetmar nach links in die Bahnhofstraße ab, nördlich verläuft parallel die Bernhardstraße. Am Zug warten andere Einberufene mit ihren Angehörigen. Eine Freundin, die ihn verabschieden könnte, hat Bernhard nicht. Der Abschied von den Eltern und Geschwistern ist einer für immer.
Bernhards letzter erhaltener Brief aus Ungarn datiert vom 17. Dezember 1944, einem Sonntag. Der Feldpoststempel trägt das Datum 26. Dezember 1944. „Liebe Eltern und Geschwister! Herzliche Grüße aus dem Südosten sendet Euch Euer Sohn und Bruder Bernhard.“ Er schreibt vom Kirchgang, die Messe war auf Deutsch. „Man freut sich, daß man wieder in der Kirche war. Die Bevölkerung ist auch sehr katholisch, sie haben eine schöne Kirche. Jetzt wo man zur Kirche war, ist es gleich ein ganz anderer Sonntag wie sonst.“ Vom Kriegsgeschehen ist in dem kurzen Brief mit keinem Wort die Rede. „Nächsten Sonntag haben wir schon Hl. Abend. Hoffentlich liegen wir dann noch hier, dann können wir Weihnachten wieder zur Kirche gehen. Aber ich glaube nicht, daß unser Wunsch in Erfüllung geht.“ Er schreibt, „mit der Verlegung habe ich jetzt 3 Wochen keine Post mehr bekommen. Zu Weihnachten wird sie noch nachkommen“.
Ein letztes Mal Post: Feldpostbrief mit Stempel 26.12.1944.
Ortsnamen erwähnt er nicht. Die Zensur verbietet es. „Gleich müssen wir noch hier zum Kartoffelschälen.“ Ein letzter Gruß. „Bis auf ein frohes Wiedersehen!“
Bernhard, am 4. Juli 1926 als drittes der fünf Kinder Theodor und Anna Althoetmars in Warendorf geboren, im Alter von drei Tagen in der Warendorfer Laurentiuskirche katholisch getauft, hellbraunes Haar, blaue Augen, glatte Gesichtszüge, mit 18 etwa 1,70 Meter groß, die abstehenden Ohren vom Vater. Als still und ausgeglichen wird er beschrieben. Sein Bruder Heinz, der jüngste der fünf, hatte noch Bilder im Kopf, wie Bernhard seine Schwester Mia im Warendorfer Ostbezirk auf dem Rad mitgenommen hatte, das kleine Mädchen hatte lachend auf der Lenkstange gesessen. Zu besonderen Anlässen ließ der Vater einen Fotografen auf den Hof kommen. Die beiden älteren Jungen, Hermann und Bernhard, sind auf den Bildern mit teuren Matrosenanzügen von Bleyle zu sehen. Der kleine Bernhard kam in die Volksschule, lernte ABC und Einmaleins, Sütterlinschrift und seine erste Fremdsprache: Hochdeutsch.
Wenn Bernhard aus der Schule kam, kümmerte er sich um seine Kaninchen, schnitzte Sachen, half auf dem Hof. Die Schulzeugnisse weisen für Rechnen, Religion, Heimatkunde, Fleiß und Betragen meist ein „gut“ aus, für Deutsch die Note „genügend“, ab der sechsten Klasse nur noch „ausreichend“, und in Musik traf Bernhard offenbar gar keinen Ton. Seinem Bruder Hermann stand er damit schulisch in nichts nach, nur daß der Ältere im Fach „Singen“ - wie später auch Heinz – offenkundig gänzlich auf Obstruktion setzte, das aber mit mehr Interesse am Deutsch-unterricht zu kompensieren wußte. So oder so: Die „Unterschrift des Erziehungsberechtigten“ unter den Zeugnissen leistete die Mutter im Namen des Vaters. Sonntags war zweimal Kirchgang, vormittags die Messe, nachmittags die „Christenlehre“ beim Pfarrer. Zu Hause wartete der Streuselkuchen, den die Mutter buk. Auch der Vater ging sonntags zweimal in die Kirche. Am frühen Abend war noch Andacht. Den Weg, je Strecke drei Kilometer, ging der tiefgläubige Bauer, der als junger Mann „Verdun“ überlebt hatte, zu Fuß. Radfahren hatte er nicht gelernt.
1932 baute Theodor Heinrich Althoetmar das Haupthaus neu. Land kaufte er bei jeder guten Gelegenheit zu. 1938 ließ er am neu errichteten Giebel des Haupthauses eine Figur anbringen, den Heiligen Josef. Eine Warendorfer Werkstatt hatte die Kunststeinskulptur gefertigt. Die Nationalsozialisten sahen es mit Argwohn, als der steinerne Josef aufgestellt wurde. Ihre eigenen Hausheiligen standen für ein anderes Kreuz.
Eines Tages wurde Theodor Althoetmar von seinem Viehhändler angesprochen. „Er solle sich nicht selbst gefährden und sich deshalb nicht mehr mit ihm sehen lassen.“ So gibt Heinz Althoetmar das Gespräch wieder. Der Viehhändler hieß Hugo Spiegel und war Jude. Spiegel, geboren am 28. Juni 1905 in Versmold, ein untersetzter, kräftiger Urwestfale mit einem nüchternen, praktischen Verstand, gesellig, bodenständig, den Beruf vom Vater und Großvater geerbt, treuer Besucher von Synagoge, Kirmes und Schützenverein. 1930 hatte er die zwei Jahre jüngere Ruth Regina Weinberg aus Rheda geheiratet, eine zierliche Romantikerin, eine Literatur- und Filmliebhaberin. Am 2. Januar 1931 kam Tochter Rosa zur Welt, das Roselchen. Die Spiegels zogen ins nahegelegene Warendorf und nahmen zwei Zimmer in der Schützenstraße 17.
Auch in Warendorfs Straßen tauchten erste SA-Trupps auf. Die Reichstagswahlen vom 14. September 1930 bescherten der NSDAP einen furiosen Erfolg. Die Nationalsozialisten wurden reichsweit mit 18,3 Prozent hinter der SPD zweitstärkste Partei - nach 2,3 Prozent bei den Wahlen im Mai 1928. Die beiden Parteien des politischen Katholizismus in Deutschland, die Deutsche Zentrumspartei und die Bayerische Volkspartei (BVP), kamen zusammen auf 14,8 Prozent. Anders der Wahlkreis Münster: 63,2 Prozent für Zentrum und BVP, 4,4 Prozent für die Nationalsozialisten. Die Weltwirtschaftskrise brachte Not und Hunger. Hugo Spiegels Geschäfte liefen schlechter und schlechter, der Fleischkonsum ging zurück. Hitler versprach Arbeit und Ordnung, und immer mehr Wähler vertrauten ihm. Aus den Wahlen vom 31. Juli 1932 ging die NSDAP mit 37,4 Prozent reichsweit als stärkste Partei hervor, während Zentrum und BVP auf zusammen 15,7 Prozent kamen. Im Münsterland war die politische Treue des ländlich-katholischen Milieus zum Zentrum ungebrochen: 65,0 Prozent Stimmanteil. Die NSDAP brachte es auf 12,3 Prozent.
Der 30. Januar 1933. Adolf Hitlers Ernennung zum Reichskanzler des Deutschen Reichs. Im Ostbezirk 30 war seit zwölf Tagen die Wiege mit dem dritten Sohn belegt. In Warendorf brüllte ein Haufen SA-Männer „Juda verrecke!“, im April 1933 waren die ersten Scheiben jüdischer Geschäfte beschmiert.
Theodor und Anna Althoetmar 1936 mit Kindern und Oma Gertrud. Links oben: Bernhard, rechts davon Gertrud und Hermann, unten links Heinz, rechts unten Mia.
Bei den letzten freien Reichstagswahlen, die bereits von Übergriffen der SA überschattet waren, brachten es Zentrum und BVP am 5. März 1933 im Münsterland nochmals auf 55,1 Prozent, die NSDAP auf 23,5 Prozent. Reichsweit sah es umgekehrt aus: 43,9 Prozent für die Nazipartei, 11,3 Prozent für das Zentrum, 3,7 Prozent für die BVP. Im Landkreis Warendorf kamen das Zentrum auf 61,2 Prozent und die NSDAP auf 29,6 Prozent.
Besuch, darunter SA-Männer, auf dem Hof im Warendorfer Ostbezirk 1934. Unten links sitzend: Hermann. Zwischen den Mädchen Bernhard, im Kinderwagen Heinz. Fotos: Bildarchiv Kai Althoetmar.
Der organisierte Boykott jüdischer Geschäfte begann am 1. April 1933. In Warendorf titelte der Neue Emsbote: „Die Durchführung des Abwehrboykotts. Anordnungen des Zentralkomitees der NSDAP“. SA und SS stellten vor den Läden Posten auf. „Die Wachen haben die Aufgabe, dem Publikum bekannt zu geben, daß das von ihnen überwachte Geschäft jüdisch ist.“ Juden wurden von den neuen Machthabern zur Rasse erklärt. „Die Religion spielt keine Rolle“, verlautbarte der Neue Emsbote. „Katholisch oder protestantisch getaufte Geschäftsleute aller Firmen jüdischer Rasse sind im Sinne dieser Anordnung ebenfalls Juden.“ SA-Leute fotografierten in Westfalen im September 1933 Bauern und Metzger, die mit „Viehjuden“ Geschäfte machten. Die, die ihren jüdischen Geschäfts-partnern die Stange hielten, fanden sich als „Judenfreunde“ diffamiert in der NS-Presse und an Anschlagstellen wieder.
Im Spätsommer 1935 ging es auch den jüdischen Viehhändlern an den Kragen. Auf Vorstoß des Warendorfer Ortsgruppenleiters der NSDAP, Heinrich Vannahme, wurden die Juden vom Fettmarkt, dem allherbstlichen großen Viehmarkt, ausgeschlossen. „Gleichzeitig bitte ich aber dafür Sorge zu tragen, daß genügend arische Viehhändler zu diesem Viehmarkte zugelassen werden, sodaß in dem Marktbetrieb keine Stockung eintritt“, schrieb Vannahme am 22. August 1935 an den Beauftragten für Viehhandel in Ostbevern. Zaghafte Einwände der Fleischerinnung wurden abgewimmelt. Die Bauern sollten gezwungen werden, ihre Geschäfte mit den jüdischen Viehhändlern zu beenden.
Einer der vielen in Sütterlin geschriebenen Feldpostbriefe Bernhard Althoetmars, die der Familie erhalten geblieben sind, bezeugt, daß der Fettmarkt auch im letzten Kriegsherbst noch stattfand. Im Brief an seine Schwester Gertrud vom 25. Oktober 1944 ist zu lesen: „Heute ist ja Fettmarkt in Warendorf, ich wollte, ich könnte auch mit dabei sein, aber der Iwan wartet auf uns. Ich will hoffen, daß wir nächstes Jahr um diese Zeit wieder zu Hause sind.“ Von daheim hat er erfahren, daß der Vater einen neuen Bullen gekauft hat, „mit dem Alten war es doch gefährlich“.
Im Viehhandel hatten Juden in Deutschland eine starke Position. Jahrhundertelang war der eines der wenigen Gewerbe, die den Juden auf dem Land offenstanden. 60 Prozent der deutschen Viehhändler sollen im frühen 20. Jahrhundert jüdisch gewesen sein.1 Ende 1937 waren von den zwölf Viehhändlern in Warendorf sechs Juden.
Mit dem Klischee vom „reichen Viehjuden“ war es nicht weit her. Noch vor dem Ausschluß vom Fettmarkt hatte Hugo Spiegel am 2. Juni 1935 an den Regierungspräsidenten in Münster geschrieben, man möge ihm die Gebühr von 50 Reichsmark für den Wandergewerbeschein herabsetzen. Spiegel schrieb: „Durch die schlechte wirtschaftliche Lage der letzten Jahre bin ich verarmt, so daß ich fast gar keine Barmittel besitze. Ich schlachte wohl mal eine Ziege, ein Kalb oder auch ein Schaf, während ich Kühe gar nicht kaufen kann. Das Geld zum Bezahlen der Tiere muß ich mir dann bei guten Menschen leihen. [...] Ich bin in Not.“ Ein Polizei-Oberwachtmeister stellte Nachforschungen über Spiegel an und hielt am 17. Juni 1935 in seinem Bericht fest: „Spiegel übt sein Gewerbe nur in sehr kleinem Umfang aus. Er beschäftigt keinerlei Mitarbeiter und hat auch sonst keine andere Beschäftigung. Die Familie lebt in sehr ärmlichen Verhältnissen.“ Der Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter Lorenz Tewes lehnte dennoch ab, da Hugo Spiegel „nicht mehr als zuverlässig gilt“.2
Am 15. September 1935 erließ das NS-Regime die Nürnberger Rassegesetze: das „Reichsbürgergesetz“ und das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“. Juden durften keine Nicht-Juden mehr heiraten, keine öffentlichen Ämter mehr ausüben, verloren ihr Wahlrecht, alle jüdischen Beamten wurden entlassen. Von den rund 9.000 Warendorfern wurden zwölf jüdische Bürger aus der Wahlkartei gestrichen.
Das „Blutschutzgesetz“ schrieb auch vor, daß „Juden weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren nicht in ihrem Haushalt beschäftigen“ durften. Eine Warendorfer Hausangestellte, die bei einem gut situierten Juden arbeitete und 1936 heiraten wollte, bat Bürgermeister Tewes, eine Ausnahme zu machen. Sie schrieb: „Ich wäre also für die Zeit von dem Ausscheiden aus meiner jetztigen Stelle bis zu meiner Hochzeit brotlos. Da das nicht im Sinne des Gesetzes sein kann, bitte ich ergebenst, dahin zu wirken, daß mir gestattet werde, meine jetztige Stelle noch bis zu meiner Hochzeit beizubehalten.“3 Vier Tage später war der Antrag abschlägig beschieden.
Silvester 1937 kam das zweite Kind der Spiegels zur Welt, Paul. Jahre später sollte der kleine Paul seinen Vater häufig auf die Höfe rund um Warendorf begleiten. Später, am Laurentianum, dem Warendorfer Gymnasium, war er einige Jahre ein Schulkamerad von Heinz Althoetmar. Nochmals 50 Jahre später wurde Paul Spiegel über Warendorf hinaus bekannt - als Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.
An die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wird er keine Erinnerung gehabt haben: die „Kristallnacht“, in der im Deutschen Reich Synagogen zu Schutt und Asche und die Scheiben jüdischer Läden und Wohnhäuser zu Scherben wurden. Der 17jährige polnische Jude Herschel Grynszpan hatte zwei Tage zuvor in Paris den deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath niedergeschossen. Sein Motiv war Rache. Grynszpans Eltern waren Ende Oktober 1938 als polnische Staatenlose nach Polen abgeschoben worden, nachdem Polen angekündigt hatte, deren Pässe nicht zu verlängern. Die von Deutschland geforderte Garantie einer Rückkehrmöglichkeit für die Staatenlosen, zumeist verarmte Juden, verweigerte Warschau. Die Gestapo verfrachtete daraufhin die Betroffenen in Züge und Laster Richtung polnischer Grenze bei Bentschen (Zbąszyń). Tausende von ihnen mußten tagelang im Niemandsland zwischen den Grenzposten ausharren. Zwei Tage nach dem Attentat starb vom Rath. Am gleichen Tag feierten die Nationalsozialisten im Reich ihren Gedenktag: den Tag des Hitler-Ludendorff-Putsches von 1923.
Sechs Jahre später sollten die Nationalsozialisten ein letztes Mal Gelegenheit haben, den toten Putschisten von 1923 zu huldigen. Bern-hards Brief von der Front, datierend vom 9. November 1944, berichtet kurz von dem Pflichtgedenken: „Zur Feier des Tages gab es heute morgen Kuchen zum Kaffee. Kuchen gibt es hier nicht oft zu sehen, aber Zigaretten und Tabak, das schon“.
In vielen Orten des Reichs rotteten sich am Abend des 9. November 1938 SA- und SS-Angehörige zusammen, instruiert von den örtlichen Propagandaämtern der NSDAP. Ungehindert zog der antisemitische Mob durch Deutschland. So auch durch Warendorf. „In Warendorf wurde das Pogrom hauptsächlich von SA-Trupps aus der Umgebung veranstaltet“, schreibt Paul Spiegel in seinen Memoiren. „Die braun Uniformierten gingen systematisch vor. Sie zerstörten die kleine Synagoge in der Freckenhorster Straße, zerrissen die Gebetbücher und Thorarollen, warfen sie auf die Straße oder stahlen sie als ‘Souvenir’.“4 Am 11. November 1938 schrieb der Neue Emsbote unter der Überschrift „Gerechte Empörung. Judenfeindliche Kundgebungen im Münsterland“: „Die noch in jüdischen Händen befindlichen Geschäfte wurden von der empörten Volksmasse einschließlich der Inneneinrichtung zerstört. [...] In Borghorst, Rheine, Warendorf und Burg-steinfurt zündete man die Synagogen an oder zerstörte sie auf andere Weise.“ Viele Täter tobten sich in Nachbarorten aus, wo man sie nicht kannte.
In Warendorf wurden mindestens vier Juden verletzt, sieben Wohnungseinrichtungen zerstört, in vier Wohnhäusern die Fenster eingeschlagen oder die Türen beschädigt.5 Einer der vier Verletzten war Hugo Spiegel. In der Nacht überfiel ein Schlägertrupp auch seine Wohnung. „Mein Vater wurde aus dem Bett gezerrt und auf die Straße getrieben. Dort rissen ihm die Nazis die Kleider vom Leib.“ Die SA-Schläger schleiften Hugo Spiegel an das Ufer der Ems und prügelten auf ihn ein. Niemand ging dazwischen. Spiegel wurde am rechten Bein und dem rechten Ohr verletzt. „Meine Mutter rannte zu mehreren Ärzten und bat sie, ihren Mann zu behandeln. Alle lehnten ab.“ Erst im HNO-Arzt fand sie einen, so berichtet Paul Spiegel, dem der Eid des Hippokrates noch etwas sagte.6
In den darauffolgenden Tagen begann die Inhaftierung männlicher Juden. Was sich beschönigend „Schutzhaft“ nannte, endete häufig mit Deportation ins KZ. Am 11. November 1938 ging im Landratsamt Warendorf ein Funkspruch der Leitstelle der Staatspolizei Münster ein: „Sämtliche arbeitsfähigen männlichen Juden im Alter von 18 bis 50 Jahren, aber nur Reichsangehörige, sind sofort festzunehmen, falls Unterbringung im Polizeigefängnis nicht möglich, sind sie in Gerichtsgefängnissen unterzubringen.“7 Landrat Josef Gerdes meldete sieben Festnahmen. Fünf weitere Juden seien krank oder arbeitsunfähig. Einer der Arbeitsunfähigen war Hugo Spiegel. Der Landrat schrieb: „Im hiesigen Krankenhaus befindet sich weiter der Jude Hugo Spiegel, Schützenstr. 17, geb. 28.5.1905. Spiegel ist in der Nacht vom 9. zum 10.11.1938 wegen Widerstandsleistung verletzt worden. Nach amtsärztlichem Gutachen leidet er z.Zt. an einer Muskelquetschung des rechten Oberschenkels und ist für 1-2 Wochen nicht arbeitsfähig.“8
„Stolperstein“ des Bildhauers Gunter Demnig vor Spiegels Haus in der Warendorfer Schützenstraße 17. Foto: Wikimedia.
Die Festgenommenen wurden Tage später wieder entlassen - die Verhandlungen über die Arisierung ihrer Geschäfte hatten Vorrang. Protest regte sich so gut wie nicht. Die allermeisten Pfarrer auf den Kanzeln schwiegen zu den Novemberpogromen. Unmittelbar nach den Gewaltausbrüchen erließ die NS-Regierung die „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ und am 3. Dezember 1938 die „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“. Juden durften nicht mehr Einzelhändler sein, nicht mehr auf Märkten und Messen verkaufen, keine Handwerksbetriebe mehr führen, nicht mehr als Geschäftsführer arbeiten, keiner Genossenschaft mehr angehören, mußten ihre Immobilien verkaufen und verloren die Kontrolle über ihre Ersparnisse. Das Vermögen ging in „arische“ Hände, zum „mäßigen Verkehrswert“ - vielfach ein Synonym für Schleuderpreise. 850 jüdische Familien Westfalens, überwiegend Kleinbauern, verloren Grund und Boden.9
Schon bald nach den Pogromen verlor Hugo Spiegel seinen Gewerbeschein und damit seine wirtschaftliche Existenz. In Europa standen die Zeichen auf Krieg. Der Streit um Danzig und die schwierige Lage der deutschen Minderheit in Polen kochte, im März 1939 marschierten deutsche Truppen in Prag ein und annektierten die „Rest-Tschechei“. Der 33jährige Westfale traf eine Entscheidung, und die hieß: Exodus. Seine Tochter Rosa brachte er bei Verwandten im niederländischen Apeldoorn im Gelderland unter. Weil er dort keine Arbeit fand, reiste er am 13. Mai 1939 nach Brüssel. Dort fand er bei einem Metzgermeister eine Gehilfenstelle und ein Zimmer.
Hugo Spiegel entschloß sich, Ruth und den kleinen Paul nach Brüssel zu holen. „Wir konnten nicht einmal unseren Haushalt auflösen, das hätte zu viel Aufmerksamkeit erregt“, schreibt Paul Spiegel. „Meine Mutter hatte in Köln den Namen eines SS-Offiziers aus Aachen erfahren, der Juden illegal nach Belgien schleuste. Der Menschenschmuggler verlangte eine exorbitante Summe, aber wir hatten keine Zeit zu verlieren. Mutter kratzte ihre letzten Ersparnisse zusammen und zahlte, was von ihr gefordert wurde.“ Auf dem Rücken des SS-Mannes durchquerte der westfälische Hosenmatz einen Nebenarm des Rheins. Die Strömung riß Paul vom Rücken seines Schleppers. „Ohne zu zögern schwamm mir der SS-Mann hinterher und fischte mich heraus.“ Der süffisante Hinweis seiner Mutter, ein SS-Mann habe ihm das Leben gerettet, begleitete fortan Paul Spiegels Kindheit.10
Mit dem Krieg kam die Kommandowirtschaft. „Regelmäßig war Viehzählung“, erinnert sich Heinz. Als Kontrolleure auf dem Hof prüften, ob dort schwarz geschlachtet wurde, verplapperte sich der kleine Heinz. Er fragte, „wo denn das Kälbchen sei“. Die Mutter drehte es irgendwie hin.
Seit dem 27. August 1939 wurden alle Höfe im Reich zwangsbewirtschaftet. „Hofberater“ kontrollierten die Verwendung der Futter- und Düngemittel, die den Landwirten zugeteilt worden waren, und hielten nach, ob die Bauern das Anbau- und Ablieferungssoll erfüllten. Eine Hofkarte hielt die Kennzahlen fest: Zahl der Familienmitglieder und Arbeitskräfte, Flächen, Bodenqualität, bisheriger Anbau und Erträge, Viehbestand, Gerätepark. Mit diesen Daten wurde errechnet, was der Bauer zu festen Preisen abzuliefern hatte und was er zum Eigenbedarf behalten durfte. Der NS-Staat wollte sichergehen, daß sich eines nicht wiederholte: die Hungerkatastrophe des Ersten Weltkriegs mit Hunderttausenden von Toten im Steckrübenwinter 1916/17.
Die Produktivität der Höfe sank dennoch von Kriegsjahr zu Kriegsjahr - ganz ohne Verschulden der Bauern. Erst wurden bei Kriegsbeginn die Pferde gemustert und eingezogen, später die Söhne, dann die Treibstoffzuteilung für die Traktoren gestrichen, schließlich Phosphor- und Stickstoffdünger rationiert. Fehlende Erträge wurden den besetzten Ländern abgepreßt und ins Reich geschafft. Der große Hunger kam erst, als sich die deutschen Truppen auf heimischem Boden wiederfanden.
Drakonischen Strafen zum Trotz war Schwarzschlachten auf dem Land weit verbreitet. Die amtlichen Rationen waren knapp bemessen, manche Bauern wollten den Papierkrieg einer legalen Hausschlachtung umgehen, andere machten ein Geschäft daraus, wieder andere sorgten für schlechtere Zeiten vor oder fütterten selbstlos Dritte mit durch: Untergetauchte, Ausgebombte, halbverhungerte Zwangsarbeiter. Das Regime verfolgte Schwarzschlachtungen und andere Verstöße streng. Eigens wurden Sondergerichte geschaffen. Zwei Drittel aller dort verhandelten Delikte waren illegale Schlach-tungen. 1942 wurden in Westfalen fünf Angehörige einer „Schwarzschlachtergesellschaft“ zum Tode verurteilt. Die Männer aus Wiedenbrück, 30 Kilometer von Warendorf entfernt, hatten in einer Scheune 50 Schweine und 27 Kälber schwarz geschlachtet und das Fleisch an Gaststätten verkauft.11 Theodor Althoetmar hätte für das verschwun-dene Kalb das Zuchthaus gedroht.
Frankreichs Kriegserklärung an das Deutsche Reich nach Hitlers Angriff auf Polen rächte sich im Frühsommer 1940. Dem anfänglichen „Sitzkrieg“ mit gelegentlichen Grenzscharmützeln an der Saargrenze folgte der deutsche „Blitzkrieg“ im Westen. Frankreichs Armee kollabierte, das Land war binnen Wochen besetzt, die Benelux-Staaten okkupierte Deutschland gleich mit. In Brüssel hörten die Spiegels die Marschstiefel von Wehrmacht und SS auf das Straßenpflaster schlagen. Zu viert drängte sich die Familie in einem möblierten Zimmer in der vierten Etage der Rue Theodore Verhaegen 42 im Stadtteil Saint-Gilles unweit der Brüsseler Altstadt. „Die deutschen Behörden und ihre belgischen Helfer gingen unverzüglich daran, die Juden zu registrieren und gleichzeitig zu entrechten“, schreibt Paul Spiegel.12 Schon in den ersten Tagen der Besatzung wurde Hugo Spiegel verraten und von belgischen Polizisten auf offener Straße verhaftet. Eine Odyssee durch die Lager begann. Erste Station: das Internierungslager Gurs im Südwesten Frankreichs. Ruth Spiegel harrte von nun an mit den beiden Kindern allein in der Wohnung aus. Um über die Runden zu kommen, putzte sie bei anderen jüdischen Familien.
Ab Oktober 1941 wurden die meisten der noch im Altreich lebenden rund 150.000 Juden in die Ghettos des Ostens deportiert, die meisten nach Riga, Reval (Tallinn), Kauen (Kaunas) und Minsk. Am 13. Dezember 1941 fuhren sechs Warendorfer Juden nach Riga in den Tod. Sieben weitere fanden in anderen Ghettos oder Vernichtungslagern ihr Ende. Etwa 300.000 jüdische Deutsche waren rechtzeitig ausgewandert oder geflohen. 31 Warendorfer Juden, einschließlich der Spiegels, fanden in Uruguay, Argentinien, England, Brüssel, New York, Chicago, San Francisco oder Johannesburg Zuflucht.
Ende 1942 fertigte Warendorfs Bürgermeister Tewes eine kurze Notiz. Anlaß war der 1. Dezember, traditionell der Tag, an dem die Warendorfer Synagogengemeinde ihren Vorstand wählte. In der Akte mit dem Aktenzeichen 1530, in der die alten Protokolle dieser Wahlen lagen, notierte er: „Warendorf ist frei von Juden, darum z.d.A.“ - zu den Akten.13
Im Ostbezirk wurde das Menetekel nur langsam sichtbar. Bernhard Althoetmar schloß 1942 die Hauptschule ab, machte pflichtgemäß seinen „Grundausbildungskurs/Fachkurs für den Land-Luftschutz“, wie der Oberluftschutzführer von Warendorf Ende 1942 bescheinigte, und absolvierte die Landwirtschaftsschule in Freckenhorst. Vom Ostbezirk waren es für den Jungen keine vier Kilometer mit dem Rad.
Alte Quittungen aus den Jahren 1943 und 1944, ausgestellt vom Reichsnährstand, Landesbauernschaft Westfalen, bescheinigen die Kosten: 50 Reichsmark Schulgeld zahlte der Vater im Jahr. Als zweitältester Sohn wäre Bernhard kaum Hoferbe geworden. Er hätte später einen Bauernhof pachten oder anderswo einheiraten müssen. Aber die Erbfolge war nicht in Stein gemeißelt. Der Vater tat sich schwer mit Hermann, dem ältesten Sohn. Zu eigenwillig war ihm der.
Zu wenig Demut. Sie vertrugen sich nicht recht, der stockfromme Altbauer und der selbstbewußte Erstgeborene, der oft anderes als Hof und Kirche im Kopf hatte, in die Wirtschaft ging, mehr las, als ein Bauer Zeit zu haben pflegte. „Sobald die Zeitung da war, ließ Hermann alles stehen und liegen“, erinnert sich sein Bruder Heinz. Alles war interessant und mußte gelesen werden. Die Glocke, für den jungen Hermann das Fenster zur Welt. Als Hoferbe aber schien er nicht mehr gesetzt.
Hermann, am 16. Oktober 1922 geboren, war schon 1941 zur Wehrmacht einberufen worden. Nach dem Besuch von Volksschule und Landwirtschaftsschule arbeitete er auf dem elterlichen Hof und einem Nachbarhof. Für Polen- und Frankreichfeldzug war Hermann noch zu jung. Dennoch sollten es fast vier Jahre werden, die er für „Führer, Volk und Vaterland“ zu opfern hatte. Nach Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges kam Hermann als Flaksoldat zur Luftwaffe, war stationiert als Kanonier in Königsberg in der Immelmann-Kaserne bei der Schweren Flak-Ersatz-Abteilung 11, 3. Batterie.
Königsberg war nach Beginn des „Unternehmens Barbarossa“ am 22. Juni 1941 mehrfach Ziel sowjetischer Luftangriffe. Die Hauptstadt Ostpreußens wurde bereits in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 1941 von Fernbombern angegriffen. Bis in den Sommer 1942 folgten sieben weitere Angriffe der sowjetischen Luftstreitkräfte. Verglichen mit Infanteristen oder Panzergrenadieren an der Ostfront hatte Hermann ein scheinbar leichtes Los gezogen. Im Ostbezirk gingen zahllose Briefe und Karten aus Königsberg ein. Militärisches durfte nicht erwähnt werden. Weihnachten 1941 mußte im Ostbezirk 30 ohne den ältesten Sohn stattfinden. Vom 7. Dezember 1941 datiert eine Karte an Heinz mit der Ankündigung: „Dieses Jahr Weihnachten werde ich nicht bei Euch sein. Wann ich jetzt Weihnachten wieder bei Euch bin, weiß ich nicht.“ Den kleinen Bruder ließ er wissen: „Hier kommt der Nikolaus nicht.“ Dem Achtjährigen trug der zuweilen schelmische Hermann auf: „Bald kommt das Christkind ja, mußt schön artig sein, sonst kommt es nicht.“
Der Kriegsdienst war Hermann von Anfang an zuwider, er wollte zurück zu Familie und Hof. Am 26. Juli 1942 schrieb er nach der Rückkehr zur Truppe: „Die ersten Tage denkt man ja doch oft an zu Haus und dann ist man das ganze Kommißleben so satt.“
Hermann (unten, ohne Helm) 1941 mit Kameraden in der Kaserne in Königsberg.
Im Sommer 1942, als die Deutschen und ihre Verbündeten die Offensive in Rußland wieder aufnahmen und Richtung Don und Kaukasus vorstießen, glaubte Hermann: „Es geht ja immer näher dem Kriegsende zu.“ Und schon im nächsten Satz Skepsis und ein sich Gott fügender Fatalismus: „Aber weiß Gott, wie lange es noch dauern wird.“
Biergartenbesuch, in der Mitte Hermann. Fotos: Bildarchiv Kai Althoetmar.
Am Ende des Briefes heißt es dann doch wieder: „Wahrscheinlich dauert es noch 2 Jahre oder 4 oder 5 Jahre.“ Den Krieg haßte die Familie, das Regime war nicht das Ihrige. Dem Vaterland, der Heimat wollte man den Dienst aber nicht verweigern und die Bedrohung durch Stalins Armeen, die Gegnerschaft zum kämpferisch atheistischen Sowjetkommunismus war real. Hermann versuchte noch etwas Gutes im Schlechten zu sehen, als er, der Flaksoldat, schrieb, es habe „ja doch auch seinen Zweck, daß wir hier liegen.