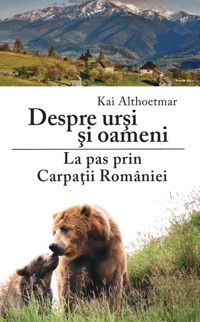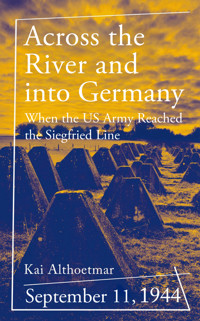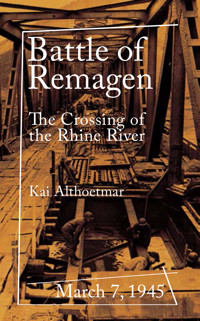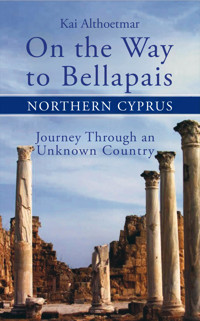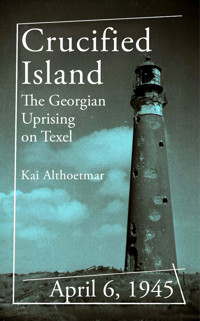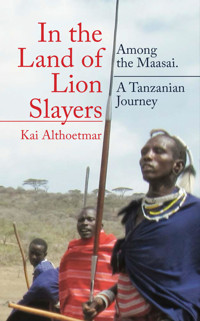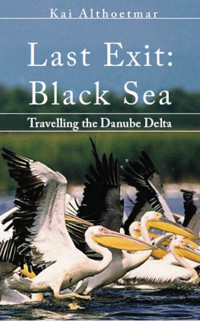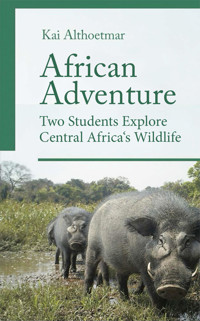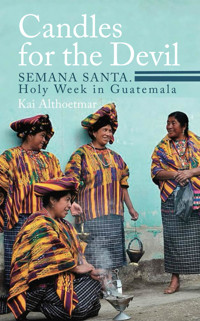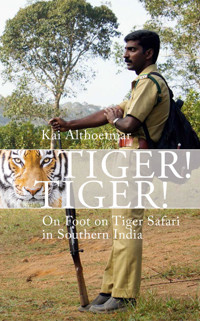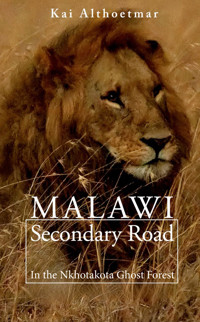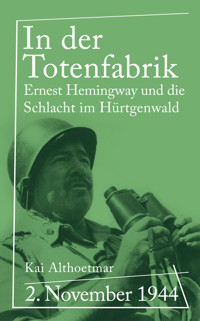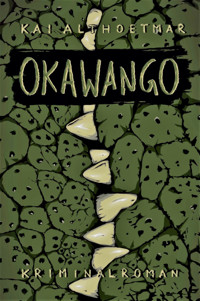
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magic Mystery Press
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Namibia im Mai 1995. Im Norden des Landes findet ein Fischer im Okawango den Torso einer weißen Frau, die seit Wochen vermißt wird. Die Tote ist eine britische Anthropologin und Opfer eines Krokodilangriffs geworden. Mit ihrem Mann wollte sie sich für ein Forschungsprojekt in einem Fischerdorf an der Grenze zu Angola niederlassen. Aus der Vermißtenanzeige geht hervor, daß der dortige Traditional Leader von dem Paar eine Mutprobe gefordert hatte: den Okawango nachts in Begleitung eines Ruderbootes zu durchschwimmen. Die Windhoeker Polizeiermittler Erwin Kandetu und Carl Barnard werden in das Okawango-Dorf beordert, um dem Fall nachzugehen. Sie tauchen ein in eine Welt, in der uralte Traditionen und archaischer Ahnenglaube im Ringen mit der Moderne sind. Schon bald keimt der Verdacht, daß hinter dem Tod der jungen Wissenschaftlerin mehr als ein Unfall steckt … Kriminalroman nach einer wahren Begebenheit, die sich 1995 im Norden Namibias ereignet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Okawango
Kai Althoetmar
Okawango
Kriminalroman
Impressum:
Titel des Romans: „Okawango. Kriminalroman“.
Erscheinungsjahr: 2023.
Inhaltlich Verantwortlicher:
Murder Mystery Press
Kai Althoetmar
Am Heiden Weyher 2
53902 Bad Münstereifel
Deutschland
Text: © Kai Althoetmar.
Cover/Illustrationen: © Stella Althoetmar.
Hinweise:
Die Zitate aus dem Roman „Alles zerfällt“ („Things Fall Apart“) von Chinua Achebe geben die Übersetzung von Uda Strätling wieder, erschienen im S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 2012.
Verlag und Autor folgen der bis 1996 allgemeingültigen und bewährten deutschen Rechtschreibung.
Okawango
Kriminalroman
Erwin Kandetu kannte sich mit den Straßen im Windhoeker Komponistenviertel zigmal besser aus als mit all den Kompositionen der Brahms', Wagners, Verdis, Mozarts und wie sie alle hießen. Geruhsam steuerte er den kleinen Toyota die Bahnhofstraße hinunter, passierte die John Meinert und bog von der Bülowstraße in die Brahmsstraße. Während er das Technikon der Universität links liegen ließ, schaltete er das Blaulicht ein und gab Gas. In der Schubertstraße lugten schon die ersten Nachbarn hinter Gardinen und Zäunen hervor. Ein Wachhund nach dem anderen schlug an. Davon abgesehen war das Viertel so ausgestorben wie immer. Friedhof der Reichen mit Doppelgarage, hatte seine Frau einmal gesagt. Mit Schwung nahm Erwin die Einfahrt zum Bungalow mit der Hausnummer 23. Kies spritzte in die verdorrten Rabatten seines älteren Kollegen. Erwin ignorierte Klingel wie Türklopfer und ging Richtung Garten und Terrasse. Die Terrassentür war angelehnt. Carl Barnard saß vor dem Fernseher und schaute Rugby. Es war Montag, der 29. Mai 1995, kurz vor zwölf.
„Du hast wieder dein Telefon ausgehängt?“ Erwins Begrüßung war mehr Feststellung als Frage, und seine Stimme klang dunkel und leicht behäbig wie immer. Carl zeigte gönnerhaft auf das Sixpack „Hansa“-Pilsener, das neben einem Reisemagazin lag. „Beer from the dry country - Bier van die dorsland“ versprach der Schriftzug auf den Büchsen in gleich zwei Sprachen. „Frankreich gegen Tonga. Videoaufzeichnung von Freitag“, sagte Carl knapp. Die Franzosen führten in Pretoria klar.
„Und bei Tonga gegen Elfenbeinküste nächste Woche schließt du dich im Keller ein, ja?“
Carl wendete den Blick vom Fernseher. Mit einem breiten Grinsen, als wollte er Jack Nicholson doubeln, sagte er mit seiner angerauhten Tenorstimme: „Ich habe frei. Überstundenausgleich! Du darfst gerne arbeiten, Chef. Ich gucke jetzt Rugby.“
Erwin schüttelte leicht den Kopf, zeigte auf das Reisemagazin. „Lust zu verreisen, Carl?“
Carl preßte die Lippen wie ein bockiges Kind zusammen, bewegte den Kopf mechanisch wie ein Wackeldackel nach links und rechts. Draußen bellten Rex und Gildo, die zwei Schäferhunde, die der Nachbar zur Rechten auf Schwarze abgerichtet hatte. „Nur zur Sicherheit“, wie er Erwin einmal treuherzig versichert hatte.
Erwin zog die Augenbrauen hoch und erklärte mit einem schadenfrohen Grinsen: „Es geht in dein altes Einsatzgebiet.“
Carl wendete den Kopf vom Fernseher und schaute leicht säuerlich drein. Nach einer Dienstreise mit Erwin war ihm heute nicht. Das Rugby-Ei flog nun ohne sein Augenmerk durch das Loftus Versfeld Stadium. Erwin warf seinem Kollegen einen großen Umschlag auf den Wohnzimmertisch. „Willst du selbst lesen? Oder soll ich es extra für Hilfssheriffs zusammenfassen?“
Jeder Widerstand war zwecklos. Carl öffnete entnervt eine Bierdose und schob sie zu Erwin. „So viel Zeit ist wohl noch.“ Erwin griff zu.
„Erzähl!“ sagte Carl.
Chief Inspector Erwin Kandetu vom Crime Investigation Directorate hatte erst am Vormittag von Commissioner Joseph Embanga die Unterlagen erhalten. Das Briefing war ihm recht nebulös vorgekommen. Angeblich war das Gesundheitsministerium involviert. Einige der Hintergrundinformationen unterlagen strenger Geheimhaltung. Der Tintenpalast hatte mündliche Ordern gegeben. Und zu alledem wäre der reinen Lehre nach das Betrugsdezernat zuständig gewesen und nicht die Serious Crime Unit von der zweiten Etage.
Auf Nachfrage hatte Embanga äußerst ausweichend geantwortet. Erwin war bald klar geworden, daß sein Vorgesetzter in diesem Fall eine Marionette von „ganz oben“ war und den obskuren Auftrag nur schnell loswerden wollte. Bloß weg damit! „Wir sind doch nicht Pinkerton, sondern Nampol“, hatte Erwin selbstbewußt entgegnet. Aber Embanga hatte nur auf die kleine Zeitungsnotiz im Windhoek Advertiser von Freitag verwiesen.
Erwin öffnete den Umschlag und nahm die Zeitungsseite heraus. „Hier. Die Anthropologin. Die Sache oben am Okawango. Erinnerst du dich? Ist erst ein paar Wochen her.“
Carl runzelte die Stirn. „Sorry, keinen blassen Schimmer.“
„Stand auch in der Allgemeinen Zeitung.“
„Sag schon!“
„Das Anthropologenpaar, das durch den Fluß geschwommen ist. Die mußten das machen, sonst hätte das Dorf sie nicht akzeptiert.“
Bei diesen Worten machte es Klick in Carls zerebralem Lochkartenregister, das von den ersten Bierdosen des Tages leicht angefeuchtet war. Ein langgezogenes „Jaaa“ kam hervor. Carl rückte auf die Kante seines speckigen, weißen Ledersofas vor und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Es folgte eine Kneipenerzählung, wonach er die Story bereits in „Joe's Beer House“ aufgeschnappt hatte. Carl versuchte sie stockend zu rekapitulieren. Erwin war ganz Ohr, hoffte auf ein paar mehr Details, als Embanga und der dürre Artikel im Windhoek Advertiser preisgegeben hatten.
„Diese beiden Wissenschaftler - das waren doch Briten, oder?“ vergewisserte sich Carl. Als Erwin nickte, setzte er fort: „Sie planten irgendwelche Feldstudien … Mußten sich wie früher die Missionare erst durch eine Mutprobe bewähren ... Durch den Fluß schwimmen … Der Mann schaffte es. Das alles nachts. Ein Ruderboot als Begleitschutz. Danach war die Frau dran. Und dann ist es passiert: schnapp, weg!“
Erwin nickte und sagte: „Die Sache ist die: Die Frau ist wieder aufgetaucht. Im wahrsten Sinne des Wortes …“
„Drei Wochen später.“
„Aber leider als Torso. Es hat sich also alles bestätigt, was der Polizei in Nkurenkuru gemeldet worden war.“
„Nkurenkuru?“
„Dort ist der nächstgelegene Polizeiposten.“
Carl griff sich den Zeitungsartikel, nuschelte einige Zeilen schwerfällig auf Englisch, zitierte dann: „… has been confirmed by a police speaker in Rundu … The corpse has been found by a fishery man in Kivundu, near Nkurenkuru.“
In Kivundu, an einem Abschnitt des Okawango, hundertvierzig Kilometer östlich von Rundu, lag eine aufgegebene Missionsstation. Früher, noch in den fünfziger Jahren, waren dort evangelische Missionare tätig gewesen. Die Verbreitung des Evangeliums hatte sich als ein mühseliges Geschäft erwiesen. Aberglaube, Hexenverfolgung, Vielweiberei, Schadenzauber - die Wiederkehr des europäischen Mittelalters hatte in diesem Abschnitt des Okawango die zugezogenen Gottesmänner und -frauen erwartet.
Carl zappte die Rugby-Aufzeichnung weg. Tonga war eh geliefert gegen die Franzmänner. Außerdem hatte er das Ergebnis sowieso schon im Radio gehört. Die zwei vormittäglichen Biere waren aus Leber und Hirn schlagartig verdunstet. Wie ein Skorpionstich hatte ihn Erwins Horrorstory aufgeschreckt. Mochten ihm die Jahre seit der Unabhängigkeit, die ganze Vetternwirtschaft der Comrades, das verlogene Getue um Versöhnung und Nationenbildung, die Litanei von den schwarzen Engeln und den weißen Teufeln, vor allem aber seine Degradierung mächtig zugesetzt, ja an manchen Tagen fast schon zermürbt haben - das hier hörte sich wie ein Fall nach seinem Geschmack an. Und wenn sie schon einen Emporkömmling vor seine Nase hatten setzen müssen, dann war Erwin mit seinen bescheidenen ein Meter fünfundsechzig im wahrsten Sinne des Wortes das kleinste Übel. Für ihn war Erwin, der junge Herero, der doch wie er ein halber Deutscher war, einer der wenigen echten Idealisten, die dem alten Motto „Ons dien met trots“ folgten. Mit Stolz dienen! Darum muß es wieder gehen, dachte Carl. Wenn Erwin nur nicht so ein Bürohengst wäre …
Elf Jahre German Democratic Republic, ein DDR-Kid, Dauerasyl unter der Obhut der Honeckers, nachdem in Südwest der Krieg voll entbrannt war. Elf Jahre Bellin und Straßfurt, Erweiterte Oberschule. Mechanikerlehre und Montage beim VEB Automobilwerk Eisenach. Zuvor, 1976, die Flucht aus Grootfontein nach Angola, das Lager in Cassinga, das Massaker der Südafrikaner 1978 - das war Erwins zeitgenössisches Simplicissimus-Schicksal, 1990 jäh gewendet, Abflug in die alte, neue Heimat. Bachelor in Criminal Justice/Policing am Polytechnikum in Windhoek, Karriereautobahn, wie junge Kommunisten in den frühen Tagen von SBZ und DDR. Die alten Eliten mußten raus, neue her, lieber gestern als heute. Inspector, Assistant Chief Inspector, Chief Inspector - das alles in nicht mal drei Jahren. Im alten Südafrika undenkbar, dachte Carl. Wenigstens hat er keinen sächsischen Akzent in das neue Südwest eingeschleppt!
Draußen auf der Straße war kein Mensch zu sehen. Die Mittagssonne war im Mai erträglich, gerade hier im Hochland von Windhoek. Nur Ferdi Frenzels alter Papagei „Mozart“ rasselte auf der Gartenterrasse des linken Nachbarhauses sein Vormittagsprogramm herunter. Jetzt verlangte er nach „Cookie, cookie!“, was den schwarzen Gärtner aber kalt ließ, derweil „Mozarts“ Besitzer im deutschsprachigen Hörfunkprogramm der NBC eines seiner Hafenkonzerte mit viel „La Paloma“ moderierte. Hamburger Hafenkonzert wohlgemerkt, denn in Lüderitz und Walfischbucht war der Hund begraben.
Carl blickte von dem Artikel im Advertiser auf und fragte mit einem ächzenden Unterton: „Also nach Kivundu?“
Erwin nickte und nippte an seiner Bierbüchse.
„Und was sollen wir da? Das Krokodil verhaften?“
Erwin reagierte nicht auf Carls Ironie, seinen Sarkasmus. Er hatte sich vorgenommen, das möglichst nie zu tun. Über diese Sprüche mußte er zwar manchmal schmunzeln, aber irgendwie waren sie doch nur Ausdruck von Verlierertum. Und ein solcher Verlierer der jüngeren afrikanischen Geschichte saß definitiv vor ihm auf einem abgewetzten Sofa der sechziger Jahre.
„Es gibt eine Anfrage einer großen Versicherung“, sagte Erwin. „Sowohl die Frau als auch der Mann hatten eine hohe Lebensversicherung laufen.“
„Wie viel?“
„Zwei Millionen Namibia-Dollar jeweils.“
„Ganz schön teures Krokodilfutter.“
Erwin schwieg und holte sich aus der Küche ein Glas, in das er sein Bier schüttete.
Warum jetzt die Polizei der Laufbursche der Finanzindustrie sein solle, echauffierte sich Carl. Wenn es Zweifel an dem Unfall gebe, könnten die doch eine Detektei einschalten. Außerdem sei die Aktion mit der Mutprobe eher ein halber Suizid gewesen. Und bei Selbstmord zahle keine Versicherung. „Der Häuptling, der diesen Mist verlangt hat, nachts durch den Fluß zu schwimmen - den können wir verhaften.“
Erwin hätte ihm wohl zugestimmt, hätte Commissioner Embanga nicht ein bestimmtes Detail erwähnt, das in dem ganzen Papierkram nicht vorkam.
„Der Mann hat für die Flußdurchquerung trainiert.“
„Woher weißt du das?“ fragte Carl.
„Das kommt vom Chef. Das englische Paar wohnte zuletzt in Matas Nachbarschaft in Eros. Mata macht ja gern auf stahlharten Cop. Na ja, sagen wir, er tut ein wenig gegen seine Bierwampe.“
Carl runzelte fragend die Stirn.
„Er ging im Freibad oft schwimmen. Der Engländer war dort vor seiner Abreise häufig. Er übte ständig Tauchen, als wollte er Perlentaucher werden. Das ist das, was Embanga mir geflüstert hat.“
„Und die Frau?“
„Hat Mata nicht erwähnt.“
„Und weiter?“
„Nichts ‘weiter’. Mata hat sich nichts dabei gedacht und nichts gefragt.“
„Dieses Paar mußte diesen Job am Okawango wohl um jeden Preis haben“, meinte Carl und starrte auf den Packen Papier. „Als gäbe es eine angolanische Ölquelle als Belohnung.“
Carl beförderte den Rest Dosenflüssigkeit in seine Kehle und fragte ahnungsvoll: „Und wir sollen jetzt in den Norden? An die Grenze? Pinkerton und Crocodile Dundee in einem?“
„Ja, Carl. Und ich habe dich hier aufgescheucht, um dir unsere sofortige Abfahrt mitzuteilen.“
Krokodile, eine verstümmelte Frauenleiche, eine Millionen-Police. Das war Carl einen letzten Spruch wert, ehe er vor seinem geistigen Auge das Rugby-Ei für unbestimmte Zeit aus seinem Leben kickte. „Kennst du den, Erwin? Fragt die Lehrerin in Ost-Berlin den sächsischen Schüler, was er zu Angola weiß. Sagt der: An Gola gendisch misch dodsaufen.“
Erwin schaute Carl nur tief in die Augen. „Was soll denn das heißen?“
„Tja, hättest du dein Exil mal in Leipzsch und nicht auf Schloß Bellin verlebt. An Cola könnte ich mich totsaufen, heißt das. Aber du warst auf deinem sozialistischen Gutshof und im VEB mit Club-Cola bestimmt überglücklich.“
„Jetzt reicht's. Pack ein paar Sachen, wir fahren. Jetzt. In Zivil. Knarre brauchst du nicht.“ Erwin holte tief Luft und legte zwei Tonlagen drauf: „Und wir sind nicht heute abend zum Braai zurück!“
Carl wollte wissen, mit welchem Auto sie die siebenhundert Kilometer zurücklegen sollten.
„Zwei Optionen“, verkündete Erwin abrupt. „Erstens: der Corolla, der draußen steht. Hundertfünfzigtausend gelaufen. Mit Warnlicht und Aufschrift ‘Police’ nicht gerade ein Inkognito-Auto. Zweitens: ein ziviler Citi Golf Chico aus dem Fuhrpark. Hat nur hundertdreißigtausend gelaufen. Die Ölwanne gestern frisch von einem neuen Aushilfsmechaniker geschweißt. Nun, Assistant Chief Inspector? Ein freies Land mit freier Auswahl!“
„Wieso nicht gleich ein Matatu? Nein, danke. Dann lieber den Variant.“
Nachdem Carl binnen Minuten eine Reisetasche und seine Feldumhängetasche gepackt hatte, fuhr Erwin im Polizei-Corolla zum Polizeihauptquartier voraus. Carl folgte ihm in seinem siebziger Jahre-Volkswagen, einem königsblauen VW Variant 1600 Kombi. An der Central Police Station gab Erwin den Corolla beim Fuhrparkmanager ab, rief von der Pförtnerloge kurz seine Frau an, die mit dem Kleinen in der Frühe für eine Woche zu ihren Eltern nach Gobabis gefahren war, und stieg zu Carl in den Variant.
Sie bogen in die Independence Avenue ein, deren Verkehrsfluß von allerhand unbeschuhten Straßenjungs unterbrochen wurde, die auf der Hauptstraße Zeitungen anpriesen, gestikulierend Parkeinweiser spielten oder an den Ampeln mit Sprühflaschen und alten Lappen Scheibenwischdienste leisteten, um die niemand gebeten hatte. Auf Höhe des Restaurants Gathemann, auf dessen Balkon die üblichen Staatssekretäre bei Straußensteak und Chardonnay saßen, kurbelte Carl die Scheibe herunter und drückte einem der Jungen im Tausch gegen eine AZ eine Namibia-Dollar-Münze in die Hand. Die Zeitung warf er in den Fußraum zu den anderen Papiererzeugnissen, die bereits Erwins Interesse erregt hatten.
Noch bevor sie die Peter-Müller-Straße erreicht hatten, druckste Carl herum, da seien noch Bücher, die er bei „Uncle Spike's Book Exchange“ eintauschen wolle, „gegen einen Chandler, einen Hammett oder irgendeinen anderen Hardboiled-Krimi“.
Erwin warf einen Blick auf den kleinen Stapel Heftromane mit dem Titel „G-man Jerry Cotton“ und meinte, dafür gebe es bei Onkel Spike höchstens einen stockfleckigen Edgar Wallace. Solche Detektivheftchen wären ja vielleicht in der DDR eine „Super-Bückware“ gewesen, aber die Zeit sei ja wohl vorbei - und woher er die Groschenromane überhaupt habe.
„Eine Bitte von Herrn Kohlschläger um gewinnbringende Entsorgung“, stieß Carl genervt hervor. „Betonung auf ‘gewinnbringend’.“
Erwin unterdrückte ein Lachen und ließ Carl als sein Vorgesetzter wissen, daß dafür jetzt schlicht keine Zeit mehr sei, schließlich gelte es, das Krokodil gerichtsfest zu überführen - oder wenigstens konform mit den AGB der Lebensversicherung.
Über den Sam Nujoma Drive verließen sie das Zentrum von Windhoek in Richtung der B 1 nach Norden. Links ließen sie Khomasdal, das Viertel der Farbigen, und das Township Katutura liegen, den „Ort, wo wir nicht leben wollen“, wie es in der Sprache der Herero hieß. Zügig bretterten sie auf Okahandja zu. Die Donkiekarren am Straßenrand drifteten noch weiter von der Straße ab, wenn Carl seinen Typ-3-VW mit Saugrohreinspritzung hochtourig vibrieren ließ. Wahrscheinlich hätte er allein für die Bosch D-Jetronic seine Sammlung Militaria der South African Defence Force verhökert, wenn nicht gar die alten Zuglaufschilder aus der Mandatszeit, die sein Vater ihm als Kind geschenkt hatte. Carl drückte das Automatikpedal immer wieder bis zum Anschlag durch, um die lausigen Käfer, Corollas, Citi Golfs, Eselsfuhrwerke und andere Verkehrshindernisse abzuhängen.
Als sie durch Okahandja fuhren und auf Höhe der Eerste Avenue in Sichtweite des Krankenhauses kamen, wollte Carl schon gewohnheitsmäßig den Blinker setzen, um zum Okahandja Hospital abzubiegen. Seit neun Jahren war seine Emmie nun hier in dem Pflegeheim, das an das Krankenhaus angeschlossen war. Achtzehn Jahre hatte er das ganze Leid mit ihr durchgestanden. Stumm wie ein Fisch war sie von dem Moment an, an dem er und sein Freund Dan sie an jenem 4. Mai 1977 in ihrem Zelt an der Blutkuppe gefunden hatten. Wie Dans Frau Beth - ausgeraubt und vergewaltigt von einer Bande Comrades, bloß daß Emmie schwanger wurde, was ihnen zuvor nicht beschieden gewesen war. Die Fehlgeburt, das Trauma, die Sprachlosigkeit. Ihr kleines Glück - zerstört an einem Nachmittag, an dem Dan und er auf die Blutkuppe gestiegen waren. Wie im Film zog die Katastrophe an seinem inneren Auge wieder und wieder vorbei - bis der Film riß und die Abwickelspule des Projektors leer durchdrehte.
Die Täter waren nie gefaßt worden, obwohl Polizei und Armee alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten und die Fahndung noch bis Anfang der achtziger Jahre intensiv betrieben worden war. Die Polizei im neuen Staate namens Republik Namibia, der sich anschickte, das alte Unrecht hinter sich zu lassen, hatte indes kein Interesse, an den ungelösten Fällen der Mandatszeit herumzudoktern und den alten Staub der Geschichte aufzuwirbeln. Es waren nicht die alten und neuen Beamten, es war die Führung, die sagte: Versöhnung jetzt, Schluß mit der Vergangenheit! We are all Namibians, lautete die neue Parole. Und in vielen gebar sie Bitterkeit. Sarkasmus sollte Carls Seele fortan panzern, aber es war nur ein dünner, glanzloser und giftiger Lack.
Jetzt saß sie den halben Tag, ein Jahrzehnt bald, allein auf einem Stuhl, starrte aus dem Fenster in den Park, wartend, daß Grace, ihre Pflegerin, sie anstubste: „Komm, Emmie, wir gehen draußen ein paar Schritte.“
Der 4. Mai 1977, sein Cassinga Day. Kürzlich erst hatte er sich wieder gejährt, und wie bei einer Sanduhr, deren Glaskolben jemand mutwillig zerschlagen hatte, war die verbleibende Zeit mit einem Schlag verstrichen, waren die guten Tage und Jahre ihres Lebens mit einem Male dahin. Alle restliche Zeit perdu, abgelaufen an einem Nachmittag im menschenleeren Steinwüstenland der Blutkuppe, durch das ein paar entseelte schwarze Teufel gezogen waren, die glaubten, die Geschichte gebe ihnen das Recht, andere Seelen auszulöschen. Bald, dachte Carl, würde er die Zuzahlung für den Heimplatz nicht mehr aufbringen können und sein Haus in der Schubertstraße, das das Haus von Emmies verstorbenen Eltern war, beleihen müssen. Oder er müßte sich von Emmie scheiden lassen. Aber das wollte er nicht. Nicht auch noch diesen Preis zahlen, nicht auch noch diesen Triumph den Tätern gewähren.
Carl drehte am Sendersuchlauf des Autoradios, bis er auf UKW einen Musiksender eingestellt hatte, der gerade das Electric Light Orchestra mit „Last train to London“ brachte. Das vertrieb die düsteren Gedanken.
Die Luft war trocken, der Staub klebte im Mund. Es waren noch sechshundert Kilometer bis Kivundu, sie hatten noch genug Benzin im Tank, eine halbe Schachtel „Camel“, es war gleißend hell draußen, und Carl und Erwin trugen billige Sonnenbrillen made in China, weil die Bullengehälter lausig waren. „Hit it!“ rief Carl unvermittelt.
Während der Fahrt stöberte Erwin in den Papieren, die ihm Joseph Embanga mitgegeben hatte. Darin enthalten war auch die Vermißtenanzeige. Der Mann des Krokodilopfers hatte sie in Nkurenkuru gestellt.
„Deborah Wilkinson heißt die Tote. Der Mann Neville. Beide geboren 1957, er in Liverpool, sie in Buckfastleigh“, zitierte Erwin aus der Akte.
„Wo ist das denn?“
„Devonshire. Am Rande des Dartmoor.“
„Konnte ja nur schaurig enden.“
Erwin blätterte. „… und hier! Beide Anthropologen, allerdings keine Doktortitel.“
„… fehlen uns auch noch!“
Carl behielt stur die Straße samt ihrer großzügigigen Randbereiche im Blick. Seit Windhoek waren sie bereits beinahe mit zwei Straßenhunden, einem Ananasverkäufer und einem die Spur kreuzenden Kudu kollidiert.
Der Rest der Unterlagen ließ sich so zusammenfassen: Die Wilkinsons waren vor einem Monat im Auftrag des Gesundheitsministeriums nach Kivundu gekommen. Das Projekt war nur mit „Epidemiologie/Prävention“ beschrieben. Was das mit Anthropologie und der Wissenschaft vom Menschen zu tun haben sollte, blieb unklar. Die Wilkinsons waren erst seit einem Jahr beim Gesundheitsministerium in Windhoek angestellt. Zuletzt hatten sie ein Tourismusprojekt in der Kalahari betreut: die Ansiedlung einer San-Gemeinschaft auf einer weitläufigen Gästefarm. Die Khoi-Buschleute sollten auf dem Farmland ihre alte Lebensweise rekultivieren und an den Tourismuseinnahmen beteiligt werden. Vorher Dozententätigkeit des Paares in Kapstadt an der Universität. 1992 von England nach Südafrika übergesiedelt. Kinder keine. Beide anglikanisch. Wohnhaft in Erospark in der Atlas Street, zur Miete.
„Ah, hier, auch interessant“, schickte Erwin hinterher. „Sie war Mitte der achtziger Jahre ein halbes Jahr in Uganda. Bei dem Bergvolk der Ik.“
„Von dem Volk habe ich mal gehört.“
„Und?“
„Dort gab es mal eine extreme Hungersnot, nachdem die Ik vertrieben worden waren, um einen Nationalpark zu schaffen. Die Eltern haben ihre Kinder schon im Alter von drei Jahren weggejagt, um sie nicht mehr durchfüttern zu müssen.“
„Unter diesen Umständen war der Besuch aus England vielleicht nicht wirklich willkommen“, vermutete Erwin.
Carl ging nicht weiter darauf ein und schlug mit einer Hand auf das Lenkrad. „Warum läßt sich ein Paar von dem Chief dort oben oder von einer Community von Hinterwäldlern dazu nötigen, den Okawango zu durchschwimmen? Jedes Schulkind in Maltahöhe oder Keetmanshoop weiß, daß es da Krokodile gibt.“
„Es muß ihnen sehr wichtig gewesen sein“, antwortete Erwin. „Oder das Risiko wurde verharmlost.“
„Wie kann denn der Chief von diesem Nest so etwas überhaupt verlangen?“
„Carl, du unterschätzt die Macht dieser Leute, die Traditionen. Die haben vor hundert Jahren die Missionare auch nicht ohne weiteres zu sich gelassen.“
„Ich dachte, das regelt man mit Geld. Oder Säcken voll Saatgut. Oder Glasperlen. Oder ein paar Flaschen Fusel für den Chief.“
„Schnaps? Das Gastgeschenk der Missionare? Aha.“
Carl dachte nach. An dem Auftrag des Paares war etwas faul. Was wollten die zwei da wirklich, daß sie als Eintrittsgeld ihr Leben aufs Spiel setzten? „Schmuggel“, sagte Carl. „Erwin, du glaubst nicht, was da an der Grenze alles geschmuggelt wird. Diamanten aus Angola. Devisen aus korrupten Ölgeschäften. Bush Meat. Umgekehrt Waffen aus dem Bürgerkrieg von hier nach Angola. An die UNITA. Alles, was hier in ein Ruder- oder Motorboot paßt. Oder zur Not in einen Einbaum.“
Erwin schüttelte bedächtig den Kopf. „Das ist kein Business für Frauen.“
Allmählich gerieten die beiden Detectives in die Dämmerung. Die öde Halbwüstenlandschaft lag hinter ihnen. Der Herbst hatte die Natur verblühen lassen. Der Boden war trocken und rissig, der letzte Sommerregen schon vor langer Zeit niedergegangen. Bis an den Okawango waren es noch mehrere hundert Kilometer. Otjiwarango und Otavi hatten sie hinter sich. Bis Tsumeb würden sie es schaffen, dann brauchten sie eine Unterkunft. Nach Osten lag Grootfontein, die „Große Quelle“ in der Sprache der Afrikaaner, „Hügelland des Leoparden“, wie es in Erwins Muttersprache hieß. Dort hatte er seine ersten elf Lebensjahre auf der Großfarm eines Südwesterdeutschen verbracht, wie schon seine Eltern und Großeltern.
Carl wies mit einem Daumen auf das alte Armeezelt, das hinter der Rückbank des Kombis lag. „Warum nicht nach Fort Namutoni?“ fragte er. „Da sehen wir vielleicht noch ein paar Nashörner oder Elefanten am Wasser.“
„Zu weit abseits“, erwiderte Erwin. Ihm war klar, daß eine Übernachtungsrechnung von einem der Zeltlager des Etosha-Nationalparks nach ihrer Rückkehr zu der unangenehmen Nachfrage geführt hätte, was sie da eigentlich im Norden gemacht hätten. Und Lust, für Eintritt und Zeltplatz selbst aufzukommen, hatte er mit Blick auf das bescheidene Gehalt, das eine kleine Familie ernähren mußte, auch nicht.
Im alten „Minen-Hotel“ im Zentrum von Tsumeb nahmen die beiden Detectives Quartier. Über dem Eingang prangten zwei gekreuzte Hammer. Nach zwei kalten „Windhoek Lager“ und Boerewors mit Kartoffelbrei, die sie im Biergarten gierig herunterschlangen, sprang Carl in alten Armeeshorts in den Hotelpool. Von überall zirpten die Grillen, während der Bratwurstgeruch durch den Hotelgarten waberte. Erwin bearbeitete den Portier, Malariapillen zu organisieren, die sie für den Norden brauchten. In Windhoek hatten sie den Kauf von Resochin schlichtweg verpennt. Aus der Entfernung sah Carl zwei schwarze Night Ladies herumstöckeln, die sich viel Mühe gegeben hatten, nicht wie vierzehn auszusehen. Erwin kam schließlich mit einer Tube Zahnpasta und einer Box Moskitospulen an.
„Rauchende Chemiebomben“, sagte Carl. „Das hassen die Mossies wie die Pest.“
„Ich geh schlafen. Du kannst ja noch mit den Ladies im Pool plantschen“, verabschiedete sich Erwin. Carl bestellte noch ein Bier und sann über den merkwürdigen Fall nach, den Embanga ihnen zugeschanzt hatte. Nachdem er sein Glas geleert hatte, folgte er Erwin in das Hotelzimmer.
Noch lange, nachdem das ungleiche Paar in seinem Doppelbett gegeneinander anzuschnarchen begonnen hatte, koberten die beiden Owambomädchen zwischen Hotelparkplatz und Biergarten erfolglos um Kundschaft.
Gegen acht Uhr morgens hatten sie das „Maisdreieck“ Otavi-Tsumeb-Grootfontein bereits hinter sich. Die winzige Wetterstation, die Carl neben dem Armaturenbrett angebracht hatte, zeigte sechzehn Grad Celsius und fünfzig Prozent Luftfeuchtigkeit. Die B 8 war wenig befahren. Jenseits von Die End, Voorwaarts und Tiervlei tauchten bald nur noch Ortsnamen auf, die ahnen ließen, bis wohin die weiße Kolonisierung einst gegangen war. Wenn Carl es die „Malariagrenze“ nannte, war das eine seiner freundlichen Zuschreibungen.
Erwin blätterte in der AZ. Lieber las er den Namibian, der leidlich regierungskritisch war, aber sich nicht ständig um Geschichten aus Deutschland oder die Probleme der Südwesterdeutschen drehte. Im Vermischten blieb er bei einer längeren Meldung hängen, die ihrer Mission in den Norden eine brisante Aktualität verlieh. In Rundu war ein Teil der städtischen Wasserversorgung zusammengebrochen - mit gravierenden Folgen. „Hier, hör dir das an“, zitierte Erwin den Bericht der Namibia Press Agency. „In Rundu müssen die Leute ihr Wasser am Fluß holen - und einer wurde von einem Krokodil attackiert.“
„In Rundu?“ fragte Carl skeptisch.
„Ja. Vielleicht am Stadtrand, das steht hier nicht. Der Mann hat es aber überlebt. ‘Mit schweren Bißverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert’, heißt es hier.“
„Ich verstehe nicht, warum die in der Situation kein Trinkwasserfahrzeug durch die Stadt schicken.“
„Vermutlich haben sie keins. Weil sie kein Geld haben.“
„Und darum ist der arme Kerl jetzt für ein Leben gezeichnet.“
Carl hatte das Radio wieder eingeschaltet und rauchte am offenen Fenster eine filterlose „Camel“. Im Auto wie zu Hause hörte er meist das deutschsprachige Programm der Namibian Broadcasting Corporation. In den Nachrichten war von einem NATO-Angriff auf Stellungen der bosnischen Serben bei Pale die Rede. „Um weitere NATO-Angriffe zu verhindern, haben die Serben etwa zweihundert UNO-Soldaten als Geiseln genommen und die Zufahrtsstraßen zum Flughafen von Sarajewo vermint.“ Im Kongo war eine sechste Nonne im Krankenhaus von Kikwit nach einem Ebola-Ausbruch an der Zoonose gestorben.
„Typisch. Wenn es schwarze Nonnen wären, würde kein Hahn danach krähen“, kommentierte Erwin die Meldung.
„Woher weißt du, daß die Pinguine Weiße waren?“ entgegnete Carl, dem alles kirchliche Leben fremd geworden war.
Am Ende kam eine Nachricht aus Namibia. „Das Minendorf Uis wurde am Montag zum Verkauf angeboten, fand jedoch keinen Abnehmer, da das höchste Angebot von einer Million Namibia-Dollar unzureichend war. Bei der Versteigerung wurde die komplette Ausrüstung der Zinnmine, die im Jahr 1990 geschlossen worden war, angeboten. Darüber hinaus stand das gesamte Dorf zum Verkauf - inklusive hundertfünfzehn Häuser, Golf- und Tennisplätze, Supermarkt, Bibliothek, Kirche, Schule und Postamt.“
„Eine Million Rand. Ist ja ein Witz“, bemerkte Carl. „Dafür bekommst du in Clifton gerade eben eine Luxuswohnung mit Strandzugang.“
„Allein um die Mine zu sanieren, bräuchte es wahrscheinlich das Zehnfache“, meinte Erwin. „Ein Nachbar meines Cousins hat dort gearbeitet. Er wurde vor zehn Jahren verschüttet. Fünftausend Rand bekam die Familie als Entschädigung.“
Carl wollte von der Politik jetzt nichts mehr hören. Später würde sein Nachbar Ferdi Frenzel aus der Schubertstraße eine Schlagerparade spielen. Zu Hause folgte er manchmal dem Aufruf des Moderators, im Sender anzurufen und gab einen Wunschtitel durch, meistens Genesis, die Stones oder die Dire Straits, manchmal, um sich einen Spaß zu machen, auch Johnny Clegg & Savuka, Miriam Makeba oder anderes, was die Südwesterdeutschen auf ihren Farmen partout nicht hören wollten. Ferdi hatte ihn bei dem ein oder anderen Braai in der Nachbarschaft freundlich gemahnt, nicht immer „diese ANC-Musik“ zu ordern, schließlich sei er doch „selber einer von der alten Garde“. Carl pflegte dann zu antworten, er sei zwar weiß und Veteran der South African Defence Force und der South West African Territorial Force, aber noch lange nicht der Vorsitzende des hiesigen Heino-Fanclubs.
Als sie das Eingangstor des Mangetti-Wildparks passierten, gestikulierte eine Hererofrau wild am Straßenrand. Carl stieg so in die Eisen, daß das Heck des VW schlingerte. Die Frau kam in ihrem wallenden Hererokleid mit einem viereckigen Transportbehälter freudig auf den Wagen zugelaufen. Mit dem rosa Kleid im viktorianischen Stil und einem gleichfarbigen flachen Kopfschmuck, der mit luftigen Hörnern ausgewölbt war, wirkte sie wie aus einem anderen Jahrhundert.
Noch bevor sie die hintere Wagentür erreicht hatte, foppte Carl seinen Kollegen, ob dessen Frau „auch so ein Ufo“ auf dem Kopf tragen würde. Natürlich wußte er längst, daß Gendrede Kandetu für die Tracht nichts übrig hatte.
Erwin verdrehte die Augen und erklärte ihm zum wiederholten Male, daß der dreieckige Kopfputz Rinderhörnern nachempfunden sei und das Kleid eine Reverenz an die Kleidung der deutschen Kolonialzeit sei. „Das macht dir doch nichts aus, oder?“
Während die Anhalterin ihren Behälter bereits auf die Rückbank schob, kommandierte Carl: „Erwin, jetzt mal schön Konversation auf Otjiherero! Damit du nicht einrostest.“
Schnell bedachte der Herero seinen Kollegen noch mit einer Retourkutsche: „Was glaubst du eigentlich, wie ich mit meiner Frau rede? Etwa auf Afrikaans?“
Die Herero-Dame lachte, war glücklich und stolz, die kostenlose Mitfahrgelegenheit in einem noch nicht schrottreifen Auto ergattert zu haben. Während Carl Gas gab, betrachtete Erwin die zwei Hühner, die ihre Hälse zwischen den hölzernen Gitterstangen emporreckten.
Wo es denn hingehen solle, fragte Erwin auf Otjiherero. Die vielen dunklen und weichen Laute der Hererosprache klangen in Carls Ohren haargenau wie die anderer Bantusprachen im südlichen Afrika, ganz gleich ob Zulu, Xhosa, Shona oder Oshiwambo. Sprach Erwin Kandetu aber sein exzellentes Deutsch, blieb als Differenz zum Muttersprachler nur der wohltuend ruhige Baß, der jedes Wort und jeden Satz grundierte, aber so wenig zu seiner schmalen Erscheinung paßte.
„Nach Rundu“, sagte die Frau mit den Rinderhörnern bestimmend und wollte gleich wissen, woher Erwin komme.
„Madame“, schaltete sich Carl auf Afrikaans ein. „Er kommt aus der Zukunft.“ Kunstvoll machte er eine Pause und schob dann nach: „Er kommt aus der DDR.“
Die Frau runzelte die Stirn und fragte, was das denn heißen solle.
Erwin wischte sich den Schweiß von der Stirn und antwortete für ihn. „Ich komme eigentlich aus der Nähe von Grootfontein, aber ich bin DDR-Kid, wie man so sagt. Und mein Kollege meint: Mit der SWAPO kriegen wir hier auch den Sozialismus. Das erzählt er mir jeden Tag bei Dienstbeginn. Dabei kommt er selbst aus einem Land, das es nicht mehr gibt …“
Die Frau lachte, ehe Erwin ihr erklärt hatte, daß sein Vater ab Mitte der siebziger Jahre mit der People's Liberation Army of Namibia im bewaffneten Widerstand gegen die Südafrikaner gewesen war und er mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester im Alter von vierzehn Jahren in der DDR Asyl erhalten hatte, nachdem die südafrikanische Armee auch die Stützpunkte der PLAN samt Flüchtlingslagern in Angola angegriffen hatte. „Führungselite sollten wir werden“, fügte Erwin hinzu. „Vierhundert Kinder waren wir. Ich war klar der Älteste.“ Er sei nur wegen seiner jüngeren Schwester mitgereist, die damals erst sechs war und mit Kinderlähmung im Rollstuhl saß.
Erwin zwirbelte verlegen in seinen krausen Haaren herum und überlegte einen kurzen Augenblick, ob es gut sei, der Fremden so freimütig sein Leben zu erzählen, aber was hatte er schon zu verstecken - und wiedersehen würde er die Frau wohl sowieso nicht. „Meinen Vater“, fügte er noch hinzu, „habe ich nie wiedergesehen …“
„Ist er im Kampf gefallen?“ hakte die Frau nach.
Erwin zögerte einen Moment, dann erzählte er die Geschichte, die Carl längst kannte: daß sein Vater mit der SWAPO-Führung in Konflikt geraten und nach Lubango verschleppt worden war. Dort, im Südwesten Angolas, hatte die SWAPO in den achtziger Jahren eines ihrer militärischen Zentren. In den Kellern des Sicherheitsapparates wurden exilierte Parteianhänger, die nicht auf Linie waren, gefangengehalten und gefoltert, viele am Ende ermordet. Erwins Vater blieb in Lubango verschwunden, seine Leiche wurde nie gefunden. Aber aus Aussagen überlebender Dissidenten, die Menschenrechtsaktivisten später zusammengetragen hatten, ging hervor, daß er unter der Folter gestorben war.
„Der Verantwortliche ist heute Chef des namibischen Heeres“, schloß Erwin seinen Bericht.
„The butcher of Lubango“, warf Carl auf Englisch ein, eine Titulierung der Opposition zitierend.
„Was wurde ihm vorgeworfen?“ fragte die Hererofrau.
„Spionage.“ Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Dieser Vorwurf ging immer.“
„Dis hartseer.“ Das sei traurig, sagte die Frau auf Afrikaans, um Carl aus dem Gespräch nicht auszuschließen. Wie der Vater geheißen habe, wollte sie nun wissen.
„Hans. Hans Kandetu.“
„Waren seine Eltern Farmarbeiter?“
„Ja“, sagte Erwin. „Auf einer deutschen Farm. Der Baas bestimmte die Namen.“
„Leichter zu merken, Mevrou!“ kommentierte Carl, sich eine Zigarette anzündend. „Bei seinem Namen“ - Carl wies mit dem linken Daumen auf Erwin - „hat der Farmer dann noch mal seine Finger im Spiel gehabt.“
„Warum?“ fragte die Frau.
„Er heißt Erwin“, antwortete Carl.
„Und was sind Sie jetzt?“ fragte die Hererofrau.
„Erwin kämpft immer noch gegen das Böse“, sagte Carl.
„Sitze ich hier in einem Polizeiauto oder einem Fahrzeug der Armee?“ fragte die Frau.
„Crime Investigation Directorate, Serious Crime Unit. Ich bin Chief Inspector und das ist mein Fahrer“, sagte Erwin nun auf Otjiherero, während die Mitfahrerin sich an einer kleinen Plastiktüte zu schaffen machte. Weitere Nachfragen traute sie sich nicht zu stellen. Einige Regenwürmer wanden sich in der Tüte wie winzige Schlangen. Mit spitzen Fingern zupfte sie einen Wurm aus der Tüte und hielt ihn den zwei Hühnern hin, die sich gierig um die Proteinzufuhr rangelten. Weitere Würmer folgten. Erwin und Carl verfolgten die Fütterung mit wachsendem Interesse, verbunden mit einem Anflug von Ekel.
Warum sie hier mit Hühnern nach Rundu wolle, fragte Erwin die Frau. Sie arbeite in der Restaurantküche des Wildparks. Dort halte man für den Speiseplan Hühner. Ihr Chef habe ihr die Tiere für die morgige Geburtstagsfeier ihres Mannes überlassen, der sei Fischhändler, da komme viel Besuch nach Rundu.
Ob es unter den Fischern viele Unfälle mit Tieren gebe, wollte Erwin wissen.
„Nein. Die Krokodile greifen normalerweise keine Boote an. Auch keine Einbäume“, erklärte sie. Flußpferden müsse man aber ausweichen. Aber die gebe es in ihrem Abschnitt des Okawango kaum. „Die Probleme fangen eigentlich erst im Caprivi an. Elefanten, die Felder verwüsten …“
Erwin überlegte. Er drehte sich zu ihr und fragte auf Afrikaans, so daß Carl es verstand: „Ernste Frage: Gibt es bei Ihnen Leute, die aus irgendeinem Grund von einem Okawango-Ufer zum anderen schwimmen?“
Die Hererofrau krauste die Stirn, während Carl einen Bakkie überholte. „Aus Spaß bestimmt nicht. Und auch nicht die Schmuggler, die Flüchtlinge oder die illegalen Einwanderer. Die kommen alle mit Ruderbooten oder Einbäumen. Die kriegt die Polizei fast nie.“
„Und was ist mit irgendwelchen Stammestraditionen?“ warf Carl ein. „Gibt es da solche Mannbarkeitsrituale - so wie bei den Massai in Ostafrika, wo man erst ein Mann ist, wenn man mit dem Speer einen Löwen erlegt hat?“
Die Frau belustigte sich. „Löwen! Für Löwen müßte man nach Etosha oder in die Gegend der Ovahimba. Oder ins Delta des Okawango.“
„Schon klar“, meinte Carl, der sich mit der Fauna im südlichen Afrika bestens auskannte. „Und andere Mutproben oder so was?“
Die Hühner in der Box fingen an, sich um die letzten elenden Würmer zu zanken. Die Hererofrau richtete sich ihren Hut zurecht und sagte: „Moment … Als der Großvater meines Mannes noch lebte, erzählt er mal so etwas. Das war Ende der sechziger Jahre. Er hatte als Kind in einem Dorf am Okawango miterlebt, daß Missionare durch den Fluß schwimmen mußten. Sie wären sonst nicht akzeptiert worden. Das Dorf hieß Katomeno, glaube ich. Das muß etwa um 1910 gewesen sein.“
Carl stieß Erwin mit dem Ellenbogen an und sagte auf Deutsch: „Sag ich doch. Die legen sich hier als Brautschmuck auch eine Boomslang um den Hals und ziehen als Mutprobe Löwen am Schwanz.“
„Andere machen heute Bunjee-Jumping oder Autorennen auf Wellblech“, entgegnete Erwin.
An einer Engen-Tankstelle, kurz hinter der Kreuzung von B 8 und C 45, ließen sie die Frau aus dem Wagen. „Totsiens!“ rief Carl, als sie die Hühnerbox ergriff.
„Dankie!“ rief sie euphorisch, als hätte Carl ihr den Wagen geschenkt.
Während Carl den VW volltanken ließ, besorgte Erwin quer gegenüber in einem Imbißladen Chickenburger mit Pommes. Sie wendeten und bogen auf die C 45 nach Westen ein, die den Okawango an seinen Biegungen tangierte. Schlangenartig bog und krümmte sich der Strom, der aus dem Hochland Angolas kam und auf vierhundert Kilometern die namibisch-angolanische Grenze bildete. Bis über Nkurenkuru hinaus mußten sie nordwestwärts den Fluß hoch.
Carl kurbelte die Scheibe herunter, um den Fett- und Hühnerfleischgeruch loszuwerden. Wie eine Löwenmähne in einem Wüstensturm legte sich sein seidiges, langes blondes Haar in den Fahrtwind, während Erwin mit einer Mischung aus Belustigung und Befremden die Namen der Dörfer von der Karte ablas, die sie noch passieren sollten: „Mupini, Kapako, Sinzogoro, Ntaranga, Bunya, Ntara, Rupara, Musese, Katanda, Nzinze, Katara, Matava, Tondoro, Nambi …“
„Tja, Erwin. Gar kein Karl-Marx-Stadt für dich dabei“, unterbrach ihn Carl. „Vielleicht bedeutet ja einer der Ortsnamen Krokodil auf Kavango.“
„Auf Otjiherero jedenfalls keiner“, sagte Erwin. „Am Mittellauf des Okawango gibt es nicht nur Krokodile, sondern auch Nilpferde. Wußtest du das?“
„Klar, steht ja in den Heftchen zu deinen Füßen.“
Erwin reagierte auf die alberne Bemerkung, indem er einen der Jerry-Cotton-Romane nahm und so tat, als lese er aus einem zoologischen Fachbuch: „Nilkrokodil. Ernährt sich von Fischen, Aas und Homo sapiens, vorzugsweise Afrikaaner - mit zwei A. Sein Schwanz wird bis zu 2,20 Meter …“
„Wie bitte?“
„Kannst du selbst nachlesen. In …“ Erwin blätterte die Titelseite auf. „‘Das Todes-Roulett’.“ Erwin warf den abgegriffenen Krimi vor sich in den Fußraum.
Carl drehte am Sendersuchlauf und wäre fast auf die rechte Spur abgekommen und in ein Matatu geknallt, hätte Erwin nicht ins Lenkrad gegriffen.
„Pasop!“ brüllte Erwin, als wäre er nicht Carls formeller Vorgesetzter, sondern sein Buschoffizier bei einem Search-and-Destroy-Kommando. Nach der Schrecksekunde fügte er ungewohnt bärbeißig hinzu: „Mit dir unterwegs zu sein, ist auch so ein Todes-Roulette.“
„Der Ferdi war weg“, sagte Carl entschuldigend. „Kein Empfang.“
„Dachtest du, die Schwarzen hier im Norden wollen Howard Carpendale und Tony Marshall hören?“
„Na ja, man könnte sich doch auf Roberto Blanco einigen.“
Erwin wendete den Kopf entnervt ab. Seit Carl vor zwei Jahren die Degradierung zum Assistant Chief Inspector hatte hinnehmen müssen, war es mit seinem dienstlichem Ernst nicht mehr weit her, solange nur Routine zu erledigen war. Reduced in rank - das sollte Konsequenzen haben. Erst wenn es um alles oder nichts ging oder ein Fall ihn wirklich fesselte oder persönlich berührte, war er voll da.
„Noch eins“, sagte Carl nach einer längeren Schweigepause. „Die haben da auch schon mal eine Schwarze Mamba auf dem Plumpsklo. Wegen der Ratten.“
„Aha. Und du hattest letztes Jahr mal eine Speikobra in deinem Garten. Schon vergessen? “
„Die schwimmt jetzt in Alkohol in einem großen Glas auf der Fensterbank …“
„Da habt Ihr ja was gemeinsam. Von wegen: im Alkohol schwimmen“, spottete Erwin und legte gleich noch nach: „Weißt du was, Assistant Inspector Barnard? Ich erteile dir hiermit den dienstlichen Befehl, morgen als Erster die Buschtoilette zu besuchen.“
Am frühen Abend erreichten sie Nkurenkuru, ein verschlafenes Provinznest mit gut fünfhundert Bewohnern, in dem die SWAPO wie in weiten Teilen des Nordens mindestens fünfundneunzig Prozent der Stimmen abräumte. Die Bewohner der umliegenden Dörfer kamen nur in den Ort, um Bankgeschäfte zu tätigen, im Warehouse das einzukaufen, was der Dorfladen nicht feilbot, und das Auto vollzutanken, sofern man ein Bankkonto, ein Auto oder wenigstens ein paar Namibia-Dollar für das Shopping im Supermarkt besaß. Andere suchten bloß die Post- oder die Polizeistation auf oder ließen sich in der kleinen Krankenstation verarzten, die aussah wie aus den Tagen Albert Schweitzers.
Zwei Schulen unterhielt der Staat in dem Kavangoflecken, der keinen Status als Stadt hatte und deshalb von Rundu aus verwaltet wurde. Eine Reihe von Obstgärten in Nähe des Flusses und Holzschnitzerwerkstätten zeugten von dem Willen der Einwohner, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern. Bürgerkriegsflüchtlinge, die aus Angola gekommen waren, hielten die Löhne gering. Ihre Kinder füllten die Schulen bis auf den letzten Platz, und die Väter, die keine Jobs fanden, tyrannisierten ihre Frauen oder hielten die Polizei in Atem.
Noch im Jahr 1910 hatten die Deutschen in dem Grenzort ausnahmsweise eine Polizeistation errichtet, weil die Nähe zum portugiesisch regierten Angola und der Okawango als eine Grenze, die das Volk der Kavango willkürlich in zwei Sektoren trennte, nach Kontrolle verlangten. Mehr als eine Handvoll Backsteinbauten erinnerte nicht mehr an die Kolonialzeit. Die neue Polizeistation war neben einer Bankfiliale in einem weiß angestrichenen länglichen Containergebäude untergebracht, dessen Fenster fast alle auf Kipp standen. Die beiden Detectives parkten unter einem Baum. Die Luft war ein wenig feucht. Vom Flußufer zog ein leichter Wind durch das Städtchen. Vor den Containerbuden roch es nach Benzinlache. Hunde kläfften hinter irgendwelchen Zäunen um die Wette. In einem Nachbarhaus stritt sich ein Paar so lautstark, daß anzunehmen war, die Beamten müßten bald in einem Fall häuslicher Gewalt ermitteln.
Erwin hatte sich und seinen Kollegen von Windhoek aus telefonisch angekündigt. Die Leiche der Anthropologin sollte hier aufbewahrt sein. Der Sergeant, mit dem Erwin gesprochen hatte, war ein Owambo namens Samuel Kauluma. Auf der Wache taten sonst nur ein Assistant Inspector, der das kleine Team leitete, ein Warrant Officer und zwei Constables Dienst. Sie waren für das gesamte westliche Kavangoland zuständig - ein hoffnungsloses Unterfangen.
Das Städtchen am Südwestufer des Okawango war seit dem späten 18. Jahrhundert Residenz der Könige der Uukwangali, eines Stammesclans, dessen König den Titel Hompa trug und dessen Ahnentafel Namen wie Sivute, Mbandu, Sikongo, Mpasi und Mpepo füllten. Anderswo im Land hießen sie einfach Traditional Leaders. In der neuen Republik Namibia mit ihrer Gewaltenteilung - und unter der südafrikanischen Mandatsmacht war es kaum anders - führten sie eine für Außenstehende obskur wirkende Parallelexistenz, eine Art Staat im Staate, der sich mit wenig mehr als etwas Pomp, informeller Gerichtsbarkeit und viel Überlieferung aufrechterhielt. Zumindest sah man es südlich der alten Roten Linie so, der Veterinärgrenze, die den Norden vom einst flächendeckend kolonisierten Rest des Landes trennte.