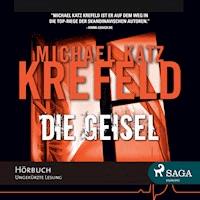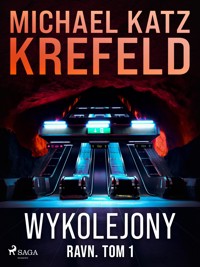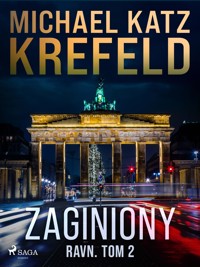8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Ravn
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nachdem der dänische Finanzmanager Mogens Slotsholm Gelder veruntreut hat, flüchtet er von Kopenhagen nach Berlin. Doch dort verliert sich seine Spur: Niemand weiß mehr, wo Mogens steckt. Seine Schwester kontaktiert in ihrer Verzweiflung den Ermittler Ravn, der noch immer unter dem tragischen Tod seiner Freundin leidet. Um sich abzulenken, stürzt er sich in die Suche nach Mogens. Dabei erfährt er, dass kürzlich weitere Männer in Berlin verschwunden sind – sie fielen einem Serienmörder zum Opfer, der offenbar von einer düsteren Faszination für Wasser getrieben wird. Droht Mogens das gleiche schreckliche Schicksal? Um das herauszufinden, muss Ravn tief in der Vergangenheit Berlins graben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Ähnliche
Buch
Der Finanzmanager Mogens Slotsholm flüchtet von Kopenhagen nach Berlin, um dort einen geheimen Bekannten zu treffen. Offenbar hat er zuvor Gelder veruntreut, aber niemand weiß, wie hoch die Summe wirklich war. Doch Mogens kehrt nicht mehr zurück, und plötzlich fehlt jede Spur von ihm. Seine Schwester Louise macht sich Sorgen und kontaktiert den Ermittler Ravn, der noch immer unter dem Mord an seiner Freundin Eva leidet. Als Anzeichen auftauchen, dass Eva ihn vor ihrem tragischen Tod betrogen hat, stürzt er sich verzweifelt in die Suche nach Mogens, um sich abzulenken. Schließlich findet Ravn heraus, dass weitere Männer in Berlin verschwunden sind – und kurz darauf tot in der Spree gefunden wurden. Dahinter scheint ein Serienmörder zu stecken, der sich ganz besonders vom Element Wasser angezogen fühlt. Ravn und Louise setzen alles daran, Mogens zu finden, bevor ihn das gleiche Schicksal ereilt wie die anderen Opfer. Doch dafür müssen sie tief in der Vergangenheit der einst geteilten Stadt graben …
Weitere Informationen zu Michael Katz Krefeld
sowie zu weiteren lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
MICHAEL KATZ KREFELD
Vermisst
Thriller
Aus dem Dänischen
von Knut Krüger
Die dänische Originalausgabe erschien 2014
unter dem Titel »Savnet«
bei Lindhardt og Ringhof, Kopenhagen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung August 2016
Copyright © der Originalausgabe 2014
by Michael Katz Krefeld & Lindhardt og Ringhof Forlag
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by agreement with Salomonsson Agency
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Arcangel/Maria Heyens
Redaktion: Hanne Hammer
AG · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-16652-6V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Lis,
meine beste Freundin,
die schönste Frau,
mein Ein und Alles.
»All along the watchtower
Princes kept the view
While all the women came and went
Barefoot servants, too«
BOBDYLAN
1
Hohenschönhausen, Berlin, 11. Juli 1989
Die hufeisenförmige Haftanstalt lag im strömenden Regen in der Nacht still da. Hinter den hohen Milchglasscheiben des Wachturms, der der Ringmauer am nächsten stand, glitten schemenhaft die Silhouetten der Wärter vorbei. Unterhalb des Turms standen vier Soldaten der Division XIV, ihre Maschinengewehre hingen lose über ihren Schultern. Es war eine ruhige Nacht, ohne Überstellung weiterer Insassen. Die Männer wechselten hier und da ein Wort miteinander, während sie ihre Zigaretten vor dem Regen schützten, sodass die Innenseiten ihrer Hände jedes Mal aufleuchteten, wenn sie einen Zug nahmen.
Im ersten Stock von Zellenblock B blieb Oberst Hausser vor der Tür des Verhörzimmers stehen und betrachtete das rote Deckenlicht. Er war Mitte dreißig, wirkte durch sein faltiges Gesicht jedoch deutlich älter. Er war in Zivil, und sein knielanger Mantel schon völlig durchnässt. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den anderen, während sich seine Finger in den schwarzen Lederhandschuhen verschränkten. Im gesamten Gefängnis herrschte ein Ampelsystem, das verhinderte, dass ein Insasse, der von seiner Zelle in einen Verhörraum gebracht wurde, andere Insassen zu Gesicht bekam. Die systematische Isolation hatte Methode, und obwohl Hausser diese Regelung begrüßte, irritierte es ihn, dass er nun selbst warten musste. Sekunden später, nachdem der Gefangene passiert hatte, sprang die Deckenampel auf Grün. Hausser, der fast zwei Meter groß war, bog um die Ecke und stapfte den langen schmalen Gang hinunter, an dem sich zu beiden Seiten schallisolierte Räume mit gepolsterten Türen befanden.
Trotz der späten Stunde waren fast alle der insgesamt hundertzwanzig Verhörräume, die sich über drei Stockwerke verteilten, belegt. Das war eine weitere Grundregel der Strafvollzugsanstalt Hohenschönhausen: den Insassen jegliche Nachtruhe zu entziehen.
Hausser schloss den letzten Raum am Ende des Korridors auf und schaltete das Deckenlicht an. Das Büro war spartanisch eingerichtet und enthielt nichts als einen Schreibtisch, zwei Stühle und einen Aktenschrank – so wie die anderen hundertneunzehn Zimmer. Obwohl er seit sechs Jahren in dem Gefängnis arbeitete, hatte Hausser in diesem Büro noch kein einziges Verhör geführt. Es diente einzig allein dazu, seine ganz speziellen Verhörmethoden zu verschleiern. Hausser schob sich an dem leeren Schreibtisch vorbei, der den Großteil des Raums einnahm, und schloss mit einem kleinen glänzenden Schlüssel den Archivschrank in der Ecke auf. Aus der obersten Schublade zog er einen Schlüsselbund, den er in die Tasche steckte.
Wenige Minuten später stand er erneut draußen auf dem Hofplatz. Er schlug den Kragen hoch und eilte im strömenden Regen dem früheren Verwaltungstrakt entgegen, in dem sich heute das Depot befand. Vor der Treppe, die in den Keller führte, stand ein junger Wachsoldat. Als er Hausser erblickte, nahm er Haltung an und salutierte. Hausser stieg die steile Treppe nach unten. Aus dem Dunkel traten ihm zwei seiner Leute entgegen. Hausser nickte ihnen kurz zu, worauf sie sich ihm anschlossen. Gemeinsam schritten sie den Gang hinunter, an dem die engen feuchten Zellen lagen. Seit dem Ausbau des Gefängnisses dienten sie als Lagerräume – mit Ausnahme der letzten Zelle am Ende des Ganges. Sie gehörte zu Haussers Abteilung, der Sektion Z. Nur sehr wenige Personen wussten von diesem Raum und davon, was sich darin befand. Nicht einmal Genosse Mielke, der Minister für Staatssicherheit in der DDR, oder der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker wussten von seiner Existenz. Hin und wieder erfuhren sie von den Ergebnissen, die hier erzielt wurden, aber das war auch alles.
Hausser holte den Schlüsselbund aus der Tasche und schloss die Tür auf. Die rostigen Scharniere knarrten, als er die schwere Zellentür mit einem Ruck aufzog.
In der Zelle brannte eine nackte Glühbirne, die ein spärliches Licht verbreitete. In diesen fensterlosen, nicht klimatisierten Raum waren einst zwanzig Gefangene auf einmal gepfercht worden. Jetzt stand nur noch eine große schwarze Metallkiste auf dem Boden. Sie bestand aus vier zusammengeschweißten Schiffstüren, die an den Enden mit Eisenplatten versiegelt waren. Hausser hatte die Türen seinerzeit von der Marinewerft in Rostock beschlagnahmt; die Schweißarbeiten hatte ein Arbeiter in aller Heimlichkeit direkt in der Zelle durchgeführt. Die oberste Tür, die als Deckel fungierte, hatte ein Bullauge. Im trüben Licht der Zelle schien es, als würde es Hausser einen trägen Blick zuwerfen. Von der rechten Seite der Kiste aus führte ein Gummischlauch zu einem Wasserhahn an der Wand. Allerdings war die Verbindung ein wenig undicht, sodass sich auf dem Boden eine kleine Lache gebildet hatte, über die Hausser einen Schritt machen musste, als er zu der Kiste weiterging. Er beugte sich über den rostigen Deckel mit der abgeblätterten schwarzen Farbe und rieb mit seiner behandschuhten Hand an dem Bullauge. Dann ballte er die Faust und schlug hart gegen das Glas. In der Kiste rumpelte es so heftig, dass das Wasser von innen gegen das Bullauge schwappte. Als Hausser erneut gegen das Glas schlug, wurde ein weißes aufgedunsenes Gesicht sichtbar. Mit blutunterlaufenen Augen warf es Hausser einen wilden Blick zu.
»Nur die Unschuldigen schlafen«, murmelte Hausser.
2
Christianshavn, 12. September 2013
Mogens drehte den Wasserhahn auf und spülte die letzten Reste des Haferbreis von seinem Teller. Mit der Spülbürste drückte er die Klumpen durch das stählerne Sieb des Abflusses, wo sie sich auflösten und verschwanden. Es war zehn vor sieben, aus der Nebenwohnung hörte er, wie die Nachbarn sich stritten und ein Kind schluchzte. Mogens trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch ab und schaute an sich hinunter, um sich zu vergewissern, dass er nicht auf sein weißes Hemd gekleckert hatte. Er öffnete den Kühlschrank, leerte den Inhalt in eine Plastiktüte, trat auf den Flur und ließ die Tüte im Müllschlucker verschwinden. Nachdem er in seine Wohnung zurückgekehrt war, ging er ins Bad, verstaute seine Zahnbürste und eine halb volle Tube Zahnpasta in seinem Kulturbeutel, in den er am gestrigen Abend bereits das Nötigste gepackt hatte. Er betrachtete sich im Spiegel. Strich sich die dünnen Haare aus der Stirn, nahm seine Brille mit den dicken Gläsern ab und rieb sich die müden Augen. Er war zweiundvierzig Jahre alt, hatte jedoch das Gefühl, bereits mehr als die Hälfte seines Lebens hinter sich zu haben. Seine ungesunde Lebensweise mit zu viel Fastfood und zu wenig Bewegung hatte deutliche Spuren in seinem schwammigen Gesicht hinterlassen. Er brachte mindestens zwanzig Kilo zu viel auf die Waage, und der extrem weite Anzug, den er heute trug, ließ ihn nicht gerade schlanker wirken. Doch damit sollte es bald vorbei sein. In Zukunft würde er weniger essen und mehr trainieren. Auch in dieser Hinsicht sollte der heutige Tag ein Wendepunkt sein. Er drehte sich um und ging ins Schlafzimmer, wo sein geöffneter Koffer auf dem Bett lag. Er legte sein Necessaire neben den durchsichtigen Plastikbeutel mit der blonden Perücke und der dunklen Sonnenbrille, womit er sich tarnen wollte, wenn die Zeit reif war. Fünf Minuten später stand er im Mantel an der Haustür, seine Lederaktentasche in der einen Hand, den Koffer in der anderen. Er warf einen letzten Blick auf die Wohnung, ehe er die Tür zuwarf, gewiss, niemals hierher zurückzukehren, ganz gleich, wie die Sache heute ausgehen würde.
Mogens ging die Overgade oberhalb des Wassers entlang, wo der Morgennebel immer noch über dem Kanal waberte, an dessen Kai die Boote vertäut waren. Die Plastikräder des Koffers ratterten so laut, dass sie eine Englische Bulldogge aufweckten, die auf dem Achterdeck eines Schiffs vor sich hin gedöst hatte. Der Hund kläffte und warf Mogens, der sofort die Straßenseite wechselte, einen grimmigen Blick zu. Als er den Fedtekælderen passierte, wo ein paar Obdachlose Kaffee tranken, nickte ein zahnloser Mann zu seinem Koffer hin und rief: »Bon voyasse!«
Mogens antwortete nicht und beschleunigte seine Schritte.
Kurz darauf zog er seinen Koffer über den Zebrastreifen am Christianshavns Torv und stellte sich an die Bushaltestelle vor dem Lagkagehuset, aus dem es verführerisch nach warmem Brot duftete. Nur die wenigsten wussten, dass sich hier einst ein Gefängnis befunden hatte, und Mogens wollte diesen Gedanken auch gar nicht weiterverfolgen. Er schaute ungeduldig auf seine Uhr, es dauerte immer noch zwei Minuten, bis der 9A kommen würde. Die Wartenden scharten sich bereits um ihn herum. Er spürte einen Anflug von Klaustrophobie. Ihm brach der Schweiß aus. Er musste seine Nerven in den Griff bekommen. Er litt ohnehin an einer Überfunktion der Schweißdrüsen und transpirierte bei der geringsten Anspannung, doch heute musste er wie die Ruhe selbst wirken. In diesem Moment rollte der Bus heran und öffnete seine Türen. Er spürte die Stöße der drängelnden Passagiere in seinem Rücken und quetschte sich in den überfüllten Bus.
Er bahnte sich seinen Weg zur Mitte des Fahrzeugs und stellte sich möglichst nah an die Türen, um zwischendurch ein bisschen Frischluft zu bekommen. Doch je länger die Fahrt durch die Innenstadt dauerte, desto weiter wurde er nach hinten geschoben, wo die Luft verbraucht war und er kaum atmen konnte. Er hatte das Gefühl, dass viele der anderen Fahrgäste ihn und seinen großen Koffer anstarrten. Dass sie ihn durchschauten und es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand die Polizei rufen würde. Erneut spürte er Panik in sich aufsteigen und hätte sich am liebsten zur Tür gedrängt, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Doch er riss sich zusammen, schloss die Augen und versuchte, seine Atmung unter Kontrolle zu bringen.
Als der Bus endlich den Hauptbahnhof erreichte, stieg er erleichtert aus und folgte dem Strom der Reisenden zu der breiten Treppe, die in die Ankunftshalle hochführte. Die Reiseübelkeit ließ allmählich nach und wurde vom Rausch des Adrenalins abgelöst, das durch seinen Körper pumpte. Mogens durchquerte die weitläufige Halle und ging zur Gepäckaufbewahrung an der Reventlowsgade. Er kam an dem kleinen Büro vorbei, das erst in einer Stunde besetzt sein würde. Das kalte Licht der Neonröhren wurde von den zahllosen Aluminiumtüren der Schließfächer reflektiert und verlieh der Gepäckaufbewahrung das Flair einer Leichenhalle. Er blickte starr auf den Boden und vermied es sorgsam, zu den an der Decke montierten Kameras aufzublicken. Die Polizei konnte ihn anhand der Bilder womöglich identifizieren, doch zu dieser Zeit würde er bereits über alle Berge sein. Er fand ein freies Schließfach und stellte seinen Koffer hinein. Dann bezahlte er die sechzig Kronen, die eine 24-stündige Aufbewahrung kostete. Wenn alles glattlief, würde er binnen fünf Stunden wieder zurück sein. Falls alles glattlief …
Er benutzte denselben Busfahrschein und setzte sich auf einen der vordersten Plätze. Die Linie A9 war nur schwach frequentiert. Dafür hatte der Morgenverkehr zugenommen, und die Rückfahrt durch die Stadt verlief etwas zäher als die Hinfahrt. Erneut blickte er auf die Uhr. Zwanzig vor acht. In sechs Minuten würde er wieder auf dem Christianshavns Torv stehen und jede Menge Zeit haben, um von dort aus die achthundert Meter bis zur Brobergsgade zu gehen. Um 07.59 Uhr würde er an seinem Arbeitsplatz einstempeln, genau wie an jedem Arbeitstag in den letzten knapp zwanzig Jahren. Keiner seiner Kollegen würde etwas ahnen. Alles war vollkommen normal. Er lächelte bei dem Gedanken … In diesem Moment kam der Bus mitten auf der Knippelsbro zum Stehen. Er starrte aus dem Fenster und sah, wie sich ein rot-weißer Schlagbaum senkte. Der warnende Hupton traf ihn wie ein Blitz, während er zusah, wie sich die Brückenklappe mitsamt der Fahrbahn himmelwärts hob, als wäre dies eine direkte Ausfahrt in den bewölkten Himmel.
Das war doch nicht möglich. Das durfte einfach nicht sein. Er konnte sein Pech nicht fassen. Alles hatte er in seinem minutiösen Plan berücksichtigt, nur das nicht. Er warf einen panischen Blick auf die Uhr. Schon Viertel vor acht. Er blickte aus dem Fenster auf das Hafenbecken, wo sich ein Dreimast-schoner im Schneckentempo der Brücke näherte. Im Stillen verfluchte er das altmodische Segelschiff. Wünschte die Besatzung zur Hölle, die den Passanten und Fahrradfahrern, die sich am Geländer postiert hatten und den unverhofften Anblick genossen, freundlich zuwinkte.
Um 8.04 Uhr sprang Mogens an der Haltestelle Christianshavns Torv aus dem Bus. Seine Aktentasche unter den Arm geklemmt spurtete er quer über die Straße und rannte die Dronningensgade hinunter. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so schnell gewesen war, und sein unbeholfener Laufstil verriet, dass auch sein Körper dies vergessen hatte. Als er endlich die Brobergsgade erreichte, musste er kurz innehalten, um ein wenig Atem zu schöpfen. Er strich rasch seine Kleidung glatt und wischte sich den Schweiß von der Stirn, ehe er durch das offene Tor schritt, das zum Firmensitz von Lauritzen Enterprise führte. Die Bauarbeiter und Handwerker des Unternehmens waren längst zu den verschiedenen Baustellen aufgebrochen. Auf dem kleinen Hof stand kein einziges Fahrzeug. In der Werkstatt sah er zwei Schmiede. Er stieg rasch die Treppe in den ersten Stock hoch, wo sich die Buchhaltung befand. Er öffnete die Tür und nahm die kleine Lochkarte, die seinen Namen trug, aus dem Regal neben der Uhr. Es war eine altmodische Firma, für die er arbeitete. Er hörte ein dumpfes KLUNK, die Stempeluhr zeigte 8.19 Uhr. Nie zuvor war er so spät zur Arbeit erschienen.
»Na, hast wohl nicht aus dem Bett gefunden.«
Mogens drehte sich um und stand dem Verkaufschef Carsten Holt gegenüber. Carsten war Mitte dreißig, sonnengebräunt und ziemlich kurzbeinig, als hätte sich nur sein Oberkörper voll entwickelt. Carsten besaß einen alten Chevrolet Camaro und liebte es, über ihn zu reden. Deshalb wurde er von den meisten Kollegen Camaro Carsten oder einfach nur CC genannt, was ihm nicht das Geringste ausmachte.
Carsten zeigte mit dem Finger auf ihn. »Mein Gott, wie du schwitzt, Mogens. Bist du krank?«
»Nein, nein, überhaupt nicht«, antwortete Mogens, trocknete sich rasch die Stirn ab und legte die Stempelkarte an ihren Platz zurück. »Wie kommst du darauf, CC?«
»Dein Gesicht glänzt, als wärst du gerade durch den strömenden Regen gelaufen.«
Er schüttelte den Kopf und beeilte sich, in sein Büro zu kommen, während er Carstens Blick in seinem Rücken spürte.
Mogens erblickte einen Berg von Rechnungen und Belegen, die andere auf seinen Schreibtisch geworfen hatten. Im Grunde waren die jungen Frauen in seiner Abteilung für die Buchführung zuständig, nicht er. Er beschäftigte sich eher mit übergeordneten Dingen, sorgte dafür, dass die Bilanzen insoweit stimmten, dass sie keinen Ärger mit dem Finanzamt bekamen. In dieser Hinsicht hatte er immer zu den Kreativen gehört. Er ließ sich schwer auf den abgenutzten Bürostuhl fallen, der unter seinem Gewicht ächzte.
Seine gesamte Planung war durch eine Hubbrücke über den Haufen geworfen worden. Hatte Camaro Carsten ihm gerade einen misstrauischen Blick zugeworfen, oder bildete er sich das bloß ein? Mogens musste an die Bulldogge auf dem Achterdeck denken, die ihn böse angestarrt hatte. Das war bereits ein schlechtes Omen gewesen, ein Gruß aus der Hölle. Doch er musste jetzt weitermachen. Wenn er seinen Plan heute nicht durchführte, würde er nie von hier fortkommen.
3
Hohenschönhausen, Berlin, 11. Juli 1989
Hausser drehte an dem runden Griff, der an einer der Schiffstüren befestigt war. Es quietschte, als er mit beiden Händen daran zog und die Tür schwer auf eine Seite der Kiste fallen ließ. Der beißende Gestank von Urin schlug ihm entgegen. Die bleiche schwergewichtige Gestalt, die halb versunken in dem verunreinigten Wasser hockte, warf sich Hausser entgegen. Das Halsband und die Ledermanschetten, die die Handgelenke des Mannes umschlossen, waren durch eine Kette mit dem Boden der Kiste verbunden und hielten ihn unbarmherzig fest. Hausser betrachtete den stämmigen Mann, der um die sechzig war. Seine Haut sah durchsichtig aus und schien sich nach den vielen Tagen im Wasser bereits aufzulösen. Die schwarze Körperbehaarung des Mannes klebte ihm wie ein nasses Fell am Rücken und an den Gliedern. »Lassen … Sie mich frei … ich … bitte Sie …«, stammelte er mit bläulichen Lippen.
»Identifizieren Sie sich, Gefangener!«
Der Mann blickte flehentlich zu Hausser hoch. »Nummer 1-6-6 … bitte … lassen Sie mich gehen.«
»Nichts täte ich lieber«, entgegnete Hausser. »Glaubst du etwa, es macht mir Spaß, hier meine Zeit zu vergeuden?«
Der Mann schüttelte den Kopf.
Hausser zog den Schlüsselbund aus der Tasche. Der Mann starrte wie hypnotisiert auf die Schlüssel, während er versuchte, Hausser seinen Arm mit der verschlossenen Manschette entgegenzustrecken. »Aber zuerst musst du mir die Wahrheit sagen.«
»Das … das habe ich doch schon getan.«
Hausser schüttelte den Kopf. »Drei Monate lang hast du die Vernehmungsleiter angelogen, bist einer Lüge nach der anderen überführt worden. Sie haben dich mit Kaffee und Zigaretten versorgt, waren freundlich zu dir, und dennoch – oder vielleicht deswegen – hast du ihnen Lügen aufgetischt. Deshalb haben sie dich mir überlassen.«
»Aber ich bin unschuldig. Ich weiß nicht mal, was ich verbrochen haben soll. Das hat mir niemand gesagt.«
»Du weißt selbst am besten, was du verbrochen hast. Das müssen wir dir nicht sagen. Doch statt deine Taten zu bereuen und zu gestehen, hast du dich entschieden zu lügen. Sieh dich an. Sieh, in was für eine Lage du dich gebracht hast.«
Der Mann wollte seine Stellung in der Kiste verändern und versuchte, die Beine zu strecken, aber die Enge und die Ketten hinderten ihn daran. »Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt.«
»Du willst mir also sagen, dass ich lüge?« Hausser ließ seinen Blick von dem Schlüsselbund zu dem Mann wandern.
»Nein … das … Ich weiß ja nicht, was man Ihnen erzählt hat. Aber ich habe auf alle Fragen ehrlich geantwortet. Habe alles erzählt. Ehrenwort. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bitte Sie … ich halte das nicht mehr aus …« Er begann zu schluchzen, seine schmale Brust hüpfte im Takt dazu.
»Leo!«, rief Hausser.
Leo hörte auf zu schluchzen, offenbar überrascht, dass ihn zum ersten Mal seit seiner Festnahme jemand beim Vornamen nannte und nicht nur mit einer Nummer in Verbindung brachte.
»Es ist einzig und allein deine Schuld, dass du in dieser Situation gelandet bist. Hättest du sofort die Wahrheit gesagt, wärst du jetzt nicht hier, sondern bei deiner Frau Gerda, bei deinen Söhnen Klaus und Johan und dem kleinen Stefan. Dann wüssten wir, dass wir uns auf dich verlassen können und dass du uns helfen willst. Helfen, den Klassenfeind zu bekämpfen und die Spione der Faschisten zu enttarnen. All die Leute, die unsere Partei und unser Vaterland bedrohen. So einfach ist das. Du allein hast alles kompliziert gemacht.«
»Aber ich will doch helfen …«
»Unterbrich mich nicht!«
Leo biss sich auf die Lippen und starrte auf das trübe Wasser.
»Der einzige Grund, warum ich mit dir rede – warum ich dich nicht in deinen eigenen Ausscheidungen ertrinken lasse –, ist der, dass du mich bisher nicht angelogen hast. Ich bin gewillt, all die Lügen zu vergessen, die du meinen Kollegen erzählt hast. All die Zeit, die du vergeudet hast. All das Vertrauen, das du missbraucht hast. Deshalb denk jetzt gut nach, Leo, und wäge deine Worte sorgfältig ab.« Hausser zog die Brauen zusammen, sodass sie wie ein Schatten über seinem Nasenrücken lagen. »Ich kann Lügen nicht ausstehen. Ich verabscheue sie. Sie bereiten mir Übelkeit.« Hausser beugte sich vor und stützte seine Hände auf den Rand der Kiste. Der Schlüsselbund in seiner Hand scharrte an der Seite entlang, und Leo warf einen verstohlenen Blick darauf. Hausser senkte die Stimme. »Verstehst du, Leo? Verstehst du, was Lügen in mir auslösen?«
Leo nickte so eifrig, dass seine Ketten rasselten. »Was … was wollen Sie wissen?«, stotterte er.
»Wie viel zahlen sie dir? All die, denen du zur Flucht verhilfst?«
Leos Blick flackerte. »Ich … ich weiß ni…«
»Pass auf, dass dies nicht dein letzter Satz wird. Wenn du mich anlügst, schließe ich die Kiste und lasse dich in deiner eigenen Pisse ersaufen.«
»Tausend Dollar!«, rief er. »Manchmal auch mehr. Das kommt auf die Unkosten an.«
»Und wo graben deine Leute den nächsten Tunnel?«
Leo keuchte heftig, während er zögerte.
»Wo, Leo?« Hausser griff nach dem Deckel.
»Ruppiner Straße 8, da ist eine Autowerkstatt.«
Hausser nickte und ließ seinen Blick nachdenklich durch den Raum schweifen. »Ich glaube, die kenne ich. Die kümmert sich um die Fahrzeuge des Innenministeriums, nicht wahr?«
Leo nickte rasch. »Als wir damit anfingen, schien das eine gute Tarnung zu sein. Wir bekamen Hilfe von hochstehenden Parteifunktionären. Alle wollen jetzt gerne weg.«
»Und wie weit seid ihr?« Leo zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich nicht. Aber es ist der längste Tunnel, der je geplant wurde, hundertsechsundvierzig Meter.« Er hörte sich fast ein wenig stolz an. »Es fehlte noch ein Stück, ungefähr vierzig Meter, als … als ich festgenommen wurde. Wenn die Jungs nicht aufgegeben haben oder abgehauen sind, müssten sie eigentlich fertig sein.«
Hausser richtete sich auf. »Wie viele Verräter sollen durch diesen Tunnel geschleust werden?«
»Etwa fünfhundert, vielleicht mehr. In der heutigen Zeit ist das fast wie eine unterirdische Filiale von Interflug … Entschuldigung, aber so ist die Realität.«
»Dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Ich schätze trotz allem einen Mann, der seine Arbeit ernst nimmt. Selbst einen Menschenschmuggler. Einen Menschenschmuggler und Pädophilen wie dich.«
Leo fiel die Kinnlade herunter.
»Oh ja, Leo, wir wissen alles. Die Staatssicherheit hat ihre Augen überall. In Schlafzimmern und Hinterhöfen, in dunklen Parks und auf den leeren Schulsportplätzen. Überall dort, wo du dich mit den Jungpionieren vergnügt hast. All den Kindern, die du mit Süßigkeiten aus dem Westen gelockt hast.«
Hausser ließ den Schlüsselbund in seiner Tasche verschwinden und griff erneut nach dem Deckel.
»Was tun Sie da?«, rief Leo. »Ich sage doch die Wahrheit …«
»Das werden wir jetzt überprüfen. Und bis dahin bleibst du, wo du bist.«
Hausser warf den Deckel zu. Als er an dem Handgriff drehte, übertönte das Scharren der Sperrhaken Leos verzweifeltes Schluchzen in der Kiste.
* * *
Drei Stunden später, als die Morgendämmerung einsetzte und der Regen nachließ, kehrte Hausser in die Haftanstalt Hohenschönhausen zurück. Erschöpft von der nächtlichen Arbeit gähnte er herzhaft, als er die Zelle betrat. Zusammen mit einer Einheit der Division VII, die für die operativen Aufgaben der Staatssicherheit zuständig war, hatte er die Gegend um die Autowerkstatt in der Ruppiner Straße observiert. Es war ihnen schnell klar geworden, dass Leos Männer trotz seines plötzlichen Verschwindens mit den Grabungsarbeiten für den Tunnel immer noch in vollem Gang waren. Mehrere Personen waren im Laufe der Nacht im Werkstattgebäude ein und aus gegangen, und am frühen Morgen hatte ein voll beladener Lastwagen das Gelände verlassen. Hausser war sich sicher, dass unter der Plane Erde und Gesteinsbrocken verborgen waren. Darum gab es auch keinen Grund, Leo noch länger warten zu lassen. Hausser setzte sich auf den Rand der Kiste, schaute durch das Bullauge und fing Leos flehentlichen Blick auf. Er hob die Stimme. »Du hast die Wahrheit gesagt, Leo. Für jemanden wie dich, der sein Leben der Lüge geweiht hat, muss das eine Befreiung gewesen sein. Ich habe versprochen, dich nicht ersaufen zu lassen, und an dieses Versprechen hätte ich mich auch gern gehalten. Das Problem ist nur, dass Müller hier«, Hausser zeigte auf den Mann mit dem kurz geschorenen Schädel, der am Wasserhahn stand, »dagegen ist, dass jemand lebend aus der Kiste herauskommt.« In diesem Moment drehte Müller den Hahn auf, sodass das Wasser durch den Schlauch ins Innere der Kiste lief. Als Leo das Eindringen des kalten Wassers spürte, begann er zu schreien und an seinen Ketten zu zerren.
Hausser legte den Zeigefinger an die Lippen, während er den Kopf schüttelte. »Es geht nicht anders. Diese Kiste ist unser Geheimnis. Das am besten gehütete Geheimnis des Staates.« Durch das Bullauge beobachtete Hausser, wie das Wasser allmählich stieg und schließlich Leos Kopf bedeckte. Er spürte, wie Leo seinen Rücken verzweifelt gegen den Deckel stemmte. Doch er kämpfte einen ungleichen Kampf gegen die massive Stahltür, und schließlich verließen ihn die Kräfte. In der Zelle wurde es still. Als sich die Kiste vollständig mit Wasser gefüllt hatte, lief ein wenig an den undichten Seiten heraus. Müller drehte den Hahn zu. Hausser legte den Kopf auf die Seite und betrachtete die letzten Luftblasen, die aus Leos offenem Mund entwichen und zum Bullauge hinaufstiegen. Die Blasen des gelblichen Wassers ließen Hausser an ein frisch gezapftes Berliner Pilsner denken. Plötzlich hatte er mächtigen Durst. Es war eine erfolgreiche Nacht gewesen. Ein weiterer Verräter hatte sein Leben ausgehaucht, und schon bald würde jemand Leos Nachfolge in der Kiste antreten.
4
Christianshavn, 12. September 2013
Es war neun Minuten nach zwölf. Mogens saß hinter seinem Schreibtisch und trommelte mit den Fingern ungeduldig auf die Tischplatte. Durch die Türöffnung sah er die runde Uhr mit den römischen Ziffern, die im Vorzimmer an der Wand hing. Als sich der große Zeiger wie in Zeitlupe auf die II schob, stand er von seinem Stuhl auf. Er nahm die Klarsichthülle, die vor ihm auf dem Tisch lag, zog eine mittelgroße Büroklammer aus dem Becher mit den Kugelschreibern und steckte sie sich in die Brusttasche. Jetzt gab es kein Zurück mehr, sein Coup gegen Lauritzen Enterprise war in vollem Gang. Ein Coup, von dem er jahrelang geträumt und den er bis ins kleinste Detail geplant hatte. Jetzt würde er sich für all die Demütigungen rächen, die er von seinem Chef, Axel Pondus Lauritzen, hatte erdulden müssen. Jetzt war er nicht mehr das Dickerchen, der Idiot, der Hornochse und Einfaltspinsel, der zu blöde war, zwei und zwei zusammenzuzählen.
Mogens verließ sein Büro und spazierte durch das geräumige Vorzimmer, dessen sechs Schreibtischplätze erwartungsgemäß nicht besetzt waren. Drei der jungen Frauen, die hier arbeiteten, aßen jeden Mittwoch gemeinsam im Café Oven Vandet zu Mittag und würden frühestens in fünfundzwanzig Minuten wieder zurück sein. Die vierte hatte sich krankgemeldet, und die letzten beiden, Karen und Ellen Thyregod, seine eigene Sekretärin, waren zu dieser Zeit in der Kantine im zweiten Stock. Ellen war die Pünktlichste von allen und würde mit Sicherheit um Punkt halb eins wieder ihren Platz am Schreibtisch einnehmen; er hatte also keine Zeit zu verlieren. Er setzte seinen Weg ins Treppenhaus fort und eilte hinunter ins Erdgeschoss, wo sich die Werkstatt befand. Durch die offene Tür sah er den polnischen Werkmeister Stefaniak mit dem Rücken zu ihm an der großen Drehbank stehen. Im selben Moment hörte Mogens, wie draußen auf dem Hof eine Palette in den Lastenaufzug geschoben wurde. Beide Aufzugtüren standen offen, sodass man durch den Aufzug hindurch direkt in den Hof blicken konnte. Der Fahrer in der gelben Jacke zog seine Handkarre unter der Palette mit dem Büromaterial weg und schloss die Aufzugtüren hinter sich. Alle sechs Wochen wurde neues Büromaterial geliefert, und es war die Aufgabe des Büroboten, Rune, mit der Lieferung nach oben in den zweiten Stock zu fahren. Mogens wusste, dass Rune jedoch stets erst zu Mittag aß, bevor er sich nach unten bemühte, um die Aufzugtüren zu schließen. Jetzt musste Mogens nur noch darauf warten, dass Stefaniaks schwache Blase den Werkmeister auf die Toilette trieb, was mehrmals pro Stunde geschah. Dass Stefaniak bereits auf der Stelle trippelte, signalisierte Mogens, dass es nicht mehr lange dauern konnte. Wenige Minuten später verließ der Pole seine Drehbank, und Mogens konnte ungesehen durch die Werkstatt zum Aufzug spazieren. Behutsam zog er die Türen zu und drückte auf den Knopf. Der alte Warenaufzug fuhr ruckelnd in den zweiten Stock, wo Mogens ausstieg und sich in die kleine Nische zurückzog, die an dem langen Gang lag. Aus der Kantine am Ende des Ganges drangen Essensgerüche zu ihm herüber. In der Ferne hörte er das Schnattern seiner Kollegen. Er streckte vorsichtig den Kopf heraus und spähte zum Empfang hinüber, wo Pauline saß und in ihre Kopfhörer sprach. Lizette, die andere Rezeptionistin, war erwartungsgemäß nicht zu sehen, weil sie zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Teil des Gebäudes beschäftigt war.
Er setzte seinen Weg fort und ging am Büro der technischen Zeichner vorbei, in dem nur Lasse, der Assistent eines der Ingenieure, saß. Lasse spielte wie immer voll konzentriert am Computer Counter-Strike und nahm keine Notiz von Mogens, als der sich an dem großen Fenster vorbeischlich. Mogens ging bis zu dem letzten Büro des Flurs weiter, vor dem er stehen blieb. Auf dem Messingschild an der Mahagonitür stand der Name des Direktors: Axel Pondus Lauritzen. Mogens legte sein Ohr an die Tür und lauschte, ehe er vorsichtig die Klinke herunterdrückte. Die Tür war abgeschlossen. Er nahm die Klarsichthülle, bückte sich und schob sie halb unter der Tür hindurch. Dann holte er die Büroklammer aus seiner Tasche, bog sie auseinander und führte sie behutsam in das Schloss ein. Er bewegte sie vorsichtig hin und her, bis auf der anderen Seite der Tür ein dumpfes Geräusch zu hören war. Mogens bückte sich erneut und zog vorsichtig die Klarsichthülle mit dem Schlüssel unter der Tür hervor. Er steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Tür.
Im Büro von Pondus Lauritzen roch es schwach nach Zigaretten. Mogens war schon unzählige Male in diesem Raum gewesen, in der Regel, um einen Rüffel zu kassieren. Trotzdem war es etwas ganz anderes, allein in dem düsteren Raum mit dem riesigen Mahagonischreibtisch, den Chesterfieldsesseln und den Porträts an der Wand zu stehen, die drei Generationen der Lauritzens zeigten – eine mürrischer als die andere. Lautlos schlich er über den dicken Teppich zum Tresor, der sich nahe am Schreibtisch befand. Von hier aus konnte er einen Blick in den Konferenzraum werfen, in dem Pondus Lauritzen am Ende des langen Tisches stand. Mogens hielt die Luft an und spürte sein Herz in der Brust hämmern, während er seinen Chef betrachtete. Pondus Lauritzen stand mit dem Rücken zu ihm, seine Hose schlackerte um seine Fußgelenke, das blaue Hemd hing ihm halb über seinen riesigen bleichen Hintern. Zu beiden Seiten von ihm schaute ein schlankes Frauenbein hervor. Die Zehennägel der Füße, die leicht auf der Tischplatte ruhten, waren rosa lackiert, ohne zu verraten, wer da auf dem Tisch lag. Doch Mogens wusste alles über die erotische Beziehung zwischen Lauritzen und Lizette, die sich jeden Mittwoch nach der Mittagspause abspielte. Eine Beziehung, die seit einem halben Jahr bestand und Mogens’ Beobachtungen zufolge jedes Mal acht bis neun Minuten dauerte. Er hoffte, dass Pondus Lauritzen seiner sechsundsechzig Jahre zum Trotz auch heute über die volle Distanz durchhielt, und beeilte sich, den Zahlencode für den Safe einzugeben: links 19, rechts 47, links 12, rechts 5. Ein Code, den man sich ebenso leicht merken konnte wie Lauritzens Geburtstag. Es klickte im Schloss, und die Tür glitt langsam auf. Mogens warf einen nervösen Blick in Richtung Konferenzraum, wo der Direktor das Tempo erhöht hatte. Er musste sich beeilen. Im obersten Fach lagen die Ringordner mit den Jahresabrechnungen – sowohl die offiziellen für die Steuerbehörde als auch die tatsächlichen, die genau auflisteten, wie viel Schwarzarbeit geleistet worden war. Daneben lagen ein Stapel mit Wertpapieren sowie drei kleine Schmuckkassetten. Die unteren Fächer waren vollgestopft mit Banknoten. Tausend- und Fünfhundertkronenscheine stapelten sich Seite an Seite. Mogens war überwältigt von dem Anblick des vielen Geldes. Es war mehr, als er gedacht hatte, vermutlich fast eine Million. Er knöpfte seine Jacke auf und begann, die Scheine in das Innenfutter zu stopfen, das er zuvor aufgetrennt hatte, um das gesamte Geld in seinem viel zu großen Jackett verstecken zu können.
»Ja!«, rief jemand hinter ihm. Mogens ließ erschrocken ein Bündel Tausendkronenscheine fallen und drehte sich um.
»Ja! Ja! Ja!«, stöhnte Pondus Lauritzen. Offenbar war das sein Schlachtruf während des Akts, der sich seinem Höhepunkt näherte.
Als keine weiteren Scheine mehr in das Innenfutter passten, steckte sich Mogens die Hosenbeine in die Socken und ging dazu über, die Banknoten in seine Hose zu stopfen, die nun als riesiger Geldsack fungierte. Nachdem er das letzte Bündel aus dem Safe genommen hatte, richtete er sich auf und blickte an sich hinunter. Er sah wie eine ausgestopfte Vogelscheuche aus, und für einen Augenblick verfluchte er seine Gier, während die Geldscheine an seinen Oberschenkeln kitzelten.
»Jaaaaaaa!«, stieß Pondus Lauritzen ein letztes Mal erschöpft aus. Für einen kurzen Moment schwankte er mit roten Wangen hin und her. Schweiß tropfte von seinem Gesicht auf Lizettes nackte Brüste. »Verdammt, Lizette, du bringst mich noch um!« Er bückte sich, zog seine Hose hoch und die Hosenträger stramm. Ehe Lizette etwas erwidern konnte, drehte er sich um und ging in sein Büro. Er sah sich kurz um, als würde er spüren, dass etwas nicht in Ordnung war, doch sein dunkles Büro war leer.
Mogens stand im Warenaufzug, der auf dem Weg ins Erdgeschoss war. Er lehnte sich gegen die Palette mit dem Bürobedarf und spürte, wie ihm der Schweiß herunterlief, nicht nur wegen seiner Nervosität, sondern auch wegen der extra Schicht Futter in seinem Jackett. Als Letztes hatte er den Schlüssel wieder ins Schloss von Lauritzens Bürotür gesteckt. Leider hatte er sie nicht abschließen können, sondern sich damit begnügen müssen, sie leise hinter sich zuzumachen. Er hoffte, dass Lauritzen es seiner eigenen Vergesslichkeit zuschreiben würde, dass sie nicht abgeschlossen war, konnte sich aber nicht sicher sein. Falls er Verdacht schöpfen sollte, würde er sofort einen Blick in den Safe werfen.
Mogens trat aus dem Fahrstuhl und stapfte in die Werkstatt. Stefaniak stand mit dem Rücken zu ihm und war so sehr in seine Arbeit versunken, dass es ihn offenbar nicht interessierte, wer den Aufzug benutzte. Mogens stieg so schnell wie möglich die Treppe zu seinem Büro hoch. Am liebsten hätte er das Fabrikgelände sofort verlassen, doch er musste erst die Mappe mit den Fahrkarten und seinem Pass aus seinem Büro holen. Das viele Geld in den Hosenbeinen behinderte ihn beim Gehen. Er kam sich wie Charlie Chaplin vor und glaubte, jeder müsse erkennen, dass sein Anzug mit Geld vollgestopft war. Glücklicherweise war noch keiner seiner Kollegen aus der Mittagspause zurückgekehrt. Er nahm seine Mappe vom Schreibtisch, und im nächsten Moment war er bereits wieder auf dem Weg die Treppe hinunter zum Ausgang und in die Freiheit.
»Mogens!«, hörte er eine Stimme eine halbe Etage über sich. »Nicht so schnell!«
Mogens erstarrte und drehte sich um.
Camaro Carsten eilte die Treppe hinunter und warf ihm einen neugierigen Blick zu. »Wo willst du denn hin?«
Mogens spürte, wie ihm der Schweiß auf die Stirn trat. »Ich … Das weißt du doch. Heute ist Mittwoch, und … ich muss … die Tippscheine …« Er klopfte leicht auf seine Mappe. In diesem Moment sah er, dass die Spitze eines Hundertkronenscheins aus seinem Jackenärmel lugte. Irgendwo musste das Futter aufgegangen sein, und es war nur eine Frage der Zeit, ehe ihm das Geld förmlich aus der Kleidung quellen würde. Er schluckte.
»Ich weiß«, entgegnete CC lächelnd, »aber nicht, ehe du auch meine Scheine mitgenommen hast.«
»Ach natürlich … tut mir leid, dass ich dich vergessen habe.«
»Ich hoffe, du hast nicht dein ganzes Vermögen gesetzt.« Carsten zog ein paar Coupons aus der Jackentasche.
»Nein, nein, das habe ich nicht.«
»Hast du auch auf Everton gesetzt?«
»Ja, äh, mit doppelter Gewinnchance.« Mogens öffnete die Mappe und legte Carstens Coupons hinein. Ein paar Tausendkronenscheine lösten sich aus seinem Ärmel und segelten direkt in die Mappe, doch Carsten schien es nicht zu bemerken. »Wir können später abrechnen.« Mogens schloss die Mappe und wollte weitergehen, aber Carsten hielt ihn am Ärmel fest.
»Findest du das falsch, dass ich doppelt gesetzt habe?«
»Nein, nein«, antwortete Mogens und entzog ihm behutsam seinen Arm. »Wer nichts wagt … wie man so schön sagt.«
Mogens spazierte die Overgade oberhalb des Wassers entlang. Ein Touristenboot glitt auf dem Kanal vorbei, und er hörte die Erklärungen des Fremdenführers in drei Sprachen. Der beißende Wind, der vom Hafenbecken herüberblies, kühlte ihm die Stirn und tat ihm gut. Bisher war sein Plan aufgegangen. Jetzt musste er nur noch eins erledigen, bevor er von hier verschwinden würde.
5
Berlin, 12./13. September 2013
Um 22.30 Uhr fuhr der Intercity aus Kopenhagen in den Berliner Hauptbahnhof ein und kam auf Gleis 2 zum Stehen. Er war eine halbe Stunde verspätet, und sobald sich die Türen öffneten, strömten die Reisenden ungeduldig auf den Bahnsteig hinaus und eilten zu den Rolltreppen. Mogens stieg als einer der letzten Passagiere aus dem hintersten Wagen. Er trug ein hellrotes Poloshirt, eine blonde Perücke und eine große Sonnenbrille, hinter der er sich versteckte. Das Gesicht und die nackten Arme hatte er mit einer dicken Schicht Bräunungscreme eingerieben, die seiner Haut einen bronzefarbenen Teint verlieh.
Mogens stapfte den Bahnsteig entlang, während er zu den vielen Stockwerken der Bahnhofshalle hinaufblickte. An der Rolltreppe standen ein paar Beamte und musterten die Reisenden, während sie leise miteinander sprachen. Mogens wusste nicht, ob bereits nach ihm gefahndet wurde, und wenn er ehrlich war, war seine Tarnung der größte Unsicherheitsfaktor seines Plans. Als er seine Flucht geplant hatte, war es ihm naheliegend erschienen, sich als Tourist zu verkleiden, und er hatte sich an den vielen ausländischen Kreuzfahrttouristen orientiert, die im Sommer in ihrer bunten Kleidung Christianshavn bevölkerten. Doch hier, am Berliner Hauptbahnhof, stach er eindeutig aus der grauen Masse heraus und bereute seine Wahl. Aber die Beamten würdigten ihn keines Blicks, als er die Rolltreppe nahm, und Mogens zwang sich, nicht zurückzublicken, so gern er dies auch getan hätte. Er fuhr zwei weitere Rolltreppen hinauf, bis er die oberste der Shoppingarkaden erreichte, und kaufte an einem Kiosk fünf Telefonkarten. Er tauschte die SIM-Karte seines iPhones aus, und kurz darauf stand er am Taxistand vor dem riesigen Bahnhofsgebäude.
»Sohn… tagstraße Nummer 15«, sagte er zu dem Fahrer und zeigte ihm sicherheitshalber die Adresse, die er auf seinem iPhone gespeichert hatte.
Der Fahrer schaltete brummend den Taxameter ein. Kurz darauf rollten sie durch die nächtliche Stadt. Trotz der späten Stunde herrschte immer noch dichter Verkehr, und Mogens spürte eine gewisse Übelkeit, die ihn bei Autofahrten stets überkam, aber auch eine wachsende Euphorie, es bis hierher geschafft zu haben. Er hatte Berlin, dessen blutige Geschichte ihn faszinierte, schon lange einen Besuch abstatten wollen. Nicht allein wegen des Zweiten Weltkriegs, sondern auch wegen des Kalten Krieges, der sowohl die Stadt als auch den deutschen Staat in zwei Hälften geteilt hatte.
Er zog sein iPhone aus der Tasche und checkte seine Yahoo-Mails. Doch es gab keine neuen Nachrichten. Er scrollte durch seine Kontaktliste bis zu »Schumann48«. Ich hab’s geschafft. Ich bin da. Wann können wir uns treffen? Er wiederholte die Nachricht auf Englisch und Deutsch und kam sich wie ein Fremdenführer vor, der versuchte, sich verständlich zu machen.
Eine Viertelstunde später setzte ihn das Taxi an der Adresse Sonntagstraße 15 in Friedrichshain ab. Von den vielen Bars auf beiden Seiten der Straße hörte er die Gäste, die immer noch draußen saßen. Die ausgelassene Stimmung überraschte ihn, da er vermutet hatte, dass es sich um eine stille Gegend handelte. Im selben Moment hörte er hinter sich ein paar dänische Stimmen, und er drehte sich zu der kleinen Gruppe mittelalter Touristen um, die gerade an ihm vorbeiging. Mogens zog den Kopf ein, ging rasch zur Haustür und drückte auf den Klingelknopf, auf dem »Schmidt« stand. Im nächsten Augenblick wurde er ins Treppenhaus eingelassen und stieg mit seinem Koffer in den zweiten Stock hoch.
»Sieht ja ganz schön schwer aus«, sagte der Mann, der in der Tür stand, auf Deutsch. Er trug Shorts und ein Tanktop, das offenbarte, dass er mehr Haare am Körper als auf dem Kopf hatte.
Mogens nickte zur Begrüßung. Er war zu sehr außer Atem, um etwas zu entgegnen.
»Sie müssen noch ein Stockwerk höher«, fuhr der Mann fort und zog einen Schlüssel aus seiner Tasche.
Mogens verstand nur die Hälfte dessen, was er sagte. »Be… zahlung?«
»Können Sie mir irgendwann morgen einwerfen«, antwortete der Mann und zeigte auf den Briefschlitz. »Auf euch Norweger kann man sich ja verlassen.« Mit einem Lächeln gab er Mogens den Schlüssel.
Mogens stellte den Koffer im dunklen Eingangsbereich ab. Dann ging er in den Wohnraum und schaltete das Licht an. Die Zweizimmerwohnung erinnerte ihn an sein eigenes Apartment in der Langebrogade und war nur spartanisch möbliert. Ohne jeden Schmuck oder Tingeltangel. Er hatte sie auf einer Internetseite entdeckt, auf der private Eigentümer ihre Wohnungen zeitweise vermieteten. Die meisten von ihnen taten dies schwarz und wollten weder einen Pass noch eine Steuernummer sehen, solange in bar bezahlt wurde. Er hatte sich für diese Wohnung entschieden, weil sie über einen längeren Zeitraum hinweg verfügbar war. Er hatte dem Eigentümer geschrieben, dass er aus Oslo stamme, in Berlin ein paar Freunde besuchen wolle und noch nicht wisse, wie lange er bleiben werde. Der Eigentümer, der den Nachbarn Schmidt als Strohmann benutzte, hatte zugesagt, solange die Miete vierzehn Tage im Voraus bezahlt wurde. Und obwohl Mogens nicht wusste, wie lange er auf diese Wohnung angewiesen sein würde, war sie bis auf Weiteres das perfekte Versteck.
Am nächsten Morgen stand Mogens auf dem schmalen Balkon und blickte auf die Straße hinunter. Er hatte kaum geschlafen. Die dichten Baumkronen verwehrten ihm den Blick auf die Cafés und Kneipen, doch die Geräusche der Gäste drangen zu ihm nach oben. Die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel, und es war bereits ziemlich warm. Viel zu warm. Er zog sein iPhone aus der Tasche und überprüfte erneut, ob irgendwelche neuen Mails eingegangen waren, was jedoch nicht der Fall war. Dann öffnete er den Browser und scrollte sich durch die Nachrichten der dänischen Tageszeitungen. Doch weder die Online-Ausgabe von Politiken noch von Berlingske oder dem Ekstra Bladet erwähnten die Angelegenheit. Vielleicht war sie trotz allem zu unbedeutend, oder die Polizei hielt sich während der Ermittlungen bedeckt. Ihm schoss der Gedanke durch den Kopf, dass sie vielleicht genau in diesem Moment seine Wohnung durchsuchten. Vielleicht sprachen sie mit seinen Nachbarn und Kollegen. Auch zu seinen Verwandten würde Kontakt aufgenommen werden, was schnell erledigt war, da er nur noch eine jüngere Schwester besaß, die er seit über einem Jahr nicht mehr gesehen hatte. Was würde Louise wohl denken, wenn die Polizei Erkundigungen über ihren Bruder einzog? Er schob den Gedanken rasch beiseite.
In diesem Moment vibrierte sein Handy. »Schumann48« erschien auf dem Display. »Glad that you’re finally here.«
Für den Bruchteil einer Sekunde vergaß er den Anflug von Reue, den er bei dem Gedanken an seine Schwester empfunden hatte. Jetzt, wo sein neues Leben beginnen sollte, war das nicht mehr wichtig. Er öffnete die Nachricht und las sie.
6
Berlin, 14. September 2013
Die Linie S7 nach Potsdam schlängelte sich im warmen Licht der Nachmittagssonne träge durch Charlottenburg. Mogens saß im ersten Wagen, schaute aus dem Fenster und versuchte, den Namen der nächsten Station zu lesen. Obwohl die SMS-Anweisung, die er bekommen hatte, an Klarheit nichts zu wünschen übrig ließ, fürchtete er, womöglich an der falschen Haltestelle auszusteigen. Als sie Charlottenburg erreichten, sah er auf der Übersichtskarte, dass es noch zwei Stationen bis Grunewald waren, wo er aussteigen musste. Er war erleichtert, dass der vereinbarte Treffpunkt weit weg vom »Dänennest« Friedrichshain lag, obwohl ihm der Name Teufelsberg ein wenig Angst machte.
Mogens hatte seine Perücke in der Wohnung gelassen und begnügte sich mit der Sonnenbrille als Tarnung. In den dänischen Zeitungen stand weiterhin kein Wort über seinen Coup. Nicht einmal der Christianshavneren, seine Stadtteilzeitung, berichtete darüber. Inzwischen zweifelte er daran, dass die Öffentlichkeit jemals von seinem Verbrechen erfahren würde. Was er hinsichtlich seines neuen Lebens, das bald beginnen sollte, als großen Vorteil erachtete. Trotz der großen Summe, die er gestohlen hatte, war ihm klar, dass das Geld nicht ewig reichen würde. Dennoch war es ein großartiges Startkapital, und für seine weitere Zukunft hegte er wunderbare und berauschende Pläne. Solange er jeden Kontakt zu dänischen wie deutschen Behörden vermied, war er auf der sicheren Seite.
Zwölf Minuten später stieg er in Grunewald aus. Er durchquerte das Stationsgebäude mit seinem kleinen Glockenturm und machte sich zu dem Waldgebiet auf, in dem versteckt der Teufelsberg lag.
»Teuflisches Festival« stand auf dem bunten Plakat mit dem brennenden Dreizack. Es war vor einer kleinen Kneipe angebracht, in der man auch Fahrräder leihen konnte und die den Zugang zu dem großen Waldgebiet markierte. Das Plakat informierte darüber, welche Bands und Künstler während des dreitägigen Tanz- und Musikfestivals auftraten, das derzeit auf dem Hügel neben der ehemaligen Abhöranlage stattfand. Der Gedanke an laute Musik und viele Menschen behagte Mogens nicht. Dennoch setzte er sich treulich in Bewegung, folgte dem langen Pfad durch den Wald und sah nach den Papppfeilen, die alle paar hundert Meter in den Bäumen hingen und den Weg markierten.
Nachdem er eine Viertelstunde gegangen war, führten ihn die Pfeile zum Teufelssee, der am Fuße des Hügels lag. Mehrere Leute badeten darin. Ihre blassen Gesichter und Schultern leuchteten wie weiße Seerosen in dem schwarzen Wasser. Neben dem See breitete sich eine saftig grüne Wiese aus. Er war überrascht, so viele Nackte zu sehen, die dort im Gras lagen und die letzten Sonnenstrahlen des Tages genossen. Am entferntesten Ende der Wiese, nahe am Waldrand, vergnügte sich eine Wildschweinfamilie. Die voll ausgewachsene Sau und die drei Frischlinge wühlten unbehelligt in der weichen Erde. Mogens konnte nicht anders, als die vielen nackten Frauen mit ihren schweren Brüsten und tiefschwarzen Haaren zwischen den Beinen anzustarren. Er ging an einem nackten lesbischen Paar vorbei, das eng umschlungen direkt vor ihm im Gras lag. Abgesehen von einigen wenigen und nicht sehr erinnerungswürdigen Besuchen bei Prostituierten hatte er kein Sexleben. Doch Phantasien hatte er immer gehabt.
Es dauerte nur wenige Minuten, bis er die Nudisten hinter sich ließ und den steilen Weg in Angriff nahm, der zur Radarstation auf dem Teufelsberg hochführte. Schon bald hörte er Livemusik, und je näher er dem Gipfel kam, desto mehr Festivalbesucher schlossen sich ihm auf dem gewundenen Pfad an. Die meisten waren sehr viel jünger als er, hatten Piercings im Gesicht und farbige Tattoos am ganzen Körper.
Als er das Eisentor des ehemaligen Militärgeländes erreichte, bezahlte er notgedrungen dreißig Euro an den breitschultrigen Wachmann und bekam dafür einen Dreizack auf sein Handgelenk gestempelt. Hätte er gewusst, dass hier oben ein Festival stattfand und er so viel Geld bezahlen musste, um überhaupt eingelassen zu werden, hätte er diesen Treffpunkt niemals akzeptiert. Aber es war zu spät, um sich darüber zu ärgern, und stattdessen ging er an der früheren Bunkeranlage vorbei und stapfte weiter bergauf, dem riesigen Hauptgebäude mit den drei großen Antennenkuppeln entgegen. Vor dem Gebäude befand sich das eigentliche Festivalgelände mit einer großen Bühne und unzähligen Ständen, an denen neben Würstchen, T-Shirts und Wasserpfeifen alles Mögliche andere verkauft wurde. Über dem gesamten Gelände hing der säuerliche Geruch von Haschisch, Grillqualm und Urin.
Mogens blieb vor der Haupttreppe stehen, an der sie sich treffen wollten. Der Lärm der Menschen und die laute Rockmusik schüchterten ihn ein. Die Leute tanzten angetrunken und bekifft vor der Bühne herum, und er dachte, dass selbst Christiania im Vergleich zu diesem Spektakel ziemlich harmlos wirkte. Einige blickten schon argwöhnisch zu ihm herüber. Er glaubte, die Wörter Stasi und Nazi zu hören. Vielleicht hielten sie ihn für einen Polizisten in Zivil. Er zog sein Handy aus der Tasche und stellte fest, dass hier oben kein Netzempfang war. Er scrollte rasch durch seine Textnachrichten, um sich zu vergewissern, dass er am richtigen Ort war. Doch die Beschreibung war eindeutig. Er schaute sich um. Während der kurzen Zeit, die er jetzt hier war, waren schon viele weitere Menschen gekommen. Er bemerkte, dass die Sonne bereits unterging und bald die Dämmerung einsetzen würde. Die Vorstellung, im Dunkeln hier oben zu bleiben, gefiel ihm genauso wenig wie der Gedanke an den Rückweg durch den großen Wald. Oben auf der Bühne hörten die Musiker auf zu spielen. Das Publikum johlte und klatschte. Mogens zog sich langsam zurück. Er musste pinkeln und suchte nach einem Toilettenschild, doch an dieses Detail hatten die Veranstalter offenbar nicht gedacht. Er ging um das Gebäude herum und entfernte sich vom Festivalgelände. Hier, wo es weniger windgeschützt war, blies es heftig. Die zerrissenen Leinwände an den Radarkuppeln über ihm klangen wie zerfetzte Segel auf einem Geisterschiff. Von den meterhohen Eingängen zu den versiegelten Schächten der unterirdischen Anlage heulte unheilvoll der Wind. In diesem Moment hatte er das Gefühl, dass der Teufelsberg seinem Namen vollauf gerecht wurde, und er suchte sich rasch einen Busch, hinter dem er sich erleichtern konnte. Während er seine Notdurft verrichtete, wurde er plötzlich vom hellen Lichtstrahl einer Taschenlampe geblendet. Er sah zum Eingang des nächsten Schachts hinüber. Erneut blinkte dort ein Licht auf. Zuerst dachte er, jemand wolle einen Spaß mit ihm treiben, und er beeilte sich, fertig zu werden. Als er hinter dem Busch hervortrat, hörte er, wie jemand vom Schacht aus seinen Namen rief. Es klang wie ein melodisches Flüstern, das sich mit dem Pfeifen des Windes vereinte. Langsam ging er zu dem Eingang. Erneut hörte er die Stimme.
»Hallo?«, fragte er ins Dunkel und kam sich ziemlich dämlich vor.
»Komm …«, flüsterten die Stimme und der Wind.
Mogens zögerte kurz, dann ging er in den Schacht weiter, wo die Dunkelheit ihn sofort verschluckte.
Über dem Hügel färbten die letzten Sonnenstrahlen den Himmel rot. Die alte Festung lag schwarz und mächtig da. Die drei Radarkuppeln türmten sich zu den Wolken hoch und erinnerten im schwindenden Licht an den Dreizack des Teufels, der den Himmel aufspießte.
7
Christianshavn, April 2014
Der Wasserspiegel des Kanals stand eineinhalb Meter über dem Pegel, was die Brücken, die sich über den Christianshavns Kanal spannten, aussehen ließ, als seien sie in die Knie gezwungen worden. Der Schiffsverkehr war komplett eingestellt worden, nur die Kajaks waren noch in der Lage, unter den Wölbungen hindurchzugleiten. Die beiden Stürme im Winter hatten das Wasser ins Hafenbecken gedrückt, und der nachfolgende Regen hatte die Situation in den umliegenden Kanälen weiter zugespitzt.
Auf dem nassen Achterdeck der Bianca saßen Ravn und Eduardo und aßen Rührei mit Schinken. Ravns Füße ruhten auf der Reling, während er seinen warmen Kaffee schlürfte. Es war ein kalter, aber schöner Morgen. Der Kaffee und das warme Rührei dampften mit ihrem Atem um die Wette.
»Globale Erwärmung«, sagte Eduardo und nickte in Richtung des hohen Wasserspiegels. »Das wird immer schlimmer werden.«
»So bleiben uns zumindest die nervigen Touristenboote erspart«, entgegnete Ravn.
»Ziemlich hoher Preis für ein bisschen Frieden, amigo.«
Ravn zuckte mit den Schultern, nahm ein Stück Schinken vom Teller und hielt es Møffe hin. Die Englische Bulldogge ließ sich nicht lange bitten und schnappte sich den Schinken aus seinen Fingern. Mit einem Schmatzen schlugen ihre Kiefer aufeinander.
»Fütterst du deinen Hund etwa mit Jamón Ibérico? Weißt du, was ich für den bezahlt habe?«
»Nee, aber muss ziemlich teuer gewesen sein, da Møffe ihn akzeptiert.«
Møffe kaute zufrieden, während Ravn ihm den Kopf tätschelte.
Kurz darauf stand Ravn von seinem Stuhl auf, zog den Reißverschluss seiner Lederjacke bis zum Hals hoch und stülpte sich die Kapuze über den Kopf.
Eduardo warf ihm einen fragenden Blick zu. »Wo willst du hin?«
»Ich bin in zehn Minuten verabredet.«
»Ein neuer Job?«, fragte er ironisch.
»Ich muss in meine Wohnung. Der Makler hat einen Käufer gefunden.«
Eduardo hob die Brauen. »Noch einen?«
Ravn nickte. »Der achte in drei Monaten. Die Interessenten stehen förmlich Schlange.«
»Und warum ist sie dann noch nicht verkauft?«
Ravn antwortete nicht.
»Du solltest dich um andere Dinge kümmern und dem Makler seine Arbeit überlassen.«
»Das tue ich ja. Ich helfe ihm nur ein bisschen, wogegen er nichts einzuwenden hat …« Ravn nahm den Becher vom Tisch und kippte den Rest des Inhalts über die Reling.
»Soll ich dich begleiten?«
»Wozu soll das gut sein?«
»Ganz ruhig, ich dachte nur …«
»Hör bitte auf.« Ravn drehte sich um und blickte den Kai hinunter. Er hatte sich immer noch nicht ganz daran gewöhnt, dass man sich durch den hohen Wasserspiegel auf Augenhöhe mit der Kaimauer befand. »Jemand, den du kennst?«
Eduardo drehte sich auf dem Stuhl um und blickte zu dem grauen Fiat 500 mit dem weinroten Stoffdach hinüber, der auf der anderen Straßenseite parkte. »Nein, aber ich hätte nichts dagegen.«
Hinter dem Steuer saß eine schlanke Frau, die elegant gekleidet war und Ende dreißig sein mochte. Als sie bemerkte, dass sie von den beiden Männern angestarrt wurde, startete sie den Motor.
»War sie schon lange da?«, fragte Eduardo.
»Keine Ahnung«, antwortete Ravn und zuckte mit den Schultern. »Aber vor ein paar Tagen war sie auch schon mal da.«
Die Frau gab Gas. Eduardo und Ravn sahen ihr nach, während sie die Straße hinunterfuhr. »Du hast immer noch deinen alten Bulleninstinkt.«
»Manche Dinge vergehen eben nie. Komm, Møffe!«, sagte Ravn und klopfte sich auf den Oberschenkel. Der Hund schnaufte wie eine Dampflokomotive, ehe er sich widerwillig in Bewegung setzte und zu seinem Herrchen trollte.
»Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll?«
»Wer macht dann den Abwasch?«
Eduardo protestierte lautstark, während Ravn mit Møffe auf dem Arm an Land sprang. Er war ziemlich sicher, dass sich Eduardo schon bald auf sein eigenes Boot, das neben der Bianca lag, zurückziehen und den ganzen Abwasch ihm überlassen würde.
8
Ravn schlenderte die Dronningensgade entlang und zog den Wohnungsschlüssel aus der Tasche, als er sich dem Haus näherte. Am Klingelschild war nur noch ein schwacher Abdruck zu sehen, wo einst Evas und sein Name gestanden hatten, und wenn der neue Eigentümer über einen scharfen Zeigefingernagel verfügte, würde er die letzten Reste leicht abkratzen können.
Er nahm Møffe an die Leine, wohl wissend, dass er ihn all die Stufen würde hinaufzerren müssen. Als sie den zweiten Stock erreichten, öffnete seine alte Nachbarin die Tür. Die dicken Brillengläser vergrößerten Kettys Augen und ließen sie zusammen mit den blauen Haaren wie ein Insekt aussehen. Ravn grüßte sie höflich.
Die alte Dame nickte gemessen zurück. »Heute geht’s hier zu wie im Taubenschlag.«
»Das ist bestimmt mein Makler mit ein paar potenziellen Käufern.«
»Schon wieder? Die trampeln da oben rum, dass mein Kronleuchter fast von der Decke fällt.«
»Ich wusste gar nicht, dass du einen Kronleuchter hast.«
Ketty blinzelte, ehe sie die Tür hinter sich zuzog. Ravn ging in den nächsten Stock weiter, wo seine Wohnungstür nur angelehnt war. Er holte tief Luft, ehe er sie aufschob und eintrat. Auf dem Boden lag ein Haufen Reklame. Seine Post ließ er sich schon seit langem auf die Bianca schicken, wo sie in der Regel auf dem Achterdeck landete, doch gegen den Werbetsunami war er machtlos.
Er hörte ein Geräusch aus der Küche, und im nächsten Moment erschien der Kopf des Immobilienmaklers in der Türöffnung. Sein Verkäuferlächeln erstarb, als er Ravn erblickte. »Tho… Thomas Ravnsholdt«, begrüßte er ihn halbherzig.
Ravn nickte und schritt über die Reklame hinweg. Der Makler, der Kjeld Soundso hieß, zog seinen silberfarbenen Schlips gerade, der wie eine tote Schlange auf seinem Spitzbauch ruhte. Er senkte die Stimme: »Ich dachte, wir hätten abgemacht, dass ich für die Wohnungsbesichtigungen zuständig bin.«
»Ja natürlich. Ich wollte nur mal schauen, wie es so läuft.«
»Es läuft gut … bis jetzt.« Er warf Møffe einen missbilligenden Blick zu. »Aber es ist dem Verkauf nicht gerade förderlich, den da mitzubringen.«
Ravn schüttelte den Kopf. »Wie meinen Sie das? Alle lieben Møffe.«
Kjeld machte eine Handbewegung, als solle Ravn seine Stimme ein wenig dämpfen. »Natürlich, ist ja auch ein … liebes Tier. Aber mit Wohnungen ist es wie mit Autos: Haustiere treiben den Preis nun mal nicht in die Höhe.«
»Ach wirklich?« Ravn machte einen Schritt in Richtung Küche.
Kjeld versperrte ihm den Weg und legte ihm behutsam die Hand auf die Brust. »Thomas, vielleicht sollten Sie noch mal mit sich selbst zurate gehen, ob Sie auch wirklich zum Verkauf bereit sind. Ich kann gut verstehen, dass es einem schwerfällt, sich von einer liebgewonnenen Wohnung zu trennen, aber …«
Ravn zuckte mit den Schultern. »Mir liegt nicht viel an der Wohnung, also …«
»Und dennoch haben wir diese Situation früher schon einmal erlebt. Es gab einen Käufer, der bereit war, den geforderten Preis zu zahlen. Trotzdem haben Sie ihn abgewiesen.«
»Es muss schon der richtige sein …«
»Der richtige Käufer, das habe ich schon verstanden. Es fragt sich nur, ob es diesen Käufer für Sie überhaupt gibt.«
Ravn sah ihn nachdenklich an. »Ich höre, was Sie sagen, Kjeld, und ich bin mehr als entschlossen zu verkaufen.«
In diesem Moment trat ein junger blonder Mann in einem dunkelblauen Anzug aus der Küche. »Also der Renovierungsbedarf ist doch erheblich«, stellte er mit affektierter Stimme fest. »In diesem Licht betrachtet kommt mir der geforderte Preis eher wie ein Angebot für einen Handwerker vor. Ich halte den Verkaufspreis, mit allem Respekt, für entschieden zu hoch.«
Thomas musterte den jungen Mann. Hielt ihn für einen Anwalt, Banker oder Steuerberater. Möglicherweise war er ebenfalls Makler, allerdings erfolgreicher als Kjeld, wenn man die Kleidung der beiden verglich. Auf jeden Fall ein aalglatter Scheißkerl, der zu viel Geld und zu wenig Manieren besaß. »Es zwingt Sie ja niemand, die Wohnung zu kaufen«, sagte Ravn und warf ihm einen eisigen Blick zu.
Kjeld fand sein Verkäuferlächeln wieder. »Natürlich nicht. Dies ist ein freies Land.« Er lachte nervös. »Aber vielleicht sollten wir uns erst einmal den Rest der Wohnung ansehen. Es gibt ein wunderbar helles Schlafzimmer und einen etwas kleineren Raum, der perfekt als Kinderzimmer geeignet wäre.« Er zeigte zum Ende des Eingangsbereichs hin und brachte den jungen Mann dazu, ihm zu folgen.
Ravn sah ihnen nach. Natürlich war es gut, dass die Menschen verschieden waren, doch die Anzahl der Schlipsträger in diesem Viertel nahm allmählich überhand. Wenn das in diesem Tempo weiterging, dürften bald sämtliche Yuppies aus Nordseeland verschwunden sein. Er wusste bereits, dass Kjeld diesen Kandidaten von der Liste streichen würde, sobald die Wohnungsbesichtigung vorüber war.
Ravn stieß die Tür zum Wohnzimmer auf und trat ein. Er war überrascht, die junge Frau zu erblicken, die mit dem Rücken zu ihm stand und aus dem Fenster blickte, während ein kleiner Junge ungeduldig an ihrer Hand zerrte. Als er Ravn und Møffe sah, drückte er sich an das Bein seiner Mutter. Die Frau drehte sich um und lächelte Ravn an – ihr Bauch offenbarte, dass bereits das nächste Kind unterwegs war.
»Wollen Sie sich nicht setzen?«, fragte Ravn und zeigte auf das helle Sofa.
»Nein danke, es geht schon. Ich dachte eigentlich, wir könnten uns die Wohnung allein ansehen, aber Sie sind offenbar auch an ihr interessiert.«
»Ganz im Gegenteil. Ich will sie loswerden. Ich hab schon viel zu lange hier gewohnt«, entgegnete er lächelnd.
Sie nickte und ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. »Sie ist wirklich sehr schön, wenn man …«
»Wenn man einiges instand setzt, ich weiß. Aber dafür ist die Lage hervorragend.« Er lächelte und machte eine ausladende Geste. »Ich wollte nicht wie ein Makler klingen, aber wir haben die Aussicht auf den Park immer sehr genossen.«
Der Junge fasste sich ein Herz und streckte Møffe seine Hand hin. »Nicht Magnus, du darfst fremde Hunde nicht anfassen.«
»Der beißt nicht, er sabbert nur ein bisschen.« Ravn lächelte den Jungen an. »Er heißt Møffe.«