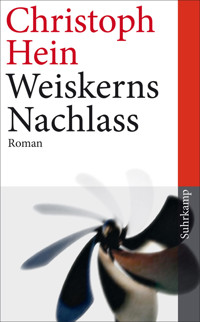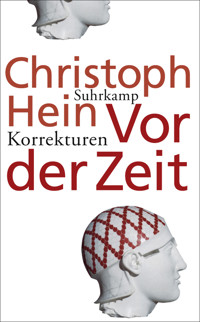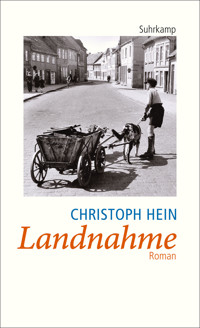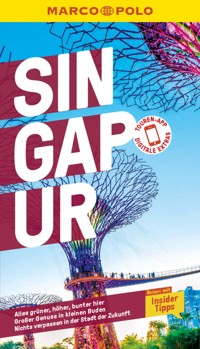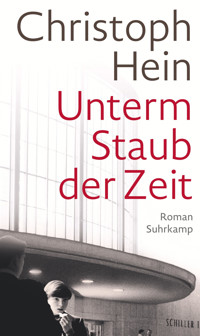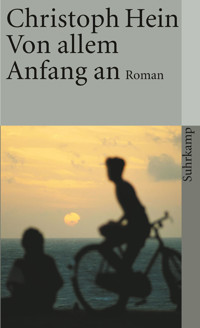11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Friedeward liebt Wolfgang. Und Wolfgang liebt Friedeward. Sie sind jung, genießen die Sommerferien, fahren mit dem Fahrrad die weite Strecke ans Meer und reden stundenlang über Gott und die Welt. Sie sind glücklich, wenn sie zusammen sind, und das scheint ihnen alles zu sein, was sie brauchen. Doch keiner darf wissen, dass sie mehr sind als beste Freunde. Es sind die 1950er-Jahre, sie leben im katholischen Heiligenstadt, und für die Menschen um sie herum, besonders für Friedewards strenggläubigen Vater, ist ihre Liebe eine Sünde. Käme ihre Beziehung ans Licht, könnten sie alles verlieren. Als sie zum Studium nach Leipzig gehen – Friedeward studiert Germanistik, Wolfgang Musik –, finden sie dort eine Welt gefeierter Intellektueller, alles flirrt geradezu vor lebendigem Geist. Und sie lernen Jacqueline kennen, die ihnen gesteht, dass sie eine heimliche Beziehung zu einer Dozentin hat. Zu viert besuchen sie die legendären Vorlesungen im Hörsaal vierzig, gehen ins Theater, tauchen gemeinsam ein ins geistige Leben der Stadt.Und da reift in den drei Freunden der Plan: Wäre es nicht die perfekte ›Tarnung‹, wenn einer von ihnen Jacqueline zum Schein heiraten würde?
In seinem Roman erzählt der große deutsche Chronist Christoph Hein bewegend von einer Liebe, die über Jahre hinweg allen Widrigkeiten trotzt, und zeichnet zugleich ein lebendiges Panorama deutschen Geisteslebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christoph Hein
Verwirrnis
Roman
Suhrkamp
Verwirrnis
Daran will ich mich später erinnern.
Friedeward Ringeling ‒ und da waren sich selbst seine engsten Freunde einig ‒ war ein Original, ein kostbares Relikt aus der Welt der Großmütter, der Kutschen und Hauskonzerte, einer Zeit, in der die Toilette nicht einen Abort bezeichnete, sondern Gegenstand des öffentlichen Interesses war und mal mehr, mal weniger Bewunderung hervorrief.
Er war jederzeit korrekt gekleidet, keiner der Freunde konnte sich, wie sie einräumen mussten, daran erinnern, ihn je unrasiert oder auch nur ohne Krawatte gesehen zu haben. Auch in seiner Wohnung hatte ihn keiner je nachlässig gekleidet angetroffen, selbst dort trug er einen Schlips, dessen Farbton offensichtlich auf das Jackett abgestimmt war, und die Freunde spotteten, er würde gewiss mit einem ausgehfähigen Pyjama ins Bett steigen, um bei einem Brand oder einem Einbruch angemessen bekleidet zu sein.
Wenn er in Gesellschaft sein Jackett ablegte, erkundigte er sich zuvor bei den anwesenden Frauen, ob sie einverstanden seien, dass er ein wenig ungezwungener am Tisch sitze. Dieses antiquierte Gebaren belustigte manche der Frauen, andere hingegen fühlten sich geehrt und lobten ihrem Partner gegenüber Friedewards feine Manieren. Von Zeit zu Zeit zeigte sich der ein oder andere weibliche Gast jedoch auch irritiert über sein Verhalten, waren doch nicht alle Frauen mit den überkommenen Sitten früherer Generationen vertraut. Sein Benehmen war ihnen eher lästig, immer wieder führte es zu Missverständnissen, die Friedeward oder seine Freunde mit langwierigen und ermüdenden Erklärungen aus der Welt zu schaffen suchten, meist jedoch vergeblich.
Friedeward jedoch war überzeugt, dass das Aufgeben gewisser Verhaltensregeln zu einem Kulturverfall führe und schließlich zu einer Rückkehr in eine vorzivilisatorische Barbarei, und hielt daher mit wilder Entschlossenheit an ihnen fest. Entschieden und unbeirrt stand er für sie überall dort ein, wo er sie leichtsinnig geopfert sah oder sie nur noch nachlässig beherzigt wurden. Ihm erschien es als eine Pflicht der älteren Generation, mit gutem Beispiel voranzugehen und den Jüngeren einen zivilisierten Umgang miteinander vorzuleben.
Er war ein edler Mensch. Diese aus der Mode gekommene Zuschreibung entsprach ihm vollkommen. Aber er war auch ein Mann, der mit seinem Schicksal haderte ‒ und mit sich selbst.
Friedeward Ringeling wurde auf den Tag genau sechs Jahre vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, am ersten September 1933, in Heiligenstadt, einer Kleinstadt im Eichsfelder Landkreis, als Sohn eines Englischlehrers und einer Krankenpflegerin geboren. Er besuchte das Staatliche katholische Gymnasium, das kurz zuvor und auf Anordnung der nationalsozialistischen Behörden in Staatliche Oberschule für Jungen umbenannt worden war. In den Fächern Deutsch und Englisch wurde er von seinem Vater unterrichtet.
Pius Ringeling war ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der sich als Siebzehnjähriger im Januar 1918 freiwillig beim Deutschen Heer gemeldet hatte und bereits zwei Monate später als dienstuntauglich ausgemustert werden musste, da er in der Frühjahrsoffensive im März 1918 im Kampf um Péronne, einer Kleinstadt im Département Somme, bei einem Einsatz von Schwefellost ‒ einem Kampfstoff, den man auch Senfgas oder Gelbkreuzgas nannte ‒ durch die eigene Truppe eine Vergiftung erlitt.
Nach Kriegsende stellte er, unterstützt durch seinen ehemaligen Kompanieführer, einen Antrag auf das kurz zuvor gestiftete Verwundetenabzeichen, und er bekam die Auszeichnung nicht in Schwarz, wie es ihm zustand, sondern sogar in Silber, obgleich er nur einmal verwundet worden war und das silberne Abzeichen zwingend fünf Verwundungen verlangte. Der tiefgläubige Katholik Pius, der nach dem Krieg die Fakultas für Deutsch, Latein und Englisch erworben hatte, trug diese Medaille bis zu seinem Lebensende tagtäglich, wenn auch in den auf den Krieg folgenden Staatsordnungen unter dem Revers. Er blieb bis zu seinem Tod Monarchist, verachtete die demokratische Verfassung der Republik ebenso wie die darauf folgenden Regime der Nationalsozialisten und der Kommunisten.
Der Lateinunterricht wurde zwei Jahre vor Kriegsende sowohl an der Staatlichen Oberschule für Jungen wie im ganzen Landkreis gekürzt und ein halbes Jahr später komplett gestrichen, so dass Gymnasialprofessor Pius Ringeling ‒ diesen Ehrentitel trug er nur wenige Jahre, denn er wurde ungebräuchlich und durch die Amtsbezeichnung Studienrat ersetzt ‒ noch eine eingeschränkte Lehrberechtigung, die kleine Fakultas, für Chemie erwarb, um weiterhin als volle Lehrkraft beschäftigt werden zu können.
Aufgrund seiner Invalidität wurde er im Zweiten Weltkrieg nicht kriegsverpflichtet, aber Ende Januar 1945 im Aufgebot II des Volkssturms zwangserfasst und hatte jedes zweite Wochenende zur Ausbildung in einem Volkssturmbataillon anzutreten. Im März 1945 wurde der Schulbetrieb vollständig eingestellt und Pius hatte sich jeden Morgen beim Volkssturm zu melden, um Gräben auszuheben und unter der Anleitung eines älteren, beinamputierten Uhrmachers jene Waffen für das Volkssturmbataillon in Stand zu setzen, die von Truppen der Wehrmacht erbeutet worden waren.
Drei Wochen nach seinem Dienstantritt beim Volkssturm erschienen dort zwei Abgeordnete der Feldgendarmerie, die Fahnenflüchtige und Versprengte im Landkreis aufspüren sollten. Sie fanden heraus, dass der beinamputierte Uhrmacher sich nach einem Lazarettaufenthalt unerlaubt von seiner Kampftruppe entfernt hatte und in seine Heimatstadt zurückgekehrt war. Aufgrund seiner an der Front erworbenen Kenntnisse hatte der Bürgermeister ihn zum Leiter der Ortskampfgruppe ernannt, was die Feldjäger nicht davon abhielt, den Mann zu verhaften und ihn in einem Kellerraum des Rathauses festzusetzen. Pius Ringeling forderte die Volkssturm-Kameraden auf, mit ihm zum Rathaus zu ziehen, um die Freilassung des Uhrmachers zu erwirken; schließlich waren sie ohne ihn nicht in der Lage, die erbeuteten Waffen wiederherzurichten. Diese Aktion führte zur sofortigen Verhaftung Ringelings, da der Bürgermeister es nicht wagte, den Uhrmacher aus dem Kerker zu entlassen, und sich hilfesuchend an die Feldjäger wandte, die Ringeling als Rädelsführer festnahmen und gleichfalls in den Keller sperrten. In der Nacht jedoch verschwanden die Feldjäger aus der Stadt, da die Gegenoffensive der Wehrmacht bei Struth unter großen Verlusten zusammengebrochen war und die versprengten Soldaten der an der Offensive beteiligten Truppenteile befehlswidrig und ungeordnet flohen. Der Bürgermeister entschied daher, die beiden Arrestanten freizulassen und sie zu ihrer Einheit zurückzuschicken, nicht ohne zuvor den gesamten Vorgang genauestens zu Protokoll zu geben.
In der Nachkriegszeit durfte Pius Ringeling weiter als Lehrer arbeiten, da Kollegen und Nachbarn bei der neuen Schulbehörde seine ablehnende Haltung den Nationalsozialisten gegenüber bezeugt hatten und die Akten im Rathaus gleichfalls für ihn sprachen. Seine Konfession und sein offen bekundeter Glaube waren der neuen Schulbehörde zwar ein Dorn im Auge, aber da unbelastete Lehrer dringend gebraucht wurden und die Mehrheit der Bevölkerung im Eichsfelder Land katholisch war und damit auch die akademisch ausgebildete Lehrerschaft, akzeptierte der kommunistische Schulrat auch den gläubigen Pius Ringeling, teilte ihm jedoch schriftlich mit, er habe sich jeder Art religiöser Propaganda zu enthalten, andernfalls würde er umgehend entlassen. Da an allen Schulen Lehrer fehlten, wurde ihm vom Kreisschulamt auf dem kurzen Dienstweg sogar die große Fakultas für Chemie erteilt, also die Lehrberechtigung für dieses Fach auch in den Abiturklassen.
Das Gymnasium war bei der Wiedereröffnung in einem Behelfsbau untergebracht, da die Rote Armee das gesamte Schulgelände besetzt und dort für Hunderttausende entlassener Kriegsgefangener und Umsiedler ein Durchgangslager eingerichtet hatte. Pius Ringeling hielt sich an die Anordnung, in den Unterrichtsstunden religiöse Themen zu meiden. Da die älteren und studierten Lehrer gläubig waren, die Neulehrer, die aus schulfremden Berufen kamen und denen man innerhalb weniger Monate den zu vermittelnden Lehrstoff beigebracht hatte, sich jedoch als strenge und pflichtbewusste Atheisten erwiesen, umging man zwar auch im Lehrerzimmer das unerwünschte Thema, besuchte aber ansonsten wie gewohnt den Gottesdienst und lebte freimütig seinen Glauben.
Studienrat Pius Ringeling war ein Mann fester Grundsätze, und diesen hatten nicht nur seine Schüler zu folgen, sondern auch seine Familie; er bezeichnete seine strengen Lebensregeln gerne als »moralisches Gebot«. Seine Frau und die drei Kinder ‒ zwei Söhne und eine Tochter ‒ hatten sich diesem unterzuordnen, hatten, wie er sagte, zu wissen, wo ihr Platz sei. Friedewards Mutter Wilhelmine unterrichtete Geburtshilfe an der Krankenpflegeschule des örtlichen Krankenhauses und sang in beiden Kirchenchören. Sie war eine kräftige und resolute Frau, die nicht auf den Mund gefallen war und sich bei den Kolleginnen und den Patienten durchzusetzen verstand, sich daheim jedoch klaglos ihrem Ehemann unterordnete. Sie widersprach ihm nie und stellte sich auch nicht gegen ihn, wenn er mit den Kindern allzu hart umsprang.
Für Pius Ringeling war die körperliche Züchtigung zwingender Bestandteil einer bürgerlichen, die Heranwachsenden überhaupt erst zum Leben befähigenden Pädagogik, ohne deren Grundsätze weder ziviles Verhalten noch Ehrgeiz und Leistungswille in die folgende Generation zu pflanzen und in ihr nachhaltig zu verankern seien. Sein ältestes Kind, eine Tochter mit dem Namen Magdalena, strafte er mit einem Klaps auf den Hintern oder mit einer Kopfnuss. Letztere Art der Bestrafung hatte er in seinen ersten Berufsjahren im Unterricht bevorzugt, ehe nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Schulgesetze der neuen Regierung den Lehrern an ostdeutschen Schulen jede Art von körperlicher Strafe rigoros untersagten. Innerhalb des Lehrerkollegiums bezeichnete Pius Ringeling dieses Verbot als pädagogisches Fiasko, verordnet von Bürokraten, die nichts von Pädagogik ‒ davon, junge Menschen bewusst anzuleiten ‒ verstünden und den Schulalltag nicht kannten. Daheim und unter Freunden nannte er das neue Gesetz einen kommunistischen Unfug, eine geradezu verbrecherische Anordnung, und prophezeite dem zweiten deutschen Staat bereits in dessen Gründungsjahr seinen baldigen Untergang. Schließlich sei mit straffrei und folglich unerzogenen Kindern kein Staat zu machen.
Im Unterricht verfiel er nun auf Maßnahmen, die seiner Ansicht nach auch im Rahmen der neuen Schulgesetze zulässig sein müssten. So pflegte er aufsässige oder undisziplinierte Schüler am Ohr oder an den Haaren zu fassen, was die Schülerinnen und Schüler als durchaus schmerzhafte Strafe empfanden, was für Pius Ringeling jedoch nicht mehr als eine herzhafte Ermunterung war. Mit Beschwerden von Seiten der Eltern musste er in all den Jahren bis zu seiner Pensionierung nicht rechnen, erschien doch fast allen Eltern in Heiligenstadt das so hochtrabend verkündete Verbot körperlicher Strafen in der Schule ebenso unsinnig wie ihm selbst. Sie waren mehrheitlich der Meinung, ein Klaps zur rechten Zeit habe einem Kind noch nie geschadet, und ohne eine schmerzhafte Verwarnung sei es weder Eltern noch Lehrern möglich, aus den Bälgern anständige Menschen zu machen.
Während sich Pius Ringeling bei seiner Tochter Magdalena mit leichteren Strafen begnügte, fielen die Strafen für die Knaben, den Zweitgeborenen Hartwig und den Nachkömmling Friedeward, härter aus. Sie wurden mit der Riemenpeitsche gezüchtigt, dem Siebenstriemer, einem kurzen Holzstück, an dem sieben je achtzig Zentimeter lange Lederstreifen befestigt waren. Das Auspeitschen galt nicht nur Pius als probates Mittel zur Erziehung und genoss beim bürgerlichen Mittelstand durchaus Ansehen. Die niederen und ärmeren Schichten griffen zur Züchtigung ihrer Kinder üblicherweise zu einem Weidenstock oder einem sonst wie geeigneten Gegenstand.
Pius' Kinder hatten sich nach erfolgter Züchtigung vor ihm aufzustellen und die immer gleiche Frage zu beantworten, nämlich die, wen diese Strafe am meisten geschmerzt habe. Laut weinend oder auch stumm, aber doch mit schmerzverzerrtem Gesicht presste das Kind dann die Worte hervor, die von ihm erwartet wurden: »Dich, lieber Vater, dich.«
Bei den Schülern war Pius Ringeling ebenso angesehen wie gefürchtet. Sie erkannten zwar seine umfassende Bildung an, hassten ihn aber seiner Brutalität wegen. Dass er die eigenen Kinder gelegentlich mit dem Siebenstriemer durchwalkte, war allen auf dem Schulhof bekannt, da Hartwig es freimütig herumerzählte. Friedeward waren neugierige Nachfragen der Klassenkameraden zu diesem Thema eher unangenehm. Hartwig jedoch sprach nicht nur unbefangen über diese Tortur, er sprach sogar gern darüber, da er seit Monaten dabei war, den Siebenstriemer zu manipulieren. Etwa einmal im Monat ‒ wenn die Eltern für längere Zeit das Haus verließen ‒ nahm er sich die Klopfpeitsche vor und kürzte die Lederriemen mit Hilfe des väterlichen Rasiermessers um wenige Millimeter. Er stutzte alle sieben Streifen gleichmäßig, um danach mit Spucke und einem Ascherest aus dem Küchenherd den hellen Schnittstellen den Anschein von Unversehrtheit zu geben.
Friedeward war über dieses Vergehen entsetzt und bat den älteren Bruder jedes Mal, das Kürzen der Riemen zu unterlassen. Er fürchtete, dass der Vater ihm zwangsläufig eines Tages auf die Schliche kommen würde und es für sie beide dann ein fürchterliches Donnerwetter und ein ausführlicheres Wiedersehen mit der Peitsche setzen würde. Er hätte es jedoch nie gewagt, den Bruder zu verraten, hatte ihm Hartwig doch für diesen Fall eine sehr viel härtere Strafe angedroht, eine Strafe, der gegenüber eine Tracht mit dem Siebenstriemer eine lustige Rutschpartie sei.
Tatsächlich war Pius nicht entgangen, dass seine Peitsche manipuliert worden war. Etwa ein halbes Jahr nachdem Hartwig damit begonnen hatte, rief Pius beide Söhne in sein Arbeitszimmer und hieß sie an dem runden Rauchertischchen Platz zu nehmen. Dort lag, neben dem gusseisernen Aschenbecher, der gefürchtete Siebenstriemer, der gewöhnlich hinter Vaters Schreibtisch über einem Bild hing, einem Schwarzweißfoto von Pius Ringeling in Armeeuniform. Pius stellte sich hinter seine beiden Söhne und fragte sie, ob sie ihm nicht etwas zu sagen hätten. Beide schwiegen, Hartwig trotzig verbissen und Friedeward in angstvoller Spannung. Da packte der Vater die beiden Jungen hart im Nacken und schüttelte sie.
»Ich meine, ihr habt mir etwas zu sagen.«
Sie schwiegen weiterhin. Der Vater lockerte den festen Griff, ließ die beiden schließlich los und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er lächelte böse.
»Nun gut, dann habe ich euch etwas mitzuteilen. Die Lederriemen sind nur noch einundsiebzig Zentimeter lang, es fehlen also neun Zentimeter, die eurer Zerstörungswut zum Opfer fielen. Ich habe es sehr wohl bemerkt, von Anfang an. Ihr Idioten habt in Physik nicht aufgepasst. Was bewirkt eine verkürzte Peitsche? Nun? ‒ Ich will es euch sagen: Die Hiebe werden geschwinder und schmerzhafter. Und wenn ihr euch weiter an meinem Siebenstriemer vergreift, so werdet ihr eines Tages stattdessen mit dem Stock Bekanntschaft machen. Ich treibe euch eure Dummheit schon aus. Freut euch schon mal auf die nächste Tracht ‒ und jetzt raus!«
Zwei Jahre nach Kriegsende verließen die beiden älteren Kinder ihr Elternhaus. Magdalena hatte ihre Lehre als Krankenschwester erfolgreich abgeschlossen und heiratete im Mai Karl Lehmann, einen aus der Kriegsgefangenschaft entlassenen Kaufmann, dem seit seinem Einsatz an der Front drei Finger der rechten Hand fehlten. Er war zwölf Jahre älter als Magdalena, betrieb die Buch- und Schreibwarenhandlung seines verstorbenen Vaters und hatte seine erste Frau bei der Geburt der kleinen Tochter verloren. Er betreute den Säugling anfangs mit Hilfe seiner Mutter und der Schwiegermutter, doch dann, im Oktober 1943, wurde seine Rückstellung vom Wehrdienst aufgehoben und er wurde nach einer dreiwöchigen militärischen Ausbildung zur Heeresgruppe Nord an die Ostfront geschickt. Das Mädchen blieb in der Obhut seiner beiden Großmütter.
An Karls drittem Tag an der Front rissen ihm die Kugeln einer Granatkartätsche drei Finger ab. Er kam in ein kurländisches Feldlazarett, wurde zwei Monate später jedoch wieder zu seiner Einheit abkommandiert, obgleich er als Kriegskrüppel nicht einmal als Schreibkraft zu gebrauchen war. Im März wurde seine Einheit, die zur Heeresgruppe Kurland gehörte, von einem Panzerbataillon der Roten Armee umstellt. Man kapitulierte kampflos und die deutschen Soldaten wurden in das Kriegsgefangenenlager 317 nach Riga gebracht. Im dortigen Kriegsgefangenenhospital 3338 erhielt Lehmann eine erste Handprothese, einen gusseisernen Haken, den er sich mittels einer Stoffmanschette anlegen konnte. Durch seine Kriegsverletzung war er im Lager nur eingeschränkt arbeitstauglich und wurde nach acht Monaten aus der Gefangenschaft entlassen.
Ende des Jahres 1945, vier Tage vor Weihnachten, erschien er in Worbis bei seiner Mutter und seiner zweijährigen Tochter Gundula. In der ersten Januarwoche erhielt er vom Rathaus die Wiederzulassung als Händler für Bücher, Papier- und Schreibwaren, und am letzten Montag des Monats konnte er sein Geschäft wiedereröffnen. Außer den broschierten und von der Militärverwaltung genehmigten Büchern bot er Schreibhefte, bedruckte Papiere und Schreibgeräte aus seinen Altbeständen an, die er zuvor sorgsam nach verbotenen Signets und Kennzeichen des untergegangenen Naziregimes untersucht hatte.
Im Juni lernte er die siebzehnjährige Magdalena kennen, als er ‒ nach einem dreiwöchigen Aufenthalt im Universitätsklinikum Göttingen, wo ihm eine neue und brauchbarere Handprothese gefertigt wurde ‒ zur weiteren Behandlung und Rehabilitation im Heiligenstädter Krankenhaus von der Schwester im letzten Lehrjahr betreut wurde. Sie fanden Gefallen aneinander. Karl Lehmann bewunderte die ernsthafte und resolute Art, mit der das junge Mädchen wehleidige und störrische Patienten zu handhaben wusste und wie sie ebenso freundlich wie bestimmt dafür sorgte, dass alle die ärztlichen Anordnungen befolgten. Magdalena ihrerseits war beeindruckt, wie gelassen und gottergeben Karl Lehmann sein Schicksal hinnahm, wie er sich jedes Mitleid verbat, da andere Kameraden seiner Einheit schwerer verkrüppelt waren als er oder den Krieg nicht überlebt hatten.
Lehmann fuhr jede Woche nach Heiligenstadt, um Magdalena zu treffen, und einmal im Monat besuchte sie ihn und seine kleine Tochter in Worbis. Gundula war es schwergefallen, den aus dem Krieg und der Gefangenschaft zurückgekehrten Mann als ihren Vater zu akzeptieren und rückhaltlos zu lieben, sie war an ihre Großmütter gewöhnt, und der Krüppel mit dem Eisenhaken anstelle einer Hand ängstigte sie lange Zeit. Magdalena jedoch schloss sie sofort ins Herz und wich nicht von ihrer Seite, wann immer die junge Frau zu Besuch kam. Die Dreijährige war es auch, die zum ersten Mal vom Heiraten sprach. Immer wieder lag sie ihrem Vater und Magdalena damit in den Ohren, dass sie dann Blumen streuen wolle, und die Kleine genoss die Verlegenheit, in die sie die beiden Erwachsenen damit brachte.
Einmal erwiderte Karl seiner Tochter: »Das musst du Magdalena fragen. Ich würde sie sofort heiraten. Lieber heute als morgen. Aber vielleicht bin ich für sie zu alt oder sie will einen Mann mit zwei gesunden Händen.«
Magdalena schüttelte heftig den Kopf und meinte, sie habe Karl und Gundula lieb, aber sie sei ja gerade erst achtzehn geworden und fühle sich noch zu jung, um sich für immer zu binden.
»Eine alte Mama will ich nicht«, erklärte Gundula, »wenn du hundert bist, dann kannst du nur noch meine Oma werden, aber Omas habe ich schon zwei.«
Ein halbes Jahr später heirateten sie. Magdalena wusste nicht, ob sie Karl wirklich liebte, ob sie tatsächlich ihr ganzes Leben an seiner Seite verbringen sollte, und sie war besorgt, weil sie nun die Stiefmutter eines nur fünfzehn Jahre jüngeren Mädchens wurde. Doch sie wollte, sie musste fort aus ihrem Elternhaus, wollte auf eigenen Füßen stehen und nicht länger wie ihre Mutter und ihre Brüder tagtäglich den Vorschriften des Vaters ausgesetzt sein und seine selbstherrliche Strenge und Gewalt erdulden müssen. Und sie wollte Karl auch deshalb heiraten, weil er sein Kind nie schlug, weil Gundula für ihn ein Engel war, wie er sagte, und er sich nicht der Strafe ewiger Verdammnis aussetzen wolle, weil er die Hand gegen einen Engel erhoben habe.
Eine Woche nach Magdalenas Auszug verschwand auch Hartwig. Er war sechzehn Jahre alt, als er heimlich die Wohnung der Eltern mit all seinen Sachen verließ. Er wählte den Zeitpunkt für sein Verschwinden mit Bedacht und brach in den Schulferien auf, als sein Vater mit anderen Thüringer Pädagogen für fünf Tage bei einem Lehrgang in Weimar war, dem damaligen Sitz der Landesregierung. Seiner Mutter erzählte er, er würde zu seiner Schwester nach Worbis fahren. Drei Tage später bekam die Mutter einen Brief von ihm, in dem er ihr mitteilte, er habe in Hamburg auf einem Kühlschiff angeheuert, auf dem er nach Nordamerika fahre, um künftig dort zu leben. Im Postskriptum merkte er an, auf dem Schiff gebe es keinen Siebenstriemer und die Prügelstrafe sei schon vor hundert Jahren abgeschafft worden.
Als Hartwigs Vater aus Weimar zurückkehrte, gab die entsetzte und völlig aufgelöste Mutter ihm noch in der Tür den Brief zu lesen. Unter Tränen brachte sie hervor, sie habe das Gefühl, nach Magdalena nun auch ihr zweites Kind verloren zu haben. Sie verstand ihren Jungen, begriff, wieso Hartwig aus seinem Elternhaus geflohen war. Auch für sie waren die Stunden, in denen sie nicht daheim zu sein hatte, die einzig glücklichen. Sie sehnte die Chorproben herbei, die Gespräche, die sie dort mit ihren besten Freundinnen führen konnte, und das ganze Jahr über freute sie sich auf den Beginn der einwöchigen Chorwerkstatt, für die der Kantor jedes Jahr einen anderen Ort aussuchte. Für acht Tage lebte sie dann mit den anderen Chormitgliedern in einem Kloster, in einem alten Schloss, das mittlerweile als Hotel genutzt wurde, oder auch in einer abgelegenen Jugendherberge. Diese eine Woche gab ihr die Kraft, den Rest des Jahres an der Seite ihres Mannes durchzustehen.
Pius Ringeling jedoch zog verächtlich die Mundwinkel nach unten, knüllte den Brief zusammen, warf ihn in den Papierkorb und sagte: »Aha, der Siebenstriemer gefiel ihm also nicht.«
Er weigerte sich, über Hartwig je noch ein weiteres Wort zu verlieren. Wann immer seine Frau von ihm sprach, schwieg er verärgert oder verließ das Zimmer. In der Schule gab er an, sein Sohn sei nach Berlin gezogen, wo er weiterhin die Schule besuchen wolle. Seine Frau und er versuchten nicht, Hartwig ausfindig zu machen, und stellten auch nicht infrage, ob er wirklich ausgewandert sei. Den Behörden gegenüber gaben sie an, ihr Sohn sei im Unfrieden fortgegangen und habe sich bisher nicht bei ihnen gemeldet, und hofften, dass weitere Nachfragen ausblieben ‒ denn das unbegründete und nicht genehmigte Verlassen der Besatzungszone war unerwünscht und sie wollten keinen unnötigen Verdacht erregen.
Den vierzehnjährigen Friedeward bekümmerte Magdalenas Heirat und ihr Umzug nach Worbis sowie das Verschwinden von Hartwig, er vermisste die älteren Geschwister. Er war nun das einzige Kind im Haus und fühlte sich beständig kontrolliert und überwacht. Tatsächlich konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Eltern stärker als zuvor auf ihren Jüngsten, zumal sein Vater den Verdacht hegte, Friedeward sei in die Pläne seines Bruders eingeweiht gewesen, oder habe insgeheim gar vor, selber zu verschwinden. Da Friedeward weder daheim noch in der Schule der Aufsicht seines Vaters entging ‒ er unterrichtete ihn in den Fächern Deutsch und Englisch ‒, fühlte er sich beständig unter Druck. Die anhaltende Angst vor seinem Vater nahm ihm die Luft zum Atmen. Anders aber als sein Bruder wagte er an Flucht nicht zu denken. Nirgends, an keinem Ort der Welt, würde er dem harten Griff seines Vaters entgehen, überallhin würde ihn sein misstrauischer Blick verfolgen, ihn ermahnen, ihn strafen. Das Einzige, wozu Friedeward sich aufraffen, ja, sich erdreisten konnte, war der innige Wunsch und sein allabendliches Gebet zum Herrgott, sein Vater möge endlich sterben.
Noch immer setzte Pius Ringeling zur Erziehung seines Sohnes den Siebenstriemer ein. Mindestens einmal im Quartal verprügelte er Friedeward und ließ sich anschließend wie gewohnt von ihm versichern, dass diese Lektion ihn selbst am meisten schmerze. Friedeward geriet in einen Teufelskreis: Die Angst vor dem Siebenstriemer lähmte ihn, es fiel ihm zunehmend schwerer, in der Schule dem Unterricht zu folgen, was ihm Tadel und schlechte Noten einbrachte. Zu Hause legte er ‒ wenn auch eher unbeabsichtigt ‒ eine Starrsinnigkeit an den Tag, die seinen Vater reizte, ihn immer wieder aufs Neue zu bestrafen. Jede Nacht murmelte er vor dem Einschlafen halblaut sein Abendgebet, Gott möge seinen Vater sterben lassen, obgleich er wusste, dass Gott ihm diesen Wunsch nicht erfüllen würde und dass es eine Sünde war, eine Todsünde, für die er Abbitte hätte leisten müssen.
Er war fünfzehn Jahre alt, als er sich zum ersten Mal auflehnte und dem Vater widersprach. An einem Freitag im November hatte ihn der Vater erneut mit der Peitsche geschlagen. Ohne eine einzige Träne und mit zusammengebissenen Zähnen hatte er die Tortur schweigend erduldet, und als sein Vater nach dem letzten Schlag den Siebenstriemer wieder an die Wand hinter seinem Schreibtisch hängte und seinem Sohn die übliche Frage stellte, sah Friedeward ihn an und sagte: »Mich, lieber Vater, mich. Nur mich.«
Pius Ringeling brauchte einen Moment, ehe er Friedewards Worte begriff. Er starrte seinen Sohn an, die Augen zu schmalen Schlitzen verengt, und mit einer raschen Bewegung riss er die Riemenpeitsche erneut vom Nagel und machte einen Schritt auf den Jungen zu. Doch dann hielt er inne.
»Vielleicht hast du recht«, sagte er, »vielleicht bist du so vernünftig geworden, dass wir auf dieses pädagogische Instrument von nun an verzichten können. Was meinst du?«
Friedeward nickte heftig.
»Gut«, sagte sein Vater, »versuchen wir es.«
Er öffnete die rechte Tür seines Schreibtischs, zog das untere Schubfach heraus, wickelte die Lederriemen um den hölzernen Griff und steckte den Siebenstriemer in die Lade. Er legte ihn ganz nach hinten.
Tatsächlich beschränkte sich der Vater fortan darauf, seinen Sohn bei Vergehen jeglicher Art nur anzuschreien. Doch Friedewards Angst vor dem Vater schwand nicht, und wann immer dieser die Stimme drohend erhob, sausten die Lederriemen vor seinem inneren Auge furchteinflößend durch die Luft, spürte er die Schläge so schmerzhaft, als hätte der Vater die Klopfpeitsche seiner Ankündigung zum Trotz wieder hervorgeholt.
Friedeward besaß, zur Freude seiner Eltern, einen Mitgliedsausweis der städtischen Bücherei und besuchte diese wöchentlich, um die bereits gelesenen Bücher abzugeben und sich ein oder zwei neue auszuleihen.
In den beiden kleinen Räumen der Bücherei waren jeweils zwei Wände mit Bücherregalen bedeckt, im größeren standen zudem der Schreibtisch der Bibliothekarin und ein weiterer Tisch mit zwei Stühlen für die Besucher. Sie nannte diesen Raum den »Lesesaal«. Sämtliche Bücher des Bestands, die vor 1945 erschienen waren, hatte sie gemeinsam mit einem Beauftragten der Stadt gesichtet und mit einem grünen Stempel versehen, um sie damit als unbedenklich und für die Ausleihe freigegeben zu kennzeichnen.
Einige Bücher und Zeitschriften jedoch lieh Friedeward nicht aus, sondern las sie am Benutzertisch im Lesesaal. Sein Vater hätte diese Lektüren gewiss missbilligt, denn sie handelten von Amerika, von den Indianern und der Besiedlung des Landes durch immigrierte Engländer.
Friedeward vertiefte sich in Reiseberichte von Europäern über den fremden Kontinent und bestaunte wieder und wieder in Bildbänden die Berge, den Grand Canyon, die Großstädte und Wolkenkratzer. Er träumte von Amerika, davon, dass sein Bruder Hartwig dort sein Glück gemacht hatte, denn anders war für ihn sein monate- und jahrelanges Schweigen ‒ kein Brief, keine Karte kam von ihm je in Heiligenstadt an ‒ nicht zu erklären. Er schwelgte in Fantasien, in denen er dem Bruder folgte und im fernen Amerika sein Glück fand, auf der anderen Seite der Erdkugel, unerreichbar für seinen Vater. Er träumte davon, als Cowboy durch die Prärie zu reiten, mit braungebrannten, unerschrockenen Männern Kühe zu hüten und wilde Pferde einzufangen, mit ihnen abends am Lagerfeuer zu sitzen und im Zelt zu schlafen oder sich mit Indianern anzufreunden, mit ihnen auf die Jagd zu gehen und das wilde, ursprüngliche Leben der Ureinwohner zu führen. Und er würde seinen Bruder finden, der im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bereits erfolgreich seinen Weg gemacht und seinen Platz gefunden hatte und der ihm beistehen würde.
Friedeward fürchtete nicht zu Unrecht, sein Vater würde misstrauisch werden, wenn er ihn bei diesen Lektüren ertappte, würde seine Pläne oder doch jedenfalls seine große Hoffnung erahnen, zumal sein Vater regelmäßig den Lesestoff des Sohnes überwachte und zu kommentieren pflegte. Friedeward war jedoch nicht nur wegen seiner heimlichen Lektüren besorgt, sondern fürchtete auch, der Vater könne aus seinen besonders guten Leistungen im Englischunterricht ‒ Friedeward war Klassenbester und der Vater unterrichtete ihn in diesem Fach ‒ den fatalen Schluss ziehen, der zweite Sohn wolle seinem ersten folgen. Die Furcht vor dem Vater beherrschte ihn, er spürte Tag und Nacht, in jeder Stunde seines Lebens die harte Hand seines Vaters im Nacken.
Als das elfte Schuljahr für ihn begann, wurde ein neuer Schüler in seiner Klasse aufgenommen, Wolfgang Zernick, Sohn des neuen Kantors der katholischen Kirche St. Aegidien. Der junge Mann zeichnete sich durch ein erstaunliches Selbstbewusstsein aus, ihn schien die Abwehr und das Misstrauen der Mitschüler, die sich dem Neuen gegenüber wie üblich reserviert und sogar feindselig verhielten, nicht zu irritieren. Er bemühte sich nicht um die Gunst oder gar Sympathie seiner Mitschüler, er ging seiner Wege, ohne sich um die Schulkameraden zu scheren. An außerschulischen Aktivitäten der Klasse beteiligte er sich nicht, war weder an Fußball interessiert noch wollte er Mitglied der Schulmannschaft für Hallenhandball werden, obwohl er durch seine Größe ‒ er überragte all seine Klassenkameraden ‒ dafür prädestiniert schien und im Schulsport rasch zu den Besten in der Klasse zählte und beim Mannschaftzusammenstellen im Sportunterricht immer zu jenen gehörte, die als Erste gewählt wurden. Stattdessen ging er dreimal in der Woche zum Musikunterricht, er spielte Klavier und Gitarre und schien andere Leidenschaften stillschweigend zu verachten.
Der Neue erregte Friedewards Interesse, er freundete sich bald mit Wolfgang an, und sie verbrachten mehrere Nachmittage der Woche zusammen. Der langgliedrige Junge imponierte ihm, er bewunderte, wie dieser sich kleidete und bewegte, ihm gefiel Wolfgangs große, kräftige Nase, die vollen Lippen und die Art, wie er seine längeren dunklen Haare immer wieder mit einer leichten und elegant wirkenden Bewegung des Kopfes aus der Stirn nach hinten warf. Friedeward eiferte ihm nach, bemühte sich erfolgreich darum, seine schulischen Leistungen zu verbessern, um Wolfgang zu beeindrucken, nahm sogar ihm zuliebe seinen Klavierunterricht wieder auf, den er zum Entsetzen der Mutter ein Jahr zuvor aufgegeben hatte. Er wollte mit dem musikalisch hochbegabten Freund mithalten oder doch jedenfalls nicht allzu offenkundig hinter ihm zurückstehen.
Friedewards Eltern gefiel der neue Freund ihres Sohnes. Dass sein Vater der in der Stadt hoch geschätzte Kantor von St. Aegidien war, stimmte Pius Ringeling zufrieden, und auch die Mutter war darüber mehr als nur erfreut, da Kantor Zernick der neue Leiter ihrer geliebten Kirchenchöre war. Wolfgang wurde von Friedewards Eltern herzlich aufgenommen und umsorgt wie ein eigener Sohn ‒ oder vielmehr sehr viel besser, da er nie von Pius angeschrien oder gar gezüchtigt wurde. Wenn Wolfgang auf dem Flügel der Familie spielte, lauschten beide Eltern ganz verzückt und rühmten ihn, wie sie die eigenen Kinder nie für etwas gelobt hatten.
Die Freundschaft der beiden Jugendlichen wurde mit der Zeit intensiver, sie verstanden sich fast wortlos, hatten ähnliche politische Ansichten, interessierten sich für Musik und für zeitgenössische Literatur, vor allem für Lyrik, und sie grenzten sich so deutlich gegenüber allen anderen Klassenkameraden ab, dass es fast schon einem Affront gleichkam.
Auch in ihrem Äußeren unterschieden sie sich von ihren Altersgenossen. Sie achteten auf ihre Frisur und Kleidung und hatten schon so etwas wie einen eigenen Stil. Das gefiel den Mädchen. Sie bewunderten die beiden, himmelten sie gar heimlich an, auch, weil sie zu den Leistungsstärksten in der Klasse zählten ‒ sie taten sich in Deutsch, Englisch und Mathematik hervor, aber auch im Sportunterricht und in den musischen Fächern. Friedeward und Wolfgang liebten es, aufzufallen. So streuten sie im Unterricht wie auf dem Schulhof ungebräuchliche Fremdwörter oder veraltete Ausdrücke in ihre Sätze, und es bereitete ihnen ein klammheimliches Vergnügen, die Lehrer zu beeindrucken, sei es durch ihr Wissen oder durch ihr Verhalten. Mit Vorliebe korrigierten sie ihre Lehrer auch, wobei sie sich äußerst höflich und bescheiden gaben. Manche Lehrer scheuten vor dieser Art der Bloßstellung zurück und vermieden es daher, die beiden aufzurufen.
Lediglich im Deutsch- und Englischunterricht verzichteten sie auf ihre arroganten Spielchen, schließlich wollten sie Friedewards Vater nicht reizen. Friedeward fürchtete nach wie vor die Peitsche, und Wolfgang wollte, wenn er bei der Familie Ringeling zu Gast war, nicht auf sein Verhalten im Unterricht angesprochen werden.
In den Unterrichtspausen wanderten sie zusammen über den Konsumflügel, wie die Schüler den östlichen Teil des Schulhofs nannten, weil ihm gegenüber der Lebensmittelladen lag. Hier war das bevorzugte Terrain der älteren Jungen. Auf der anderen Seite, dem Kirchenflügel, spazierten die Mädchen der höheren Klassen, während in der Mitte des Schulhofs die jüngeren Schüler miteinander spielten. Man blieb unter sich. Die Jungen starrten freilich unverhohlen zu den Mädchen hinüber, kommentierten untereinander deren Aussehen, ihre Kleidung, Frisuren und Bewegungen. Die Mädchen hingegen schauten nur selten zu den jungen Männern. Wurde eine dabei von den anderen ertappt und mit einer spöttischen Bemerkung bedacht, schoss ihr die Schamröte ins Gesicht.
Ab und an wurde die unsichtbare Grenze auch überschritten. Hatte einer der Jungen mit einem Mädchen etwas zu bereden und musste deswegen auf den Kirchenflügel hinüber, wurde er von höhnischen Kommentaren seiner Kameraden begleitet.
Drei Mädchen aus der zwölften Klasse gingen in der großen Hofpause regelmäßig gemeinsam zum Konsumflügel hinüber, in einen Bereich, der von den Treppenstufen der Schultür aus, wo die Pausenaufsicht zu stehen pflegte, nicht zu sehen war. Dort, verborgen hinter einem Mauervorsprung der kleinen Halle für die Sportgeräte, war die Raucherecke des Schulhofs, wo ein, zwei Dutzend Schüler billige Zigaretten qualmten. Wenn sich ein Lehrer näherte, gaben Kameraden ein verstecktes Signal und die brennenden Zigaretten flogen in hohem Bogen auf eine verwilderte Brache hinter dem Zaun.
Die Mädchen liefen auf dem Schulhof zu zweit oder in kleinen Grüppchen umher, eingehakt oder auch eng umschlungen, die Köpfe vertraulich aneinandergelehnt und beständig im Gespräch. Die meisten von ihnen plauderten unaufhörlich und waren offensichtlich in der Lage, den Freundinnen zuzuhören, ohne dabei den eigenen Redeschwall zu unterbrechen.
Auch die Jungen auf dem Konsumflügel standen zu zweit oder in vertraulichen Grüppchen zusammen, plauderten miteinander, vermieden es aber, sich zu berühren. Nur gelegentlich stupste man sich gegenseitig an. Einige freilich hatten bei einem vertraulichen Gespräch einen Arm um die Schulter oder den Hals eines Freundes gelegt, um weitere Zuhörer auszuschließen. Ab und zu geschah es, dass einer der beiden überraschend den Arm herunterzog und den Freund abrupt in den Schwitzkasten nahm. Wenn er dabei das Gesicht des anderen an seinem Mantel rieb, reizte der grobe Stoff ‒ die Mäntel und Joppen bestanden zumeist aus umgearbeiteten Soldatenmänteln ‒ wie ein Reibeisen Wange und Ohren.
Friedeward hatte nichts dagegen, wenn ein Schulkamerad den Arm um ihn legte, aber den Schwitzkasten empfand er als überaus unangenehm und sogar beschämend. Er wappnete sich stets innerlich, um beizeiten seinen Kopf zurückzuziehen. Bei Wolfgang allerdings war das anders. Instinktiv fühlte er, dass ihm von diesem Freund niemals eine solch alberne Zuneigungsbekundung drohte. Seine warmen braunen Augen versprachen Freundschaft und nicht Heimtücke, und seine Umarmung brachte ihm vertraute und durchaus erwünschte Nähe.
Friedeward und Wolfgang träumten von einem Leben als Künstler. Sie trugen sich gegenseitig auf langen Spaziergängen selbstverfasste Gedichte vor. In ihrem jugendlichen Hochmut zollten sie einander höchste Anerkennung, versicherten sich gegenseitig ihrer zukünftigen Bedeutung und ihres Ruhms, der einst weit über ihren Heimatkreis hinausreichen werde. Zugleich sprachen sie ihren späteren Lesern, Leuten wie ihre Klassenkameraden, jedes Verständnis für Kunst und Literatur ab.
Ihre Lektüre lieferte ihnen immer ausreichend Gesprächsstoff. Wolfgangs Tante Helena besaß eine reichhaltige Bibliothek aus der Zeit vor dem Krieg. Sie hatte ihrem verstorbenen Mann gehört, einem Maler, und sie hielt sie zu seinem Gedenken in Ehren. Mit Freuden lieh sie ihrem Neffen und seinem Freund Bücher aus und beriet sie auch durchaus kundig bei der Auswahl. So hatten Friedeward und Wolfgang neben dem Schulstoff, der die deutsche Klassik in den Vordergrund stellte, auch einige wichtige Texte der Moderne gelesen, ebenso Bücher aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, die zum Teil noch nicht wieder verlegt worden waren oder gegen die von den Zensoren des neuen Staates ein Druckverbot verhängt worden war, da diesen die Bücher missfielen oder sie ihre Autoren als faschistisch oder der gerade frisch gegründeten Republik gegenüber als feindlich gesinnt einstuften.
Zwei Bücher aus der Bibliothek, die ihnen Tante Helena ausdrücklich empfohlen hatte, waren zu ihrer Lieblingslektüre geworden. Sie lasen sie mehrmals, lasen einander daraus vor und konnten einzelne Sätze Wort für Wort und fehlerfrei zitieren. Es handelte sich um Thomas Manns Novelle Tonio Kröger und Robert Musils Verwirrungen des Zöglings Törleß