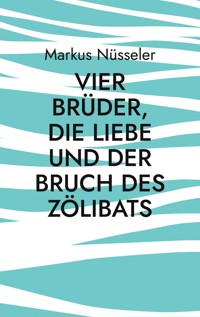
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Aaron, Priester und Seelsorger aus Leidenschaft, stößt an Grenzen. Da tritt Susanne in sein Leben. Jonas, Gymnasiallehrer und Ehemann von Amelie, findet durch eine Fahrgemeinschaft zu seiner Kollegin Vanessa. Luis ist Steuerberater und neben seinem Beruf mit Erzieherin Lisa verheiratet. Schleichend wird sein Arbeitseifer zur Sucht. Odo, der jüngste Bruder, ist Journalist und findet in Fiona eine feinfühlige Frau. Doch von Afra kommt er nicht los.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Nüsseler wurde 1954 in Bern/Schweiz geboren. Sein Erstlingswerk Carola – es begann nach dem Oktoberfest erschien im März 2022 und wurde im Verlag BoD – Books on Demand, Norderstedt, veröffentlicht. Der Roman Wendepunkte der Liebe führt die Geschichte um die Hauptpersonen des Erstlingswerks, Martin und Carola, zu Ende und erschien am 30.09.2022.
Im Mai 2022 erschien sein zweiter Liebesroman Lea – zwei Freundinnen und ein Ehemann. Mit diesem Roman beginnt die Trilogie um den Hotelier Tim, seine Frau Lea und deren Tochter Anna.
Der Roman Anna und Mia oder die ungleichen Töchter führt die Trilogie fort. Er erschien im März 2023 und begleitet Menschen auf der Suche nach dem, was ihr Herz zum Singen bringt, ihrem Leben einen tiefen Sinn verleiht und es lebens- und liebenswert macht.
Der fünfte Roman Tims Abschied und Mias Wiederkehr beendet die Geschichte um den Hotelier Tim, seine Familie und seine Freunde. Zentrales Thema des letzten Werks der Trilogie ist die Suche eines erfüllten Lebens während der Zeit der Berufstätigkeit und im Ruhestand.
Der sechste Roman Vier Brüder, die Liebe und der Bruch des Zölibats schenkt dem Leser Einblicke in die Lebensgeschichte von vier Brüdern. Vier verschiedene Erwartungen an das Leben und entsprechend konträre Antworten auf die Frage: »Wofür möchte ich leben, was ist für mich wichtig?«, ergeben ein facettenreiches Bild einer Familie.
Markus Nüsseler studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an der Hochschule für Philosophie SJ München. Der Autor ist verheiratet und hat einen Sohn. Er lebt seit 1976 in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
1
Samstagmorgen, und Daniel Maier saß bei seiner Frau Nicole beim erweiterten Frühstück. Einer ungeschriebenen Tradition folgend, fiel die erste Mahlzeit des Tages bei Familie Maier heute größer aus als unter der Woche. Sie ersetzte das Mittagessen und hätte eher den Namen Brunch verdient. Eben hatte Daniel die letzten Reste des Rühreis auf die Gabel geschoben, als ihn seine Frau erwartungsvoll ansah. »Wie hast du dir denn die Gestaltung der Weihnachtsfeiertage vorgestellt?« – »Nun ja, ich schlage vor, Heiligabend wieder Wiener Würstel mit Kartoffelsalat zu essen. Aber sag, wann kommen denn die Kinder? Hast du Nachricht von ihnen?« – »Nein, ich wollte erst mit dir darüber reden. Ich hatte daran gedacht, dass wir Jonas mit Amelie für Heiligabend einladen. Es wäre schön, wenn die beiden mit dem vierjährigen Niklas schon am späten Nachmittag zu uns kommen könnten. Ich würde die Würstchen und den Kartoffelsalat schon für halb sechs Uhr abends herrichten, sodass wir um sieben Uhr bescheren können. Damit Niklas nicht zu müde ist und den Baum und die Geschenke mitbekommt.« – »Und was ist mit Luis?« – »Er hat mir gegenüber durchblicken lassen, dass er lieber am ersten Feiertag kommen möchte. Er wird uns aber noch Bescheid geben.«
»Und was ist mit unserem Jüngsten, mit Odo?« Der Vater biss sich auf die Lippen, hob die Augenbrauen und fixierte seine Frau. Sein Blick verriet Skepsis mit einem Anflug von Misstrauen. Nicole wusste, dass ihr Mann den unsteten Lebenswandel seines Sohnes Odo und dessen opportunistischen Einstellungen missbilligte. »Sei bloß nicht wieder so scharf in dem, was du sagst, nicht dass Odo eines Tages ganz mit uns bricht! Gerade Weihnachten ist doch ein Fest der Familie und des Friedens. Halte dich bloß zurück mit deinen kritischen Äußerungen und deinen bösen Blicken!«
Der Vater lachte kurz auf. Es war ein kurzes, aber bitteres Lachen. Er wusste, er würde seinen jüngsten Sohn nicht ändern können. Er wusste auch, dass seine Widerrede an seinem Sohn Odo abprallen und seine kritischen Fragen ins Leere laufen würden. Nicht, weil Odo die besseren Argumente ins Treffen führen würde. Nein. Die nonchalante, fast liebenswürdige Antwort seines Sohnes entwaffnete ihn jedesmal: »Siehst du Papa, und ich denke eben anders darüber. Verstehst du nicht, dass man dazu auch eine andere Meinung haben kann?« Mit leiser Stimme vorgetragen, unterstützt durch ein entwaffnendes Lächeln, setzte Odo immer wieder seinen Vater schachmatt.
Daniel schwieg. »Mein Sohn, aber nicht mein Kind …«, sinnierte er und versank in ein dumpfes Brüten. Nein, diesmal wollte er keinen aussichtslosen Kampf führen.
Seine Frau unterbrach seine Gedanken. »Odo werde ich eine WhatsApp schreiben. Ach ja, und mit Aaron habe ich gestern telefoniert. Er erwartet uns am letzten Samstag vor dem Jahreswechsel und möchte uns zum Mittagessen einladen. Er ist ja an Weihnachten voll im Geschirr. Er ist immer heilfroh, wenn der 27. Dezember anbricht!«
Auf des Vaters Gesicht zeigte sich ein seliges Lächeln.
Aaron konnte er konzentriert zuhören, obwohl er seine Gedanken oft nicht teilte. Aber in Aarons ruhiger, getragener Stimme schwang eine Festigkeit und eine Gelassenheit mit, die beruhigend auf ihn wirkte. Ein unerschütterliches Vertrauen und eine große Sicherheit trugen seine Worte.
War er nicht der Meinung seines Sohnes, ließ er dessen Aussagen ohne Widerrede stehen. Als hätten sie eine höhere Geltung als die des jüngsten Bruders.
Er freute sich darauf, seinen ältesten Sohn zu treffen. Obwohl er beruflich in einer anderen Welt lebte, war er gelegentlich stolz auf seinen Ältesten.
Aaron lächelte Kritik und Gegenargumente nicht weg, sondern blieb seiner Überzeugung treu. Behielt diese zunächst für sich, zeigte sich jedoch geistig beweglich, stellte Gegenfragen, die den Gesprächspartner dazu brachten, die eigene Meinung zu hinterfragen. Bei Auseinandersetzungen zeigte er ein resilientes, nachgiebiges Verhalten. Wurde diplomatisch, gelegentlich auch akademisch. Er hasste harte Worte und schroffe Ablehnung. Er war katholischer Priester und seit einigen Jahren geistlicher Leiter eines großen Pfarrverbandes in einem Dekanat im Münchener Süden.
Als Aaron sich zum Studium der katholischen Theologie und zum Eintritt in das Münchener Priesterseminar bekannt hatte, war die ganze Familie aus allen Wolken gefallen. Nur die Mutter hielt losen Kontakt zur örtlichen Pfarrei. Sonntäglicher Kirchgang war ein Fremdwort und Gebet und geistliche Besinnung passten weder zum Lebenskonzept dieser Familie noch zu ihrer Interessenlage. Bei seinen Mitschülerinnen und Mitschülern am Gymnasium hatte seine Absicht, Pfarrer zu werden, eine Mischung aus ungläubigem Staunen und Kopfschütteln hervorgerufen. Sein bester Freund versuchte gar, ihn zum Studium eines handfesten, praxisnahen Gegenstandes zu bewegen, etwa Wirtschaftswissenschaften. »Damit kannst du was machen. Und wenn du im Beruf erfolgreich bist, kannst du ordentlich verdienen, es zu etwas bringen.« Doch Aaron stand zu seiner Entscheidung. Er wollte Theologie studieren. Dass vor dem Studium der biblischen Texte und der Interpretation der Kernaussagen des christlichen Glaubens noch das Studium des Bibelgriechischen und das Büffeln des Hebräischen, jene Sprache, die heute noch in Israel gesprochen wird und die gemeinhin Iwrit genannt wird, stand, verunsicherte ihn nicht.
Durch ein persönliches Erlebnis war Aaron dazu gekommen, im Evangelium, im Neuen Testament, zu lesen. Immer wieder nahm er das Neue Testament zur Hand. Er begann mit dem Evangelium nach Markus, dem ältesten und auch kürzesten der vier Evangelien. Die Radikalität der Worte Jesu in der Bergpredigt im Matthäusevangelium frappierte ihn, ließ ihn nicht mehr los. Er stieß auf Jesu radikale Forderung von Gewaltverzicht und bedingungsloser Friedfertigkeit, ja Feindesliebe gepaart mit einem unerschütterlichen Gottvertrauen. Eine einmalige Kombination, die Aaron faszinierte. »Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.« (Mt 6,34)
Bei der weiteren Lektüre in den Evangelien fühlte er sich durch die Botschaft Jesu, wie er sie im Evangelium nach Lukas und vor allem im Evangelium nach Johannes fand, ganz persönlich angesprochen. So, als würde Jesus selbst ihm gegenübersitzen und ihm sagen: »Aaron, folge mir nach! Komm zu mir, werde auch du mein Jünger!«
2
Aaron saß hinter seinem Schreibtisch. Dem Direktorium, dem liturgischen Kalender der Erzdiözese München und Freising, hatte er entnommen, dass für die Lesung im adventlichen Sonntagsgottesdienst ein Text aus dem Alten Testament, aus dem 61. Kapitel des Buches Jesaja, vorgeschrieben war.
»Der Geist Gottes ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen, und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, zu verkündigen den Gefangenen die Entlassung und den Gefesselten die Befreiung.« (Jes 61,1)
Die frohe Botschaft, von der der alttestamentliche Text sprach, bezog die Kirche auf Jesus. Er hatte das Anbrechen des Reiches Gottes verkündet und Gottes unwiderrufliche Liebe zu allen Menschen gepredigt, das Gebot der Gottesund Nächstenliebe zur Richtschnur des Handelns gemacht und sich über das jüdische Religionsgesetz hinweggesetzt, wo dies den Menschen durch seine Vorschriften im Weg stand oder ihm unsinnig erschien.
Für Jesus war rechtes Tun ohne Liebe undenkbar.
»Wer aus Liebe handelt, erfüllt den Willen Gottes.« Nicht der Zaddik, der fromme, gesetzestreue Jude, war Gottes Programm, sondern der Mensch, der sich für Gott öffnet, an ihn glaubt und Gottes Liebe an seine Mitmenschen weiter schenkt.
Die Liebe, die Jesus verkündete und in seinen Gleichnissen bildreich darstellte, sollte die Herzen der Menschen öffnen, sie großzügig und nachsichtig machen gegenüber dem Fehlverhalten der Mitmenschen. An erster Stelle sollten sie aber über ihr eigenes Leben nachdenken und erkennen, bei welchen Gelegenheiten sie in ihren Gedanken und Taten gegen die Liebe verstoßen hatten. Und bereit werden, sich in Zukunft am Gebot der Gottes- und Nächstenliebe zu orientieren.
Aaron kratzte sich hinter dem Ohr. »Keine einfache Perikope. Wo beginnen? Und vor allem: Was möchte ich den Menschen mit auf den Weg geben?«
In der Homiletik, der Predigtlehre, hatte er im Theologiestudium als Werkzeug zur Vorbereitung einer Predigt die Maxime mitbekommen: »Vom Kernsatz zum Zielsatz.« Das bedeutete im Hinblick auf die Predigtvorbereitung eine zentrale Aussage des Textes auszuwählen und dann so auszulegen, dass der Zuhörer einen Gedanken mit in sein Leben, in die nächste Woche mitnehmen konnte.
Aaron las den Text ein weiteres Mal durch. Bei den »Gefesselten« blieb er hängen. Er beschloss, über die Fesseln zu predigen, unter denen wir selbst leiden.
Welches sind unsere Fesseln? Unser Festhalten an vorgefertigten Meinungen und Vorurteilen, schlechte Gewohnheiten wie unkontrollierter Konsum von Süßwaren und Knabbergebäck während des Fernsehabends. Körperliche Abhängigkeiten, die uns innerlich und äußerlich einschränken, die uns unfrei machen und unser Wachstum behindern wie Alkohol- und Nikotinsucht. Mentale Fesseln, die wir uns selbst auferlegen: überspannter Ehrgeiz, Perfektionismus, Pflichtvergessenheit, der Wunsch, es immer allen Mitmenschen recht zu machen, Harmoniesucht. Termindruck, den wir aufbauen. Mangelnde Zeit für die Familie, für uns selbst, Unfähigkeit, sich zurückzunehmen oder mal abzuschalten.
»Alle diese Fesseln machen uns armselig und klein. Gott selbst hat mehr mit unserem Leben vor …« Ein zufriedenes Lächeln erschien auf Aarons Gesicht. »Gott will befreite Menschen, die sich aus selbst auferlegten Fesseln befreien. Jeder darf sich fragen: Welche Fesseln kann ich abstreifen? Wie kann ich ein freierer Mensch werden?«
3
Odo hatte die WhatsApp seiner Mutter gelesen und unverzüglich beantwortet. »Klar, komme 24.« Obwohl Odo Politikwissenschaften studiert hatte und mittlerweile im Bereich Journalismus bei einer überregionalen Tageszeitung arbeitete, war er im privaten Austausch schreibfaul. Er geizte mit Worten und behielt Privates für sich. Es schien, als wollte er jedes private Wort für seine berufliche Tätigkeit als Redakteur aufsparen.
Während seines Studiums hatte er ein Volontariat bei einer Zeitschrift für Finanzwesen gemacht. Nachdem er seinen Master in Politischen Wissenschaften beim zweiten Anlauf geschafft hatte, konnte er eine Teilzeitstelle bei seinem aktuellen Arbeitgeber antreten und fand über eine Bekanntschaft, die er in einer Frankfurter Bar unweit des Römers gemacht hatte, in einer WG eine Bleibe. Die Frau, die ihm ein Zimmer in einer Vierzimmerwohnung in einem Frankfurter Außenbezirk in der Nähe des Flughafens vermittelt hatte, hieß Elisabeth und war eine promovierte Kunsthistorikerin, die sich mit Führungen und Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. Ein Zubrot verschaffte Elisabeth ihre Verwendung als kunsthistorische Begleiterin bei Akademos Reisen, einer Agentur, die für eine anspruchsvolle und betuchte Klientel Studienreisen in europäische Metropolen anbot. Mit dem Besuch der jeweiligen Kunstmuseen.
Die geistig rege und vielseitig interessierte Frau war schon Ende dreißig und damit fast zehn Jahre älter als Odo. Elisabeth hatte ein breites Gesicht, trug eine Brille mit dicken Gläsern, hinter der zwei braune Augen neugierig auf den Betrachter gerichtet waren. Ihr schulterlanges Haar trug sie in der WG und in ihrer Freizeit offen.
Die dritte Bewohnerin, die Mieterin dieser Wohnung, hieß Simone und war Flugbegleiterin. Sie war größer als Odo, war blond und hatte die Wohnung von ihrer Mutter übernommen, als diese in ein Altenheim gezogen war. Sie kam und ging zu ständig wechselnden Zeiten. Sie bewahrte auch im privaten Leben eine professionell wirkende Zurückhaltung und setzte sich nur selten zu Elisabeth und Odo in die Küche. Nach einem kurzen Smalltalk zog sich Simone stets in das Wohnzimmer ihrer Mutter zurück. Sie hatte daneben noch das Schlafzimmer für sich.
Als Elisabeth Odo mit Simone bekanntgemacht hatte, war ihm Simone auf Anhieb sympathisch gewesen. Er wäre gerne mit Simone mal ausgegangen, aber das schien jedes Mal an den Dienstplänen, das heißt dem Flugplan der Fluggesellschaft mit dem Kranich im Logo, zu scheitern. Und an freien Tagen frequentierte sie besonders gerne einen Tennisplatz in der Nähe oder besuchte ihre Mutter, zu der sie ein inniges Verhältnis zu haben schien.
Einen Freund oder Lebenspartner hatten weder Elisabeth noch Simone.
In seiner kumpelhaften, gelegentlich saloppen Art hatte Odo beide Frauen auf das Thema Mann angesprochen. »Willst du denn ewig ledig bleiben, Elisabeth?«, hatte er gefragt. Elisabeth hatte geschluckt und mit einem erzwungenen Lächeln geantwortet: »Den richtigen habe ich leider noch nicht kennengelernt!«
Selbstbewusst kam von Simone: »Noch kein Bedarf!«
»Na ja, dann muss ich mit Elisabeth vorliebnehmen«, stellte Odo für sich fest. Tatsächlich hatte er schon zwei oder drei Mal mit Elisabeth abends eine Flasche Rotwein geleert. Und sie hatten sich sehr angeregt unterhalten. Das hatte auch Odo so wahrgenommen. Aber als er nach dem gemeinsam verbrachten Abend in sein Zimmer zurückgekehrt war, fielen ihm wieder die dicken Brillengläser Elisabeths ein. »Wenn sich Elisabeth für Linsen entscheiden könnte …«, sinnierte Odo. »Das würde sie um Längen hübscher machen.«
Nach der erfolgreichen Bewerbung auf eine Teilzeitstelle wurde Odo dem Ressort »Markt und Finanzen« zugewiesen, wohl wegen seiner Erfahrungen, die er von seinem Volontariat mitbrachte. Doch er war in der Finanzwelt nie heimisch geworden. Erst hatte er sich in die kryptisch anmutenden Kürzel wie KGV, KBV, ROI, PEG und RSL und viele andere einarbeiten und daran gewöhnen müssen, dann hatte er bemerkt, dass das Börsenbarometer so wechselhaft war wie das Wetter. Eine Stellungnahme des Chefs der FED, und schon bewegten sich die Kurse gen Süden. Odo war nie heimisch in dieser Materie geworden, obwohl er sich eingearbeitet hatte und die Begrifflichkeiten ihm mittlerweile vertraut waren.
Er war überglücklich, dass er zum 1. Januar in das Ressort Gesellschaft wechseln konnte. Jetzt endlich schien er auch das Wissen aus seinem Politikstudium anwenden zu können. »Vielleicht freut das auch meinen Vater?«, überlegte er.
4
Steuerberater Luis nahm das Handy und checkte die WhatsApps. Er öffnete die neue WhatsApp seiner Partnerin Lisa. Diese bestätigte die Verabredung zum gemeinsamen Essen im Da Marco in der Leopoldstraße in Schwabing. »Kann pünktlich weggehen. Bin um 18 Uhr im Lokal. LG Lisa.« Lisa war Erzieherin in einem städtischen Kindergarten. Die beiden hatten sich vor zwei Jahren kennengelernt. Es war Lisas erste Stelle, und sie war erst Mitte zwanzig, zwei Jahre jünger als Luis. Lisa teilte sich mit einer anderen Erzieherin eine Dreizimmerwohnung, während Luis ein winzig kleines Eineinhalbzimmerappartment bewohnte. Das reichte Luis für den Augenblick, denn er war abends und auch an den Wochenenden viel unterwegs. Zwei Mal wöchentlich, am Montagabend und am Donnerstagabend ging er zu seiner Volleyballgruppe ins Training. Am Mittwochabend besuchte er außerdem einen Italienischkurs in einer Sprachenschule. Dort ging er immer gerne hin, denn er schätzte die gesellige Runde nach dem Kurs, die passenderweise in einer kleinen italienischen Pizzeria gleich um die Ecke der Sprachenschule stattfand. Dort ging es mitunter recht heiter zu, und der Kellner vernahm mehrmals im Verlauf des Abends den Wunsch: »Ci porti un’ altra caraffa di vino rosso, per favore!«
Luis war dankbar dafür, dass er Lisa kennengelernt hatte. Lisa war eine eher zurückhaltende, verschlossen wirkende junge Frau, die sich in geselliger Runde gelegentlich erst dann einbrachte, wenn die Unterhaltung stockte und das Gespräch zum Erliegen kam. »So lange die anderen reden, sage ich nichts«, lautete ihre Devise. Wer Lisa noch nicht kannte, mochte ihr Schweigen als Schüchternheit auslegen. Doch dieses Urteil war eine grobe Fehleinschätzung. Die lebensfrohe und unternehmungslustige Frau kam schnell in Fahrt, wenn es etwa darum ging, eine gemeinsame Unternehmung zu planen oder ein Weihnachtsbüffet zu gestalten und dafür eine passende Auswahl leckerer Häppchen zu treffen. Lisa wurde temperamentvoll und sprühte voller Phantasie. Auch in ihrer Beziehung zu Luis gab sie selbstbewusst den Takt vor. »Komm, gehen wir. Es ist schon spät.« Oder sie hielt fest: »Wir gehen einmal im Monat zum Vietnamesen zum Essen.« Gemeint war dabei ein nettes kleines Lokal mit familiärer Atmosphäre in unmittelbarer Nachbarschaft zum Elisabethplatz. Mit solchen Vorgaben seiner Frau konnte Luis bestens leben. Er selbst brauchte nicht zu fragen und schätzte eine solche Ansage als Ausdruck Lisas Selbstbestimmtheit.
Der Entscheidung, sich im Da Marco zu treffen, waren keine langen Überlegungen vorausgegangen, denn dieser Italiener war ihr Stammlokal. Nachdem sie dem Kellner ihre Wünsche an die Küche mitgegeben hatten, eröffnete Lisa das Gespräch. »Was möchtest du deinen Eltern zu Weihnachten schenken?« – »Nachdem sie keine konkreten Wünsche geäußert haben und auch keine großen Weintrinker sind, bleibt wohl nur ein Geschenkgutschein. Vielleicht von einem Reiseunternehmen.« Luis nannte den Namen eines bekannten Busunternehmens, das auch Wellnesswochenenden im Programm führte. Lisa machte eine abwägende Kopfbewegung. »Die Idee mit dem Gutschein, den sie für eine Reise einsetzen können, ist an sich nicht schlecht. Aber ein Gutschein über eine bestimmte Summe an Euro zum Einlösen ist etwas Unbestimmtes. Nicht viel anders, als wenn du die gleiche Summe in ein Geschenkkuvert steckst und dann unter den Christbaum legst. Besser fände ich es, wenn der Gutschein ein konkretes Erlebnis verspricht. Was hältst du davon, an der Kasse der Oper einen Geschenkgutschein zu kaufen? Unser Gutschein verspricht dann ein unvergessliches Klangerlebnis!« Sichtlich stolz über ihren Einfall, lächelte Lisa vor sich hin.
Anerkennend nickte Luis und lächelte. »Volltreffer! Danke Lisa! Nicht nur wegen des einmaligen Klangerlebnisses, das wir meinen Eltern verschenken. Auch deswegen, weil sie sich einen Abend in der Oper nicht so ohne weiteres leisten würden. Du weißt ja, meine Eltern sind eher sparsam.«
5
Nach dem seelsorglichen Gespräch begleitete Aaron Frau Müller noch zur Außentüre des Pfarrhauses. »Wo haben Sie Ihren Wagen geparkt?«, erkundigte er sich. »Ich bin mit dem Rad gekommen.« – »Dann kommen Sie mir wohlbehalten nach Hause! Und schlafen Sie gut!« Beim Weggehen drehte sich Frau Müller noch einmal um: »Danke noch für das Gespräch. Es hat mir gutgetan.«
Aaron ließ seinen Blick noch über den Kirchenvorplatz schweifen, bevor er sich umdrehte und nachdenklich die Außentüre des Pfarrhauses hinter sich zuzog. Er nahm den Schlüsselbund aus seiner Hosentasche, suchte den passenden Schlüssel, steckte ihn in das Schloss und drehte zwei Mal um. Das gleiche Prozedere wiederholte er mit dem Schloss am Sicherheitsbalken.
Es war kurz vor halb neun Uhr abends. Der letzte Programmpunkt dieses Dienstags war zu Ende. Aaron blieb mit seinen Gedanken, den Fragen und Nöten, die an ihn herangetragen worden waren, allein. Nach der Betriebsamkeit des Tages, einem Krankenbesuch, den Vorbereitungen für den nächsten Abend in der Reihe »Bibel teilen«, des überraschenden Besuches einer jungen Frau, die ihn mit der Frage überrascht hatte: »Herr Pfarrer, sagen Sie mal, kann ich denn kirchlich heiraten? Mein Mann ist nämlich geschieden und aus der Kirche ausgetreten!«, worauf er die junge Frau in das Sprechzimmer mitgenommen hatte und für sie beide je eine Tasse Kaffee geholt hatte. Nach einigen gezielten Fragen konnte er die junge Frau beruhigen. »Ja, so wie der Fall liegt, stehen Ihre Chancen gut. Ich muss die Papiere jedoch zum »Nihil obstsat« an das Erzbischöfliche Ordinariat senden. Ich werde mich noch absichern und genau nach der Art der Dokumente erkundigen, die Sie und Ihr Mann zum gemeinsamen Termin mitbringen müssen. Denken Sie vor allem daran, dass wir zwei neue Taufscheine brauchen.« Daraufhin war er in das Büro gegangen und hatte unter der Nebenstelle 1449 den zuständigen Sachbearbeiter angerufen und sich nach den erforderlichen Dokumenten für diese kirchliche Trauung erkundigt. Die Trauung der jungen Frau mit ihrem deutlich älteren Partner, dessen erste Ehe gescheitert war.
Als Aaron sich auf den Weg in sein Zimmer machte, empfing ihn die nächtliche Stille des Dienstgebäudes. Er wohnte und arbeitete in dem stattlichen Pfarrhaus, das mit seinen neun Zimmern Platz für zwei Familien geboten hätte.
Im Erdgeschoss befanden sich neben der Toilette zwei Büroräume, eines für die Sekretärin und ein weiteres für eine Assistentin, der auch die Buchhaltung anvertraut war. Daneben ein großes Besprechungszimmer für Arbeitsgruppen und das Sprechzimmer, in welchem die Geistlichen den Nöten ihrer Pfarrkinder und weiterer Hilfesuchender zuhörten. Für den Fall, dass ein Gläubiger sein Leben vor Gott stellen wollte und um die sakramentale Lossprechung bat, lag in einem Schrankfach eine Stola bereit, die der Priester sich in diesem Fall um den Hals legte.
Auf der ersten Etage befand sich die Küche, das geräumige Esszimmer und die Schlafzimmer. Eines für Aaron und, da er allein hier wohnte, zwei Gästezimmer.
Durch die Trennung der beiden Etagen in einen Büround in einen privaten Wohnbereich blieb dem Pfarrer nur ein kleiner Privatbereich. Aarons Schlafzimmer war beileibe nicht nur zum Schlafen bestimmt. Vielmehr schuf es mit seiner kleinen Sitzecke aus schwarzem Leder und dem angrenzenden Schreibtisch mit den beiden Sukkulenten, die sich Aaron selbst gekauft hatte, und dem Ausblick auf den Pfarrgarten auch etwas Intimität, um zu persönlicher Stille und Entspannung zu finden. So stand auf dem modernen Glastisch vor der Sitzecke mit den schwarzen Sesseln auch eine Kerze auf einem Glasuntersatz.
Aaron holte sich ein Glas Mineralwasser in der Küche, zündete die Kerze an und ließ sich in einen der beiden Ledersessel fallen. In Gedanken blieb er beim letzten Gespräch dieses Tages hängen. Frau Müller hatte nach der Scheidung von ihrem Mann ihre Mutter bei sich aufgenommen und diese aufopferungsvoll gepflegt. Sie war im Februar dieses Jahres verstorben. Das Leben von Frau Müller hatte bis zum Tod ihrer Mutter nur noch einen Inhalt: die Pflege ihrer Mutter, wobei sie vom Pflegedienst Unterstützung bei der Morgen- und Abendtoilette bekam. Als sie ihrer Mutter das letzte Geleit gab, hatte sie vor der Trauerhalle oft die Worte gehört: »Es war doch sicher auch eine Erlösung für deine Mutter.« Einige unter den Trauergästen hatten ihren Trost gar in die Worte gekleidet: »Das ist doch auch für Sie eine Erlösung!« Der Tod der Mutter als Erlösung!
Wie eine Keule hatten diese Worte auf Frau Müller gewirkt. Als im August ihr Sohn Aljoscha, ihr einziges Kind, durch einen Motorradunfall ums Leben gekommen war, brach sie völlig zusammen. Und heute Abend wollte sie eine Antwort auf die Frage bekommen, die sie seit dem Ende dieses Sommers quälte: »Womit habe ich das verdient? Erst die Scheidung meines Mannes wegen einer jüngeren Frau, dann der Tod meiner Mutter! Und jetzt noch der Tod meines Sohnes? Sagen Sie mir, Herr Pfarrer, wieso schlägt mich Gott mit so viel Unheil? Erst die Scheidung, dann zwei Todesfälle in einem halben Jahr! Dass meine Mutter sterben wird, das war eine Frage der Zeit. Das kann ich noch verstehen. Aber dass mein Mann sich eine andere, jüngere Frau anlacht und mir wegen ihr den Laufpass gibt, weil diese fröhlicher und lustiger und vielleicht auch besser im Bett ist als ich, und dass dann nach der Scheidung mir auch noch mein Sohn weggenommen wird, was habe ich bloß getan, dass Gott das zulässt! Sagen Sie mir, Herr Pfarrer, wieso diese Kette von Unglück in meinem Leben! Wieso tut Gott mir das an?«
Aaron hatte mit verständnisvollen Worten die Schicksalsschläge von Frau Müller und ihre Verzweiflung in eigenen Worten zusammengefasst. Die Frage von Frau Müller hatte er aufgegriffen: »Und angesichts dieser Schicksalsschläge fragen Sie sich, ob Gott Sie verlassen hat, ja, ob er Sie damit strafen will?« Und Aaron hatte an Hiob gedacht, den Frommen aus dem Alten Testament, dessen Glaube an Gott auf den Prüfstand gelangt war.
Aaron hatte Frau Müller fragend von unten angesehen, fast so, als wollte er sie fragen: »Ist das Ihr letztes Wort?«
Daraufhin hatte er genickt. Er schmunzelte kurz in sich hinein, dann begann er nachdenklich: »Ob Gott Ihrem Mann die hübsche junge Frau über den Weg geschickt hat, das weiß ich nicht.« Aaron machte eine Pause. »Das glaube ich auch gar nicht. Ich denke eher, da haben zwei Herzen zueinander gefunden. Aber dadurch, dass Ihr Mann deswegen die Scheidung von ihnen wollte, hat er gegen die eheliche Treue verstoßen. Gegen das Jawort, das er Ihnen in der kirchlichen Trauung gegeben hat.« Nach einer kurzen Pause fuhr Aaron fort:
»Sie haben ja wiederholt mit Ihrem Mann gesprochen. Ich fühle mit Ihnen, wenn sie wütend auf ihn und frustriert darüber sind, dass ihre Ehe geschieden wurde. Aber dieses Ergebnis können wir nicht Gott in die Schuhe schieben. Gott hat uns beides, die Freiheit und die Verantwortung geschenkt.«
Aaron hatte die Tränen in Frau Müllers Augen gesehen. Wortlos hatte er ihr ein Päckchen mit Papiertaschentüchern zugeschoben. Beide hatten einen Moment geschwiegen. »Was Ihre Mutter betrifft: Jeder Tag unseres Lebens ist ein Geschenk. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und hat wunderbare Gaben und Talente in sein Leben mitbekommen. Durch die Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Und Gott hat uns zu einem Leben in Fülle berufen. Die Natur hat uns unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten zugeteilt. Und vielleicht hilft es Ihnen an dieser Stelle auch, an all das Gute zu denken, das sie Ihrer Mutter verdanken.«
Frau Müller hatte genickt. »Ja, als sie noch gehen konnte und ein eigenständiges Leben geführt hat, da haben wir uns öfters auch mal in der Stadt getroffen und uns bestens unterhalten. Wie in alten Zeiten. Es war der körperliche Zerfall, ihre Schwäche, mit der sie selbst nur schwer klarkam. Darum war sie gelegentlich unleidlich.«
Frau Müller hatte wieder Haltung gewonnen. »Und dass mein Sohn zu schnell mit dem Motorroller unterwegs war, das stand im Polizeibericht. Er hat den Unfall selbst verschuldet.«
Aaron hatte versucht, die Leidensgeschichte von Frau Müller in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Ihm war sehr daran gelegen, dass der Rückblick seiner Gesprächspartnerin nicht einseitig an negativen Erfahrungen haften blieb.
Er wusste: Momente von tief empfundenem Glück, freudige Erlebnisse und die Erfahrung, etwas geschafft zu haben, auf sich selbst stolz sein zu können, erfüllte fast alle Menschen mit Dankbarkeit oder wenigstens mit Zufriedenheit.
Auch im Gespräch mit Frau Müller war es ihm gelungen, durch einen positiveren Blick auf ihr Leben die Schicksalsschläge erträglicher zu machen.
Aaron griff nach seinem Brevier. »Darf ich Ihnen ein passendes Wort aus dem Buch der Psalmen, aus Psalm 23, vorlesen?« Fragend sah Aaron in Frau Müllers Gesicht. »Ja, gerne. Wenn es nichts Trauriges ist.« Tatsächlich war es Aaron gelungen, Frau Müller wieder aufzurichten. Und er hatte es geschafft, Frau Müller zu einem ehrlichen, unverstellten Blick auf die traurigen Erfahrungen des zu Ende gehenden Jahres zu führen.
Nicht Gott war es, der das Leid in das Leben der Menschen brachte. Die Naturgewalten, menschlicher Leichtsinn, Eigensinn, Egoismus oder Bosheit und Lieblosigkeit brachten Leid.
Aus Psalm 23
»Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.
Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.«
6
Die Redaktionssitzung, die morgendliche Besprechung des Chefredakteurs mit den Kollegen der einzelnen Fachgebiete, war vorbei. Odo fiel die Aufgabe zu, für die Wochenendausgabe in der Rubrik »Gesellschaft und Soziales« die Dokumentation für das Schwerpunktthema »So leben wir im Alter« zum ersten Infoblock »Arm im Alter« zu erstellen. Heute war Montag, und er hatte Zeit, Fakten zusammenzutragen, durch zwei oder drei exemplarische Berichte zu ergänzen und durch Fotos plakativ zu veranschaulichen. Gefragt war von der Redaktionsleitung auch stets eine Schlagzeile mit einem kleinen Blickfang für die Titelseite der Zeitung. Mit einem kleinen plakativen Foto, das auf das Thema aufmerksam machte. Ob Odos Bericht den Sprung in die Headlines der Titelseite schaffen würde, entschied die Redaktionsleitung.
Odo machte sich an die Arbeit und stellte die statistischen Daten zusammen.
Im Jahr 2022 lag die Armutsgefährdungsquote von Personen im Alter ab 65 Jahren in Deutschland bei 17,5 Prozent, d.h. 17,5 Prozent der Senioren und Seniorinnen waren von relativer Einkommensarmut betroffen. (Stand 15.05.2023).
Odo entnahm den Statistiken weiter folgendes: Die meisten Rentnerinnen und Rentner, die eine gesetzliche Rente beziehen, bekommen weniger als monatlich 1.500 € Rente. 80 Prozent der Frauen ab 65 müssen mit weniger als 1000 Euro im Monat über die Runden kommen. Über Jahrzehnte erbrachte Leistungen im Beruf zählen da wenig. Auch Männer sind betroffen.
Beamte und Beamtinnen schneiden hingegen deutlich besser ab. Ein Autor fasste diese Ungleichheit in die Worte: »Beamte im Ruhestand stehen auf der Sonnenseite der Gesellschaft.« Da sind es über 90 Prozent der Pensionsbezieher, die mehr als 1500 € Pension erhalten. Eine Zweiklassen-Gesellschaft in der Altersversorgung. Ungerecht, wenn man den Blick zum Beispiel auf Österreich wirft, wo es deutlich höhere Altersrenten gab. Außerdem hatte Österreich die Sonderstellung der Beamten bei der Altersversorgung abgeschafft.
82 Prozent der gesetzlichen Renten liegen unter 1500 € monatlich. Bei den Pensionen der Bundesbeamten sieht die Sache ganz anders aus. Hier erhalten 95 Prozent mehr als 1.500 € Altersgeld. Odo entnahm den Beiträgen zu seinem Thema, dass das Risiko von Altersarmut steigt. Eine Million Menschen sind aktuell auf eine staatliche Grundsicherung im Alter angewiesen, doppelt so viele wie vor zehn Jahren.
Odo schaute über die Homepage der Deutschen Rentenversicherung nach. Dort fand er folgende Auskunft: »Als einfache Faustregel gilt: Wenn Ihr gesamtes Einkommen unter 973 Euro liegt, sollten Sie prüfen lassen, ob Sie Anspruch auf Grundsicherung haben.« (Stand August 2023).
Nachdenklich kratzte sich Odo hinterm Ohr. »Da liegt doch ein enormer sozialer Sprengstoff verborgen. Es wird eine der Hauptaufgaben der künftigen Bundesregierung sein, auf dem Gebiet der Sicherung der Altersversorgung gegen diesen Missstand für Abhilfe zu sorgen. Und die künftigen Rentenbezüge aller Arbeitnehmer zukunftsfest zu machen. Das ganze Rentensystem gehörte auf den Prüfstand. Und mit ihm die Sonderstellung der Beamten und der Selbständigen. Außerdem müsste eine obligatorische betriebliche Pensionskasse für alle Beschäftigten verpflichtend vorgeschrieben werden, wie das in der Schweiz der Fall ist. Eigentlich ist es eine Schande, dass in einem wirtschaftlich so erfolgreichen Land wie Deutschland die Altersversorgung deutlich unter vergleichbaren Ländern wie Österreich oder den Niederlanden liegt.«
Odo stand auf und holte sich eine Tasse Kaffee. Als er wieder zurück an seinem Arbeitsplatz war, grübelte er darüber, wie er seinen Beitrag illustrieren könnte. Im Archiv fand er ein Foto, das die gefurchten Hände einer alten Frau zeigte, die ihren fast leeren Geldbeutel zeigte. Auch das Foto eines Flaschensammlers von hinten, der eben eine Bierdose aus dem öffentlichen Papierkorb entnahm, war anschaulicher als zwei Seiten Text. Ferner fand er einige Interviews mit Rentnern, die Grundsicherung bekamen. Erschreckend, wenn im Alter kein Geld mehr dafür da war, um Kindern und Enkeln ein kleines Geschenk zu Weihnachten zu machen. Oder wenn der Gang zum Stammtisch ein Luxus wird, den sich tüchtige und fleißige Arbeitnehmer, die 40 Jahre und länger gearbeitet hatten, nach dem Eintritt in den Ruhestand nicht mehr leisten konnten.
Odo begann, den redaktionellen Text zu verfassen. Und wie schon so oft, kam er beim Schreiben richtig in Fahrt. Ein Flow hatte ihn erfasst.
Als er nach drei Stunden auf dem Notebook den Stand der Uhr wahrnahm, war schon fast zwei Uhr nachmittags. Er entschied für heute diese Aufgabe zu beenden. Morgen wollte er noch einmal darüber schauen. Einer guten Angewohnheit folgend, beendete er das Schreiben, klappte das Notebook zu, holte sich eine Tasse Kaffee und fuhr mit dem Aufzug auf die Dachterrasse des Redaktionsgebäudes. Oben angekommen, stellte er die Tasse ab und zündete sich eine Zigarette an.
Nachdenklich sah er hinunter in die Straßenschlucht und verfolgte die Autos, die wie kleine Punkte ihren Weg fanden. Unvorstellbar, dass unter den Passanten, die sich wie kleine Ameisen am Straßenrand entlangschoben, Arme und Reiche, Glückliche und Unglückliche waren. Überschuldete und Millionäre.
Oft war in ihm bei der Fahrt in der S- oder U- Bahn die Frage aufgekommen: »Was mag mein Gegenüber beruflich machen? Geht es ihm finanziell gut oder quälen ihn Sorgen?« Diese Frage konnte er auch bei intensivem Hinschauen nicht beantworten.
Anonymität verwischte die persönlichen Lebensumstände. Die Menschen verloren in der Anonymität einen großen Teil ihrer Persönlichkeit. »Wie kann ich einen Menschen verstehen, wenn ich nicht weiß, aus welchem Milieu er stammt, was er für einen beruflichen Hintergrund hat, was er gegenwärtig beruflich macht, in welchen Lebensumständen er lebt?«, dachte Bodo und nahm einen tiefen Zug aus der Zigarette.
Wieder sah er nachdenklich in die Tiefe. »Jeder von uns ist doch unendlich viel mehr als eine Ameise im Weltgetriebe«, hielt Odo fest.
7
Jonas, Amelie und ihr gemeinsamer Sohn Niklas bewohnten eine Dreieinhalbzimmerwohnung in Freiham. Jonas war Lehrer an einem städtischen Gymnasium in Augsburg und Amelie arbeitete in Teilzeit in einer Bankfiliale in der Münchner Innenstadt.
Es war kurz vor sechzehn Uhr. Jonas war eben mit dem Auto vom Einkaufen zurückgekommen. Er fuhr täglich mit dem Auto an sein Gymnasium in Augsburg. Auf diese Weise erreichte er nach einer Fahrt von vierzig Minuten seinen Arbeitsplatz in Augsburg und brauchte damit nur wenig länger als seine Frau Amelie, deren Bankfiliale am Rosenheimer Platz war. Amelie hätte viel dafür gegeben, wieder in der Zentrale ihrer Bank in der Sparkassenstraße/Ecke Tal zu arbeiten. Dort hatte sie ihre Ausbildung absolviert. Und noch immer hatte sie private Kontakte zu Mitarbeiterinnen, die sie aus der Zeit ihrer Banklehre kannte. Leider war nach dem Ende ihrer Lehrzeit keine Stelle in der Zentrale frei gewesen. Aus diesem Grund hatte sie mit einem Arbeitsplatz in der Niederlassung am Rosenheimer Platz vorliebnehmen müssen.
Jonas legte die frischen Einkäufe in den Kühlschrank und verstaute die restlichen Besorgungen. Er schenkte sich ein Glas Mineralwasser ein und setzte sich zur Korrektur einer Matheschulaufgabe an den Esszimmertisch. Zwei Stunden Korrekturarbeit lagen vor ihm. Das müsste reichen, um die 26 Arbeiten zu korrigieren und Punkte zusammenzuzählen. Das Notenrechnen wollte er auf morgen lassen. Er war froh, dass er Mathe- und Physiklehrer geworden war. Eine Schulaufgabe in einer Fremdsprache zu korrigieren, würde doppelt oder dreimal so lange dauern. Er hatte das selbst mitverfolgen können, denn er war lange Jahre mit einer Kollegin zusammen gewesen, die Englisch unterrichtet hatte. Er hatte von ihr auch erfahren, dass Sprachen lebten, sich im Laufe der Zeit entwickelten, und dass ein Englischlehrer sich bei der Korrektur gelegentlich die Frage stellte, ob die Version, die der Schüler verwendete, noch möglich war. Ob ein halber oder ein ganzer Fehler vorlag. So etwas war ihm als Mathe- und Physiklehrer fremd. Entweder wendete der Schüler die richtige Formel an, oder die Anwendung war falsch. In den Naturwissenschaften gab es kein »Das geht vielleicht noch.« Die exakten Wissenschaften, so wie die Schüler sie im Unterricht kennenlernten, boten zweifelsfreie Gewissheiten. Es gab nur richtig oder falsch. Allenfalls in der Astrophysik wurden Modelle verwendet, um Phänomene zu erklären, Zusammenhänge herzustellen und Entwicklungen verstehbar zu machen. Jonas hatte Freude daran, Mathematik und Physik zu unterrichten. Und manchmal gelang es ihm sogar, Schüler für die Unterrichtsgegenstände zu begeistern.
Und aus den Erfahrungen, die er mit einer Kollegin gemacht hatte, war er auch froh, dass seine Frau als Sparkassenangestellte feste, geregelte Arbeitszeiten hatte. Wenn sie nach Hause kam, war ihre Arbeitszeit zu Ende. Der Beruf lag hinter ihr und sie hatte Zeit für den familiären Teil ihres Lebens. Und den Kopf frei für ihr privates Leben.
Er hoffte, gegen sechs Uhr abends mit der Korrektur fertig zu sein. Amelie und Niklas erwartete er innerhalb der nächsten halben Stunde zurück. Auf dem Nachhauseweg von der Bank fuhr Amelie zum Kindergarten und holte dort ihren Sohn Niklas ab. Gelegentlich übernahm auch ihr Mann diese Aufgabe, und sie machte Station beim Biomarkt.
Die richtige Auswahl von frischem Salat und Gemüse im Biomarkt war Amelies Domäne. Sie zog kleine Fachgeschäfte mit Kundenbezug den Supermärkten vor. Einkaufszentren entsprachen Jonas’ Naturell, und da er mit dem Auto von der Arbeit kam, boten sich ihm zwischen Augsburg und Freiham mehrere Möglichkeiten. Jonas genoss diese Freiheit in der Wahl des Marktes und entschied jeweils spontan. Die Einkäufe teilten sich Amelie und Jonas auf. In der Regel schob Amelie ihrem Mann beim Frühstück einen kleinen Einkaufszettel mit den Besorgungen zu, die er übernehmen sollte.
Viel Zeit für den persönlichen Austausch nahmen sich beide am samstäglichen Brunch. Dieser bot endlich Zeit für längere Gespräche, an dem auch Niklas teilnahm, und bildete den Auftakt zu vielen gemeinsamen Unternehmungen, auch mit Freunden.
Jonas hatte sich eben über eine weitere Schulaufgabe gebeugt, da vernahm er die Klingel der Wohnungstüre. »Das sind Amelie und Niklas!«, durchfuhr es Jonas. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht erhob er sich und begab sich zur Wohnungstüre. Kaum hatte er die Türe geöffnet, da empfingen seine Arme Niklas, seinen Sohn. »Papa!« – »Wie war es im Kindergarten?« – »Super. Wir haben einen Schneemann gebaut!«
Amelie zog nun ihrerseits Jonas an sich und küsste ihn. »Wie war dein Tag?« – »Erzähle ich dir beim Essen. Aber erst muss Niklas aus seinen Hosen raus.« Stimmt. Die Hosenbeine waren nass, nicht nur die Mütze seines Sohnes. »Das übernehme ich. Komm Niklas, ich zieh dich um.« Vater und Sohn verschwanden im Badezimmer. Bald hörte man Niklas, wie er laut und munter mit seiner hellen Kinderstimme von seinem Kindergartentag berichtete.
8
Odo hatte seinen Beitrag zum Schwerpunktthema »Arm im Alter« am Dienstagnachmittag fertiggestellt und ihn an den Chef dieser Sparte weitergeleitet. Je öfters er den Beitrag kritisch im Hinblick auf seinen Aufbau und die innere Logik hin geprüft hatte, desto mehr wurde ihm die gesellschaftliche Bedeutung des Themas bewusst. Denn seine Fallbeispiele waren nicht nur erschütternd, sondern auch brisant. In einem reichen Land wie Deutschland erwartete Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet hatten, wenn auch durch Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen streckenweise nur in Teilzeit, eine Rente, die sie trotzdem am Rande des Existenzminimums zurückließ.
Er war froh, dass er sich jetzt für die Dokumentation »So leben wir im Alter« dem nächsten Beitrag »Neue Wohnformen im Alter« zuwenden konnte. In einem Vorort von Köln entstanden zwei Wohnblocks für Mehrgenerationenhäuser. Das Projekt war dem Gedanken verpflichtet, dass sich die Generationen gegenseitig unterstützen. Rüstige Seniorinnen und Senioren sollten in die genossenschaftlich organisierte Kinderbetreuung eingebunden werden. Als Gegenleistung würden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihr berufsbezogenes Wissen einbringen und Dienste im Bereich PC-Anwendung, Besorgungen, Fahrdienste oder Antragstellung bei Behörden übernehmen. Odo las sich in die Dokumentation der politischen Gemeinde und des Bauträgers ein. Im Verlauf der Woche würde er Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort führen, am besten im Zusammenhang mit einem Ortstermin.
Als er abends nach Hause in seine WG kam, setzte er sich in die Küche und machte Brotzeit. Er hatte sich eben eine halbe Vollkornsemmel mit Leberwurst bestrichen, da hörte er an der Haustüre sperren. Es war Simone. Odo war aufgestanden und neugierig in die Diele getreten. Simone kam von ihrem heutigen Dienst bei der Kranichfluglinie zurück. »Hallo Simone. Schon so früh wieder gelandet?«, fragte er scherzhaft. Simone verzog den Mund. Sie setzte ihre Tasche ab und seufzte. »Weißt du, seit wann ich heute auf den Beinen bin?« Odo zog die Augenbrauen hoch und signalisierte Interesse. »Ich bin kurz vor halb fünf hier weggegangen.« – »Oh!«, entfiel es Odo. »Da habe ich noch tief und fest geschlafen. Darf ich dir etwas anbieten? Willst du dich kurz zu mir setzen?« – »Ein Glas Wasser würde ich gerne trinken. Ich verstaue nur erst meine Sachen und ziehe mich um.« Simone verschwand und kam zehn Minuten später in Jeans und weißer Bluse zurück.
»Oh!«, machte Odo erneut bei Simones Anblick. So chic hatte er sie noch nie gesehen. Die Röhrchen Jeans und die weiße Bluse machten Simone schlank und betonten gleichzeitig ihre weiblichen Formen. »Hast du noch etwas vor?«, fragte Odo und schenkte Simone ein Glas Wasser ein. Ein Lächeln umspielte Simones Mund. »Ich treffe mich noch mit einer Freundin zum Essen. Wir haben uns schon länger nicht gesehen und es gibt allerhand zu berichten. Sie arbeitet bei einer großen Bank und hat mich zum Essen eingeladen. Nachher wollen wir noch zum Tanzen gehen. Ich habe morgen und übermorgen frei.« Odo sah fragend in Simones schmales Gesicht. »Dann verdient sie sicher ganz gut?« – »Sei bloß still! Das Doppelte von dem, was ich bekomme, wenn nicht gar noch mehr. Und auch ihre Arbeitsbedingungen sind optimal. Zwei Mal in der Woche macht sie Homeoffice, und wenn sie mal ein Kind hat, kann sie in Teilzeit gehen. Die haben so tolle Teilzeitmodelle. Sie könnte zum Beispiel nur noch an drei Tagen die Woche arbeiten, davon zwei Tage von zu Hause aus.« Odo nickte anerkennend. »Das klingt ganz familienfreundlich. »Lass mich raten, arbeitet sie für die Bank mit den Zwillingstürmen?« – »Ja. Aber der Stress bleibt.« – »Sag mal Simone, möchtest du mit ihr tauschen?« – »Jein. Mein Job ist abwechslungsreich. Kein Tag ist wie der andere. Und seit wir auf den Europaflügen kein Essen mehr ausgeben, ist ein entscheidender Stressfaktor weggefallen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es an Bord gemütlich zugeht. Und mit Teilzeit ist das beim Kabinenpersonal so eine Sache. Ganz abgesehen davon, dass sich die Arbeit dann kaum noch lohnt, wenn ich nur an drei Tagen die Woche an Bord bin.«
Odo zeigte auf die Rotweinflasche auf dem Tisch. »Möchtest du ein Glas Wein trinken?« – »Nein danke. Kein Alkohol vor dem Ausgehen.« – »Sag mal Simone, in welchen Klub geht ihr denn?« Simone nannte den Namen. »Wir gehen immer ins Cindy. Komm halt nach, wenn du Lust hast. Aber vor elf ist da nicht viel los. Schau einfach vorbei. Dann lernst du auch meine Freundin Fiona kennen.« – »Das klingt vielversprechend«, dachte Odo. »Ja, gerne. Gehst du öfters dorthin?« – »Ein bis zwei Mal im Monat. Meist ohne vorheriges Essen. Aber jetzt haben wir uns drei Monate lang nicht gesehen. Da habe ich mich sehr gefreut, dass Fiona mich eingeladen hat.«
Simone war aufgestanden. »Dann mache ich mich mal fertig. Tschüss!« – »Viel Spaß«, rief Odo Simone hinterher. Dabei empfand er ein klein wenig Neid. Seine Mitbewohnerin Simone machte sich auf in einen vergnüglichen Abend.
Odo goss den Rest der Bierflasche in das Glas und starrte versonnen in die Schaumkrone. »Soll ich mich umziehen und später Simone und Fiona ins Cindy folgen? Mein Termin in Köln im Mehrgenerationenprojekt ist erst nachmittags um 14 Uhr 30. Vor halb zehn brauche ich in Frankfurt Hauptbahnhof nicht loszufahren. Das wird ein entspannter Tag. Ich denke, ich kann noch was aus dem angebrochenen Abend machen.«
Als Odo gegen halb zehn Uhr abends das Haus verließ, war er ganz beschwingt. »Vielleicht lerne ich Simone mal von einer anderen Seite kennen. Nicht nur »Guten Morgen« beim Gehen oder »Hallo« beim Kommen. So viel Zeit wie heute Abend hatte ihm Simone noch nie geschenkt. Es gab oft Tage, an denen sich Odo und Simone gar nicht begegneten.
Nachdem Odo das Cindy erreicht hatte, durchmaß er suchend die halbdunklen Räume nach Simone. Trotz der schmissigen und lauten Musik war die Tanzfläche ziemlich leer. Odo suchte auch die Tische am Rande ab, doch er fand Simone nicht. Odo machte kehrt und ging zurück in Richtung Bar. Dort war er noch nicht gewesen. Und da sah er sie, die schlanke Frau in den eng anliegenden Jeans und der weißen Bluse: Simone. Sie saß ihrer Freundin schräg gegenüber.
Odo näherte sich den beiden, und Simone beugte sich zu ihrer Freundin vor und schrie ihr Odos Namen ins Ohr. Zum Glück legte der DJ gerade eine Pause ein und es gelang Simone, Odo mit Fiona bekannt zu machen. Odo nickte freundlich und zeigte sich erfreut. »Viel hat mir Simone von dir noch nicht verraten. Aber vielleicht erzählst du mir später etwas mehr von dir? Du bist bei der Presse?« – »Ja. Aber keine Angst: Du musst mir kein Interview geben!« Beide lachten. Schon trat der DJ wieder in Aktion und Odo zog Simone auf die Tanzfläche. Nach etlichen Tänzen begleitet er Fiona auf das Parkett. Fiona war etwas kleiner als Simone und trug ihre langen braunen Haare hochgesteckt. Sie erschien Odo temperamentvoller als ihre Freundin Simone. Und es war offensichtlich, dass sie sehr gerne tanzte. Immer wieder warf sie ihre Arme in die Höhe und gelegentlich drehte sich Fiona sogar um die eigene Achse. Ihr Blick war versonnen nach unten gerichtet. Fiona ließ sich von den schnellen Rhythmen der Musik mitreißen, und dennoch schien es, als wäre sie konzentriert bei sich. Lebhaft und ausdrucksstark – und doch ganz Fiona.
Odo machte es Spaß, mit Fiona zu tanzen. Ihre Lebendigkeit steckte ihn an und erfüllte ihn mit Leben und Leichtigkeit.
Nach einer halben Stunde hielt Fiona inne und machte eine Bewegung mit dem Kopf in Richtung Bar.
Odo bot Fiona einen Drink an, doch sie verwies lächelnd auf ihr noch halb volles Glas. »Vielleicht ein andermal?«, fand Odo und sah in Fionas Gesicht. Fiona lächelte charmant, aber unbestimmt.
Nachdem Odo noch ein Getränk bestellt hatte, lösten sich Simone und Fiona vom Tresen und gingen zurück auf das Parkett. Jetzt tanzten die beiden Frauen zusammen. Bei langsamen Rhythmen zog Simone Fiona an sich, und beide überließen sich den Klängen der Musik. Im Gewitter der bunten Lichtblitze fielen sie nicht auf.
Versonnen glitten Odos Blicke über die Tanzenden. Er träumte vor sich hin und erschrak beinahe, als Simone an ihn herantrat. Sie lächelte ihn an und ihr Kopf näherte sich Odos Ohren. »Wir trinken noch aus und brechen dann auf.«
9
Aaron hatte es geschafft. Er hatte sich nur mit Mühe von der Weihnachtsfeier des Seniorenkreises im Pfarrsaal lösen können. Er hatte am Ehrenplatz an der Stirnseite des Quertisches unmittelbar vor der Bühne des Pfarrsaals neben den Organisatoren des adventlichen Zusammenseins mit stimmungsvoller Musik, besinnlichen Texten und dem gastweisen Auftritt des Kirchenchores Platz nehmen müssen. Wieder saß er bei jenen, mit denen er im Alltag des pfarrlichen Betriebes regelmäßig zu tun hatte. Deren Familienverhältnisse, persönliche Vorlieben und Sorgen er bestens kannte, mit denen er dienstlich zusammenarbeitete. Einige davon zählten gar zu den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates. Übereifrige fanden sich sogar in mehreren der Fachausschüsse, die das pfarrliche Leben durch ihr Engagement, die Präsenz im Online-Pfarrbrief und durch ihre Aktivitäten am Leben hielten. Zum Beispiel im Ausschuss »Pfarrfeste und Feiern«.
Aaron jedoch lagen zwei Ausschüsse besonders am Herzen. Es war die Arbeitsgruppe »Junge Christen« und der Bibelkreis. Es gab kaum etwas, was Aaron mehr Freude bereitete als das gemeinsame Lesen in der Bibel mit dem Versuch, aus den Aussagen der Perikopen eine ganz persönliche Botschaft zu entnehmen. An diesen Abenden ermunterte er nach der Lektüre des Abschnitts aus der Bibel und einer Phase der Stille die Teilnehmer, für sich einen Satz zu finden, der ihnen besonders gefiel, der sie ansprach.
Nachdem er eine Tasse Tee getrunken und ein Stück Stollen gegessen hatte, verließ er mit einem Nicken in Richtung der Organisatorin seinen Ehrenplatz, den er wider Willen eingenommen hatte und ging in die Runde, von Tisch zu Tisch. Und das dauerte, denn immer wieder hörte er die Bitte: »Herr Pfarrer, kommen Sie kurz zu mir!« Dabei musste er seine Aufmerksamkeit, sein teilnehmendes Zuhören immer wieder wegen der zahlreichen Darbietungen unterbrechen. Dieser Teil seiner Arbeit war ihm sehr wichtig. Als Pfarrer wusste Aaron, dass Geduld und Zuhören das A und O der Seelsorge waren. Auch wenn das Zuhören allein die angesprochenen Probleme nicht lösen konnte. Doch das Gefühl, ein Ohr gefunden zu haben und mitfühlende Worte mit nach Hause zu nehmen, stärkte die Menschen, denen er sich zuwandte.
Das Direktorium sah für den Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend die Perikope aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Verse 1 – 14 vor. Für die Predigt wählte Aaron schwerpunktmäßig die Aussage der Verse 8 – 11 aus.
»8 In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
9 Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr.
10 Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll:
11 Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.«
Aaron hatte die Textstelle, auf der er seine Predigt aufbauen wollte, mehrmals durchgelesen. Die Hirten waren es, die als erste die Nachricht von der Geburt Jesu, unseres Retters, erhielten. Einfache Menschen am Rande der Gesellschaft, schlecht bezahlte dienstbare Geister, die sich um die Tiere ihres reichen Herrn kümmerten, denen die Aufsicht über einen Teil seines Vermögens anvertraut war. Während ihr Arbeitgeber in einer gut geheizten Villa bei einem Glas Wein saß und plauderte, waren sie der unwirtlichen Kälte des Winters ausgesetzt und kauerten sich in ihre Decken.
Hirten hatten zur Zeit Jesu keinen guten Ruf. Sie waren Mietlinge und standen im Ruf, unehrlich zu sein. Schlecht gekleidet, ungepflegt, mit wirren Bärten und langen Haaren. Am besten, man ließ sich nicht mit ihnen ein. Auf diese Un- und Angelernten draußen, auf freiem Feld, in Decken gehüllt, richtet der Regisseur Lukas in seiner Erzählung seine Scheinwerfer: Hört her, Gott ist Mensch geworden, er ruft uns zu sich!
Und die Hirten waren es, die sich auf den Weg zum Stall von Bethlehem machten. Ohne Fragen zu stellen, ohne zu diskutieren.
»15 Und es geschah, als die Engel von den Hirten in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat.«
»Komisch«, dachte Aaron. »Wenn ausländische Staatsmänner zu Besuch kommen, werden sie mit militärischen Ehren und einer Parade empfangen und über den roten Teppich geführt. Alle sind in makellosen Anzügen oder in Uniformen mit Rangabzeichen gekleidet.
Als Jesus geboren wurde, waren die ersten Besucher ein paar zerlumpte Gesellen von draußen. »Heute wären das die Obdachlosen, die Jesus den ersten Besuch machen würden. Sicher würde Lukas sie in seine Story einbauen.« Aaron blickte in die Kerze, die auf seinem Schreibtisch brannte. »So unscheinbar und völlig unerwartet ist Gott in unsere Welt gekommen. Und er hat sich zuerst den Menschen gezeigt, die ein offenes Herz für ihn hatten. Die ersten Empfänger der frohen Botschaft waren die Hirten, die Menschen am Rande der Gesellschaft. Sie haben Jesus gefunden und ihn angenommen.«
»17 Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
18 Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde.«
»Weihnachten ist das Fest der Liebe, und wir machen uns gegenseitig Geschenke, mit denen wir lieben Menschen Freude bereiten wollen. Denken wir dabei auch an jenes Geschenk, das Gott uns machen will, an Jesus?«





























