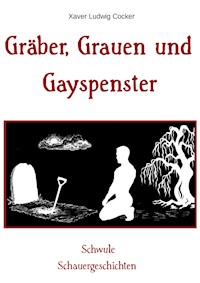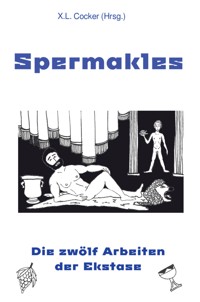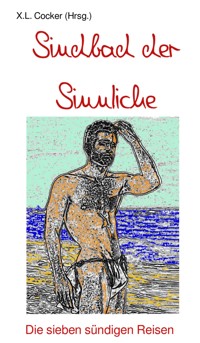8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Yeoj Selbstverlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
In weiter Ferne liegt das Land der lila Liebeslust, wo es keine Seltenheit ist, wenn ein Königssohn das Herz eines anderen Prinzen erobert. Niemand nimmt Anstoß am wollüstigen Ritter, der auf seiner Burg fröhlich mit seinem Knappen im Stroh rauft. Von solcherlei Begebenheiten wollen die Märchen in diesem Band erzählen - mal sinnlich und sehnsüchtig, mal frech und frivol, jedoch allesamt angehäuft mit liebenden lila Lüstlingen. Garniert werden die Märchen mit über 70 Illustrationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Xaver Ludwig Cocker (Hrsg.)
Vierzig schwüle Nächte
Homoerotische Märchen aus dem Land der lila Liebeslust
Band III (15.-21. Nacht)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by X.L. Cocker
Umschlaggestaltung und Illustrationen: © Copyright by Yeoj
Verlag:
YEOJ Selbstverlag
Postfach 11 11 03
35390 Gießen
Die fünfzehnte Nacht
»Diese Demse, diese Demse«, beschwert sich Margarete und meint damit die drückende Hitze.
Ich stelle fest, dass sie mit diesem regionalen Ausdruck unbewusst ihre Herkunft preisgibt, aber ich verzichte auf einen Kommentar diesbezüglich. Schließlich plagt mich die Hitze genauso wie sie und die fünf anderen Geflüchteten, die sich in Giovannis Haus im Wald verstecken.
»Wenn wir uns nicht hier im abgelegensten Winkel der Welt verstecken müssten, würde ich sofort Zuflucht in einem Freibad suchen«, meint Arne.
Basil mustert ihn von hinten und zwinkert verdächtig. Vermutlich stellt er sich unser jüngstes Gruppenmitglied in engen Badeshorts vor. Margarete tippelt währenddessen hin und her und platziert diverse Schüsseln und Schalen mit Wasser an strategisch günstige Stellen.
»So kann ich, wo ich auch hinmuss, die Füße ins Nass tauchen«, erklärt sie. »Das tut bei dieser Demse gut, glaubt mir.«
Und mit gravitätischer Geste fügt sie hinzu:
»Ihr dürft eure Treterchen natürlich auch hineinlegen. Aber nicht zu wild herumplanschen!«
»Wenn du dich nicht so einpacken würdest in deinen Wust von Wäsche, dann würdest du nicht so schwitzen«, rät ihr Wilko.
Aber Margarete will auf Büstenhalter und Strumpfhosen unter Bluse und Rock nicht verzichten, denn erst diese Staffage macht sie, die ja eigentlich ein Mann ist, äußerlich zu einem weiblichen Wesen. Sie ignoriert Wilkos Hinweis und lenkt das Gesprächsthema hin zur Abendgestaltung.
»Die dritte Woche beginnt und es heißt wieder einmal Märchenzeit. Um uns vor zu viel Routine zu schützen, sollten wir den Rahmen aber abwechslungsreicher gestalten, finde ich.«
»Du langweilst dich, meine Gute?«, lächelt Giovanni. »Vielleicht solltest du das Protokollieren unserer Märchen übernehmen, wenn du unterfordert bist.«
Margarete schüttelt entrüstet den Kopf.
»Bei meiner Sauklaue tun wir damit niemandem einen Gefallen«, versichert sie. »Es wäre schade um eure Ideen und das gesamte Projekt. Nein, ich hatte anderes im Sinn.«
Da gerade nicht alle zugegen sind (Max fürchtet sich bei zu viel Sonne vor einem Sonnenbrand und Charlie hat sich mit Kopfweh hingelegt), wartet sie aufs Abendessen, ehe sie uns in ihre Gedanken einweiht.
»Es geht um Folgendes«, erklärt sie, während wir einen kühlenden Salat verputzen. »Giovanni hat vorletzte Woche Abend für Abend so hübsch die erzählten Märchen auf eine gemeinsame Moral heruntergebrochen und vergangene Woche bewiesen wir alle, dass wir das auch können. Daher schlage ich vor, das intellektuelle Level zu heben und unseren Gastgeber zu bitten, das übergeordnete Thema der Erzählungen vorzugeben, bevor wir die Märchenrunde starten. Was sagt ihr?«
Max ist nicht begeistert und erinnert uns alle daran, dass jeder sich gewöhnlich den ganzen Tag Gedanken macht, was er in der nächtlichen Erzählrunde beitragen will.
»Da ist es unnötiger Stress, wenn man unmittelbar vor Beginn der Runde erst erfährt, unter welchem Motto man seine Geschichte hätte konstruieren sollen.«
Giovanni pflichtet ihm bei. Wilko meldet sich und schlägt vor, dass man alternativ das Thema für die kommende Nacht immer am Ende der abgelaufenen Märchenrunde bekanntgeben könne.
»Damit kann ich mich schon eher anfreunden«, sagt Max. »Aber das würde bedeuten, dass wir erst morgen mit Margaretes neuem Level an Erzählanspruch starten können.«
»Vielleicht nicht«, entgegnet Giovanni. »Wenn ich mir für heute ein Motto überlege, das viel Interpretationsspielraum lässt, weil es weit gefasst ist, müssten wir heute schon die Idee in die Tat umsetzen können.«
Wir ahnen, dass er von Margaretes Vorschlag einfach sehr geschmeichelt ist und nicht noch einen Tag warten will, um sich mit seinen Vorgaben wichtig zu machen. Aber weil er unser aller Freund ist und ein lieber Kerl, selbst wenn er sich aufplustert, verzeihen wir ihm dieses Vorpreschen und bitten ihn, seinen Vorschlag fürs nächtliche Thema preiszugeben.
»Denn du hast bestimmt schon was im Hinterkopf«, lächelt Charlie.
»Exakt«, nickt Giovanni, hebt bedeutsam den Finger und sagt nur ein Wort:
»Unersättlichkeiten!«
»Gutes Stichwort«, witzelt Basil und scheffelt sich noch etwas Salat auf den Teller.
»Den Begriff kann man wirklich vielfach deuten«, meint Wilko anerkennend. »Ja, zu meiner Geschichte, die ich heute erzählen will, könnte er passen.«
»Zu meiner auch«, sagt Arne eifrig.
»Damit ist es abgemacht«, ergreift Giovanni wieder das Wort. »Unsere Märchen werden heute alle unter dem Motto ›Unersättlichkeiten‹ stehen und wir wollen uns nach jedem Beitrag darüber austauschen, wie gut der Erzähler das Thema getroffen hat.«
Eine Stunde später, nachdem die Teller aufgewaschen und die Beete gegossen sind, treffen wir uns auf der Terrasse wieder und Basil bittet darum, das erste Märchen erzählen zu dürfen.
»Wilko deutete zwar vorhin an, er wüsste schon eine passende Geschichte«, sagt er, »aber meine brennt mir quasi unter den Nägeln und ich will sie los werden, bevor ich Einzelheiten vergesse.«
Wilko hat kein Problem damit, andere vorzulassen, und mit verschmitztem Gesichtsausdruck fängt Basil an.
Sechse fickeln durch die ganze Welt
Auf seinem Lustschloss saß einst ein sehr reicher König. Es war nicht verwunderlich, dass er reich war, denn er hatte so viele begabte Lustdiener bei sich, die seine Gäste wunderbar zu verwöhnen wussten, dass jene oft und öfter zu Besuch kamen und jedes Mal ihren Gastgeber mit Gold und Silber beschenkten. Auch hatte der König allerlei Liebesspielzeug angehäuft. Da gab es Luststäbe in allen Formen und Größen; weiche Kissen, in denen die Grafen und Herzöge ihre Fleischspeere einführen konnten; Fesseln, Seile, zarte Peitschen und Kostüme aller Art. Pülverchen und Tinkturen zur Steigerung der Manneskraft lagerten in den königlichen Gemächern und Statuen mit reizvollen Körpern sowie Gemälde mit üppigen Gestalten ließen das Auge eines jeden Gastes freudig lustwandeln. Doch um seine Gästen bei ihren Besuchen stets aufs Neue zu unterhalten, hieß der König am Ende eines jeden Lustgelages seine Minnediener gehen, um frischem Fleisch Platz zu machen, und statt eines guten Lohnes bekam jeder nur drei Heller Zehrgeld auf den Weg. Einer jener entlassenen Minnediener zog mit seinem stolzen Riemen zwischen den Schenkeln und den drei Hellern in der Tasche durch das Land und schimpfte über den König:
»Wart, mein Lieber, das lass ich mir nicht gefallen! Wenn ich die rechten Freunde finde, sollst du ein armer Mann werden, alle deine Schätze der Lust wirst du noch herausgeben! Für drei Heller soll ich den Grafen und Herzögen meinen Hintern geöffnet haben? Das bisschen Geld schmilzt doch dahin wie der Schnee in der Frühlingssonne! Nein, das beleidigt meine Ehre! Ich werde euch noch zeigen, wer hier der Meister der Lust ist!«
Sprach’s und lief voller Zorn in den Sommerwald. Darin sah er einen kräftigen Burschen stehen, der hatte sich gerade ins weiche Moos gelegt und seine Beinkleider geöffnet, aus denen ein unglaublich dicker Knüttel herauslugte und den er genüsslich wichste. Der Knüttel wurde immer größer und der Minnediener staunte nicht schlecht, denn keiner der Grafen und Herzöge hatte um die Lenden ein solches Ausmaß vorweisen können. Er blieb stehen und sagte:
»Oho, dem sag ich gut gewichst! Was vergnügst du dich hier ganz allein? Lass mich neben dich, dann wollen wir uns gegenseitig wichsen, bis wir schnaufen und schwitzen.«
Da sagte der Dickknüttel:
»Gesellschaft habe ich gern. Wenn dich mein Knüttel nicht fürchten lässt, so packe ihn nur mit beiden Händen und reibe ihn recht ordentlich, je härter, desto besser.«
Der ehemalige Minnediener ließ sich das nicht zweimal sagen und legte ordentlich Hand an. Das Fleisch des Burschen war fest und kräftig und der Minnediener hatte gut zu tun, mit seinem Schlund allein die mächtige Spitze zu befeuchten. Der Knüttel war so dick, dass einzig schon die blauen Äderchen die Breite eines Daumens hatten. Sie wichsten, schnauften und schwitzten gemeinsam, dass es nur so eine Freude war, und endlich entluden sie sich in hohen Fontänen.
Als sie sich erschöpft nebeneinander legten, bemerkte der Minnediener, dass der Knüttel des Burschen kaum kleiner wurde. Im Gegenteil, er schien so groß zu bleiben, dass man beinahe darauf stehen konnte. Das hätte dem Dickknüttel auch nichts ausgemacht, denn er war so stark und zäh, dass er nach getanem Wichs sogar noch Holz darauf stapeln konnte, um es zu seiner Mutter zu bringen.
»Einen starken Knüttel wie den deinigen sieht man nicht alle Tage«, lobte der Minnediener den Burschen. »Möchtest du nicht mit mir gehen? Ich will hinaus, unser Land der lila Liebeslust erkunden und um Wege zu finden, wie ich dem König die Schmach heimzahlen kann.«
»Mir ist es gleich«, meinte der Dickknüttel, »nur muss ich zuerst der Mutter den Stapel Holz bringen, damit sie Feuer unter dem Brei machen kann und nicht friert, wenn der erste Schnee fällt.«
Er schlug seinen mächtigen Knüttel noch gegen eine kleine Buche, die sogleich umfiel, und legte sie auf den Stapel obenauf, der ihm nun von den Lenden bis zur Brust reichte. So ging er mit dem Minnediener zusammen zur Mutter.
»Hier, Mutter, hast du das Holz«, sagte der Bursche, »ich will jetzt gehen und mich in der Welt probieren.«
Die Mutter sagte, er solle, sobald er etwas verdient habe, zurückkehren und für sie sorgen.
»Und vielleicht findest du ja eine Möglichkeit, deinen Knüttel auch mal für länger zu erleichtern. Es ist hart, für einen Sohn für dich stets neue Beinkleider zu nähen.«
Nun ließ sie ihn ziehen und gab ihm ihre besten Wünsche mit. Nicht lange, und sie kamen an einen Obsthain. Wie sie unter den Bäumen spazierten, fiel dem Dickknüttel plötzlich ein Apfel auf dem Kopf.
»Das nenne ich Bedienung«, brummte er und biss hinein.
Der Minnediener wollte etwas erwidern, da fiel auch ihm ein Apfel auf den Kopf.
»Nanu, es ist doch noch gar nicht Erntezeit«, sagte er verwundert und besah sich das Obst.
Er stellte fest, dass am Stiel klebriger, weißer Saft haftete, und kostete davon.
»Der Apfelstiel schmeckt nach dem Lendensaft eines Mannes, wie ich ihn schon oft im Königsschloss geschmeckt habe«, rief er da aus.
Kurz darauf trat aus dem Gesträuch ein kecker Halbstarker in bunter Uniform heraus. Zwischen seinen Beinen war ein Loch, aus dem sein kleiner, aber ansprechender Riemen herauslugte.
»Habt ihr meine Äpfel aufgesammelt? Ich traf sie von Weitem mit einem gezielten Spritzer und sie fielen vom Baume!«
Die zwei anderen Gesellen zweifelten an diesen Worten, doch der kleine Schütze bestand darauf:
»Ich bin ein Zielspritzer und kann mit meinem Ding schießen!«
Der Dickknüttel und der Minnediener verstanden nicht.
»Du musst es uns zeigen«, sagten sie.
Der Schütze griff zum Loch seines Rockes, packte seine kleine, lüsterne Zündschnur und zielte. Die anderen beiden meinten, dieser Kamerad wolle nur in die Luft spritzen, denn sie konnten beim besten Willen kein Ziel sehen. Der Schütze rieb seine glänzende Zündschnur immer schneller, der Saft schleuderte heraus und zischte an dem Dickknüttel vorbei in die Weite. Dann steckte der Schütze seine Zündschnur wieder ein und sagte selber:
»Gut getroffen. Seht ihr, dort über zehn Dörfer auf dem fünften Hügel steht ein Eichbaum, darunter fummelt gerade ein Lausebengel an sich herum. Dem habe ich in das linke Auge meinen Saft geschossen.«
Der dickknüttlige Bursche sah nichts, denn es war viel zu weit, und genauso ging es dem Minnediener. Darum wanderten sie hin, um nachzusehen, und fanden unter dem Eichbaum einen Lausebengel, der sich gerade sein linkes Auge auswusch. Als der die lachenden Gesellen sah, lief er schamhaft davon. Und weil die drei über die Zeit friedlich zusammen gewandert waren, sagte der Minnediener:
»Wir wollen alle Freunde sein.«
»Gut«, sagte der Dickknüttel, »das gefällt mir. Ich kann mit meinem kräftigen Knüttel ganze Bäume umhauen.«
»Und ich kann mit meiner Zündschnur jedes Ziel treffen, was man mir nennt«, fügte der Schütze hinzu.
»Und ich«, schloss der Minnediener sinnend, »will sehen, wie unsere Fähigkeiten uns zu reichen Männern machen.«
Darauf gaben sie einander die Hand und gingen weiter. Bald begegneten sie einem Mann mit einem Holzstück zwischen den Schenkeln. Dem war es allein zu langweilig, und darum wollte er mit ihnen ziehen. Die drei Gesellen mochten ihn zuerst nicht mitnehmen, weil er ihnen mit einem Holzpimmel keinen Jubel entlocken konnte. Als sie aber den Mann laufen sahen, merkten sie, dass er unter dem Holzstück seinen echten Riemen verbarg. Der war aber an das rechte Bein gebunden und durfte nicht benutzt werden. Auf ihre Frage, was das zu bedeuten hatte, erklärte ihnen der Mann, dass seine Manneskraft so übermäßig war, dass seine Lenden ein Eigenleben führten.
»Binde ich den Riemen los, so zieht er meinen Leib zu jedem fickelbereiten Schlitz in der Umgebung und rammelt alles hemmungslos bis zur Erschöpfung. Deshalb verstieß man mich aus meinem Dorf; der Pfarrer bangte um all die Jungfrauen der Gemeinde. Um aber nicht gänzlich von allen geächtet zu werden und halbwegs moralisch zu bleiben, fessle ich meine Manneskraft ans Bein und trage das Holzstück als Schutz.«
»Ein hurtig Fickelnder, ein hemmungslos Lüsterner«, murmelte der Minnediener. »Das passt zu meinen Gesellen, dem Dickknüttel, dem Schützen und auch zu mir.«
Nun nahmen sie den neuen Freund gern mit. Als sie Hunger verspürten und der Schütze etwas zum Essen schießen wollte, sagte der Holzpimmel:
»Lass das, Zielspritzer, ich trage uns Speis und Getränk zusammen. In der Nähe ist eine kleine Stadt, deren Wirte und Köchinnen sich über eine ausgiebige Fickelpause freuen werden.«
Und weil ihr Hunger groß war, band er seine Manneskraft los und die zog seinen Leib unverzüglich zur Stadt hin, sodass er in der Ferne verschwand, um alsbald mit einem gebratenen Hirsch, Sauerkraut und süßen Äpfeln zurückzukehren. Diesen brieten sie am Feuer; ebenso drei Wildgänse, die der Zielspritzer im Vorbeifliegen mit einem ordentlichen Spritztreffer abgeschossen hatte. Sie speisten reichlich und es konnte sich keiner beklagen.
»Der Koch des ersten Wirtshauses war sehr beglückt ob meines Besuchs«, erzählte der Holzpimmel, »denn während er am Kessel stand, bohrte ich so tief in seinen hinteren Schlitz, dass er jubelnd seine weiße Soße in den Eintopf feuerte und mir dankbar den Hirsch versprach. Im zweiten Gasthof waren die Mägde derart verzückt, ihre heiße Mitte versorgt zu bekommen, dass sie mir mit liebevollen Blicken das frischeste Kraut reichten. In der dritten Kneipe aber entjungferte ich den süßen, runden Hintern des jungen Schankwirts, den diese Erfahrung so begeisterte, dass er mir seine Äpfel schenkte.«
Der Holzpimmel prahlte, ohne rot zu werden.
»Ihr müsst wissen, fickele ich auch kurz, so rammle ich doch so flink, dass beinahe jeder binnen kurzer Zeit ein herrliches Hochgefühl in seinem Leibe spürt.«
Gesättigt und von den Geschichten des Holzpimmels gut unterhalten, legten sich die vier zur Nachtruhe hin. Doch der Minnediener war es nicht gewohnt, ohne leiblichen Beistand schlafen zu gehen, und so fummelte er an sich herum. Der Holzpimmel sah dies, wurde wieder lüstern und bat, seine Manneskraft losbinden zu dürfen. Da sagte der Minnediener:
»Schon viele Herzöge und Grafen fühlte ich in mir, doch noch keinen, der von sich behauptete, mich in kürzester Zeit zum Lustgipfel zu führen. Gern will ich nachspüren, ob deine Worte der Wahrheit entsprechen.«
So zog er seinen Rock herunter und präsentierte seinen prallen Hintern. Der Holzpimmel grinste und löste seine immersteife Manneskraft vom Schenkel, sprang an den Minnediener und rammelte ordentlich zu, sodass der andere stöhnte und der ganze Wald widerhallte. Der Bursche mit dem dicken Knüttel sah den beiden zu und wichste sich was dabei. Doch wuchs in ihm die Neugier und ein bisschen auch der Neid, denn taten seine zwei Freunde da etwas, das er noch nie selbst erlebt hatte. Der Schütze bemerkte den sehnsüchtigen Blick in den Augen des Dickknüttligen und sprach:
»Ich glaube, Freund Holzpimmel, du darfst später auch unseren jungen Burschen hier beglücken. Doch will ich dessen jungfräulichen Schlitz erst mit meiner kundigen Zunge befeuchten und mit zärtlichen Fingern erkunden, damit deine immersteife Manneskraft ihn nicht abschreckt.«
So rammelte der Holzpimmel weiter den japsenden Minnediener und schaute dabei ungeduldig zu, wie der Schütze seine feuchte Zunge um den nackten Kranz des Dickknüttels fahren ließ. Der seufzte lustvoll, als der erste Finger in seinen Schlitz hineinglitt, und noch lustvoller, als der zweite und dritte Finger folgten. Als der Minnediener tatsächlich binnen kurzer Zeit zweimal ein strahlendes Hochgefühl erlebt hatte und völlig erschöpft war, sagte der Schütze zufrieden:
»Jetzt ist dieser Liebesschlitz gut für seinen ersten ausgewachsenen Besuch vorbereitet. Freund Holzpimmel, du darfst loslegen.«
Das ließ sich der lüsterne Bock nicht zweimal sagen, sprang an den Dickknüttel und führte flink seine Manneskraft ein. Er rammelte erneut mit einer Leidenschaft, welche den Minnediener staunen ließ, dem Dickknüttel aber ganz neue Gefühle der Glückseligkeit bescherte. Noch die halbe Nacht vergnügten sich die vier Gesellen miteinander, denn jeder schürte das Feuer in den Lenden des anderen stets von Neuem an.
Am nächsten Morgen gingen sie zufrieden weiter und näherten sich sieben Wassermühlen. Es war ein heißer, trockener Sommertag, das Land umher war wüst, kein Lüftchen wehte und kein Blättlein rührte sich. Alles schien vertrocknet und verdorrt, und dennoch drehten sich die Mühlenflügel recht hastig. Bei der ersten Mühle angelangt, gerieten die vier Freunde in einen Schlamm, der fortan um ihre Beine spülte und der es auch war, der die Wassermühlen antrieb. Um das Merkwürdige zu ergründen, liefen sie stromaufwärts und kämpften sich voran, dorthin, wo der seltsame Schlamm herkam; der Dickknüttel ging mit gesenktem Kopf voraus, die andern in seinem Schutze hinterher. Nach Stunden sollten sie erfahren, aus welchem Loch das Flüssige rann: nämlich aus den Lenden eines dicken Mannes, der da an der Hecke saß.
»Ei!«, rief der Minnediener. »Bisher dachte ich, die Obstbäume unseres Königs trügen die größten Pflaumen des ganzen lila Landes! Nun sehe ich aber, wie du ebenfalls zwei Stück solch prächtiger Früchte dein Eigen nennst.«
Das stimmte: Was dem dicken Fremden hinter dem Riemen wuchs, waren wahrhaftig zwei mächtige Zwetschgen. Die rechte hatte er abgebunden, drückte auf der linken herum und ließ auf diese Weise unentwegt Saft aus seinem Schlauche fließen. Der war weiß wie Schnee, mischte sich mit der Erde und floss als Schlamm den Wassermühlen zu.
»Freundchen, du gefällst mir«, rief der Minnediener. »Du sitzest gemütlich und verdienst dir wohl eine Menge Geld mit Saftpressen, wenn du die Mühlen selbst im trockensten Sommer antreibst.«
»Du irrst«, antwortete der Mann, der da seinen Zwetschgensaft fließen ließ, »es ist ein armseliges Geschäft, das ich hier treibe.«
Der Dickknüttel meinte, er solle doch die rechte Pflaume losbinden und aus beiden pressen, wenn er so nicht genug verdiene. Der Saftpresser aber antwortete:
»Das darf ich nicht, sonst fließen die Mühlen weg; schier unerschöpflich ist nämlich das, was meine Zwetschgen mir durch den Schlauch pumpen. Das könnte der König mir übel nehmen und mich entlassen. Ich möchte wohl zufrieden sein, wenn mir der König etwas mehr zahlen wollte!«
»Deine Saftladung ist so stark, dass sie ganze Wassermühlen forttragen könnte?«
Der Minnediener lächelte und sagte, das treffe sich gut, da sie auf dem Weg zum König seien, um besseren Lohn zu fordern, und er solle mit ihnen kommen. Dem Neuen gefiel das, und weil man zu fünft besser geht als allein, so ließ er die Mühlen stehen und lief mit. Er band beide Zwetschgen ab, sodass kein Saft mehr aus seinem Schlauch floss, sondern nur noch bescheiden tropfte. Sie gingen vergnügt miteinander des Weges, und wenn einem der anderen Gesellen hungerte oder dürstete, durfte er die Tropfen vom Saftpresser lecken, bis er sich gesättigt fühlte. Jener Zwetschgensaft schmeckte recht gesund und zugleich sauer und süß, sodass die anderen oft und gern davon kosteten. Der Saftpresser selbst ließ das freilich mit Entzücken über sich ergehen.
Auf dem Weg zur Stadt trafen sie einen baumlangen Kerl, der seine Beine eng beieinander hielt und deshalb nur mit kleinen, zierlichen Schritte dahertippelte. Der Minnediener sagte zu ihm:
»Keck, sehr keck läufst du daher. Warum tippelst du beinahe wie ein hohes Fräulein? Bist du so weibisch?«
»Ich bin gar nicht weibisch«, sagte der Lange, »ich darf’s nicht anders, denn in meinem Hintern steckt ein großer Korken, den ich mit den Backen presse, damit er nicht rausflutscht. Daher mein auffälliger Gang.«
»Aber wieso schiebst du dir einen Korken in den Darm?«, lachte da der Holzpimmel.
Der Lange erklärte ernst:
»Mein Schlitz ist ein großes, gieriges Ding, das lüstern alles riemenförmige aufsaugen will, um sich damit zu fickeln. Es ist eine riesige Höhle, glaubt mir, und vielerlei Dinge presse ich mir rein, um Frieden zu finden. Da ich aber nicht ständig fickeln kann – denn ein Mann muss ja auch essen, trinken und schlafen – stecke ich mir den Korken rein, damit meine Höhle nicht juckt und mich ablenkt.«
Der Holzpimmel konnte das Dilemma des Langen nachvollziehen, und auch die anderen fanden Gefallen an dem Kerl. Sie meinten, wenn alle fünfe die Lust packte, könnten sie sich bei dem Langen wohl gut austoben, und der würde dabei sogar seinen Spaß haben. Sie fragten ihn, ob er mit zum König kommen wolle, und weil dieser den König noch nie gesehen hatte, ihn aber gern einmal sehen wollte, zog er als Sechster mit.
Am Abend hielten es die anderen vor Neugierde nicht mehr aus und baten den Langen, seinen Korken zu lösen. Der tat es und sofort juckte ihn die rot leuchtende Höhle so sehr, dass er einen großen Stein vom Wegesrand nahm, um sich damit zu fickeln. Dann nahm er einen dicken Ast und bohrte ihn zusätzlich rein.
»Merkt ihr nun, wie gierig mein Schlitz ist? Ich brauche unbedingt etwas, das mich ausfüllt!«
Das ließen sich die anderen nicht zweimal sagen. Sie steckten ihre Fäuste in die weite Höhle des Langen und walkten sein Gedärm damit, dass er rundheraus jubelte. Daraufhin setzte der Dickknüttlige an und fickelte den Langen ordentlich durch, bis der zufrieden schnurrte.
»Der Riesenknüttel unseres jungen Burschen und die weite Höhle unseres neuen Freundes passen ideal zusammen«, meinte der Minnediener. »Da haben sich zwei gefunden!«
Als sie am Tage darauf vor die Stadt des Königs und zum Tor kamen, verweigerte ihnen der Wächter den Durchgang; er habe strengen Befehl, niemanden ohne des Königs Erlaubnis hineinzulassen. Nun hätten sie aber hineingemusst, um die Erlaubnis vom König zu erbitten, hinein durften sie aber nicht, weil sie diese nicht hatten. Das war dumm und fast hätten sie draußen bleiben müssen. Da zog der Minnediener den Torwächter beiseite und sprach:
»Sieh dir uns Gesellen an. Ich bin ein ehemaliger Lustdiener des Königs und kann deine Lenden verwöhnen. Wenn du dicken, klebrigen Pflaumensaft liebst, so lass dir von dem Saftpresser mit den abgebundenen Zwetschgen eine frische Schlauchdusche geben. Der Lange wünscht sich nichts sehnlicher, als einen ordentlichen Riemen in seiner Höhle zu spüren. Willst du selbst dergleichen erleben, so lass dich erst von dem Holzpimmel beglücken und hernach von dem strammen Knüttel unseres Waldburschen hier. Liebst du hingegen das Wichsen, lass unseren Zielspritzer mit seinen flinken und geschickten Händen dir was Gutes tun. Was sagst du dazu?«
Der Torwächter, der schon viele Geschichten aus dem Lustschloss gehört hatte und immer etwas neidisch war, dass er an den Gelagen der Grafen und Herzöge nicht teilnehmen durfte, wurde bei den Worten spitz wie kein anderer. Er enthüllte seine Lenden, welche der Minnediener sofort mit dem Schlund verwöhnte, kostete den Vorsaft des Saftpressers, fingerte an der Höhle des Langen herum und schließlich ließ er den Holzpimmel und den Dickknüttel an sich heran, während der Schütze seine Zündschnur am Leib des Torwächters rieb. Weil jenen das Gelage gleich mehrfach beglückte und seine Augen zum Glänzen brachte, war er hernach derart zufrieden, dass er die sechs Gesellen mit guten Wünschen in die Stadt ziehen ließ.
Der König derweilen grämte sich schon lange, dass seine Tochter noch nicht verheiratet war. Aber die Prinzessin hatte die Angewohnheit, sich eine Zinnlatte als künstlichen Riemen umzuschnallen, und wollte nur einen zum Manne haben, der sich von einer Frau gern den hinteren Schlitz erobern lassen wollte. Dabei musste der Freier ihr aber beim Wettfickeln gleichkommen. Nun wäre das weiter nicht schlimm gewesen, hätte sie nicht die Bedingung daran geknüpft, dass jeder, der von ihr besiegt würde, einen Keuschheitsgürtel angelegt bekommen müsse. Viele junge Männer, darunter auch einige schöne fremde Prinzen, waren auf die Art um ihr Liebesleben gekommen, und die eingebildete Prinzessin hatte noch nicht genug.
Die sechs Gesellen meldeten sich beim König und ließen ihn wissen, dass sie einen unter sich hätten, der den Wettkampf mit der Prinzessin wagen wollte. Die Gescheiten und die weniger Gescheiten am Hofe rätselten, welcher von den Sechsen es wohl probieren werde. Die einen meinten der Lange, der anderen glaubten der Starke, die nächsten setzten auf den ehemaligen Minnediener oder den Schützen, und die Übrigen gar auf den dicken Saftpresser. Nur an den Holzpimmel dachte keiner.
Am nächsten Morgen sollte der Wettkampf stattfinden. Auf dem Platze vor der Stadt, wo jene Wettbewerbe zur Belustigung der Gäste stets ausgetragen wurden, versammelte sich eine Menge Volk. Als der Holzpimmel vortrat, bedauerten ihn die einen, verspotteten ihn die andern, und die Prinzessin, ihre große künstliche Zinnlatte umgeschnallt, zog ein verächtliches Gesicht und wollte gar nicht erst beginnen. Aber gesagt ist gesagt, und sie musste antreten. Es wurden folgende Wettkampfregeln bestimmt: Wer zuerst eine Reihe von zwanzig fickelbereiten Hintern (hierzu hatte man bereitwillige Gäste angeworben, die sich am Wegesrand in zwei Reihen aufgestellt hatten) so gerammelt hatte, dass aus den zugehörigen Riemen die Spritzer flogen, solle gewonnen haben. Dazu müsse man die Schlitze aber sowohl auf dem Weg fort vom Stadttor rammeln als auch auf dem Rückweg; jeder blanke Hintern musste also zweimal zum höchsten der Gefühle getrieben werden. Man gab dem Holzpimmel ein Krüglein in die Hand und der Prinzessin auch eines, die sie unterwegs mit dem Saft der Beglückten zu füllen hatten. Dann zählte man: »Eins, zwei, drei und los!« und die beiden Riemen, der eine echt, der andere künstlich, begannen zu fickeln.
In weniger Zeit als man braucht, um sich dreimal auf der Ferse herumzudrehen, war vom Holzpimmel nur noch ein lautes Hecheln zu vernehmen. Begleitet wurden seine Ausrufe von dem verwunderten, doch nicht minder lustvollen Gestöhne der ihm zugeteilten Männer, denn bereits drei hatte er ordentlich zum Lustgipfel gefickelt und deren Saft in seinem Krug gesammelt, während die Prinzessin erst einen Schlitz hinter sich gebracht hatte.
Bald war der flinke Geselle beim Letzten angelangt, füllte sein Krüglein mit den Spritzern und kehrte wieder um. Die Menge jubelte und staunte, denn so etwas hatten sie dem Holzpimmel nicht zugetraut. Sie wussten ja auch nicht, was es mit seinem Holzstück auf sich hatte und dass er nun seine echte Manneskraft vom Schenkel gebunden hatte. Die Prinzessin war noch nicht auf der Mitte der ersten Strecke, als sie schon den Holzpimmel auf dem Rückweg herankommen sah. Schnell zeigte sie auf einen Birnbaum und rief:
»Sieh dort die herrlichen Früchte! Jetzt, wo du mehr Zeit hast als ich, solltest du dich nach deiner flinken Fickelei stärken!«
Der Holzpimmel ließ sich das nicht zweimal sagen, zumal er ja viel mehr Zeit hatte als die Prinzessin, und frische Birnen liebte er über alles. Die Prinzessin hatte den Weg der Hintern längst wieder aufgenommen, als der Holzpimmel immer noch Birnen aß. Das schnelle Fickeln konnte ihn nicht ermüden, aber das Birnenessen strengte ihn an, und er legte sich, faul geworden, in den kühlen Schatten des Baumes, um ein ganz klein wenig auszuruhen, denn immer noch hatte er viel Zeit übrig. Prompt fing er an zu schnarchen und sein Schlaf war breit und tief.
Unterdessen war die Prinzessin auch beim Letzten ihrer Reihe angelangt, füllte das Krüglein und kam auf dem Rückweg nach langer Zeit wieder beim Birnbaum vorbei. Ihre Schadenfreude war groß, als sie den Holzpimmel schlafen sah. Sie leerte sein Krüglein aus und fickelte weiter der Stadt zu. Die fünf Gesellen, die mit den vielen Leuten vor der Stadt warteten, sahen mit Schrecken die Prinzessin dem Ziel zustreben, jedoch von ihrem Freund war nichts zu sehen. Da stieg der Zielspritzer dem Langen auf die Schultern, um Ausblick zu nehmen, und bemerkte mit seinen scharfen Augen den schnarchenden Holzpimmel unter dem Birnbaum. Schnell packte er seine Zündschnur aus, wichste sie bis zum Höhepunkt und schoss so geschickt seinen Saft auf den Stiel einer saftigen Birne, dass jener entzwei brach, die Frucht herunterfiel und auf der Nase des Schläfers zerplatzte. Der erschrak heftig, wischte sich das Birnenmus aus dem Gesicht, sah die Prinzessin der Stadt zueilen und bemerkte sein leeres Krüglein.
Doch der wackere Geselle verlor den Mut nicht. Schnell besann er sich auf seine eigene Manneskraft und husch! stöhn! keuch! begann er nochmals, all die willigen Hintern durchzupflügen, schöpfte neuen Saft, kehrte um und husch! stöhn! keuch! pfiff er schon durchs Ziel; so kam er noch kurz vor der Prinzessin auf den Platz zurück und hatte gewonnen. Die Prinzessin wollte sich nicht geschlagen geben und sagte, der Holzpimmel hätte die Spritzer nicht; aber er hatte ein volles Krüglein. Die Prinzessin stampfte mit dem Fuß und ging zornigen Mutes heim. Einen solchen Possen hatte ihr noch niemand gespielt!
Den König kränkte es aber noch mehr als seine Tochter, dass sie ein gewöhnlicher Geselle mit einem Holzpimmel davontragen sollte. Sie berieten, wie sie ihn mitsamt seinen Freunden los würden. Da sprach er der Prinzessin beruhigend zu:
»Ich habe ein Mittel gefunden, lass dir nicht bang sein. Die liederlichen Kerle sollen nicht wieder heimkommen.«
Und er wandte sich zu ihnen:
»Ihr sollt euch nun zusammen lustig machen und euren Sieg feiern. Dafür überlasse ich dem fleißigen Fickeler meine königliche Dampfstube und er darf seine Freunde gern mit hineinnehmen.«
Er führte sie zu einer Kammer, die hatte einen Boden von Holz und die Türen und Wände waren auch von Holz und Fenster gab es keine. In der Stube stand ein Kessel voll heißem Wasser, welches die Luft neblig machte und eine angenehme Hitze ausstrahlte.
»Geht hinein, ob mit oder ohne Tücher um den Unterleib, und genießt das wohlige Schwitzen«, lächelte der König.
Die arglosen Gesellen machten sich ans Saunieren und nahmen sich – nicht aus Scham, sondern nur zum Scherz – klitzekleine Tücher mit, die kaum ihre Knüttel zu verbergen vermochten. Damit wollten sie einander in der Dampfstube reizen und necken. Wie sie aber darinnen waren, ließ der König den Koch kommen und befahl ihm, unter der Stube so lange ein Feuer zu machen, bis die Liederlinge vor Glut sterben würden. Das tat der Koch auch, und es ward den sechsen in der Stube ganz warm und sie meinten, das käme vom Saunieren. Als aber die Hitze immer größer ward und sie hinaus wollten, die Tür aber verschlossen fanden, da merkten sie, dass der König Böses im Sinne gehabt hatte und sie ersticken wollte.
»Es soll ihm aber nicht gelingen«, sprach der Minnediener. »Dickknüttel, du sollst mit deinem Ding den Holzboden zerschmettern, worunter das Feuer brutzelt. Saftpresser, du dagegen löse deine linke Zwetschge, auf dass ihr Saft die Flammen löscht!«
Gesagt, getan. Der Dickknüttel brachte die Holzlatten zum Bersten und alsbald spritzte der Saftpresser einen feuchten Schwall in das tiefe Loch, vor dem sich das Feuer schämen und verkriechen musste.
Als nun ein paar Stunden herum waren und der König glaubte, sie wären in der Hitze verschmachtet, ließ er die Türe öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. Aber wie die Türe aufging, standen sie alle sechse da, lachten und begrabbelten einander lüstern und sagten, es wäre ihnen lieb, dass sie heraus könnten, um sich zu wärmen, denn bei der großen Kälte in der Stube frören die Zungen an den Knütteln fest. Da ging der König voll Zorn hinab zu dem Koch, schalt ihn und fragte, warum er nicht getan hätte, was ihm wäre befohlen worden. Der Koch aber antwortete:
»Es war Glut genug da, aber plötzlich fiel eine Unmenge weißer Sahne herab und löschte die Kohlen. Seht nur selbst!«
Da sah der König, dass ein gewaltiger Sahneschaum auf dem Kohleberg prangte, und merkte, dass er den Liederlingen auf diese Weise nichts anhaben konnte. Mit knirschenden Zähnen ließ er darum jedem der sechs ein Häuflein Lustspielzeug und je drei silberne Dukaten vorzählen. Dem Holzpimmel versprach er sogar zwei, wenn er auf die Heirat verzichte. Dieser sprach:
»So mag es denn meinetwegen mit der Freite sein Bewenden haben, wenn Ihr mir dafür eine Tonne von Dukaten und Lustspielzeug versprechen wollt.«
Dem geizigen König war das zu viel – da würde ja nichts mehr übrig bleiben und seine Gäste würden fortan nicht mehr aufs Lustschloss kommen! Sie feilschten, ohne ein Ende zu finden. Als es dem Minnediener lange genug erschien, fasste er einen Plan und sagte:
»Wir wollen nicht weiter markten! Wenn uns der König so viel Lustspielzeug und Dukaten geben will, als zwei Männer mit ihrem Riemen und ihrem Schlitz halten können, so wollen wir zufrieden sein. In drei Tagen werden wir unsern Teil holen.«
Der König war froh um die drei Tage Frist und willigte ein. Als die Gesellen unter sich waren, sagte der Minnediener:
»Jetzt gehen wir in die Stadt und kaufen bei den Händlern alles gestapelte Segeltuch. Der Holzpimmel holt unterdessen alle Gesellen aus der Schneidergasse, die sollen uns zwei Säcke nähen, so groß sie der Stoff nur hergeben will. Mit diesen Säcken sollen der Dickknüttel und der Lange mit dem gierigen Schlitz das Lösegeld holen.«
Also klopften am vierten Tag der Dickknüttel und der Lange bei des Königs Schatzmeister an, um den neuen Sack füllen zu lassen. Der meinte jedoch, dass der König den Befehl erlassen hatte, die Gesellen müssten selbst das Tor öffnen, wenn sie sich bereichern wollten. Sie hatten aber freilich keinen Schlüssel und der König hoffte, sie würden unverrichteter Dinge wieder abziehen. Doch weit gefehlt! Der Waldbursche setzte seinen riesigen, zähen Knüttel an das Schlüsselloch der Schatzkammer, presste ihn hinein, bis das Blech barst und sprengte so das Schloss. Der Schatzmeister war sogleich erschrocken beim Anblick von solch unheimlich starker Manneskraft.
Als das Tor zur Schatzkammer aufgeschlossen war, konnte man endlich die vielen Lustspielzeuge des Königs sehen. Der Schatzmeister spottete und meinte, wegen dem bisschen Zeug wäre ein solcher Sack nicht vonnöten gewesen, dürfe er doch nicht mehr mitnehmen, als er allein auf seinem Knüttel tragen könne. Der andere wäre zudem kaum in der Lage, in seinen Hintern etwas von Belang reinzutun. Der Dickknüttel gab zurück: »Besser zu groß als zu klein; ein Rand darf schon frei bleiben, damit man recht zubinden kann«, und hielt den leeren Sack auf. Nachdem der Schatzmeister aus einer Tonne bis zum Ellenbogen goldene und silberne Luststäbe herausgeschafft hatte, wischte er sich den Schweiß ab und sagte:
»Was meinst du, Bursche, getraust du dich wohl, den Sack noch vom Boden zu lupfen?«
Der Dickknüttel sagte: »Wer will sich schon rühmen, eh er’s versucht hat?« und leerte die Tonne in den Sack, die andern Fässer mit den Pülverchen, den Kostümen und all den anderen Lustspendern folgten hinten nach. Dem armen Schatzmeister fuhr der Schreck gewaltig in die Glieder, er konnte nicht einmal mehr »Halt!« oder »Genug!« rufen.
Als der Sack voll ward, zog der Lange seinen Korken aus dem Hintern und verlangte, dass sein Schlitz gut gestopft werde. Da die Schatzkammer aber bereits geleert war, musste der König nicht nur seine Minnediener opfern, die es sich in der Höhle bequem machten, sondern auch von allen reichen Leuten des Landes ihre Lustspielzeuge herbringen lassen. Siebenundsiebzig Wagen Liebespuppen und Fesselstricke wurden noch zusammengefahren, die schob der Dickknüttel allesamt in den gierigen Hintern des Langen und entließ nur die Fuhrleute. Zu guter Letzt nahmen sie auch noch der Prinzessin ihre künstliche Zinnlatte ab und ließen sie nackend stehen, ohne ihr liebstes Bettspielzeug. Alsdann band der Bursche seinen Sack zu, huckte ihn auf den Knüttel und ging mit seinem Freund fort, der die Backen zusammenkniff und mit all den Schätzen im Hintern hinterher tippelte. Sie trafen ihre Freunde und gingen mit ihnen fort. Auf dem Marktplatz hielten sie nochmals an, um die Schneidergesellen zu entlöhnen. Jeder bekam sein Handgeld und einen Minnediener dazu, damit er sich einmal ordentlich austoben könne.
Kaum hatten die Gesellen die Stadt im Rücken, als schon alle reichen Leute zum Schloss rannten, um zu lamentieren. Wie sollten sie jetzt der Lust frönen? Was sollte mit ihrem Liebesleben passieren? Der König wusste sich nicht anders zu helfen, als seine Tochter umzustimmen, sie musste in die Heirat einwilligen. Schluchzend sagte sie:
»Was kann ich tun? Der Holzpimmel will mich nicht mehr.«
»So nimm den Dickknüttel oder den Langen!«, schrie der König. »Die haben die Schätze!«
Eilig schickte der König den sechs Gesellen einen Versöhnungsboten nach. Der rief den Burschen zu:
»Freunde, liebe Brüder, der König bittet euch zurückzukommen, er will sich auf ewig mit euch vertragen, und seine Tochter ist bereit zu freien, sie will den Starken oder den Langen nehmen!«
Der Dickknüttel antwortete:
»Ich nehme keine Frau, ohne meine Mutter zu fragen. Eine Prinzessin würde ihr kaum passen. Ich mag den Langen selbst viel lieber!«
Dann gab er dem Langen einen Schmatzer und die beiden spazierten Hand in Hand weiter. Der Bote aber kehrte unerledigter Dinge zurück. Jetzt merkte der König, dass er seine tüchtigen Hauptmänner beordern und selbst mit seinem Heer die Gesellen verfolgen und zur Übergabe der Schätze zwingen musste. Rot vor Zorn zog er sich seine blaue Paradeuniform an und wollte in die Schlacht ziehen. Mit all seinen Regimentern nahm er die Verfolgung auf und holte die Gesellen endlich ein. Mit langgezogener Stimme rief er ihnen zu:
»Ihr seid gefangen! Bringt den Sack her und presst die anderen Schätze aus dem Hintern, oder wir hauen euch zusammen!«
Der Saftpresser drehte sich um und rief mit ebenfalls langgezogener Stimme:
»Haltet den Hut fest, damit er euch nicht abhandenkommt!«
Dann löste er seine Zwetschgen, und zwar beide, und ließ aus seinem Schlauch eine Ladung Saft hervorsprudeln, dass die Regimenter auseinanderstoben und weit verteilt übers Land gespült wurden. Die Leute ringsum wunderten sich nicht wenig, als sie überall Soldaten auf schneeweißem Schlamm herumschwimmen sahen, obwohl sie doch keine Fische waren und gar kein Winter herrschte.
Der Wachtmeister der Torwache rief um Gnade! Er sei ein braver Kerl, hätte ihnen nichts zuleide getan und möge ihnen die Lustschätze wohl gönnen.
»Daheim habe ich Frau und Kinder! Komme ich saftverschmiert zurück, wird die Alte schimpfen und die Kinder werden Angst haben, dass ich die Familie um eines anderen Mannes willen verlasse!«
Da erbarmte sich der Saftpresser, band die rechte Zwetschge ab und ließ mit der andern den Saft nach, sodass der Wachtmeister sanft auf trockenen Boden kam und ohne Schaden zu Weib und Kind heimkehrte. Als der König viel härter am Schlosshof angespült wurde und neben seiner Tochter zu sitzen kam, sagte er:
»Wir müssen die Kerle ziehen lassen, mit ihnen ist es unheimlich!«
Die sechs Gesellen aber zogen heim, machten Sack und Hintern auf, teilten die Schätze untereinander auf und lebten lang und vergnügt in einem neuen Dorf, das sie am Rande des Gebirges gründeten und welches viele Wanderer lüstern willkommen hieß. Und wenn sie nicht gestorben sind, so fickeln sie noch heute.
***
»Na, bei so einer wunderbar unzüchtigen, derben Story erübrigt sich die Diskussion, ob das Thema erfüllt worden ist«, lacht Charlie. »Die sechs Freunde waren ja jeder für sich auf ’ne Art unersättlich, dass es für alle folgenden Märchen des heutigen Abends gereicht hätte.«
»Und trotzdem will ich mit meinem Beitrag ebenfalls etwas zur Unersättlichkeit sagen, aber vielleicht auf eine ganz andere Weise«, sagt Wilko geheimnisvoll und wir wenden uns ihm zu, schweigend und lauschend.
Hundertfleck
Es hatte ein junger König einst einen Minister, der kümmerte sich gar sehr um dessen Wohlergehen. Er sorgte für täglich frischbezogene Betten, für eine prall gefüllte Vorratskammer und für beste Pferde in den Ställen. Er suchte mit Bedacht die mutigsten Soldaten und flinksten Boten aus und tat im Ganzen alles, um in den Augen seines Herren als unentbehrlich zu gelten. Aber so viel er auch glänzte und die freundliche Zuneigung des Königs genoss, sein eigentlicher Herzenswunsch blieb unerfüllt. Denn heimlich, ohne dass es jemand ahnte, war der Minister in den jungen König verliebt und hätte gern, ach so liebend gern den Bund der Ehe mit ihm geschlossen.
Was nützte es, in alten weisen Büchern nach Rezepten gegen Herzenskummer zu suchen? Was blieb von guten Ratschlägen, wenn sie ungehört verhallten? Der Minister wusste wohl, dass des Königs Lüsternheit sich ausschließlich nach dem weiblichen Geschlecht richtete. Und er wusste auch, dass ein unglücklich Liebender ausziehen und sich anderswo nach Glück und Wonne umschauen sollte. Aber über solche Aussichten rümpfte er nur die Nase:
»Soll ich etwa in billige Spelunken einkehren, wo Männer erst den Leib erfreuen, ehe sie sich wahren Gefühlen hingeben? Soll ich bei dem unflätigen Treiben der Schandlustigen mittun, die sich zuhauf in dunkle Kammern drängen, um fremdes Fleisch blindlings und wahllos zu spüren? Nein, mein Begehren ist von höherem Wert, und bleibt es unerfüllt, will ich es mit hoch erhobenem Haupt ertragen.«
Weil er demgemäß aus purer Hochmut jegliche Annäherung anderer Männer ablehnte, wurde sein liebendes Herz langsam, ohne dass er selbst es merkte, zu Stein. So ward es nicht verwunderlich, dass er eine gar teuflische Kabale erfand, als der junge König sich mit einer schönen Prinzessin verlobte.
»Ich will meinem Herren zeigen, wie schändlich diese Frau ist, damit er sie verjagt«, sagte er sich. »Auch wenn ich dafür lügen und betrügen muss! Der König soll mir ganz allein gehören und niemand darf seine Liebe gewinnen.«
Der Minister suchte Zuflucht in der Zauberei. Er schlich in eben jene Spelunke, die von eben jenen fleischeslustigen Männern gern besucht wurde, die er im Grunde so verachtete. Der Minister versteckte sich hinter den Abort und brauchte nicht lange zu warten, bis ein angetrunkener Soldat nebst einem strammen Stallknecht in die Ecke trat. Die beiden wollten einander feuchte Küsse und weitere Gaben weit feuchterer Natur spenden. Durch ein Astloch in der Wand beobachtete der Minister das wilde Treiben, und als die zwei Lüstlinge dem Höhepunkt entgegeneilten und etliche Tropfen weißer Männlichkeit in die Lüfte spritzten, holte er eine goldene Schale hervor und fing damit den herben Regen auf. Weil Soldat und Stallknecht in ihrem Rausch die Augen geschlossen hatten, merkten sie gar nichts von dem Diebstahl des Dritten.
»Zwei habe ich schon«, murmelte der Minister. »Noch achtundneunzig sollen folgen!«
Und er versteckte sich noch in vielen weiteren Spelunken, um die Samentropfen weiterer Männer in seiner goldenen Schale zu sammeln. Wenn er in einer Schankwirtschaft merkte, wie an einem Tisch die haarigen Hände eines Gastes heimlich unter der Platte zwischen die Schenkel des Nächstsitzenden griffen, kroch er unter die Platte, wartete seine Zeit ab und fing die Spritzer auf, die dort vom Hosenbund gen Boden fallen wollten.
Eilte ein Dienstbote im Schloss des Königs des Nachts zum Wasserlassen hinaus, saß dort schon der Minister im Unrat, duldete den warmen Strahl und griff dann, nachdem der Diener abgeschüttelt hatte, rechtzeitig nach dem Gliede, ehe es unterm Rock verstaut werden konnte.
»Ich bin ein gutes Nachtgespenst«, log er dann mit verstellter Stimme, »das dir Gutes tun will, um erlöst zu werden.«
Seine Hand rieb auf und ab und die Dienstboten ließen es willig geschehen, dass der vermeintliche Geist ihnen Tropfen um Tropfen abnahm, und empfanden reizvolle Lust dabei. Der Minister hingegen verspürte nichts als heimtückische Freude, wenn er die goldene Schale eins ums andere Mal füllen konnte. Wo andere sich den munteren Zungenspielen, Schoßgriffen und Reibesübungen freudig ange-schlossen hätten, verfolgte er stur seinen Plan.
Als endlich die Schale mit hunderterlei verschiedener Mannestropfen gefüllt war, kochte er das Ganze zu einem Sud, gab verschiedene magische Kräuter hinzu und reichte den Trank mit falscher Höflichkeit der Prinzessin.
»Trinkt dies, denn es wird Euch noch schöner machen und Euch Stärkung für die Hochzeit bringen«, sagte er.
Nachdem die Prinzessin den Sud hinuntergeschluckt hatte, zeigten sich plötzlich seltsame Beschwerden bei ihr. Sie konnte weder den Schatten noch die Sonne ertragen. Wenn sie sich im Sonnenschein befand, verlangte sie dringend, in den Schatten gebracht zu werden. Befand sie sich dorten, zitterte sie vor Kälte und wollte zurück in die Wärme.
»So pflegt es bei schwangeren Frauen zuzugehen«, sprach der Minister zum König.
Und wirklich zeigte sich nach ein paar Tagen ein runder Bauch unterm jungfräulichen Busen der Prinzessin. So sehr sie nun beteuerte, mit niemandem jemals das Bett geteilt zu haben, der bestürzte König konnte ihr keinen Glauben schenken.
»Ich kann keine Frau heiraten, die ein fremdes Kind unterm Herzen trägt«, sagte er. »Auch wenn es mich mit Gram und Traurigkeit erfüllt, muss ich unsere Verlobung lösen.«
»Ein solch hinterhältiges Frauenzimmer gehört bestraft«, keifte der Minister gehässig. »Gewiss hat sie Euch mit Stallknechten, Soldaten oder Dienstboten betrogen. Am Ende verführte sie mannsholde Jünglinge, um sie zu verkehren und sich dessen zu rühmen! Ja, sie verdient es, ins Reich der riemigen Rammelriesen verbannt zu werden.«
So weit wollte der junge König, der ein friedliches Gemüt besaß, jedoch nicht gehen.
»Sie soll in den Wald geführt werden, wo sie den Heimweg antreten kann«, befahl er. »Bei ihren Eltern kann sie den Bastard großziehen. Ich derweil werde die Hochzeit absagen und so bald kein anderes Weib anschauen können.«
Verletzt zog sich der junge König zurück, die Prinzessin aber wurde weggebracht. Nun hatte der Minister sein Ziel erreicht und freute sich, seinen Schützling wieder ganz allein umsorgen zu können.
Die Prinzessin ging aber nicht zu ihren Eltern zurück. Sie wusste, dass ihr Vater sie ebenso unbarmherzig verstoßen würde, erführe er von ihrem Zustand, und darum beschloss sie, im Walde zu bleiben. Sie setzte sich ins Gras und weinte, bis sich alle wilden Tiere um sie versammelt hatten und mit ihr weinten. Sie erzählte ihnen von ihren Erlebnissen und fragte jedes einzelne Tier, ob es wisse, wie sie in diese Lage gekommen sein konnte. Weder das Eichhörnchen noch der Hirsch, nicht einmal der schlaue Fuchs konnten sich ihre Schwangerschaft erklären. Einzig eine alte Eule ahnte, dass es an dem Zaubertrank gelegen haben mochte.
»Der Minister hat dir einen Sud eingeflößt, der deinen Leib unnatürlich anwachsen ließ«, sagte sie. »Wer weiß, was das noch für Folgen haben wird?«
Die wilden Tiere beschlossen, die Prinzessin in eine Höhle zu führen und selbige zu verschließen, damit keine Räuber kämen und sie umbringen konnten. Das Innere der Höhle wurde von den Finken und Meisen geschmückt, der Bär hingegen wälzte ein mächtiges Felsstück vor die Öffnung. Wolf und Fuchs versprachen, jeden Tag ein Stück ihrer Beute vor einen schmalen Ritz zu legen, und die Hasen brachten Tag für Tag frische Kräuter und wildes Gemüse dazu. Davon lebte die Prinzessin drei Monde, bis plötzlich ihr geschwollener Leib zu zucken begann. Es war, als müsse sie niesen, und kaum hatte sie sich geschnäuzt, entsprang ihrem Nabel – ganz ohne Riss und Schmerz – ein Kind. Über und über war es mit Muttermalen verschiedenster Farbe und Form übersät. Manche Flecke waren dunkel, manchen entsprossen Haare, andere wieder waren rötlich oder violett.
»Guten Tag, Mutter«, rief das Kind fröhlich, denn es war bereits alt genug, um zu sprechen und aufrecht zu stehen. »Ich bin dein Sohn!«
»Bist du mein Sohn, war ich wahrhaftig schwanger«, erkannte die Prinzessin. »Aber wer mag nur dein Vater sein?«
»Ich habe hundert Väter und doch keinen«, lachte das Kind und erzählte, durch welche Zauberei es zustande gekommen war. Jene Zauberei war es auch, die ihm das Wissen darüber eingegeben hatte.
»All die Male und Flecke stammen daher, dass so viele verschiedene Männer ihr Erbe in mein Blut gegeben haben. Vom Stallknecht stammt der Leberfleck unterm linken Auge, vom Soldaten das Muttermal an der Wange, die Sommersprossen auf dem Glied habe ich vom Dienstboten mit der schwachen Blase und die Haarbüschel auf dem Rücken von dem triebigen Griffelgast der Schankwirtschaft.«
So zählte er auf, von wem er jedes einzelne Mal geerbt hatte, das seinen Leib zierte, und die Prinzessin verstand nun, weshalb ihr Sohn derart bunt übersät war.
»Nun wollen wir aber zum König zurückkehren, um ihm alles zu verraten«, beschloss das Kind.
Seine Mutter aber schüttelte den Kopf.
»Du mit deinen vielen Leberflecken und Muttermalen wirst ihn nur ängstigen und am Ende bin ich es, die als Hexe verbrannt wird. Nein, Kind, lass uns hier im Walde bei den lieben Tieren bleiben und abgeschieden leben.«
Ihr Sohn erklärte sich einverstanden, bat sich aber aus, den Wald verlassen zu dürfen, sobald er alt genug dafür wäre.
»Du musst mir einen Namen geben«, verlangte er, »denn du kannst mich nicht ständig nur ›Kind‹ rufen.«
Die Prinzessin beschaute sich ihren Sprössling, streichelte seine bunte Haut und lachte dann:
»So will ich dich Hundertfleck nennen.«
Ihr Sohn war’s zufrieden. Weil er nun aber ein Zauberkind war, wuchs und gedieh er in einem Jahr wie andere Jungen in sieben, und so war bereits im dritten Frühling aus ihm ein stattlicher Mann geworden. Die Zeit seines Heranwachsens ließ Hundertfleck nicht untätig verstreichen. Weil er die Spuren seiner hundert Väter nicht nur auf seiner Haut trug, sondern auch in seinem Blute wallen fühlte, versuchte er Tag für Tag, den Felsen vor der Höhle ein Stückchen weiter zu rollen; Monat für Monat ihn ein Stückchen weiter in die Luft zu heben.
»Dermaleinst kann ich meine Kräfte mit dem Bären messen«, prahlte er und die Prinzessin, die ohnehin aus mütterlicher Liebe über seine Hässlichkeit hinwegsah, war sehr stolz auf ihn.
Nicht nur in den Muskeln der Arme und Beine spürte Hundertfleck das Erbe seiner Väter. Auch zwischen den Beinen brodelte es immer ärger und eine geheime Macht brachte ihn dazu, die wilden Tiere während des Lenzes zu verfolgen und deren Brunft ausgiebig zu beobachten.
»Schaukelt mein Beutel nicht viel anmutiger als das Gehänge des Auerochsen?«, fragte er sich. »Leuchtet die Kuppe meines Gliedes nicht auffälliger als jene des Wolfes und ist das Haar an meinem Rumpf nicht prächtiger gelockt als jenes des Bären? Ja, mein Leib ist ihnen an Männlichkeit mindestens ebenbürtig.«
Hundertfleck wandte seinen Blick daher von der tierischen Brunft ab, betrachtete sein Spiegelbild auf der Oberfläche eines Waldsees und erfreute sich an der Gestalt seines Gliedes, aller hässlichen Male und Flecken zum Trotz, so sehr, dass die Spritzer weißer Manneskraft gleich hundertfach aus ihm heraussprudelten.
»Welch ein kribbelnder Regen, der sich da aus mir entfacht«, staunte der Jüngling und japste erregt nach Luft. »Mir ist, als spürte ich die Lust all meiner Väter zugleich, die sie empfanden, als sie ihr Erbe auf die goldene Schale schleuderten!«
So erfreute sich Hundertfleck immer öfter an seinem eigenen Leib, wie es Jünglinge eben gern zu tun pflegen. Doch in allem vergaß er nicht, was er seiner Mutter schuldig war, und zum Glück war in den drei Jahren nicht nur sein Leib, sondern auch sein Verstand gereift. Er sagte sich:
»Soll meine Mutter mit ihrem Versprochenen glücklich werden, muss erst der Minister verschwinden. Nur wie kann ich ihn dazu bewegen, seinen Posten aufzugeben?«
Er sann hin und her. Schließlich erkannte er, dass er vom abgelegenen Wald aus nichts ausrichten konnte.
»Ich brauche eine Anstellung im Schloss, um aus der Nähe auszukundschaften, was möglich ist«, entschied er.
Hundertfleck nahm Abschied von seiner Mutter, die ihm unter Tränen alles Glück der Welt wünschte, und ließ sich von den wilden Tieren, die ihm gute Freunde geworden waren, aus dem Wald geleiten.
Da traf es sich, dass der König gerade die Straße entlangkam. Hundertfleck stellte sich in den Weg und rief:
»Haltet ein wenig! Wünschet Ihr keinen Knecht?«
Da sah der König aus dem Wagen heraus, und wie er den Jüngling mit den hunderterlei Malen im Gesicht und an den Gliedern erblickte, so entsetzte er sich.
»Nein, nein!«, rief er gleich und befahl weiterzufahren; aber Hundertfleck zog sein fleckiges Glied heraus, rieb es hart und spritzte eine gewaltige Fontäne herber Mannestropfen auf die Straße. Die Hufe der Pferde traten hinein und klebten sofort am Boden fest – der Wagen konnte nicht von der Stelle.
»Ihr seht, ich trage zwar die Mängel von hundert Vätern auf meiner Haut, aber ich trage auch die Kraft von hundert Männern zwischen meinen Schenkeln. So nehmt mich doch, ich werde Euch treue Dienste leisten! Was zaudert Ihr?«
»Ich fürchte mich vor dir«, gestand der König, »und meine Leute würden alle davonlaufen, wenn sie dich nur sähen!«
»So gebt mir eine Stellung, die mich am Tage vom Schloss fernhält und mich nur in den Stunden der Nacht und der Dämmerung in die Nähe kommen lässt.«
Der König sah, dass er anders nicht frei werden konnte, und versprach Hundertfleck eine Arbeit.
»Du wirst der Hirte meines alten Schäfers werden und die königliche Schafherde hüten«, entschied er.
»So ist’s mir recht!«, sprach Hundertfleck, half den Pferden aus den kleisternen Pfützen und marschierte mit dem König zum Schlosse hin.
Dort wurde ihm die Hütte des Schäfers gezeigt, der nicht minder vor dem Anblick des Neuankömmlings erschrak wie der König selber. Er wies Hundertfleck einen Schlafplatz im Keller, gab ihm auch Essen und Trinken, verschloss allerdings die Türe, weil er sich vor seiner Ungestalt fürchtete. Erst am nächsten Morgen kurz vor Sonnenaufgang ließ der Schäfer Hundertfleck wieder frei und sprach:
»Führe die Schafe auf die Weide diesseits des Tales. Hüte dich, sie auf die andere Seite zu bringen, mag das Gras dir dort auch noch so saftig erscheinen! Keiner meiner Knechte kam je von dort zurück, denn da liegt das Reich der riemigen Rammelriesen!«
Hundertfleck versprach, der Warnung Folge zu leisten, und zog mit den Schafen in das Tal. Wie er dort die Herde hütete und eingedenk der Worte des Schäfers darauf achtete, dass keines der Tiere die Grenze zum Reich der Rammelriesen überschritt, gedachte er der letzten Nacht. Wohl hatte sein neuer Herr geglaubt, er habe die ganze Zeit im Keller zugebracht, hinter dem dicken Riegel. Was aber war ein Riegel schon für einen Jüngling, in dem die Kraft von hundert Vätern schlummerte? Er war flugs ausgebüchst, hatte sich ins Schloss geschlichen und die Kammer des schlafenden Ministers gefunden.
»Dir also habe ich meinen grässlichen Zustand zu verdanken«, hatte er geflüstert.
Da war das Mondlicht durchs Fenster gefallen und hatte das Antlitz des Ministers beschienen. Hundertfleck hatte gestaunt, wie wohlgefällig sein ärgster Gegner aussah: Er sah in ein angenehmes, rundes Gesicht mit vollen Wangen, die von weinfarbener Haut geschmückt waren. Die geschlossenen Augen waren mit dichten Wimpern besäumt. Dem Jüngling war der Atem gestockt, als er den Minister betrachtet hatte, und als jener im Schlafe auch noch die Decke von sich streifte und seinen anbetungswürdigen Leib offenbarte, war es um Hundertfleck geschehen.
Nun stand er bei der Weide und grübelte, was tun? Wenn er den Minister fortschaffte, wäre zwar der Weg für seine Mutter in die Arme des jungen Königs frei – er selbst aber könnte nie wieder den schönen Mann im Mondschein betrachten.
»Das Beste wird sein, ich umgarne den Minister und gewinne sein Herz«, entschloss sich Hundertfleck.
Er setzte sich ins trockene Gras, nahm Feder und Papier und schrieb einen inbrünstigen Liebesbrief. Sein eigener Mannessaft diente ihm als Tinte.
»Werter Minister«, schrieb er, »vergesst eure Schwärmerei für den König und wendet euch einem kecken Hirtenknaben zu. Folgt mir auf die Weide, wo wir in freier Natur den Sonnenschein in den wollüstigsten Stellungen genießen können. Wie aus weiter Ferne wird das Gezwitscher der Vögel an unser Ohr dringen und sich in ein Liebeslied wandeln, während wir bar aller Kleider uns umreigen.«
Und er dichtete:
»Sei mir ein Lager, auf dem man kost,
das Gras wird uns zum weichen Minnebett.
Sei meiner Sehnsucht ein Trost.
Sei mir ein Bach, kühl meine Hitze!
Gib meinem Hirtenstab festen Halt.
Sei der Schaft für meine Lanzenspitze.«
»Gemäß dem Lied wollen wir uns verhalten und ich verspreche: verklärte Verzückung wird Euer Antlitz schmücken!«
Er setzte seinen Namen darunter und ließ den Brief noch am selben Abend, gleich nach seiner Rückkehr, dem Minister bringen. Anderntags lag ein Antwortschreiben vor der Tür des Schäfers, welches lautete:
»Nimmer will ich wie das gemeine Volk in der Wildnis irgendwelchen Neigungen nachgehen. Bleibe Er bei seinen Schafen und lasse mich in Ruh!«
Niedergeschlagen steckte Hundertfleck das Schreiben in seine Brusttasche und zog mit den Schafen ins Tal. Die Antwort traf sein Herz nicht so sehr wie seinen Stolz, drum fasste er sich bald und meinte:
»Einem einfachen Hirten ist er sich zu schade. Ein Held mag ihm dagegen gut genug sein! Ich will die Herde über die Grenze schaffen und sehen, ob ich mich nicht gegen die Rammelriesen behaupten kann!«
Gesagt, getan. Er führte die Schafe ins Reich jenseits des Tales, wo die Wiesen grüner, das Gras saftiger und das Wetter freundlicher war. Zunächst geschah nichts und Hundertfleck glaubte schon, dass des Schäfers Verbot nichts als eine Finte gewesen war. Kurz bevor die Sonne unterging, bogen sich zwei mächtige Fichten zur Seite, als ob es dünne Strohhalme wären, und ein Riese, hoch wie ein Kirchturm, trat ihm entgegen. Hundertfleck sah gleich, warum man ihn den riemigen Rammler nannte, denn alles, was an einem Mann gewöhnlich baumelte oder stand, war bei seinem Gegenüber von gewaltigem Ausmaß.
»Menschenkind, wie kommst du hierher?«, herrschte ihn der Riese an. »Kein Hirte wagt es sonst, meinen Wald mit seinen Schafen zu verunreinigen und mein Auge mit seiner mickrigen Männlichkeit zu beleidigen! Du musst dich mit mir schlagen oder ringen, was willst du lieber?«
»Weder das eine noch das andere«, entgegnete Hundertfleck keck. »Ich bin gekommen, mit dir zu wetten!«
»Um was willst du wetten?«, fragte der Riese.
»Darum, wer die meiste Männlichkeit aushält«, erwiderte Hundertfleck, »denn ich meine, die Größe des eigenen Gebaumels gibt keinen Aufschluss über die hinteren Fähigkeiten.«
Der Riese lachte, denn zum einen glaubte er sich schon als Sieger, zum anderen lüsterte es ihn nach riemigen Rammeleien – und da kam ihm so ein frecher Jüngling gerade recht.
»Ich habe hier meinen Wonnestab aus gutem Eichenholz«, sprach er und zeigte einen sieben Ellen langen Baumstamm vor, der zum Abbild eines harten Gliedes gehobelt und geschliffen war. »Du wirst sehen, Winzling, dass ich ihn hintenrum aufnehmen kann und es verstehe, ohne mich vorne zu berühren, einen Schwall weißer Tropfen zu entladen.«
Schon führte sich der Rammelriese das Holzglied ein, legte die Hände auf den Rücken und ritt in wilder Wonne darauf herum. Hundertfleck sah, wie sich das riemige Riesenfleisch aufbäumte, und versteckte sich noch rechtzeitig hinter einer Birke, ehe die warme Männlichkeit aus seinem Gegner herausspritzte, einem berstenden Staudamm gleich. In einer Kuhle bei den Birken sammelte sich der Guss und ward zu einem dickflüssigen Teich.
»Nun tue es mir nach«, befahl der Riese und setzte Hundertfleck auf die Spitze des Eichenstamms. »Schaffst du es nicht, musst du mir fortan hinten in meinem Loche dienen. Du wirst darin wohnen, es regelmäßig ausmisten und darin hin und her springen, um mich zu erquicken.«
Hundertfleck ließ sich davon nicht schrecken. Freilich wusste er, dass er viel zu klein war, um das Holzglied in seinen Leib aufzunehmen. Aber er besann sich auf die Kraft seiner hundert Väter, spannte seine Backen an und presste damit das Eichenholz so fest zusammen, dass es in Stücke zerbrach. »Knack!« und »Knirsch!« machte es da und plötzlich lagen statt eines sieben Ellen langen Baumstamms viele tausend handtellergroße Holzglieder herum.
»Was hast du gemacht«, jammerte der Riese. »Für mich, den riemigen Rammler, sind diese Spielzeuge viel zu klein, als dass ich hinten irgendeine Wonne verspüren würde! Da ziehe ich mich lieber in jenen Berg dort zurück und schlafe. Nicht eher will ich erwachen, bis es keine wackeren Männer wie dich mehr gibt, die mit ihrem Hintern Holz spalten können!«
»Dann musst du wohl tausend Jahre schlafen«, gab Hundertfleck zurück.
Der Riese seufzte:
»So leb denn wohl, Winzling, der mir zum Meister wurde. Weil du mir über bist, will ich dich zum Abschied noch warnen: Rühre den Guss meiner Männlichkeit nicht an, der sich dort in der Kuhle zum Teich staute, denn Riesentropfen sind für Menschen gefährlich!«
Hundertfleck dankte für den Rat. Während nun der Rammelriese, dem es gar nicht mehr riemig zumute war, traurig dem Berg zu stiefelte und schließlich darin verschwand, sammelte der Jüngling die vielen Holzglieder ein und lud sie auf seinen Rücken.