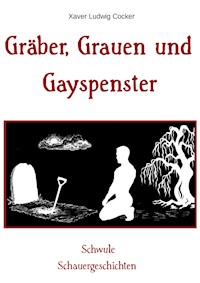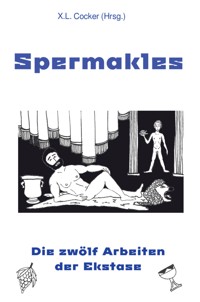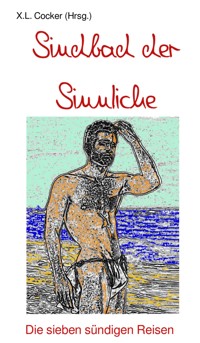8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Yeoj Selbstverlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Sieben Männer flüchten sich in ein abgeschiedenes Haus und beginnen, sich zum Zeitvertreib Märchen im schwulen Gewand zu erzählen. In vierzig heißen Sommernächten dreht sich alles darum, wie der tapfere Held das Herz des schönen Königssohns erobert, wie sich wollüstige Ritter mit ihren Knappen im Stroh raufen oder wie Jäger sich den verführerischen Zauberkünsten sinnlicher Hexenmeister hingeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Xaver Ludwig Cocker (Hrsg.)
Vierzig schwüle Nächte
Homoerotische Märchen aus dem Land der lila Liebeslust
Band IV (22.-28. Nacht)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Texte: © Copyright by X.L. Cocker
Umschlaggestaltung und Illustrationen: © Copyright by Yeoj
Verlag:
YEOJ Selbstverlag
J. Springstein
Marktlaubenstraße 9
35390 Gießen
Die zweiundzwanzigste Nacht
»Heute bricht die vierte Woche unseres Rückzugs an«, stellt Max fest, während er das Frühstücksgeschirr abwäscht.
Weil Arne und Charles eine Woche »küchendienstfrei« haben, übernimmt er freiwillig all ihre Schichten. Er meint, er habe schon immer gern gespült und abgetrocknet; auch damals, als er noch bei seiner Frau und den Töchtern wohnte. Ich erschrecke mich, weil ich seine Bisexualität ganz vergessen hatte.
»Du hast ja Kinder«, erinnere ich mich nun. »Ob sie dich vermissen?«
Max zuckt mit den Schultern. Da keiner von uns mehr Kontakt zur Außenwelt hat, kann auch niemand wissen, wie unsere Angehörigen – egal ob Kinder, Eltern, Cousins oder Tanten – zu unserem Verschwinden stehen.
»Sie werden froh sein«, vermutet Basil düster. »Schwule, bisexuelle oder queere Verwandte los zu sein, wird in diesen Zeiten vielen entgegenkommen. Es ist ein Gefallen, den wir ihnen tun, indem wir uns hier in Giovannis Haus verstecken und so tun, als gäbe es uns nicht.«
»Oder sie merken langsam, was sie an uns hatten«, widerspricht Margarete sanft. »Wir sollten Vertrauen haben, dass sich alles zum Guten wenden wird. Schließlich ist ›Vertrauen‹ auch das Motto unseres heutigen Märchenabends.«
Sie freut sich schon darauf, wenn wir zu siebt im Garten sitzen und uns gegenseitig Geschichten erzählen, die altbekannte Märchenmotive aufgreifen und homoerotisch umdeuten.
»Das Ritual lenkt so schön von der drückenden Hitze ab«, sagt sie.
Und von dem Gefühl, sich in Giovannis Waldhäuschen eingekerkert zu haben, würde ich am liebsten hinzufügen. Doch ich schweige.
Der Tag vergeht ohne weitere Vorkommnisse und gleicht im Grunde den meisten vorangegangenen. Abends sitzen wir auf der Terrasse und beginnen mit unseren Märchen. Margarete möchte anfangen, erinnert uns nochmals an das übergeordnete Motto und sagt:
»Mal sehen, ob mein Märchen eurer Meinung nach zum Stichwort ›Vertrauen‹ passt oder nicht!«
Der Rosshüter und die wilden Kater
Auf einem Gestüt lebte ein alter Pferdezüchter, der hatte weder Frau noch Kind. Drei junge Burschen dienten bei ihm als Rosshüter. Wie sie nun etliche Jahre bei ihm gelebt hatten, sagte der Züchter eines Tages zu ihnen:
»Ich bin alt und will mich hinter den Ofen setzen. Einer von euch soll mein Nachfolger werden und um ihn zu wählen, teile ich jedem zwölf meiner Pferde zu. Dagobert, du bist der älteste Bursche und sollst meine Schimmelstuten hüten. Heribert, du bist der mittlere Bursche und erhältst die fuchsroten Pferde. Engelbert, der Jüngste, wird die schwarzen Zuchtrosse aufpassen. Jeder von euch nimmt eine der grünen Koppeln. Wer nach drei Tagen kein Pferd verloren hat, dem will ich das Gestüt überschreiben und der darf mich dafür bis an meinen Tod verpflegen.«
Die Augen Dagoberts und Heriberts glänzten, denn die Pferdezucht war ein blühendes Geschäft im Lande der lila Liebeslust und versprach Geld und Ruhm. Nur Engelbert machte sich nichts daraus; vielmehr fürchtete er sich, ganz allein auf die ungestümen Rappen aufpassen zu müssen, noch dazu bei den grünen Koppeln.
»Dort sind die Weideflächen zwar besonders saftig, doch grenzen sie zum Süden hin an den düsteren Urwald, in den niemand sich hinein traut«, wusste er. »Reißt eines der Pferde aus und läuft dorthin, wer wird ihm folgen und es fangen?«
Dagobert und Heribert hielten seine Ängste für albern und der Auftrag dünkte ihnen eine Kleinigkeit. Anderntags zog ein jeder seiner Koppel zu und musste achtgeben, dass keines der Pferde abhandenkam. Engelbert hatte alle Mühe, die schwarzen Rosse davon abzuhalten, über die Koppelgrenze hinein in den Urwald zu springen. Als sie endlich friedlich grasten, kam geradewegs aus dem Dickicht eine fesche Jägerin daher und hatte an ihrer Leine keinen Hund, sondern einen struppigen Wildkater. Der junge Rosshüter fragte:
»Was machst du mit dem Wildkater?«
»Ich fand ihn im Wald«, sagte die Jägerin, »und will ihm sein Fell abziehen. Das schenke ich meiner Mutter, die arg an der Gicht leidet.«
Engelbert tat das wilde Tier leid und er bat:
»Schenk ihm das Leben! Du sollst dafür eins der schwarzen Zuchtrosse haben!«
Die Jägerin brauchte sich nicht lange zu bedenken, denn ein solcher Hengst konnte ihr auf dem Markt Geld genug für allerlei Gichtheilmittel beschaffen. Darum ging sie auf den Handel ein und nahm ein Ross mit, während Engelbert den wilden Kater von der Leine ließ und ihn in den Urwald zurückschickte.
»Dort in der Wildnis ist dein Zuhause«, rief er ihm nach. »Lauf und lass dich nicht noch einmal einfangen!«
Der Rest des ersten Tages verlief ohne weitere Ereignisse und bei Sonnenuntergang trafen sich die drei Hüter bei dem Lager, das sie zwischen den drei Koppeln aufgeschlagen hatten. Heribert schlief im Schein des Lagerfeuers schnell ein, die anderen beiden hingegen plauderten im Flüsterton über dies und das. Als Engelbert von der Begegnung mit der Jägerin zu reden begann, schüttelte Dagobert bestürzt den Kopf und sagte:
»Ein Dummkopf bist du! Unser alter Meister hätte dich schon genug gescholten, wäre dir eins seiner Rosse ausgerissen. Aber dass du es aus freien Stücken verschenkst, wird er dir nie verzeihen!«
»O weh«, erschrak Engelbert. »Dann darf er es nie erfahren!«
»Von meinen Lippen wird kein Sterbenswörtchen rinnen«, versprach Dagobert und setzte mit einem miesen Lächeln hinzu: »Wenn du dich von mir an des Meisters statt bestrafen lassen willst!«
Die Züchtigung durch den Kameraden erschien dem Rosshüter empfehlenswerter als die Wut des Meisters selbst, und so willigte er ein. Was dann folgte, war erniedrigend und boshaft: Dagobert öffnete seinen Hosenstall und holte seinen Mannesschweif heraus. Unter Drohungen und höhnischen Worten zwang er Engelbert, selbigen in den Mund zu nehmen, und öffnete er seine Lippen nicht genug, versetzte er ihm Maulschellen, welche die Wangen des jungen Rosshüters zum Glühen brachten.
»Ja, nuckle an meinem Schwanz«, befahl ihm Dagobert. »Zähne auseinander, du Wicht! Ist das Fleisch hart, darfst du gern ein wenig darauf kauen, jetzt aber schiebe es zwischen Zunge und Gaumen, wo’s nass und weich ist! Schmeckst du den Schweiß und den Harn? Beide erzählen dir von dem langen Tag, den mein Schweif – eingesperrt in enge Hosen – erlebt hat. Merkst du, wie es an der Spitze langsam würziger wird? Lutsche die Würze, Dummkopf, und schlucke, was da kommt! Lass dir das eine Lehre sein, die Rosse des Gestüts an wildfremde Leute zu verschenken!«
Engelbert musste sowohl den Spott ertragen wie auch die Drangsal, die der dicke Schweif in seinem Rachen mit sich brachte. Immer wieder musste er würgen und der Speichel rann in Strömen von seinen Mundwinkeln. Dagobert erfreute sich an dem Bild der Qual und zog den armen Rosshüter an den Haaren, damit er noch tiefer in dessen Kehle dringen konnte. Das währte seine Zeit, und als der älteste Bursche das Zenit seiner derben Lust erreichte und sich in Engelberts Mund entlud, standen dessen Augen voller Tränen und konnten gar nicht sehen, wie Dagobert vor Verzückung zitterte und schwankte. Kaum aber war der letzte Tropfen Burschenseim aus der Schweifspitze geflossen, hatte der Spuk ein Ende – Dagobert stieß den jungen Rosshüter von sich, spuckte ihm ins Antlitz und sagte:
»Zieh dich in den Dreck zurück, alberner Schwanzsauger!«
Zuerst wollte Engelbert protestieren. Er war ja von Dagobert gezwungen worden, den »Schwanzsauger« zu mimen; wieso sollte ihm das nun zum Vorwurf gemacht werden? Dann aber besann er sich, dass diese Zurückweisung noch Bestandteil der Strafe sein mochte, und legte sich schweigend auf sein Lager. Dagobert schnarchte bereits, doch Engelbert brauchte noch lang, bis er einschlafen konnte, denn sein verrenkter Kiefer schmerzte sehr.
Am folgenden Tag ging jeder Bursche zurück auf seine Koppel, um die Pferde zu hüten. Die schwarzen Hengste bereiteten Engelbert diesmal weniger Mühe und er passte auf, dass keiner dem Urwald zu nahe kam. Gegen die Mittagsstunde kam aus dem Dickicht ein Holzfäller mit seinem Wagen gefahren. Neben zahlreichen Baumstämmen hatte er auch einen hölzernen Käfig geladen, in dem ein Luchs hockte und den Rosshüter eindringlich anschaute. Der sprach den Holzfäller an und fragte, wo er den Luchs denn herhabe?
»Der ist mir vor die Axt gelaufen und beinahe hätte ich ihm versehentlich den Kopf abgehauen«, erzählte jener. »Ein dummes Vieh, das keine Achtung vor Menschen hat. Es verdient, ausgestopft zu werden und eine Stube zu zieren!«
»Nein, lasst den Luchs am Leben«, bat Engelbert.
»Meinetwegen, wenn dir so viel daran liegt«, erwiderte der Holzfäller. »Aber was gibst du mir dafür, dass ich ihn freilasse?«
Wie tags zuvor bot der junge Rosshüter einen schwarzen Hengst zum Tausch. Der Holzfäller ging auf den Handel ein, überließ Engelbert den Käfig und zog mit dem neuen Pferd davon. Der Luchs rannte, kaum war die Käfigtür offen, dem Urwald zu und verschwand darin.
»Dort in der Wildnis ist dein Zuhause«, rief Engelbert ihm nach. »Lauf und lass dich nicht noch einmal einfangen!«
Des Abends, als er mit den anderen Burschen beim Feuer saß, wagte er zunächst nicht, die Begebenheit zu erwähnen. Als aber Dagobert eingeschlafen war, hielt der Rosshüter es nicht länger aus und vertraute sich Heribert an. Der ward allerdings noch ernster als sein älterer Kamerad, sobald er die Neuigkeit vernahm, und sprach:
»Welch ein Dummkopf bist du! Unser Meister wird dir den Rest deines Lebens zürnen und sich unaussprechliche Strafen ausdenken, hört er erst, dass du seine Pferde verschenkst! Aber guck nicht so erschrocken, von mir wird er nichts erfahren. Nur bitte ich mir eine Gegenleistung für mein Schweigen aus!«
Da glaubte Engelbert zu wissen, was folgen würde, und öffnete seinen Mund weit. Heribert jedoch herrschte ihn an:
»Schließe deine Gusche, die begehre ich nicht. Drehe deine Längsseite zu mir und zeige, ob du dich hinten genauso weit öffnen kannst wie vorn! Mein Daumen wird dir dabei helfen, und wenn du dir einbildest, es sei kein Daumen, der an deinem Sitzfleisch zugange ist, dann finde dich mit deinem Irrtum ab. Drehe dich aber nicht um und lass mir meine Freude!«
Dem armen Rosshüter dünkten die Worte zunächst rätselhaft. Als er aber gehorsam die Rückseite zu Heribert drehte, merkte er alsbald, was gemeint war. Noch nie hatte irgendwas außer seinem eigenen Finger dort gesteckt, nun aber war es ein dicker, fremder Daumen und nach einer Zeit sogar deren zwo. Als auch der zweite Daumen abgelöst wurde, ahnte Engelbert, was es mit dem dritten Gast zwischen seinen Hinterbacken auf sich hatte. Um aber den Maulschellen und dem Haareziehen zu entgehen, wagte er nicht, sich umzudrehen, sondern duldete Ruck um Ruck und Stoß um Stoß.
Wäre Heribert nur ein wenig mitfühlender gewesen! Hätte er seinem Kameraden nur ein einziges liebevolles Wort gesagt! Ja, dann hätte der Rosshüter durchaus Gefallen an dieser Art Strafe gefunden, denn die Spitze des fremden Schweifs traf in seinem Inneren einen Punkt, der jeden Schmerz in einen angenehmen Schauer eitlen Wohlbefindens zauberte. Aber ach, der mittlere Bursche war ebenso hartherzig wie der Älteste, und als seine Begierden gestillt waren, dankte er es Engelbert mit einem Tritt in den Hintern.
»Fort mit dir«, schimpfte Heribert und setzte demütigende Namen und Bezeichnungen hinzu, die seinen Kameraden nicht nur kränkten, sondern seine Seele wie Stiche verletzten.
Anderntags machte sich jeder Hüter wieder zu seiner Koppel auf. Engelbert fand seine Rosse friedlich grasend vor und meinte, sie seien vielleicht darum nicht mehr so wild, weil es ihrer weniger waren als zu Beginn der Frist. Er hatte aber keine Zeit, länger darüber nachzudenken, denn vom Urwald her drangen juchzende Rufe an sein Ohr. Er sah zum Waldrand und erspähte eine Schar Brombeerpflücker, die mit ihrem Beerenkamm ein schwarzes Tier vor sich hertrieben. Als sie näher kamen, sah Engelbert, dass es ein Panther war.
»Wo habt ihr ihn her?«, fragte er.
»Er hielt sich unter einem Strauch versteckt«, erwiderten die Brombeerpflücker. »Er wollte uns mit seinen Krallen und Zähnen angreifen, aber den scharfen Spitzen unseres Beerenkamms ist er nicht gewachsen!«
»Was habt ihr mit ihm vor?«, wollte der Rosshüter weiter wissen.
»Wir bringen ihn an den Hof des Königs, wo der Panther von allen bestaunt werden soll«, lautete die Antwort.
»Lasst ihn hier in der Wildnis, wo er hingehört«, bat Engelbert. »Ich gebe euch auch einen schwarzen Hengst dafür!«
Die Brombeerpflücker gingen auf den Handel ein, nahmen sich ein Ross und ließen den Panther laufen. Ausgerechnet in diesem Augenblick kam der Pferdezüchter daher und wollte überprüfen, wie gewissenhaft seine Burschen ihren Dienst versahen. Als er die Brombeerpflücker mit seinem schwarzen Hengst davonziehen sah, ahnte er Schlimmes und lief dem Rosshüter zu.
»Was gibst du meine besten Pferde heraus?«, fragte er. »Bist du toll geworden?«
Da erzählte Engelbert wahrheitsgemäß, wie er dreimal ein armes Tier mithilfe der Hengste ausgelöst hatte, denn eine Lüge schien ihm nun nichts mehr wert; sein Meister hatte ja mit eigenen Augen gesehen, dass das Ross nicht fortgelaufen, sondern herausgegeben worden war. Wie erwartet, war der Alte wütend und hätte den dummen Burschen am liebsten ausgepeitscht. Der aber sprach:
»Seid gewiss, dass Eure anderen Burschen sich bereits um meine Bestrafung gekümmert haben. Kiefer und Backen tun mir jetzt noch weh. Wollt ihr Eurem Zorn dennoch Luft machen, lasst mich die rechte Stellung einnehmen.«
Und er zog die Hosen herunter, ging auf die Knie wie ein Hund, öffnete den Mund und reckte sein Hinterteil in die Höhe. Der Pferdezüchter staunte und frug, was das solle. Engelbert erzählte, dass Dagobert und Heribert ihn jeweils von vorn und von hinten mithilfe ihrer Schweife gezüchtigt hätten und er das Gleiche nun vom Meister erwarte. Der schlug bestürzt die Hände über den Kopf zusammen:
»Was haben dir die zwei unflätigen Kerle angetan! Sie haben deine Reue missbraucht, um gewaltvoll an dir ihre Lust zu stillen. Derartige Verbrechen sind im Land der lila Liebeslust nicht gestattet. Was du erlitten hast, sollen sie büßen!«
Seine Wut über den Verlust der Pferde war verraucht und machte dem Sinn der Gerechtigkeit Platz. Weil aber Beweise für Engelberts Behauptung fehlten, brauchte der Züchter das Eingeständnis der anderen beiden Burschen und suchte sie sogleich auf, um ihnen die Anschuldigungen des Rosshüters kundzutun. Dagobert und Heribert waren von dem plötzlichen Verhör überrascht, stammelten blöde und verhaspelten sich, sodass dem Alten klar war, wer Wahrheit und wer Lüge sprach.
»Vors Gericht sollt ihr gebracht werden«, entschied er.
Das war heikel für die beiden, denn fiele das Urteil zugunsten Engelberts aus, würde der das Gestüt erhalten. Sie selbst hingegen würden in Haft geraten und nimmermehr eine Anstellung als Pferdewirt erlangen. Darum fassten sie kurzerhand den Entschluss, Engelbert aus dem Weg zu räumen, getreu dem Leitsatz:
»Wo kein Kläger, da kein Richter!«
Ehe ihr Meister mit den Bütteln des Gerichts zurückgekehrt war, hatten sie den armen Rosshüter aufgesucht, ihn hinterrücks bewusstlos geschlagen, danach an Armen und Beinen gepackt und zum Urwald geschleppt. Am Waldesrand fanden sie eine tiefe Grube, wohinein sie Engelbert warfen. Dann machten sie sich fort und ließen den Kameraden liegen in der Meinung, sich recht fein aus dem Schlamassel beholfen zu haben.
Erst als die Sonne unterging, erwachte der Rosshüter. Das Haupt war verbeult, die Glieder zerschunden und er wusste nicht, wie ihm geschehen war. Er guckte sich überall in der Grube um und weinte:
»Ach je, wo bin ich nur? Ich bin hier ganz allein und verlassen, wie soll ich nur Hilfe finden?«
Unter Schmerzen erhob er sich und krabbelte die Grube hinauf. Weil es aber dunkel war, fand er den Weg aus dem Urwald nicht, sondern verlief sich immer tiefer darin. Endlich vernahm er das Gluckern von Wasser, fand ein Bächlein und legte sich daneben, um zu trinken. Darüber wurde er müde und schlief, so gut oder schlecht es seine pochenden und stechenden Verletzungen eben zuließen.
Während er schlummerte, fanden sich in der Nähe drei Tiere ein, die um eine Beute stritten. Es handelte sich um einen Proviantkorb, den der Holzfäller unlängst im Walde vergessen hatte. Der schwarze Panther hatte ihn gefunden und wollte sich an der Wurst laben, die er darin fand. Das erspähte wiederum der Luchs mit seinen scharfen Augen und wollte dem anderen den Korb abluchsen. Sie fauchten und fletschten die Zähne, was wiederum den Wildkater anlockte, der sich den Streit aus der sicheren Höhe eines Astes ansah und auf die passende Gelegenheit wartete, mit der Pfote nach dem Korb zu haschen. Wie sich nun zankten, wem die Beute gehöre, vernahmen ihre Katerohren das jämmerliche Stöhnen Engelberts.
»Da liegt einer hinterm Gebüsch«, stellte der Luchs fest. »Panther, du bist der Stärkste von uns. Schleich dich hin und sieh nach!«
»Ich werde gehen, aber lasst die Beute in Ruhe, bis ich wiederkomme«, knurrte das schwarze Tier.
»Wir werden nichts anrühren«, sagten die beiden anderen und hielten ihr Versprechen.
Als der Panther kurz darauf zurückkehrte und ihnen erzählte, es läge jener Bursche verletzt im Wald, der ihnen vormals das Leben geschenkt hatte, kamen die drei wilden Kater überein:
»Wir wollen den guten Rosshüter gesund pflegen. Bis er genesen ist, herrsche Frieden zwischen uns. Wir werden zusammenhalten und jede Beute redlich in vier Teile teilen.«
Mit den Pfoten scharrten sie feuchtes Moos, allerlei Kräuter und Laubwerk zusammen. Das brachten sie dem Schlafenden und deckten ihn damit zu, damit er sich nicht verkühle.
»Wir brauchen Arzeneien, um seine Wunden zu behandeln«, stellte der Panther fest.
»Wo kriegen wir die her?«, fragte der Wildkater.
»Nicht weit vom Urwald, auf seiner anderen Seite, wohnt ein Medicus«, wusste der Luchs. »Wenn er uns in unserer Tiergestalt sieht, wird er aber jegliche Hilfe verweigern.«
»Also müssen wir uns verkleiden«, entschied der Panther. »Als mich die Beerenpflücker letztens fanden und Schabernack mit mir trieben, verlor einer von ihnen den Hut. Den wird sich der Wildkater aufsetzen. Das Tuch, das hier im Korb um die Wurst gewickelt ist, soll sein Mantel sein. Dann hockst du dich auf mich und lässt den Schwanz herabbaumeln, dass es aussieht, als sei es ein Menschenbein. Ich aber will wiehern und schnauben wie ein Pferd. Wenn wir dergestalt im Dunkel der Nacht vor das Haus des Medicus erscheinen, wird er glauben, wir seien ein Reiter. Was meint ihr?«
Sie probierten die Verkleidung sogleich aus und er Luchs mit seinen scharfen Augen begutachtete das Ergebnis.
»Wenn der Katerschwanz wie ein Menschenbein aussehen soll, braucht er noch einen Stiefel«, meinte er.
Sie hatten aber keinen Stiefel. Also tauchte der Wildkater seinen Schwanz kurzerhand in eine Schlammpfütze, der Luchs band einen Matschklumpen daran und formte ihn so, dass er wie ein schmutziger Schuh aussah.
»Jetzt ist die Maskerade vollkommen«, lobte er. »Eilt euch, ehe sich die Wunden unseres Schützlings entzünden!«
Panther und Wildkater hetzten durch den Urwald und verlangsamten ihren Lauf erst, als sie dessen Grenze erreicht hatten. Sobald das Haus des Medicus in Sichtweite kam, versuchte der Panther wie ein Pferd zu traben. Seine samtenen Pfoten waren allerdings zu leise, um jemanden zu täuschen, darum rief der Wildkater bei jedem Schritt:
»Klack! Klack! Klackediklack!«
»Was soll das?«, flüsterte der Panther.
»Das ist der Klang deiner Hufen, die aufs Pflaster schlagen«, erklärte der Wildkater.
Sie hielten vor dem Haus des Medicus. Nur ein Fenster war erleuchtet und da blickten sie hinein. Was sie sahen, war bemerkenswert: Ein nackter Jüngling lag auf einem Tisch, die Arme artig an die Seite gelegt, die Beine leicht gespreizt. Ein Mann in weißem Kittel stand daneben und trug schwarze, hautenge Handschuhe, die mit einer glänzenden Substanz eingeschmiert waren. Über Mund und Nase war eine Maske gespannt.
»Das ist gewiss der Medicus, der einen Patienten untersucht«, mutmaßte der Wildkater.
Der Panther wunderte sich darüber und stellte viele kluge Fragen:
»Welcher Medicus führt zu solch später Stunde noch Sprechstunden durch? Weshalb muss der Jüngling sich vollständig entkleiden, wenn nirgends an seinem Leib ein erkennbares Leiden zu sehen ist? Warum lächelt er bei jeder Berührung des Medicus und kannst du mir erklären, weshalb jener unter seinem weißen Kittel nichts trägt? Man sieht ja sein Geschlecht durch die Knopfleiste lugen!«
Der besserwisserische Wildkater gab viele dumme Antworten:
»Der Medicus muss den Jüngling nackt vor sich haben, weil in seinen gelehrten Büchern die Abbildungen auch immer nackt sind. Der Patient lächelt, weil er sich auf seine Heilung freut. Siehst du die Beule zwischen seinen Beinen, die wächst und wächst? Mit jedem tiefen Spritzenstich, den der Medicus ihm weiter unten beschert, bäumt sie sich auf. Gleich wird Eiter hervortreten und die Beule abschwellen. Dann ist der Jüngling von seinem Leiden erlöst. Der Medicus selbst trägt nichts unter dem Kittel, weil sein Operationssaal bestimmt ziemlich warm ist und er nicht unnötig schwitzen will.«
Der Panther ahnte, dass es mitnichten Eiter war, der aus der vornehmlichen Beule hervorschoss. Auch zweifelte er daran, dass es eine Spritze war, die der Medicus seinem Patienten hinten einführte. Doch er hatte keine Lust zu streiten, denn es gab Wichtigeres zu tun. Mit der Schnauze pochte er an die Fensterscheibe und wieherte, während der Wildkater den Hut tief übers Antlitz zog und winkte. Die beiden Menschen erschraken, aber als sie merkten, dass die Gestalten vor dem Haus keine Einbrecher waren, öffneten sie das Fenster und fragten nach dem Begehr.
»Wir haben einen Verwundeten bei uns, der leidet unter Beulen und Schrammen. Gebt uns Arzeneien, Herr Medicus.«
Da schluckte der Mann im Kittel verlegen und gestand, dass er gar nicht der echte Medicus sei.
»Ich bin nur ein Diener und spiele gern Doktor mit lieben Freunden«, sagte er und lächelte den vermeintlichen Patienten an. »Wir schleichen uns allnächtlich her, um in Rollen zu schlüpfen. Bitte verachtet uns darum nicht und verratet niemandem etwas!«
Der Wildkater bedachte sich das und schnurrte schließlich:
»Euer Geständnis verleitet mich dazu, im Hause Alarm zu schlagen und den echten Medicus über euer geheimes Spiel zu unterrichten. Wenn ihr aber in den Schränken nachschauen wollt, ob ihr Salben und Pulver zur Wundbehandlung findet, wohl auch Pflaster und Binden, und sie uns unentgeltlich herausgebt, will ich schweigen.«
Die beiden Ertappten waren mit dem Vorschlag einverstanden und suchten zusammen, was ihnen der Forderung angemessen schien. Sie überreichten dem Wildkater die Arzeneien und merkten die ganze Zeit über nicht, dass der Fremde mit dem Hut gar kein Mensch war. Darüber lachten Wildkater und Panther auf dem Rückweg, und Letzterer musste lobend zugeben:
»Du erkennst zwar die Liebelei zwischen zwei Burschen nicht, aber warst sehr schlau, als es darum ging, die Arzeneien zu beschaffen. In all unserer Hast haben wir nicht daran gedacht, dass wir den echten Medicus hätten bezahlen müssen, und wir haben ja gar kein Geld!«
Als sie den Urwald erreicht hatten, war der Rosshüter bereits erwacht. Erschrocken wich er zurück, wie er der wilden Tiere ansichtig wurde, aber der Luchs beruhigte ihn:
»Fürchte dich nicht! Wir sind die drei wilden Kater, die du errettet hast. Wir wollen dir deine gute Tat vergelten. Lege nun die Kleider ab, damit wir deine Wunden auslecken können, ehe wir sie einsalben und verbinden! Andernfalls könnten sich Keime darin verfangen.«
Engelbert gehorchte und entblößte Arme, Brust, Rücken und Beine. Die warmen Zungen der Kater taten ihm wohl, doch fiel es den Tieren schwer, mit der Salbe und den Binden umzugehen, denn ihre scharfen Krallen hätten dem Rosshüter beinahe neue Kratzer zugefügt. Allein in den Bereich seines Schoßes wollte Engelbert die Schnauzen der Tiere nicht haben.
»Dort unten von einem Miezekater geleckt werden? Nein, das will ich nicht, das tut man nicht.«
Er nahm von den Arzeneien, was ihm passend schien, und pflegte die dortigen Wunden selbst. Dann legte er sich aufs Moos und schlief wieder ein, denn er war nach wie vor sehr erschöpft und kraftlos.
»Unser Schützling braucht nun ein stabiles Bett und ein Dach über dem Kopf«, meinte der Luchs. »Aber wo kriegen wir das her?«
»Unweit des Urwalds wohnt ein Holzfäller, der kann uns die Bretter zurechtschlagen«, antwortete der Panther.
Abermals stellte er sich als Pferd zur Verfügung, doch diesmal sollte der Luchs den Reiter mimen. Kaum war die nächste Nacht hereingebrochen, setzte er sich den Hut auf, zog sich das Tuch um die Schultern und setzte sich auf den schwarzen Rücken. Es dauerte nicht lange, bis sie den Hof des Holzfällers erreichten. In der Scheune brannte Licht. Ihr Tor stand weit offen und ein Bursche lief dort missmutig im Kreise herum, die Axt in der Hand.
»Den Holzfäller habe ich älter in Erinnerung«, flüsterte der Luchs. »Und warum lässt er das Scheunentor auf, dass jeder hineinsehen kann, anstatt es zu schließen und ins Bett zu gehen?«
Der Panther raunte, das sollten sie den Burschen am besten selbst fragen. Also räusperte sich der Luchs und grüßte:
»Heda, Holzfäller, so spät noch auf den Beinen? Ich hätte da einen Auftrag für Euch!«
Mit einem Mal verschwand die schlechte Laune aus dem Gesicht des Burschen und er strahlte die Fremden an:
»Ich warte schon viele Nächte, dass sich solch eine Gelegenheit bietet! Wisst, ich bin nicht der Holzfäller, sondern sein Sohn. Mein Vater nimmt mich nicht mit in den Urwald, auch verbietet er mir, mit der Axt umzugehen. Er fürchtet, ich könne mich verletzen. Im Nachbarhof aber wohnt ein Jüngling, dem ich zeigen will, wie kräftig und geschickt ich bin. Sein Schlafzimmerfenster gewährt ihm Blick auf diese Scheune. Doch weiß ich nicht, was ich mit der Axt schlagen soll, um ihn zu beeindrucken, denn haue ich wild drauflos, wird er mich auslachen. Ein Auftrag muss her, der mir seine Gunst einbringt!«
»Einen solchen Auftrag habe ich«, sagte der Luchs, »doch muss dir die Gunst des Nachbarjünglings genug sein, denn ich habe kein Geld, dich zu bezahlen.«
In seinem Eifer versicherte der Bursche, dass ihm das nichts ausmache, und sobald er von den Brettern und Bettpfosten hörte, die es herzustellen galt, packte er einen Baumstamm um den andern, hieb mit der Axt die Zweige fort und sägte das Holz mit Fleiß und Mühe, bis es die passende Form und Größe hatte. Er begann zu schwitzen und zog darum sein Hemd aus. Da sah man, wie sich seine Muskeln spannten; die Kraft seiner Sehnen trat unter der Haut hervor und die Männerbrust schwoll an.
Der Luchs kehrte sich um und sah mit seinen scharfen Augen zum Nachbarhaus. Durch die Scheibe konnte er einen Jüngling erkennen, der immer näher ans Fenster trat. Zuerst war es Neugier, die in seinem Antlitz stand. Als die Arbeit des Holzfällerburschen voranschritt, wandelte sie sich in Bewunderung, und nachdem jener sich bis auf die Haut ausgezogen hatte, konnte der Luchs in dem Jünglingsgesicht Begierde und Wollust lesen. Dessen Mund stand offen, die Augen waren groß und die Regelmäßigkeit, mit der Schultern und Arme sich bewegten, verriet, dass der Gaffer den Anblick des Holzfällerburschen zum Anlass genommen hatte, sich untenherum Befriedigung zu verschaffen. Mit dem letzten Axthieb des Burschen spritzte der Jüngling milchweiße Tropfen auf die Innenseite der Fensterscheibe. Da lachte der Luchs und versicherte dem Sohn des Holzfällers:
»Die Gunst deines Nachbarn hast du gewonnen! Sieh nur die Spuren der Freude, die er an seinem Ausguck hinterlassen hat. Sie zeugen davon, wie er sich an deiner Kraft und Geschicklichkeit ergötzt hat. Eile zu ihm, lass dir von seinen zarten Händen deine Muskeln streicheln und beweise, dass du nicht nur Axt und Säge schwingen kannst, sondern auch gänzlich andere Dinge.«
Das musste er dem Burschen nicht zweimal sagen. Der warf die Axt von sich, achtete auch nicht auf sein Hemd, sondern rannte halbnackt, wie er war, zum Nachbarhof. Luchs und Panther hörten, wie dort eine Tür sich knarrend öffnete und wieder zuschlug – das Licht im Fenster des Jünglings aber erlosch.
»Nun können wir nicht beobachten, was weiter geschieht«, seufzte der Panther.
»Na, man kann es sich ja denken«, schnurrte der Luchs. »Sammeln wir die Bretter zusammen und laden sie auf den Wagen dort. Dann bringen wir sie in den Urwald. Los!«
Gesagt, getan. Obschon Tatzen und Pfoten eigentlich nicht für ihre Eignung zu handwerklichen Tätigkeiten bekannt sind, schafften es Wildkater, Luchs und Panther, dem Rosshüter ein Bett zu zimmern und ein Dach zu bauen. So war er von Wind und Regen geschützt.
»Nur die Kälte der Nacht, die wird ihm schaden«, ängstigte sich der Panther. »Ich werde ihm wärmende Decke sein.«
»Und mich darf er als Kissen nehmen«, rief der Wildkater.
»So will ich mich neben ihn legen und an ihn kuscheln«, sagte der Luchs, »auf dass er einen Bettgenossen hat.«
Mit den katerlichen Kissen und Decken erklärte sich Engelbert einverstanden. Doch einen tierischen Bettgenossen lehnte er ab:
»Von einem Miezekater bekuschelt werden? Nein, das will ich nicht, das tut man nicht.«
»Dann will ich Wache halten«, lenkte der Luchs ein und setzte sich vors Bett.
Das ging ein paar Nächte so und der Rosshüter erholte sich sichtlich. Die Beulen schwanden, die Schrammen heilten und weder Knochen noch Muskel taten mehr weh.
»Jetzt, wo er gesund ist, sieht man erst, welch ein schöner Bursche er ist«, raunte der Panther dem Wildkater zu.
»Du hast recht«, nickte jener. »Es wäre ein Jammer, müsste er den Rest seines Lebens allein in diesem Urwald zubringen.«
Der Luchs hatte ihr Gespräch belauscht und mischte sich ein:
»Ihr seht die Sache wie ich, Freunde. Wollen wir also dem Rosshüter zu seinem Glück verhelfen!«
Das wollten die anderen gern tun, aber wie? Der Luchs erzählte:
»Während meiner Nachtwachen haben mein Augen und Ohren mitbekommen, wie eine Meile weit von hier die garstige Jägerin, die einst den Wildkater fing, dem Fürsten von jenseits des Urwalds auf einem seiner Ausflüge aufgelauert und ihn entführt hat. In einer Schlucht, wo sie in einer Hütte wohnt, hält sie ihn so lange gefangen, bis er bereit ist, ihre alte Mutter zu heiraten, damit sich jemand um sie kümmere. Weil jene aber noch böser ist als die Jägerin selbst, möchte der Fürst nicht einwilligen.«
»Lass uns mit deiner hässlichen Alten in Ruhe«, unterbrach ihn der Panther. »Erzähle lieber vom Fürsten. Ist er hübsch?«
»Und wie«, rief der Luchs. »Ein zierlicher Bart schmückt sein kantiges Antlitz, stattlich sind Schultern und Rumpf, und weil er in seinem Zwinger nackend sitzen muss, konnte ich sehen, dass sein Schweif eine kostbare Mitgift für jenen Menschen darstellt, der ihn dermaleinst heiraten darf. Wohl deshalb hat die Jägerin ihn für die Mutter vorgesehen. Das muss ein geiles Luder sein!«
»Wichtiger als sein Leib ist sein Herz«, mahnte der Wildkater. »Ist es gütig?«
»Brav und wohltätig ist der Fürst«, wusste der Luchs. »Er gibt den Armen, spricht mildes Recht über seine Untertanen und gilt überall als beliebt. Was soll er da im Zwinger der Jägerin sitzen und am Ende deren Mutter ehelichen?«
»Das soll nicht geschehen«, entschied der Panther. »Wir wollen ihn dem Rosshüter zusprechen, denn er klingt nach einem vortrefflichen Bräutigam. Führe uns zur Schlucht, lieber Luchs, und auf dem Wege wollen wir beraten, wie wir den Fürsten befreien können!«
Unterwegs fassten sie ihren Plan. Der Wildkater, weil er am wendigsten war, sollte in den Hühnerhof der Jägerin springen und die Hühner jagen. Sobald die Jägerin käme, um ihn zu verjagen, würde der Luchs in ihre Hütte dringen, um den Zwingerschlüssel zu stehlen. Mit dem sollte der Panther zum Fürsten eilen.
»Lasse ihn aber nicht eher aus seinem Gefängnis, bis er dir versichert hat, unseren Engelbert zu heiraten«, sagte der Luchs.
Als sie die Jagdhütte erreichten, gackerten die Hühner friedlich in ihrem Gehege und die Jägerin kochte in ihrer Hütte einen Brei. Der Wildkater kletterte auf einen Baum nahe des Hühnerhofs, balancierte vorsichtig auf einem dünnen Ast entlang, bis er über dem Hahn schwebte, und sprang schließlich fauchend auf dessen Rücken. Da stoben die Vögel aufgeregt auseinander und wussten nicht, wohin mit sich. Der Lärm lockte die Jägerin hinaus und Luchs und Panther konnten ohne Schwierigkeit ihren Teil des Vorhabens erfüllen.
Der Fürst erschrak sehr, als er vor dem Zwinger das schwarze Tier erblickte, und glaubte erst, die Jägerin hätte es auf ihn gehetzt, damit es ihn fresse. Der Panther konnte ihn jedoch beruhigen und flüsterte:
»Pst, pst, Fürst! Fürchte dich nicht! Ich bin gekommen, dich zu befreien. Doch musst du versprechen, den Rosshüter zu heiraten, ja?«
Der Panther merkte, wie der Fürst zögerte, und setzte hinzu:
»Das ist kein Ultimatum wie das der bösen Jägerin. Vertrau mir, der Engelbert ist ein anständiger, schmucker Bursche!«
Da ließ sich der Fürst überreden und fing den Zwingerschlüssel auf, den der Panther ihn durch die Gitterstäbe zuwarf. Er öffnete das schwere Vorhängeschloss, setzte sich auf den Rücken des schwarzen Tieres und ließ sich aus der Schlucht heraustragen, bis die Jagdhütte außer Sichtweite war.
»Die Alte wird noch zu tun haben, ihr Federvieh zusammenzusuchen«, lachte der Panther. »Eile du in dein Fürstentum und erwarte uns dort mit einem Fest! Wir werden den Rosshüter Engelbert holen und mit ihm bei dir einziehen!«
Dem Fürsten blieb nichts anderes übrig, als in seiner Nacktheit durch den Urwald nach seinem Fürstentum zu eilen. Es war ein Glück, dass seine Wachen und Diener ihn gleich erkannten, in die schützenden Gemächer führten und mit Kleidung sowie stärkender Speise versorgten. Wie wunderten sie sich aber, als er nach ein paar erfrischenden Bissen den Befehl gab, alles im Schloss für einen prachtvollen Empfang vorzubereiten, denn sein Bräutigam würde in Kürze erscheinen. Hui, da wurden die besten Früchte aufgetragen, die Blumen aus dem Schlossgarten zu Girlanden geflochten, edle Tränke in kostbare Karaffen gefüllt und vieles mehr.
Unterdessen waren die wilden Katzen zum Rosshüter zurückgekehrt und verkündeten ihm die frohe Kunde seiner bevorstehenden Heirat. Noch ehe Engelbert fassen konnte, was man ihm berichtete, hatte der Luchs seine Zähne sanft in sein Hosenbein gestoßen und zog ihn daran durch den Urwald. Der Panther stupste ihn mit der kräftigen Schnauze immer wieder von hinten an, der Wildkater dagegen sprang vergnügt voraus. Dem Rosshüter war das zunehmend unangenehm und er sprach:
»Mit einem Gefolge aus wilden Tieren soll ich vor den Fürsten treten? Nein, das will ich nicht, das tut man nicht.«
Die Kater ließen von ihm ab und schnurrten:
»So lassen wir das Stoßen und Zerren. Aber gewähre uns wenigstens, im gebührenden Abstand hinterdrein zu laufen.«
Um die Tiere nicht zu kränken, willigte Engelbert ein. Je näher er dem Schloss des Fürsten kam, desto lauter wurde das Gemurmel der Wachen und Diener. Sie glotzten blöde, zeigten in Engelberts Richtung und tuschelten immerfort.
»Sie halten mich für einen Wilden, weil ich mit Panther, Luchs und Wildkater daherkomme«, meinte er und schämte sich.
Da gewahrte er die langen Schatten, welche die Sonne, die ihm im Rücken stand, auf den Weg vor ihn warf. Seinen eigenen erkannte er natürlich sofort, aber die drei anderen konnten nimmer wilden Katzen gehören. Die Umrisse zeigten deutlich, dass dicht hinter ihm drei Gestalten folgten, die jeweils auf zwei Beinen daherschritten. Engelbert drehte sich um und sah, dass Panther, Luchs und Wildkater sich in Menschen verwandelt hatten.
»Wundere dich nicht«, lächelte der Dunkelste von ihnen und der Rosshüter erkannte an der Stimme, dass er der Panther gewesen war. »Ein böser Hexer hatte uns einst zu Tieren verwandelt, weil wir ihn verschmähten.«
»Erst durch eine gute Tat konnte sich jeder von uns erlösen«, setzte der Zweite hinzu, dessen blitzende Augen verrieten, dass er vorher der Luchs gewesen.
»Wir danken dir, dass du unsere Hilfe annahmst und uns damit den Weg in die Rückverwandlung geebnet hast«, lächelte der kleinste der drei Männer. »Wenn du möchtest, nehmen wir nun Abschied, es sei denn, du willst uns auch fortan als deine treuen Diener behalten.«
Wie konnte Engelbert da nein sagen? Es wartete auf ihn zwar ein bildhübscher Fürst, doch Leib und Gemüt der drei Mannsleute waren von derartiger Beschaffenheit, dass er sie gern stets um sich haben wollte. Der Fürst selbst hatte die Verwandlung vom Schlosstor aus gesehen, eilte nun zu seinem Bräutigam und stellte sich höflichst vor. Dann grüßte er die drei einstigen wilden Kater und bemerkte:
»Als vornehme Diener von Grazie und Ebenmaß passt ihr mir viel besser an meinen Hof denn in eurer Tiergestalt. Eure Versprechungen hinsichtlich des Rosshüters aber waren nicht in den Wind gesprochen. Er ist wahrhaftig ein Bursche, wie es keinen Schöneren weit und breit gibt. Drum soll er, sofern er will, mein Bräutigam sein.«
Und Engelbert wollte. Da nahm ihn der Fürst bei der Hand und gemeinsam betraten sie das Schloss, wo die Menge zu jubeln und zu feiern begann. Es gab ein herrliches Hochzeitsfest mit leckerem Schmaus, reizenden Tänzen, beschwingter Musik und viel Gelächter. Als es aber zur Hochzeitsnacht kommen sollte, zögerte Engelbert und der Fürst merkte dies. Besorgt fragte er, was los sei, und der Rosshüter vertraute ihm die bösen Taten an, die seine früheren Kameraden auf der Pferdekoppel an ihm verbrochen hatten.
»Komm, lass uns auf dem Bette ruhen und deine Ängste vertreiben«, sagte der Fürst mit milder Stimme, nachdem er sich alles in Ruhe angehört hatte.
Er fasste seinen Bräutigam sanft bei den Armen und ließ ihn nicht los, bis sie wohlig auf den duftenden Decken des Hochzeitsbettes lagen. Dabei versicherte er Engelbert stets aufs Neue seine Liebe und Zuneigung und schwor, ihm nicht wehtun zu wollen. Seine Ermutigungen wandelten sich in Schmeicheleien, seine beruhigenden Hände in gewandte Kundschafter auf den Pfaden edler Linien. Doch nicht nur seine zärtlichen Finger wollten dem Rosshüter getreulich beistehen, auch das Adergewebe seines fürstlichen Schweifs ward geweckt, sodass selbiger sich aufstellte und bereit war, jeglichen Kummer zu vertreiben. Wie behagte das dem Fürsten und er flüsterte seinem Bräutigam zu:
»In meinem Reich gibt es ein Sprichwort, welches lautet: Bekämpfe weder Lust noch Liebe, denn wer weiß, was sonst noch bliebe?«
Engelbert schmunzelte über den Reim und fasste Vertrauen. Die Nähe des Fürsten linderte seine Furcht vor neuerlichem Schmerz und ließ ihn die trüben Erinnerungen vergessen. Er wunderte sich über den Frieden in der eigenen Brust, der sich dort breitmachte, und es tat ihm wohl, wie die fremde Manneshand seinen Leib berührte und sein Antlitz betastete. Der Fürst wagte einen sanften Kuss, erst auf die Wange, dann auf die Lippen.
Sie lagen beide auf dem Bette wie in einem Traum. Mal erschauerte der Rosshüter, mal der Fürst, aber niemand widersetzte sich dem Vorgang, der allzu natürlich vonstattenging und sie mit aller Macht erfasste. Behutsam wurde auch der letzte Knopf gelöst, die Hüllen fielen und ein Nabel küsste den anderen.
Da musste Engelbert mit dem Fürsten verschmelzen, er konnte nicht anders; jegliches Warten wäre abscheuliche Qual gewesen. Anders als bei all den vorherigen Erlebnissen – ob allein mit sich oder mit seinen derben Kameraden auf der Koppel – bescherte ihm dieses Eindringen keine ungezügelte Pein, sondern tiefen, reinen Frieden.
›Der Fürst gehört mir‹, war alles, was er denken konnte. ›Er gehört mir und ich will ihn immerdar mit den Armen umspannen und in steter Bewegung um sein Glück ringen.‹
Der heilsame Verlauf jener Nacht lehrte Engelbert, dass nicht alle Menschen ihre Begierden auf gewalttätige Weise zu stillen suchten, und in ihm wuchs eine aufgeschlossene Haltung gegenüber der Männerliebe heran. Weder der Fürst noch die drei Diener wurden müde, seinen neuen Wissensdurst zu stillen und seine Erfahrungen zu mehren, und so wandelte sich der schüchterne Rosshüter in einen herausragenden Kenner aller Spielarten der Wollust.
Nun möge man aber nicht glauben, jener Zeitvertreib hätte Engelberts Leben für immer bestimmt. Er blieb auch weiterhin der freundliche und gutherzige Mensch, der er schon während seiner Zeit als Rosshüter gewesen war. Darum hielt er es nicht aus, seinen alten Meister noch länger in Ungewissheit über sein Schicksal zu lassen, und sprach zum Fürsten:
»Der Pferdezüchter, bei dem ich diente, wollte mir beistehen und für Recht sorgen. Ehe er dazu kam, verschwand ich und er wird fragen, wo ich abgeblieben bin. Womöglich glaubt er gar, ich sei gestorben, und grämt sich darüber. Also will ich einen Brief aufsetzen und ihm von meinem Glücke berichten, damit er sich auf seine alten Tage keine Sorgen mehr um mich machen muss.«
Der Fürst hieß diesen Einfall gut und alsbald war ein Bote auf die andere Seite des Urwalds entsandt, wo die Pferdekoppeln lagen. Der alte Meister freute sich sehr über den Brief und gab dem Boten ein Antwortschreiben mit, dass Engelbert mit seinem baldigen Besuche rechnen dürfe. Der wartete nach Empfang des Schreibens ungeduldig Tag um Tag, doch der Pferdezüchter zeigte sich nicht. Zunächst konnte der Fürst ihn beruhigen, indem er sprach:
»Der Weg durch den Urwald ist weit und dein Meister schon alt. Gedulde dich, denn nicht jeder kann den Weg so flink bewältigen wie meine Boten. Am Ende möchte der Pferdezüchter uns ein Geschenk bringen, anlässlich unserer Hochzeit, und verspätet sich darum?«
Das ergab Sinn, doch als wiederum eine Woche vergangen war, begann sich auch der Fürst selbst zu sorgen. Schon wollte er seine Boten ein weiteres Mal zu den Pferdekoppeln schicken, als die Torwache die Ankunft des Pferdezüchters meldete. Aber ach! Wie sah er nur aus? Schmutzig und humpelnd trat er ins Schloss und erzählte, er sei im Walde schwer gestürzt und habe Tage in einer tiefen Grube zubringen müssen.
»Oh weh, mein Meister«, rief da Engelbert aus. »So erging es mir einst, doch hatte ich freundliche Wildtiere an meiner Seite, die mich hegten und pflegten. Ein Glück, dass Ihr von allein die Kraft fandet, in Eurem Zustand aus Grube und Urwald zu uns zu finden. Nun sollen meine drei liebsten Diener Euch ein wohltuendes Bad bereiten und für Eure Erholung sorgen, ehe Ihr Genaueres erzählen dürft.«
Er rief die drei Erlösten herbei und sie nahmen den Züchter in die Badestube, wo sie ihn entkleideten und in eine goldene Wanne setzten.
»Ich schrubbe Euren Rücken, werter Meister«, sagte der Dunkle, welcher der Panther gewesen war.
»Ich wasche Eure Füße«, sagte der Grünäugige, der einstige Luchs.
»Ich dagegen bin schmal und zierlich«, sagte der Kleine, der vorher als Wildkater durch den Wald gestreift war. »Darum lasst mich zu Euch in die Wanne kriechen, auf dass ich den Schoß säubere.«
Der Pferdezüchter war über die Zuwendung verblüfft und genoss die Pflege, die ihm geschenkt wurde. Bald merkte er, wie Schwämme und Seifen verschwanden und statt derer sanfte Hände seine Haut streichelten. Kräftige Daumen kneteten Sohlen und Schultern, feinfühlige Finger hingegen streichelten seinen Altherrenschweif, bis neue Jugend darin wallte und zu ihrem Recht kommen wollte. Angesichts des erhobenen Fleisches riefen die Diener freudig:
»Wählt den, der Euch am besten gefällt, und tobt Euch in ihm aus!«
Der Alte aber gab vorwitzig zurück:
»Wenn meine Manneskraft schon geweckt ist, dann soll sie in allen dreien wüten!«
Als ob die Diener gehofft hatten, genau jene Worte zu hören, stiegen sie alle zugleich in die Wanne und bewiesen dem Meister, dass ein Mann nur als so alt galt, wie er zu lieben imstande war. Da schwappten warme Wellen umher, es gab ein Planschen und Spritzen und erst zwei Stunden später fand sich der Pferdezüchter – sichtlich erfrischt und mit glühenden Wangen – bei seinem einstigen Rosshüter ein.
»Nun berichte, was dir zugestoßen ist«, bat Engelbert.
»Es geschah mitten im Urwald, als ich den Weg verfehlte und stolperte«, sagte der Pferdezüchter. »Ich wollte mich noch an einem Zweig festhalten, doch der gab nach und ich stürzte in die Tiefe. Zum Glück war der Boden feucht und matschig, sodass ich weich genug landete. Dennoch verbläute ich mir den Rücken und konnte mich eine Zeitlang nicht regen. Auch war mit vom Stolpern der Fuß verstaucht. Ich sagte mir: ›Ehe diese Verletzungen verheilt sind und du dich wieder aufraffen kannst, wirst du verhungert sein. Niemand findet dich hier!‹ Schon schloss ich die Augen und wollte mir einen frühen Tod herbeiwünschen, als ich mich auf die Weisheit der Altvorderen besann, zufolge derer das Benagen von Wurzelwerk nahrhaft sei. Ich tastete im Finstern um mich her und fand allerlei holziges Gestrüpp, an dem ich mich versuchte. Es schmeckte schlecht, aber der Hunger forderte seinen Tribut. Nachdem ich eine Weile an den knochigen Wurzeln genagt hatte, fand ich plötzlich links und rechts von mir zwei starke Äste, die nicht nur stramm aus dem Erdreich ragten, sondern sich überdies warm und weich anfühlten. Um herzhaft hineinzubeißen, fehlte mir die Kraft, also setzte ich die Enden beider Äste an meine Mundwinkel und saugte mal an dem einen, mal an den anderen. Immer wieder trat aus jenen Wurzeln ein sonderbarer Saft, der süß und würzig zugleich war. Mal waren es nur einzelne Tropfen, mal kräftige Schübe, die mich labten. Der Saft jener wundersamen Wurzeln stärkte mich zusehends, bis ich mich endlich erheben und zu euch ins Schloss humpeln konnte.«
Engelbert und der Fürst gaben zu, noch nie eine merkwürdigere Geschichte vernommen zu haben. Der Pferdezüchter aber hob die Hand und meinte:
»Das Allermerkwürdigste folgt erst noch. Eben, als ich mich mit euren drei holden Dienern in der Badestube tummelte, war es mir, als ob mir abermals jene Wurzeln an den Mundwinkeln lägen und ich schmecke noch jetzt den würzig-süßen Geschmack, wie ich ihn im Urwald kostete.«
Der Fürst klatschte sich mit der flachen Hand an die Stirn und rief:
»Ich vermag zu erraten, was das alles bedeutet! Meister, was Ihr in der Grube genossen habt, war kein Wurzelsaft, sondern der Seim strammen Burschenfleisches! Bedenkt jedoch, was das bedeutet – dort neben der Grube sind zwei Männer begraben, die es zu erretten gilt!«
Er ließ die Pferde satteln und zog mit Engelbert und dem Pferdezüchter aus, die Stelle zu finden, wo der Alte auf solch wunderbare Weise vom Hungertod bewahrt worden war. Dank der schnellen Hengste dauerte es nicht lange, bis sie die Grube fanden, und tatsächlich schauten aus dem Erdreich zwei Zipfel heraus, deren Form und Farbe alles andere als wurzelgleich waren.
»Grabt!«, befahl der Fürst den Soldaten, die mitgekommen waren.
Sie nahmen Spaten und Schaufel und wühlten die Erde rechts und links neben der Grube auf. Der Fürst beaufsichtigte sie streng, Engelbert hingegen sah sich um und entdeckte einen Spruch, der in die Rinde eines nahen Baumes eingeritzt war:
»Hier unten ruhen zwei Sünder, die niemand finden soll.«
Engelbert fragte sich, wer jene zwei Sünder wohl wären und was sie bewogen habe, sich ins Erdreich einzugraben. Just gab der Erdwall neben der Grube nach und machte den Blick frei auf zwei winzige unterirdische Höhlen, in denen jeweils ein Bursche lag und schlief.
»Das sind ja Dagobert und Heribert«, riefen Engelbert und sein alter Meister wie aus einem Munde.
Ihre lauten Stimmen weckten die Schlummernden, und als sie aus den Höhlen krochen und erkannten, dass sie entdeckt worden waren, sprachen sie:
»Kurz nachdem wir den Rosshüter in der Wildnis ließen, übermannte uns ein lähmendes Gefühl der Reue. Aus Furcht vor den Bütteln des Gerichts flüchteten wir in den Urwald und vergruben uns in diese Erdhöhlen, aus denen ihr uns nun gegraben habt. Wir wollten dem Schicksal überlassen, was aus uns Sündern wird. Da ihr uns nun gefunden habt und dem Gericht ausliefern werdet, müssen wir erkennen, dass niemand der Gerechtigkeit entkommen kann.«
Als der Fürst hörte, dass dies die Burschen waren, die seinem Bräutigam Drangsal und Leid angetan hatten, wollte er sie fesseln und in den Kerker werfen lassen. Engelbert aber hob die Hand und sprach:
»Wir wollen ordentlich Gericht über Dagobert und Heribert halten. Dabei werden die Richter gewiss anerkennen, dass die zwei, von Reue geplagt, als Selbstgeißelung das unselige Eingraben gewählt hatten. Auch soll nicht unberücksichtigt bleiben, dass sie – wenn auch unwissentlich – unserem Meister dank ihres Saftes vor dem Hungertod gerettet haben.«
Der Fürst erkannte Engelberts kluge Worte an, schickte die Soldaten mit den Gefangenen zum nächsten Gericht und überließ es den unvoreingenommenen Richtern, ein Urteil zu fällen. Zwar verlangten auch sie, gemäß den Statuten des Landes der lila Liebeslust, die Inhaftierung der beiden Burschen. Doch wurde die Strafe in Anbetracht dessen, was sich im Urwald zugetragen hatte, abgemildert. Dagobert und Heribert wurden Lakaien am Fürstenhof, wo sie den drei treuen Dienern zur Hand gehen mussten. Als jene von dem Urteil erfuhren, knurrte der einstige Wildkater voller Groll:
»Sind das die Unholde, die unseren Schützling so arg zugerichtet haben? Wenn ich noch ein Kater wäre, ich wollte ihnen das Gesicht zerkratzen!«
»Und ich würde ihnen den Hals zerbeißen, wäre ich noch ein Luchs«, setzte sein Kamerad hinzu.
»Ich hingegen würde ihnen mit meinen Krallen den Leib aufreißen, besäße ich noch meine Panthergestalt«, rief der dritte Diener.
Bei diesen Drohungen begannen Dagoberts Knie zu schlottern und Heribert machte vor Angst beinahe unter sich. Engelbert trat hinzu und gebot den Dienern, Ruhe zu bewahren.
»Was würde es nützen, Rache zu üben?«, fragte er. »Wir wollen von der Gelegenheit, die uns das Schicksal in die Hände gibt, besseren Gebrauch machen. Auf meinen Wunsch hin sollt ihr, meine drei treuen Diener, Dagobert und Heribert nicht nur zu euren Lakaien haben. Sie sollen auch eure Schüler sein, denn ich wünsche, dass ihr ihnen den wichtigen Unterschied zwischen Spiel und Ernst beibringt, wenn es um Erniedrigung und Demütigung geht.«
Das war weise gesprochen und die Diener gehorchten. Fortan kümmerten sie sich um Dagobert und Heribert mit Strenge und Sorgfalt, bis jene geläutert waren und endlich verstanden, was sich zwischen zwei Männern – im gegenseitigem Einvernehmen – ziemte und was sich schlichtweg nicht gehörte. Die beiden Burschen nahmen sich alles zu Herzen, was sie der einstige Panther, der einstige Luchs und der einstige Wildkater lehrten. Und solltest du einen der beiden einmal treffen, so darfst du gewiss sein, dass du nicht an einen Falschen geraten bist.
***
»Jetzt ist bereits im ersten Märchen des Abends die Ambivalenz des Vertrauensbegriffs thematisiert worden«, ergreift Giovanni das Wort und klingt wie ein Literaturdozent. »Zum einen wurde das blinde Vertrauen Engelberts schamlos ausgenutzt. Zum anderen vertraute er den wilden Katern und das hat zu seinem Glück geführt.«
»Gleich fragst du uns, was wir daraus lernen, gell?«, kommentiert Basil mit einer Mischung aus Spott und Liebenswürdigkeit.
»Nö«, grinst Giovanni. »Ich frage euch nicht, sondern präsentiere gleich meine Deutung: Enttäuschtes Vertrauen darf nicht zu Misstrauen führen, sondern verdient immer eine neue Chance.«
»Riskante Philosophie«, meint Charles, erklärt aber nicht, was genau er damit sagen will.
»Jedenfalls hast du das Motto erfüllt, Margarete«, lobt Wilko. »Wer will der nächste sein?«
Giovanni meldet sich und beginnt, mit sanfter Stimme zu erzählen.
Die beiden wedelnden Wanderer
Berg und Tal begegnen sich nicht, wohl aber die Menschenkinder und darunter besonders jene, deren Wanderlust sie nirgends lange bleiben lässt. Dabei passiert es freilich, dass auch gute und böse Leutchen aufeinandertreffen. So kamen einmal ein griesgrämiger Schuster und ein vergnügter Schneider zusammen. Der Schneider war ein kleiner hübscher Bursche, immer lustig und guter Dinge und nicht abgeneigt, am Wegesrand mit seiner wackeren Schneiderelle zu wedeln, die anders als bei anderen Gesellen seiner Zunft nicht aus Holz, sondern aus Fleisch und Blut war und seinem Schoße entsprang. Mit dieser nahm er oft das Maß an anderen Burschen, anstelle seinen Arm zu gebrauchen. Als er den Schuster bei einer Weggabelung von ferne kommen sah und an dessen Felleisen merkte, was für ein Handwerk er betrieb, rief er ihm ein freches Liedlein zu:
»Ich steck meine Nadel in jedes Öhr,
der Schlag meiner Elle findet Gehör.
Die Schuster, die schlagen mit Lederriemen
und füllen die Löcher mit ihren Pfriemen!«
Der Schuster aber konnte keinen Spaß vertragen. Er verzog das Gesicht, als ob er Essig getrunken hätte, und wollte den Schneider schon am Kragen packen.
»Machst du dich lustig über meine Zunft? Oder meinst du, nur weil deine Elle schon von Weitem wedelt, müsse mein Spitzknochen zurückwinken?«
Denn der Schneider hatte seine Beinkleider noch nicht von seinem letzten Stelldichein mit einem Bauern zugeknöpft gehabt und gar nicht gemerkt, dass er mit entblößtem Schoß vor dem Schuster stand. Der kleine Geselle fing aber an, versöhnlich zu lachen und reichte dem Schuster seine Flasche hin.
»Es ist doch all dies nicht bös gemeint! Trink einen Schluck, ich habe meine Flasche im letzten Dorf mit Wein aufgefüllt. Das soll dir helfen, die Galle hinunterzuschlucken!«
Der Schuster tat einen gewaltigen Schluck und das Gewitter auf seinem Gesicht verzog sich.
»Die Flasche hat mir gut getan, mit solcherlei Getränk lässt es sich gut spazieren. Wollen wir zusammen wandern?«
»Mir ist’s recht«, antwortete der Schneider, denn er hoffte, dass sein neuer Kamerad ebenso gern wedelte wie er und sie gemeinsam viel Spaß haben würden. »Wenn du nur Lust hast, in eine große Stadt zu gehen, wo es an Arbeit nicht fehlt«, fügte er hinzu.
»Gerade dahin wollte ich auch«, antwortete der Schuster, »denn in einem kleinen Nest ist nichts zu verdienen. Auf dem Lande laufen die Leute lieber barfuß.«
Der Schneider nickte und pflichtete ihm bei:
»Gar zu oft sparen sie auch an Ausbesserungen oder neuen Kleidern, drum kann auch ich keine gute Arbeit im Dorfe finden. Gerade im Sommer ergötzen sie sich an der blanken Haut, die durch die Lumpen hindurch schimmert, und finden ihre Lust daran!«
Sie wanderten also zusammen weiter und setzten immer einen Fuß vor den anderen, wie es jeder tut, der voran will. Von Dorf zu Dorf zogen sie, grüßten die Leute und fragten nach Arbeit. Der muntere Schneider mit seinen roten Backen und seinem wackeren Ellenstab wedelte den Bauernburschen zu, die sich daraufhin gern die Löcher in ihren Latzhosen stopfen ließen und den Wandersmann mit Geld und Wein, Wurst und Kuss bezahlten. Doch immer, wenn der Schneider hernach mit dem Schuster zusammentraf, sah er, dass jener wegen seiner Griesgrämigkeit kaum Leute fand, die ihm einen Auftrag geben wollten, und sein Bündel darum klein und die Beschäftigung seines Spitzknochens dürftig blieb. Der Schuster wiederum schnitt beim Anblick des reichlichen Lohns vom Schneider ein schiefes Gesicht und brummte:
»Je größer die Elle, desto größer auch der Schelm.«
Da erkannte der Schneider, dass er einen mieslaunigen Kameraden hatte, der ihm sein wackeres Werkzeug und dessen vergnügliche Arbeit neidete. Doch ließ der Schneider sich davon nicht verdrießen. Er teilte kameradschaftlich seinen Lohn und mit jedem Schluck Wein, den der Schuster nahm, besserte sich auch dessen Laune und er wurde erträglich. Und hatte der Schneider mal ein paar Groschen mehr in der Tasche als der Kamerad, so lud er ihn in die Schänke ein, denn er wollte dem Griesgram dazu verhelfen, ein fröhlicherer Mensch zu werden. Und bald schaffte er es auch, dass der Schuster seinen Spitzknochen auspackte und damit wedelte, wenn auch sein Werkzeug längst nicht so wacker erschien wie das des Schneiders.
Als sie eine Zeitlang gewandert waren, kamen sie an den Rand eines großen Waldes, durch welchen man gehen musste, um zur großen Königsstadt zu gelangen. Es spaltete sich aber der Weg und es führten derer zwei hindurch. Aus dem Dorfe wussten die beiden Wanderer, dass ein Weg sieben Tage dauerte, der andere nur zwei, aber niemand von ihnen wusste, welcher nun der kürzere war. Die zwei Wanderer setzten sich unter einen Eichenbaum und beratschlagten, was sie tun und wie viel Brot sie kaufen wollten. Der Schuster sprach:
»Man muss weiter denken als man geht, deshalb will ich für sieben Tage Brot mitnehmen.«
Er stand auf und lief zurück ins Dorf, wo er beim Bäcker sieben Laibe kaufte. Der Schneider hingegen sagte zu sich:
»Für sieben Tage Brot auf dem Rücken schleppen wie ein Lasttier? Dabei kann ich mich ja kaum umschauen und keine kecken Burschen finden, denen ich mit meiner wackeren Schneiderelle zuwedeln kann! Ich spare mir das Geld, bevor das Brot hart wird oder schimmelig. Zwei Laibe sollen mir reichen!«
Er lief ebenfalls zurück ins Dorf, ließ sich zwei Brote backen, und derweil sie im Ofen schön knusprig braun wurden, vergnügte er sich mit dem Bäcker zwischen Teig und Mehl, dass es nur so stiebte. Der Schuster wartete verdrießlich unterm Eichenbaum, bis sein Kamerad endlich zurückkam.
»Wenn du deinen lasterhaften Lüsten stets nachgibst, wird für dich auch der zweitägige Weg noch sieben Tage dauern«, brummte er tadelnd, doch der Schneider ließ sich nicht beirren.
»Am Spaß vorbeizulaufen ist nicht meine Art«, lachte er.
Der Schuster fühlte sich ob dieser Worte beleidigt und dachte:
›Na warte, Bürschlein, ich werde deinen Spaß noch zu hemmen wissen.‹
Dann gingen sie auf gut Glück in den Wald hinein und wählten den breiteren Weg linkerhand. In dem Wald war es still wie in einer leeren Kirche. Kein Windchen wehte, kein Bächlein rauschte, kein Vögelchen sang und kein Sonnenstrahl drang durch die dichtbelaubten Äste. Der Schuster schnaubte nur kurz:
»Hier hat unsereins wenigstens Ruh!«
Er ging voran, das Brot drückte auf seinen Rücken und der Schweiß floss über sein verdrießliches Gesicht. Der Schneider aber blieb munter, sprang daher, pfiff auf einem Blatt oder sang ein Lied und hielt Ausschau, ob irgendwo ein zartes Blümelein zu bestaunen war. Des Abends suchten sie sich einen Platz, zumeist bei umgestürzten alten Bäumen, und zündeten dort ein Feuerchen an. Daran wärmten sie sich und aßen ihr Brot und der Schneider lud den Schuster ein, mit ihm das Werkzeug zu wedeln.
»Lass uns die Abgeschiedenheit ausnutzen und das Leben genießen. Hier brauchst du dich nicht zu schämen, keiner kann uns sehen«, sagte der Schneider, denn er glaubte, der Griesgram sei nur deswegen so mürrisch gewesen, weil er seinen kleinen Spitzknochen vor anderen nicht zeigen mochte.
Doch auch diesmal lehnte der Schuster ab und der Schneider musste sich allein begnügen. So ging es auch am zweiten Abend, doch am dritten stellten sie fest, dass der Wald noch lange kein Ende nehmen wollte. Da fiel dem Schneider das Herz doch eine Armlänge tiefer herab. Indessen verlor er nicht den Mut, sondern verließ sich drauf, dass im Schuster die Gutherzigkeit siegen würde. Der stellte sich tatsächlich freundlich, als er am Feuer den hungrigen Schneider sitzen sah, und bot ihm eines seiner Brote an:
»Iss dich satt und dann gibst du mir von deiner Flasche Wein und wedelst meinen Spitzknochen für mich. Ich bin nämlich nur müde vom Wandern, deshalb kann ich abends nie mit dir gemeinsam Spaß haben. Nimmst du mir aber die Arbeit ab, will ich das Leben genießen, wie du es tust.«
Der Schneider ging froh auf den Handel ein. Das Brot schmeckte ihm und einen fremden Spitzknochen zu wedeln machte ihm nichts aus. Der des Schusters war zwar klein, lag ihm aber gut in der Hand und das Hin und Her und Auf und Ab ging hurtig voran. Dem Schneider war sogar, als ob ein zufriedenes Lächeln um den Mund des Kameraden spielte, und glaubte, nun endlich dessen Herz und Freude erweckt zu haben.
Am vierten Tag war es beinahe wie am vorigen, nur bestand der Schuster diesmal darauf, dass sein Kamerad erst ein Brot erhalten sollte, nachdem er ihm seinen Spitzknochen gewedelt hatte. Der Schneider ging darauf ein, doch wie staunte er, als am Ende seiner Arbeit die weiße Schustersuppe auf dem Brot landete, was ihm zugedacht war. Da musste er in den nassen Teig beißen und schmecken, wie schlecht Schustersuppe und Brot zusammenpassten. Sein Kamerad aber lachte böse über den Anblick und rief:
»Nun schlucke, was du verdient hast! Oft genug hast du mich zum Wedeln aufgefordert, jetzt merkst du, was du davon hast.«
Am fünften Tage hatten sie nur noch einen Laib übrig, und mit dem war es merkwürdig. In der einen Hälfte war am Ende ein Loch, aus der es wässrig tropfte. Das hatte aber der Schuster gepult, um seinen Spitzknochen hineinzustecken. Lachend teilte er dem Schneider jenen verdorbenen Teil des Laibs zu, während er selbst das frische verschlang. Und wie sie da am Feuer saßen und jeder nur eine Hälfte Brot gegessen hatte, hörten sie ihre Mägen knurren, denn sie waren nicht satt. Der Schneider seufzte betrübt, der Schuster aber machte einen grausigen Vorschlag:
»Du hast eine wackere Elle, wie man selten eine sieht. Keinen kümmert’s, was daneben noch lagert. Da wird es dir wohl nichts ausmachen, von deinen zwei Nähkissen, die dir darunter baumeln, etwas abzugeben? Ich will dir eines abschneiden, das können wir braten und verspeisen.«