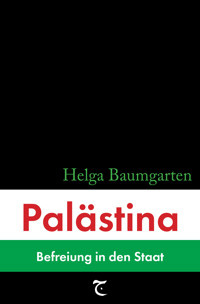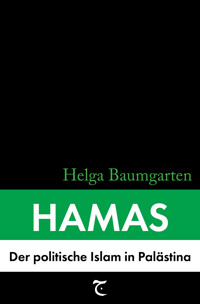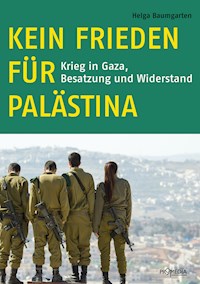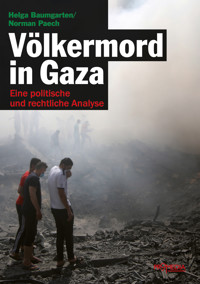
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Antwort auf das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 begann Israel mit der Bombardierung des Gazastreifens. Aus dem Rachefeldzug ist ein unvorstellbarer Völkermord geworden. Die komplette Zerstörung der Infrastruktur hat den Landstrich unbewohnbar gemacht. Krankenhäuser, Straßen, Schulen, Moscheen und Kirchen sowie mehr als die Hälfte aller Wohnhäuser liegen laut UNO in Schutt und Asche. Helga Baumgarten und Norman Paech zeigen auf, wie und warum das israelische Regime diesen Völkermord begonnen hat. Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil unternimmt Helga Baumgarten eine politische und ökonomische Analyse des israelischen Siedlerkolonialismus mit seiner zunehmend rassistischen Ausprägung gegen arabische und muslimische Menschen. In Teil 2 bietet Norman Paech die erste in die Tiefe gehende historisch-juristische Analyse der israelischen Politik auf der Basis des internationalen Rechts. Er untersucht dabei die juristischen Grundlagen dieses Konflikts, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zwischen jüdischen Siedlern und der arabischen Bevölkerung besteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Helga Baumgarten/Norman PaechVölkermord in Gaza
© 2025 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
Umschlaggestaltung: Gisela Scheubmayr
Coverfoto: Shutterstock
ISBN: 978-3-85371-927-5(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-542-0)
Der Promedia Verlag im Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über die AutorInnen
Helga Baumgarten, geboren 1947 in Stuttgart, ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Seit 1993 (emeritiert 2020) lehrt sie an der Universität Birzeit im Westjordanland; sie lebt in Ost-Jerusalem. Sie veröffentlichte bei Promedia das Buch »Kein Frieden für Palästina. Der lange Krieg gegen Gaza. Besatzung und Widerstand« (3. Auflage 2023).
Norman Paech, geboren 1938 in Bremerhaven, studierte Rechtswissenschaften. Als Völkerrechtler lehrte er an der Universität Hamburg und zog über die Linksfraktion im Jahr 2005 als außenpolitischer Sprecher in den Deutschen Bundestag ein. Im Jahr 2010 nahm er auf dem Schiff Mavi Marmara an der Gaza-Hilfsflotte teil.
gewidmet den Kindern Gazas
Helga Baumgarten: Völkermord in Gaza – eine historisch-politische Analyse
Vorwort
Völkermord in Gaza, Menschen werden erbarmungslos in den Tod gebombt, der Gazastreifen wird zu einem Kinderfriedhof.
Nach dem Oktober 2023 schickte die deutsche Regierung mehr Waffen als in den vorangegangenen Jahren nach Israel. Der deutsche Kanzler behauptet weiter ungeachtet der Realität, Israel halte sich strikt an das geltende internationale Recht. Die deutsche Außenministerin pilgert nach Tel Aviv und Jerusalem, um die israelische Regierung der unverbrüchlichen Freundschaft Deutschlands zu versichern. Die deutsche Presse ist auf einem Auge blind und will nicht sehen, was im Gazastreifen passiert.1
Wieder einmal in der deutschen Geschichte gibt es eine Gruppe von Menschen, die man entmenschlicht, dehumanisiert. Im Nazi-Deutschland waren es die Juden, heute sind es die Palästinenser und mit ihnen pauschal alle Muslime (dabei vergisst man geflissentlich, dass es in Palästina Christen gibt und dass der christliche Glaube in Bethlehem bzw. in Jerusalem mit Jesus seinen Ursprung hat2), die nicht mehr als gleichwertige Menschen gesehen und behandelt werden: Antisemitismus wird durch Islamophobie und »Anti-Palästinismus« ersetzt. Rassismus bestimmt große Teile der deutschen Gesellschaft. Vor allem die deutschen Rechtsextremen haben inzwischen gleich zwei Zielgruppen für ihre rassistische Menschenverachtung: Juden und Muslime.
Dieses Buch setzt ein Zeichen gegen all diese unsäglichen Entwicklungen, von Rassismus bis zur Kriegsbegeisterung. Auf den folgenden Seiten sollen die Menschen im Mittelpunkt stehen, soll am Beispiel des Siedlerkolonialismus zwischen Mittelmeer und Jordantal gezeigt werden, was die palästinensische Gesellschaft seit Ende des 19. Jahrhunderts an Unterdrückung, Gewalt und ständigen Demütigungen zu erleiden hatte.
Gefragt wird nach den Möglichkeiten der Veränderungen, gefragt wird, wer dabei die entscheidenden Akteure sind: in der israelischen Gesellschaft, international und vor allem im deutschsprachigen Raum. Gefordert wird ein Ende des Siedlerkolonialismus, der Freiheit für die Menschen vor Ort grundsätzlich verhindert. Gefordert wird aber auch, dass im ehemals kolonialen Norden die Eliten in Regierung und Presse endlich ihre kolonial geprägte Überheblichkeit überwinden. Gefordert wird, dass der Druck aus den Gesellschaften im deutschsprachigen Raum so stark wird, dass Regierung, Opposition und Medien keine andere Wahl haben, als zu akzeptieren, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser, dass die Araberinnen und Araber, dass alle Menschen im globalen Süden, vor allem aber, dass die Kinder in Gaza gleichwertige Menschen sind. Gefordert wird, dass die Menschen im Norden erkennen: sie sind nicht besser als der Rest der Welt. Liberté, égalité, fraternité: Diese bis heute revolutionären Forderungen aus dem Frankreich des Jahres 1789 müssen endlich aufhören, leere Parolen zu sein.
HelgaBaumgartenOstjerusalem, imJanuar2025
1 Annette Groth. 2024. »Die anhaltende Hölle für Gazas Bevölkerung darf nicht vergessen werden!«, in: NachDenkSeiten, 11. Dezember. https://www.nachdenkseiten.de/?p126055
2 Wir warten alle auf Pfarrer Munther Isaacs Weihnachtspredigt zum Völkermord, Jahr 2, aus Bethlehem. Hier noch einmal seine Weihnachtspredigt 2023. »Christus unter den Trümmern: Weihnachtspredigt in der Lutherischen Kirche in Bethlehem«, https://forum-friedensethik.de/christus-unter-den-truemmern-weihnachtspredigt-in-der-lutherischen-kirche-in-bethlehem/
Kapitel 1: Die historischen Anfänge des Siedlerkolonialismus
Siedlerkolonialismus in Palästina; Unterstützung des Siedlerkolonialismus durch Europa und die USA; Die Anfänge der palästinensischen Nationalbewegung 1897−1947/48: Widerstand gegen Siedlerkolonialismus
Siedlerkolonialismus in Palästina und Unterstützung durch Europa und die USA
1897 fand in Basel/Schweiz der Gründungskongress für die zionistische Bewegung unter der Ägide seines ideologisch-programmatischen Vaters Theodor Herzl statt. Die Ziele der neuen zionistischen Bewegung waren für jeden unübersehbar klar. Palästina sollte in einen jüdischen Staat transformiert werden. Für die palästinensische Gesellschaft, für die indigene Bevölkerung, gab es dort keinen Platz. Sie gehörten zu den »Barbaren«, gegen die der jüdisch-zionistische Staat eine Mauer bilden sollte. Auf der einen Seite der neue Staat, der sich als Teil des kolonialistischen Westens, der »Zivilisation«, verstand; auf der anderen Seite die arabische Welt, die Welt der »Barbaren«. Dorthin sollten alle Palästinenser in einem »Bevölkerungstransfer« gebracht werden.
Die kolonialistische Programmatik, die Herzl in seinen entscheidenden Schriften, »Der Judenstaat« von 1896 sowie dem utopischen Roman »Altneuland« von 1902, entwickelte, ist für jeden aufmerksamen Leser deutlich entfaltet. Im Kapitel »Der Plan« in »Der Judenstaat« wird klar ausgedrückt, dass es um die Schaffung eines Staates mit voller Souveränität geht und dass dieser Staat »unter dem Protectorate der europäischen Mächte« stehen soll.
Herzl war sich bewusst, dass die zionistische Bewegung die Unterstützung mächtiger europäischer Staaten brauchte. Er versuchte, diese Unterstützung zu bekommen, zuerst im Deutschen Reich. Als er damit gescheitert war, konzentrierte er seine Anstrengungen auf Großbritannien. Dort war er letztendlich, auch wenn sich der Prozess relativ lange Jahre hinzog, erfolgreich.
Noch ehe es zu dieser vollen Unterstützung des zionistischen Projektes kam, erfolgte die erste klare palästinensische Kritik an den Plänen Herzls aus Jerusalem und zwar durch Yusuf Diya-addin al-Khalidi. Am 1. März 1899 schrieb er einen Brief3 an den französischen Oberrabbiner Zadok Kahn, der ein enger Freund Herzls war. Dieser leitete den Brief weiter.
Wie argumentierte Yusuf al-Khalidi? Er begann taktisch sehr klug, indem er darauf hinwies, dass Juden wie Araber in Abraham einen gemeinsamen Vorfahren hätten und deshalb Cousins seien. Und er gestand der zionistischen Bewegung auch zu, dass sie historische Rechte auf Palästina hätte. Allerdings, und dann ging er zur zentralen Kritik über, existiere eine neue Realität in Palästina, und Herzl und die zionistische Bewegung hätten keine Alternative, als sich mit dieser zu konfrontieren.
Palästina sei Teil des Osmanischen Reiches, vor allem aber sei es nicht von Juden, sondern von anderen Menschen bewohnt. »Diese Realität … bietet dem Zionismus keine Hoffnung auf Realisierung« seiner Ziele. Yusuf al-Khalidi empfahl Herzl deshalb, anderswo nach einem Ort zu suchen, an dem die zionistischen Pläne umzusetzen wären, denn nur dies sei die einzig »rationale Lösung der jüdischen Frage«. Sein Brief endet mit einem dringenden Appell: »Aber, im Namen Gottes, lasst Palästina in Ruhe.«
Zwei Dinge sind erwähnenswert und werden oft übersehen, wenn auf den Brief al-Khalidis Bezug genommen wird. Al-Khalidi macht Herzl darauf aufmerksam, dass es auch in Palästina, wie überall in der Welt, Fanatiker gäbe, die die Juden hassen würden. Er verweist dabei in erster Linie auf fanatische orthodoxe und katholische Christen, aus deren Sicht Palästina nur ihnen gehören würde. Außerdem würden diese Christen keine Chance auslassen, auch Muslime gegen die Juden aufzuhetzen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die wohl größte Fehleinschätzung des sonst fast prophetischen Briefs al-Khalidis. Er warnt nämlich Herzl, dass keine Großmacht bereit sei, mit Waffen und Soldaten für die Schaffung eines jüdisch-zionistischen Staates in Palästina zu kämpfen. Dies treffe insbesondere auch auf die den Juden am meisten gesonnenen Staaten wie Großbritannien und die USA zu.
Theodor Herzl schickte folgende Antwort4 an Yusuf al-Khalidi: Sein Hauptargument ist, dass »die indigene Bevölkerung realisieren müsse, welche wunderbaren Brüder sie bekäme, genau wie der Sultan treue Bürger erhielte, die diese osmanische Provinz, ihr historisches Vaterland, zur Prosperität bringen würden.« Außerdem weist er darauf hin, wie »friedlich (die Juden) seien und dass sie einfach nur in Ruhe gelassen werden wollten. Es bestehe deshalb absolut kein Grund, sich vor ihrer Einwanderung zu fürchten.«
Interessant, wie er auf das Argument al-Khalidis bezüglich der Existenz einer indigenen Bevölkerung eingeht. Zum einen nennt er sie schlicht »die nicht-jüdische Bevölkerung«. Zum zweiten weist er entschieden zurück, dass irgendjemand vorhabe, »sie zu vertreiben.«
Ganz im Gegenteil, so Herzl: der Preis ihres Landbesitzes würde sich innerhalb von Monaten vervielfachen. Schließlich betont Herzl, dass die heiligen Stätten in Jerusalem der ganzen Welt gehörten, den Muslimen genauso wie den Christen und den Juden. »Der universelle Frieden, auf den alle guten Menschen hofften, würde sein Symbol in der brüderlichen Einheit an den heiligen Stätten finden.«.
Zum Vorschlag Yusuf al-Khalidis einer »rationalen Lösung der Judenfrage« antwortet Herzl mit Erstaunen und einer impliziten Drohung: Einerseits meint er, dass die zionistische Bewegung kein Problem haben würde, einen anderen Ort für die Realisierung ihrer Pläne zu finden. Allerdings weist er darauf hin, dass der Sultan und das Osmanische Reich enorme Vorteile hätten, würden sie die zionistische Bewegung willkommen heißen. Dabei weist er nicht zuletzt auf die Möglichkeit hin, dass die Pforte eben damit ihre finanziellen und ökonomischen Probleme lösen könne.
Wie ist dieser Brief zu interpretieren? Wir können uns nur der Bewertung5 von Rashid Khalidi anschließen:6 »Herzl unterschätzte seinen Briefpartner.«7 Yusuf al-Khalidis Brief zeigt deutlich, dass er sehr genau verstanden hatte, dass es keineswegs um die Einwanderung einer begrenzten Zahl von Juden ging, sondern vielmehr um die Transformation des gesamten Landes in einen jüdischen Staat. Die Antwort Herzls ließ für al-Khalidi deshalb nur zwei Folgerungen zu: Entweder wollte ihn der zionistische Führer täuschen, indem er die wahren Ziele der zionistischen Bewegung zu unterschlagen versuchte. »Oder aber er meinte, Yusuf al-Khalidi und überhaupt alle Araber Palästinas seien es nicht wert, ernstgenommen zu werden.«8
Rashid Khalidi kritisiert die selbstgefällig-herablassende Einstellung kolonialer Europäer des 19. Jahrhunderts, die meinten, sie könnten die Palästinenser bestechen und gleichzeitig an der Nase herumführen bezüglich der zionistischen Pläne und des zionistischen Denkens. Entscheidend ist, dass diese Haltung und die davon geprägte Politik bis heute andauern. Sie bestimmt nach wie vor die Ideologie und Politik Israels und der sie unterstützenden Staaten wie die USA und die europäischen Länder.9
Zum Schluss betont Herzl, dass dies zweifellos die letzte Chance für Istanbul sei und er spreche in diesem Brief als Freund der Türken. Sein letzter Satz enthält schließlich eine vage implizite Drohung: »Erinnert Euch daran!«
Im Rückblick lässt uns eine Inschrift in Salzburg innehalten und fragen, wie anders sich die Geschichte Palästinas hätte entfalten können ohne den virulenten Antisemitismus in Europa, nicht zuletzt in Österreich-Ungarn.
In dieser Inschrift lesen wir nämlich: »In Salzburg brachte ich einige der glücklichsten Stunden meines Lebens zu. Ich wäre auch gerne in der schönen Stadt geblieben. Aber als Jude wäre ich nie zur Stellung eines Richters befördert worden.«10 Herzl schrieb diese denkwürdigen und historisch so bedeutsamen Sätze über seine kurze Arbeit in Salzburg im Sommer 1885.
Ilan Pappe zeigt einen weiteren – und meist systematisch ausgeklammerten – Ursprung des Zionismus auf, wenn er auf die evangelikalen Christen und ihre ideologischen und politischen Aktivitäten hinweist, die um ihre Unterstützung einer Rückkehr der Juden nach Palästina kreisten.11 An dieser Stelle kann aus Platzgründen nicht weiter darauf eingegangen werden. Entscheidend für unsere Analyse ist die Entwicklung der Agitation der zionistischen Bewegung und Herzls, nicht zuletzt durch ihre Lobbyarbeit in Großbritannien, die über eine längere Periode hin zur Balfour-Erklärung führte. Ilan Pappe betont die zentrale Rolle eines britischen Papiers aus dem Jahre 1915, »Die Zukunft Palästinas«, ein Memorandum12 verfasst von Herbert Samuel. In diesem Memorandum fasste Samuel im Auftrag der zionistischen Bewegung deren Ansprüche zusammen. Sie sollten »die Basis für die Diskussion der zukünftigen Politik Großbritanniens gegenüber Palästina werden.«13
1918 hatte Großbritannien ganz Palästina militärisch besetzt. Im Anschluss daran einigte es sich mit seinen Verbündeten aus dem Ersten Weltkrieg und mit dem Völkerbund, dass es im Rahmen eines zu errichtenden Mandates frei über die Zukunft des Landes entscheiden könne. Dies wurde schließlich eine völkerrechtliche Grundlage für die weitere Politik in Palästina, indem die Balfour-Deklaration 1922 direkt in den offiziellen Text der Mandats-Charta aufgenommen wurde. Herbert Samuel wurde 1920 zum ersten »High Commissioner« (Hochkommissar) Palästinas ernannt und garantierte für die kommenden Jahre die pro-zionistische britische Politik.
Ein kaum bekanntes, aber folgenreiches Abkommen für die direkt betroffenen Menschen war die französische Überlassung von sieben libanesischen Dörfern an der Grenze zwischen dem – laut Sykes-Picot Abkommen – französischen und dem britischen Gebiet an Großbritannien.14 Der Druck der zionistischen Bewegung hatte dazu geführt, dass Großbritannien dieses Ansinnen an Frankreich stellte, das problemlos positiv beschieden wurde. Eine neue Grenzlinie, die Paulet-Newcombe-Linie, wurde gezogen und damit wurden paradoxerweise sieben libanesisch-schiitische Dörfer und alle ihre Bewohner auf einen Schlag zu Palästinensern gemacht. Interessanterweise behielten sie jedoch ihre libanesischen Ausweise. Dies sollte 1948 von Relevanz werden. Und 2024 spielten eben diese Dörfer eine wichtige Rolle bei den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Hizbollah und Israel. Aber darüber mehr in den kommenden Kapiteln.
Zusammenfassend können wir für die Periode 1897 bis 1917/1922 die Schlussfolgerung ziehen, dass die historisch erste zionistische Lobby in Großbritannien bis 1917 erstaunliche Erfolge erzielte:
Herzl und die von ihm inspirierte Lobby in Großbritannien formulierten die zionistischen Ziele klar und deutlich.Die zionistische Lobby konnte die Regierung in London überzeugen, dass die Ziele der zionistischen Bewegung mit den strategischen Zielen Großbritanniens in Palästina und generell in Westasien identisch waren.Parallel dazu gelang eine vollständige Marginalisierung der Palästinenser, gemeinsam von der zionistischen Bewegung und von der neuen Kolonialmacht in Palästina durchgesetzt.Der entscheidende völkerrechtliche Erfolg der zionistischen Bewegung und der neuen Kolonialmacht bestand darin, dass die Balfour-Deklaration vollständig in den Text des Mandats integriert wurde.15Damit war das siedlerkolonialistische Regime, getragen durch die zionistische Bewegung und unterstützt durch die kolonialistische »Mandatsmacht« Großbritannien etabliert. Dieses Regime dauert bis heute an. Die entscheidende Unterstützung – militärisch, politisch und finanziell – kommt seit 1948 bzw. vor allem seit 1967 aus den USA. Die europäische Unterstützung setzt sich ebenfalls fort. Inzwischen spielt Deutschland hier die führende Rolle.16
Die palästinensische Nationalbewegung: 1917 bis 1948
In dieser Arbeit geht es um den Völkermord in Gaza seit dem Oktober 2023. Aus diesem Grund sollen hier nur die Perioden und Aspekte analysiert werden, die uns erlauben, die Herausbildung des palästinensischen Widerstandes gegen den zionistisch-israelischen Siedlerkolonialismus besser zu verstehen.
Marginalisierung der Palästinenser unter der kolonialistischen Mandatsherrschaft17
Zwei Entwicklungen unter der britischen kolonialen Mandatsherrschaft sind zentral.
Herbert Samuel als erster Hochkommissar (1920−1925) in Jerusalem förderte die zionistische Einwanderung. Er unterstützte alle relevanten institutionellen Entwicklungen für einen jüdischen Staat. Und der Hochkommissar von 1932 bis 1937, Arthur Grenfell Wauchope18, etablierte, bewaffnete und schulte schließlich eine zionistische Gruppe,19 die »jüdische Siedlungspolizei«, als Vorläufer für eine Armee. Damit machten die britischen Hochkommissare von Samuel bis Wauchope und danach den Weg frei für die Implantierung des vor-israelischen zionistischen Siedlerkolonialismus, nicht nur politisch, sondern auch militärisch.
Parallel dazu wurden die Palästinenser, die indigene Bevölkerung (sie konstituierten 94 % der Bewohner Palästinas am Ende des Ersten Weltkrieges), wie schon in der Periode bis 1917,20 aber nun viel systematischer, auf allen Ebenen marginalisiert: politisch, institutionell und ökonomisch. Der Politizid,21 die Zerstörung der palästinensischen Nation, begann also nicht erst 2001 unter Ariel Sharon.
Widerstand der Palästinenser
Der Widerstand der palästinensischen Gesellschaft entwickelte sich in der Elite und von unten, in der sich radikalisierenden Jugend und der in Entstehung begriffenen Mittelklasse und unteren Mittelklasse22 in den palästinensischen Städten, ebenso wie bei den direkt durch Enteignung und Vertreibung – also durch ethnische Säuberung – betroffenen Bauern in den Dörfern Palästinas, der überwiegenden Mehrheit (zwei Drittel) der bis dato vor allem ländlich geprägten palästinensischen Gesellschaft.
Die palästinensische Elite spielte eine wichtige Rolle in der Vertiefung des kulturellen Bewusstseins, nicht zuletzt durch die verschiedenen Zeitungen, die publiziert wurden: Filastin in Jaffa, herausgegeben von Issa al-Issa, und Najib Nassars al-Karmil aus Haifa. In beiden Zeitungen wurde der Lokalpatriotismus gestärkt. Vor allem aber wiesen Issa al-Issa und Najib Nassar auf die Gefahr der engen Kooperation zwischen den beiden kolonialen Akteuren in Palästina, der britischen Mandatsmacht und der zionistischen Bewegung bzw. dem Yishuv hin. Issa al-Issa hatte schon 1914 in einem Aufmacher in Filastin gewarnt, dass die Palästinenser »eine Nation seien, … die … von der Vertreibung aus ihrem Heimatland bedroht sei«.23
Auf der politischen Ebene organisierte sich eine Opposition, die – letztendlich vergeblich – versuchte, auf der Pariser Friedenskonferenz und im neugebildeten Völkerbund die palästinensischen Forderungen nach Selbstbestimmung und gegen den britischen und zionistischen Kolonialismus vorzubringen. Im Lande selbst wurden neue oppositionelle palästinensische Institutionen geschaffen: die Muslimisch-Christlichen Assoziationen, die von 1919 bis 1928 insgesamt sieben Kongresse abhielten und die eine arabische Exekutive bildeten für Verhandlungen mit der britischen Kolonialmacht. Die Palästinenser forderten Unabhängigkeit, eine palästinensische Regierung, Beendigung der jüdisch-zionistischen Einwanderung inklusive der massiven Landkäufe und damit die vollständige Zurücknahme der Balfour-Erklärung. Die britische Kolonialmacht wies all diese Forderungen kategorisch zurück. Sie verweigerte den Kongressen und ihrer Führung jegliche Legitimität, bestand stattdessen, ehe sie überhaupt auf Verhandlungen einging, auf der Anerkennung der Balfour-Erklärung und der Bestimmungen der kolonialen Mandatsherrschaft. Damit aber verurteilten sie alle politischen und rechtlichen Interventionen der palästinensischen Elite zum Scheitern.
Aus eben diesem Grund spielten die Demonstrationen, Streiks und die regelrechten Rebellionen und Aufstände mit der damit notwendigerweise einhergehenden Gewalt gegen die koloniale Herrschaft der Briten und der Zionisten eine immer größere Rolle. Vorreiter war zweifellos Scheich Izz-al-Din al-Qassam, der von seiner Basis Haifa aus einen bewaffneten Aufstand vorbereitete. Die britische Unterdrückung sowohl friedlicher Demonstrationen als auch der gewaltförmigen Aufstände war durchgängig hart und brutal.
Die Große Revolte in Palästina: 1936−1939 – DER anti-koloniale Aufstand der Palästinenser
Die Große Revolte von 1936 bis 1939 nimmt in diesem Kontext DEN zentralen Platz ein. Charles Anderson hat sie in seiner Dissertation (2013) und in einem Aufsatz von 2017 völlig neu interpretiert.24 Ich folge hier seiner überzeugenden Argumentation. Die Revolte besteht aus zwei Phasen. Die erste Phase ist ein sechsmonatiger Generalstreik, gekoppelt mit einem bewaffneten Aufstand ab April 1936. Die zweite Phase ist der Aufstand gegen den britischen und zionistischen Kolonialismus vom Herbst 1937 bis Ende 1938/Anfang 1939.
Ein Auslöser für diese Revolte war sicher die bis dato zahlenmäßig größte jüdische Einwanderungswelle nach Palästina. Ein beträchtlicher Teil kam aus Nazideutschland. 1935 war es nämlich aufgrund des »Ha’avara-Transfer-Abkommens«25 möglich geworden, dass deutsche Juden nach Palästina auswanderten und einen Teil ihres Vermögens mitnahmen. Auf diese Weise kamen etwa 100.000 Dollar (139,6 Millionen Reichsmark)26 ins Land als Basis für den weiteren Ausbau des Yishuv.27 Insgesamt wanderten 50.000 deutsche Juden zwischen 1933 und 1939 nach Palästina aus, 20.000 davon mit einem sogenannten »Kapitalisten-Zertifikat«.28
Der palästinensische Generalstreik wurde im April 1936 von den Nationalkomitees in Nablus und Jaffa ausgerufen und verbreitete sich blitzartig im ganzen Land. Überall wurden neue Nationalkomitees geschaffen, in Städten, kleineren Gemeinden und in den Dörfern. In einem ersten Schritt wurde der Hafen in Jaffa lahmgelegt. Läden und Fabriken schlossen, Händler stoppten jegliche Arbeit.
Die Ziele des Streiks waren klar: Druck auf die britische Regierung, um endlich die schon seit Jahren geforderten Konzessionen zu erreichen, vor allem den Stopp der jüdisch-zionistischen Einwanderung. Sehr schnell folgte die Forderung nach vollständiger Unabhängigkeit. Dabei spielten die Partisanen auf dem Land die führende Rolle. Ihr Vorbild war Scheich Izz al-Din al Qassam. Wie oben angesprochen, bereitete er aus Haifa einen landesweiten bewaffneten Aufstand vor. Ehe dieser Aufstand jedoch überhaupt in Gang kam, wurde der Scheich von der britischen Kolonialmacht im November 1935 in Ya’bad bei Jenin getötet.29
Die palästinensische Elite, völlig überrascht von den Ereignissen, schloss sich dem Streik an und bildete das »Arab Higher Committee« unter der Führung von Hajj Amin al-Husseini, in dem zum ersten Mal auch die Opposition, angeführt von den Nashashibis, vertreten war.
Das hervorstechende Charakteristikum war die von unten, also von den Partisanen, geschaffene Infrastruktur. »Neben den Nationalkomitees gab es Komitees zur Überwachung des Streiks, medizinische Hilfskomitees, Komitees für finanzielle Unterstützung, für Versorgung, für Rechtshilfe, für den Boykott jüdischer und britischer Waren, Komitees zur Schlichtung und Lösung von Konflikten, studentische Komitees und Frauenkomitees.«30
Nicht zuletzt diese Vielzahl von Komitees führte zur Verbreitung des Aufstandes und zur organisierten Teilnahme der großen Mehrzahl der palästinensischen Gesellschaft.
Vertreten waren alle, von den Professionellen der Mittelklasse und reichen Händlern bis zu jugendlichen Aktivisten und Arbeitern. Entscheidend war die enge Zusammenarbeit der Komitees mit den bewaffneten Rebellen auf dem Land. Sie wurden in allen Bereichen unterstützt: finanziell, mit Lebensmitteln und mit Waffen und nicht zuletzt mit Informationen. Dabei spielten arabische Polizisten (eigentlich bei der Mandatsregierung angestellt), die zu regelrechten Doppelagenten wurden, eine wichtige Rolle.
Dezentralisation war eine der Stärken der Revolte. Jede Verhaftungswelle resultierte in der Schaffung weiterer Komitees und neuer, nachrückender Aktivisten in diesen Komitees. Weil es keine zentrale Führung gab, konnte die britische Kolonialmacht den Streik und den Aufstand nicht mit einem Schlag beenden.
Probleme innerhalb der Nationalkomitees, zunehmende Spannungen zwischen den städtischen Aktivisten und den ländlichen Rebellen sowie die abnehmende Streikdisziplin ermöglichten dem »Arab Higher Committee«, also der städtischen politischen Elite unter Führung der Notabeln-Familien, wieder die Initiative zu ergreifen und Verhandlungen zur Beendigung des Streiks zu propagieren. Dabei spielten gerade arabische politische Führer eine wichtige Rolle mit ihrer Aufforderung an die Palästinenser bzw. direkt an die Notabeln-Elite, »die Waffen niederzulegen und der britischen Justiz zu vertrauen«.31
Die palästinensische Gesellschaft betrachtete den Stopp des Aufstandes dennoch lediglich als »Waffenstillstand«, als hudna. Die Rebellion sollte weitergehen bis zur Unabhängigkeit und zur Bildung eines palästinensischen Staates, nicht von oben, sondern von unten.
Die Zweite Phase der Revolte: Revolutionäre Staatsbildung von unten
In dieser zweiten Phase der Revolte konnten sich die Rebellen als eigenes Regime etablieren. Überall wurden regelrechte Regierungsapparate aufgebaut. »Sie machten ihre eigenen Vorschriften publik, zogen Steuern ein, suchten Arbeitskräfte zusammen, stellten militärische Einheiten sowie Sicherheits- und Informationsnetzwerke auf und errichteten ein Rebellen-Gerichtssystem.«32
Die Rebellen bzw. ihr mukhabarat (also das Geheimdienst-/Sicherheitsnetz) waren relativ erfolgreich. Selbst die britischen Kolonialherren nannten sie »sehr gut organisiert, korrekt geleitet und mit voller Unterstützung der Gesellschaft (der öffentlichen Meinung).«33 Die Kollaboration mit den Briten nahm rapide ab. Damit konnte die Revolte aufrechterhalten und sogar ausgeweitet werden.
Das Gerichtssystem der Rebellen war in den Augen von Anderson der Höhepunkt ihrer Selbstorganisation und ihrer institutionellen Entwicklung. Die palästinensische Gesellschaft akzeptierte die Rolle der Gerichte uneingeschränkt. Das reflektierte nicht zuletzt das enorme Prestige der Rebellen. Dazu trug vor allem bei, dass die Menschen erkannten, wie diese Gerichte den Armen und Schwachen zum ersten Mal in der Geschichte halfen, die Reichen und Mächtigen zu konfrontieren.
Demgegenüber wurde der koloniale Staat sukzessive zum Rückzug gezwungen. Vor allem auf dem Land gab es zusehends mehr »befreite Gebiete«, wo die Gerichte die Souveränität der palästinensischen Menschen repräsentierten. Ein Staat-im-Entstehen kristallisierte sich heraus.34 Erst die Entwicklungen in Europa und speziell in Deutschland führten zu einer völligen Umkehr der Prozesse, die seit 1937 durch die Rebellen in Gang gesetzt worden waren.
Das Münchner Abkommen vom September 1938 schaffte zunächst Entspannung in Europa und erlaubte Großbritannien, eine zweite Truppen-Division nach Palästina zu entsenden zur Niederschlagung der Revolte. Parallel dazu ging die britische Kolonialmacht zu neuen Formen kollektiver Bestrafung über. Ganze Dörfer und Stadtteile wurden in »Freiluftgefängnisse« verwandelt. Die zionistischen Geheimdienste trugen das ihre dazu bei. Auch konterrevolutionäre palästinensische Kollaborateure machten sich wieder breit. Gleichzeitig kamen weitere Einwanderer aus Ost-Europa und Nazideutschland nach Palästina. Nach Porath35 waren es 1935 genau 66.472 Einwanderer, 1936 etwa 30.000, 1937 etwa 10.630, 1938 knapp 15.000 und 1939 etwas über 31.000.
Trotz der Niederschlagung der Revolte und dem Scheitern ihres Ziels der Unabhängigkeit müssen wir festhalten, dass die Rebellen dabei waren, einen Staat von unten zu schaffen. Anderson weist darauf hin, dass dies immer wieder zu beobachten ist in anti-kolonialen Bewegungen unter Führung von Bauern. Eric R. Wolf hat dazu die relevanten Analysen vorgelegt.36
Die entscheidende Rolle bei der Niederschlagung der Revolte spielte zweifellos das brutale Vorgehen der britischen Kolonialmacht/Armee/Polizei gemeinsam mit zionistischen bewaffneten Kräften.37 Laut britischen Angaben aus dem Jahr 1938 war die Stärke der Rebellen auf etwa 5000 angewachsen. Der rein zahlenmäßigen Überzahl auf Seiten der britischen Armee, unterstützt durch die bewaffneten jüdisch-zionistischen Verbände, die kontinuierlich stärker wurden, konnten sie auf die Dauer nicht standhalten. Ausschlaggebend war die Unterdrückung der Rebellen und der palästinensischen Gesellschaft, in die sie eingebettet waren und die sie unterstützte. Rashid Khalidi spricht zu Recht von einem blutigen Krieg gegen die Palästinenser,38 in dem 10 % der erwachsenen männlichen Bevölkerung Palästinas getötet, verwundet, eingekerkert oder ins Exil verbannt wurden.39
Spontane Hinrichtungen von gefangen genommenen Rebellen, die die Armee oder jüdische Verbände oder Siedlungen angegriffen hatten, wurden zur Normalität. Nach Sabotageakten vor allem gegen die Öl-Pipelines wurden benachbarte Dörfer nachts angegriffen, die Männer gegen die Wand gestellt und oft auf nacktem Rücken ausgepeitscht. Eine besonders brutale Rolle spielte dabei der britische Geheimdienstoffizier Orde Wingate, unter dem immer wieder Massenerschießungen angeordnet wurden. Yigal Allon, der spätere israelische Außenminister, soll an einer dieser Aktionen beteiligt gewesen sein, so Tom Segev.40 Es wird berichtet, dass Soldaten betrunken in palästinensische Dörfer eindrangen, die Menschen dort folterten und die Dörfer ausraubten. Vieles davon geschah offensichtlich auf der Basis der konkreten Erfahrungen der britischen Armee in Irland und in Indien bzw. der Unterdrückung, die dort angewandt wurde, und den Methoden der Unterdrückung, die dort entwickelt wurden.
Wichtig scheint, wieder laut Tom Segev, was im Lexikon der israelischen Armee von 1992 zu lesen ist: »Die Lehre von Orde Charles Wingate, sein Charakter und seine Führung, wurden für viele Hagana-Führer zur Grundlage für ihren Kampf, und sein Einfluss ist in der Kampf-Doktrin der IDF (Israelische Verteidigungs-Truppen, also der israelischen Armee) zu verfolgen.«41
Die Menschen in Gaza heute müssen dazu kein Armee-Lexikon lesen. Denn eben das ist seit dem Oktober 2023 ihre tägliche Erfahrung. Matthew Hughes’ ausführlicher Bericht über die Methoden der Unterdrückung, die 1937/38 in Palästina seitens der britischen Kolonialmacht benutzt wurden, ist hierzu sehr lehrreich. Seit Ende 1937 war die britische Armee »berechtigt zu Durchsuchungen und Verhaftungen, unabhängig von der Polizei. Sie hat das Recht auf jeden zu schießen und ihn zu töten, der versucht, einer Durchsuchung zu entkommen … Granaten können eingesetzt werden, wenn Höhlen, Brunnen etc. durchsucht werden. Seit November 1937 waren Flugzeuge, die bei den Durchsuchungen eingesetzt wurden, mit Bomben ausgerüstet und die Piloten waren angewiesen, ›bewaffnete Gruppen‹ mit Maschinengewehren anzugreifen oder zu bombardieren.«42
Damit stand Palästina während der britischen Kolonialherrschaft unter Kriegsrecht, etwa seit Ende 1937 bzw. spätestens Anfang 1938, zwar nicht de jure, aber de facto.
Hughes zeigt auf der Basis britischer Dokumente im Detail den Horror auf, dem die palästinensische Gesellschaft insbesondere zwischen 1937 und 1939 ausgesetzt war. »Zerstörungen und Vandalismus wurden während der Revolte bei den britischen Operationen gegen die Aufständischen systematisch eingesetzt. Sie wurden legitimiert durch das damals gültige Recht. Neben den Zerstörungen raubten die Soldaten auch das Eigentum der Betroffenen …«
Die schönsten und größten Häuser in den angegriffenen Dörfern wurden gesprengt. Dazu kamen »Vergeltungsaktionen« in Form von massiven kollektiven Geldstrafen, Zwangsarbeit und Dorfbesetzungen, deren Kosten von den Dorfbewohnern getragen werden mussten.
Trotzdem war die Armee anfangs nicht in der Lage, die Rebellen zu schlagen. Aus diesem Grund ging sie zu einer Doppelstrategie von »Rache« und »Kollektivbestrafung« über: Man versuchte, sowohl die Rebellen als auch die Dorfbevölkerung, die sie unterstützten, anzugreifen. Beispiele für die verheerenden Folgen sind das Dorf Beit Rima bei Ramallah oder Halhul im Süden bei Hebron.
Die Dörfer wurden spät in der Nacht angegriffen, Männer und Frauen getrennt und teilweise in regelrechten Käfigen festgehalten. Die Soldaten drangen derweil in die Häuser ein und schlugen alles kurz und klein: »Wir zertrümmerten Garderoben, Spiegel und Möbel – alles, was wir sehen konnten …«. Getreide wurde verbrannt, die Vorräte an Olivenöl wurden über Nahrungsmittel und Kleidung geschüttet. Das schrecklichste Beispiel der Zerstörung ist die Stadt Jaffa im Juni 1936, als die Armee massive Sprengstoffladungen einsetzte und dadurch zwischen 220 und 240 Gebäude (Tom Segev43 spricht von 200, 300 und arabische Quellen sogar von etwa 800 Häusern) explodierten.
Die Zeitung al-Difa’ berichtete darüber: »Goodbye, goodbye old Jaffa, die Armee hat dich in die Luft gesprengt«. Mindestens 6000 Palästinenser verloren ihr Dach über dem Kopf, standen von einem Moment zum anderen ohne alles da. Viele konnten noch nicht einmal ein Minimum an Kleidung retten. Der Vandalismus hatte unermessliche Ausmaße erreicht.
Dörfer, die sich wehrten, wurden dem Erdboden gleichgemacht, wie z. B. das Dorf Mi’ar bei Akka im Oktober 1938. Immer wieder zwang die Armee auch palästinensische Bewohner, ihre Häuser selbst zu zerstören. Palästinenser aus Jerusalem sind damit seit Jahren vertraut.44
Eine englische Lehrerin in Palästina bemitleidete die Soldaten, die nicht wüssten, was sie tun sollten und schlicht gelangweilt waren. Eben deshalb, so ihre Erklärung, seien sie so destruktiv.45
Schon in dieser Periode machte die britische Kolonialherrschaft einen klaren Unterschied zwischen Muslimen, die DER Feind waren, und Drusen und teilweise auch Christen. Drusen wurden als freundlich bezeichnet. Vor allem betonte man, dass sie die Araber, sprich die Muslime, aus tiefstem Herzen hassen. Auch christliche Dörfer rund um die Stadt Nazareth wurden »gelobt«, wie z. B. das Dorf Mghar.
Die heutigen Bewohner des Flüchtlingslagers in Jenin werden erstaunt sein zu erfahren, was die üblichen Praktiken der britischen Kolonialarmee in den 1930er Jahren waren: »Die Armee zwang regelmäßig lokale Araber, mit Militärkonvois zu fahren, um Minen-Angriffe zu verhindern. Oft wurden sie von Soldaten auf die Motorhaube von Lastwagen gebunden oder als Geiseln auf kleine Pritschenwagen vor die Züge gelegt, alles um bewaffnete Angriffe durch Scharfschützen oder Minen zu verhindern.«
Ein britischer Offizier beschreibt das sehr offen: »Die bösen Jungs, die wir in den Gefangenenlagern in Käfigen eingesperrt hatten, wurden in Fahrzeuge an der Spitze unserer Konvois gesteckt, einfach zur Abschreckung.« Schließlich machten sich die Soldaten noch einen letzten »Spaß«: »Wenn die Soldaten am Ziel angekommen waren, bremsten sie ganz hart, damit der Araber auf der Motorhaube herunterfiel und sie gleichsam versehentlich über ihn fahren, ihn töten oder zum Krüppel machen würden.«46
Wie schon ausgeführt, spielte Orde Wingate mit seinen »Special Night Sqads«, in denen britische Soldaten und zionistische Kämpfer zusammen »operierten«, die wohl extremste und grausamste Rolle. Sie peitschten die Menschen aus, folterten sie und richteten sie schließlich hin.
Zwei Beispiele für besondere Gräueltaten führt Hughes an, das Dorf al-Bassa im Distrikt von Akka, nahe der libanesischen Grenze, im September 1938 sowie Halhul bei Hebron im Mai 1939 (wo mindestens 15 Männer, vor allem ältere Männer, auf grausamste Weise umgebracht wurden). Hier kann nur al-Bassa ausführlich gezeigt werden.47
Nach dem Tod von vier britischen Soldaten durch eine Mine, die auf der Straße explodiert war, wollte die Armee Rache nehmen. Das Dorf al-Bassa war das nächste in der Umgebung. Die Armee attackierte zunächst alle Menschen, die sich im Dorf bewegten. Danach wurde das gesamte Dorf völlig niedergebrannt. Abschließend zwang die Armee etwa fünfzig Männer in einen Bus, der über eine vorher gelegte Mine fahren musste. Alle im Bus wurden aus ihren Sitzen geschleudert und regelrecht zerfetzt. Die Dorfbewohner mussten die Reste der Getöteten einsammeln. Danach wurden sie gezwungen, ein Loch zu graben, in das sie die Toten werfen mussten.
In einem Brief in arabischer Sprache, den Hughes zitiert, werden weitere Details gegeben: Vier Männer wurden von der Armee ausgewählt. Sie wurden nackt ausgezogen und die Dorfbewohner mussten sie schlagen, bis sie tot waren. Die Fleischfetzen flogen regelrecht überall hin. Schließlich muss noch auf sexuelle Übergriffe verwiesen werden, die Hughes anführt. Das schlimmste Beispiel dabei ist sicher die Vergewaltigung eines zwölfjährigen Mädchens.48
Ergebnisse bis 1948, dem Jahr der nakba
Charles W. Anderson konnte mit seinen Forschungen auf der Basis neuer Fragestellungen zeigen, was die Ziele der Revolte von 1936−1939 waren: Revolutionäre Staatsbildung von unten. Ihre dezentrale Struktur erlaubte ihr, relativ lange dem Terror und der Unterdrückung durch die kontinuierlichen Gräueltaten des britischen Kolonialismus und der mit ihnen kooperierenden jüdisch-zionistischen Verbände zu widerstehen. Wichtig ist dabei für unsere Analyse, dass die Entwicklungen in Palästina strukturell den Staatsbildungsversuchen bäuerlicher nationaler Befreiungsbewegungen im globalen Süden entsprechen, wie Eric Wolf überzeugend dargestellt hat. Die palästinensische Gesellschaft bildet also wohl keine Ausnahme, wenn sie dem Ansturm der kolonialen Unterdrückungsmaschinerie nicht widerstehen konnte. Das gilt durchaus auch für die palästinensische Elite, die trotz ihrer Versuche, Einigkeit herzustellen, und trotz ihrer Initiativen in Richtung von Verhandlungen brutal unterdrückt und entweder ins Exil verbannt wurde oder aber rechtzeitig flüchten konnte.
Das Ergebnis für die palästinensische Gesellschaft war verheerend, gerade auch für zukünftige Herausforderungen. Die Zerstörungskampagnen durch die britische Armee und die zionistischen bewaffneten Verbände hinterließen zweifellos Traumata in der Gesellschaft. Die Rebellen waren ausnahmslos getötet, die städtische Notabeln-Führung war verbannt oder ins Ausland geflüchtet. Damit war eine tabularasa etabliert, die der zionistischen Führung und dem zionistischen Siedlerkolonialismus freie Hand zur Erreichung ihres Ziels eines jüdischen Staates verschaffte, soweit irgend möglich ohne Palästinenserinnen und Palästinenser.
Siedlerkolonialismus und die Analyse palästinensischer Geschichte und Gegenwart
Auf den vorangegangenen Seiten habe ich immer wieder mit der Terminologie »Siedlerkolonialismus« gearbeitet. Was aber ist Siedlerkolonialismus überhaupt und wie hilft uns der Begriff, zu verstehen, was seit Oktober 2023 in Gaza passiert und welche historischen Entwicklungen dahin führten bzw. notwendigerweise dahin führen mussten?
Folgen wir Patrick Wolfe, dann ist Siedlerkolonialismus ein Konzept, das uns erlaubt, eine besondere Struktur des Kolonialismus zu analysieren, zu verstehen, damit zu arbeiten und auf inhärente Gefahren aufmerksam zu machen.49 Lorenzo Veracini argumentiert in ähnlicher Weise und analysiert damit Siedlerkolonialismus als eine spezielle Form der Herrschaft im globalen Süden unter Kolonialherrschaft bzw. im israelischen Ausnahmefall bis heute.50
Fayez Sayegh benutzte schon 1965 den Begriff Siedlerkolonialismus, um den Zionismus, seine Geschichte und Politik zu verstehen. Damit war er den heute bekanntesten Spezialisten zum Siedlerkolonialismus um Jahrzehnte voraus. Leider zieht man es bis dato im Westen vor, palästinensische Wissenschaftler mit ihren Büchern und Artikeln zu übergehen. Nach der Etablierung des »Palestine Research Center« (PRC/Palästinensisches Forschungszentrum) in Beirut war Sayeghs Buch »Zionist Colonialism in Palestine« (Zionistischer Kolonialismus in Palästina)51 die erste Publikation des Zentrums, welches er ein Jahr lang leitete, ehe sein jüngerer Bruder Anis dessen Leitung übernahm.
Für Sayegh sind es drei essenzielle Charakteristika, die die Struktur des zionistischen Siedlerkolonialismus bestimmen, ebenso wie seine Dynamik, die sich seit Ende des 19. Jahrhunderts und bis heute prozessartig entwickelt hat:
Rassismus gegenüber der endogenen Bevölkerung,Gewalt und Anwendung von Terror gegen die einheimischen Palästinenser,territoriale Expansion, bis mindestens das gesamte historische Palästina »from the river to the sea«, möglichst ohne Palästinenser, in der Hand des zionistischen Siedlerstaates ist.Sayegh war es, der die entscheidende Initiative für die Verabschiedung der Resolution 3379 der UN-Vollversammlung vom 10. November 1975 ergriff, mit der der Zionismus als Rassismus und rassistische Diskriminierung gekennzeichnet und verurteilt wurde. Er war damals UN-Vertreter Kuwaits. Die Resolution wurde übrigens 1991 aufgehoben als Vorbedingung für Israels Teilnahme an der durch die USA einberufenen Madrider Konferenz.
Der zionistische Rassismus bestand für Sayegh in der Selbst-Segregation der Zionisten einerseits, der Ablehnung jeglicher Koexistenz mit der endogenen Bevölkerung andererseits. Daraus musste notwendigerweise ein Prozess der physischen Vertreibung der einheimischen Bevölkerung erwachsen, also ein Prozess der ethnischen Säuberung,52 die bis heute andauert. Patrick Wolfe nennt dies »the elimination of the native« (»die Eliminierung der Einheimischen«). Eben dies führt letztendlich zu einem Apartheidstaat. Besonderes Charakteristikum des zionistischen Apartheidstaates ist, wie schon Sayegh zeigt und wie sowohl Patrick Wolfe als auch Lorenzo Veracini betonen,53 dass, anders als in Südafrika, der zionistische Staat nicht abhängig sein will und nie abhängig wurde von palästinensischer Arbeit bzw. diese konsequent und systematisch ausgrenzt mit dem Schlagwort: Jewish labor only (Arbeit nur für Juden bzw. »Jüdische Arbeit«).
Die Ziele des Siedlerkolonialismus in Palästina konnten wegen der Präsenz der Palästinenser, die bis 1948 die große Mehrheit im Land bildeten, nur mit Gewalt und Terrorismus durchgesetzt werden. Sayegh nennt dafür die Periode 1917 bis 1948 und dann vor allem das Jahr 1948. Aber auch nach der israelischen Staatsgründung wurde diese Gewalt weiter gegen die Palästinenser angewandt, sowohl 1956 bei der kurzen Besetzung Gazas als auch in Israel selbst gegen die Palästinenser, die ja zu Staatsbürgern gemacht geworden waren, selbst wenn sie bis 1966 unter Militärherrschaft standen.
Territoriale Expansion schließlich, die Expansion des zionistischen Staates, bis das gesamte »Erez Israel« unter israelischer Souveränität steht, ist das Ziel, das Israel bis 1967 (und wir müssen hinzufügen, bis heute, 2025) verfolgt. In den Worten von Fayez Sayegh, es ist das »unfinished business« des Zionismus. Je nach ideologisch-politischer Ausrichtung geht es um das historische Palästina »from the river to the sea« bis hin zum zionistischen Programm von 2019, in dem ganz Jordanien, der Südlibanon und das südliche und südwestliche Syrien miteingeschlossen sind und schließlich bis zu den zionistischen Extremisten, die das biblische Konzept »vom Nil bis zum Euphrat« als die Basis ihres Ziels der territorialen Expansion betrachten.
Maxime Rodinson (1969/1973) folgte den Argumenten von Sayegh, allerdings nicht als Tatsachenbehauptung, sondern in Form einer provozierenden Frage, die er zu einem Buchtitel machte: »Israel: A colonial settler state?« (Israel: Ein siedlerkolonialistischer Staat?«). Im Unterschied zur palästinensisch-nationalistischen Analyse von Sayegh ist die Analyse von Rodinson eine im Wesentlichen marxistische. Interessanterweise kommen aber beide zu identischen Ergebnissen.
Abschließend möchte ich die Hauptargumente von Patrick Wolfe und Lorenzo Veracini zusammenfassen. Patrick Wolfes wichtigster Aufsatz trägt den Titel: »Settler Colonialism and the Elimination of the Native« (Siedlerkolonialismus und die Eliminierung des Einheimischen). Das führt notwendigerweise zur Frage, wie diese »elimination of the native« durchgeführt wird. Siedlerkolonialismus, so Wolfe, hat eine eingebaute Tendenz zur Eliminierung, in den Worten von Wolfe, »inhärent im Siedlerkolonialismus ist die Logik der Eliminierung«.
Wichtig für unsere Analyse ist Wolfes Unterscheidung zwischen Eliminierung und Völkermord. Er zeigt überzeugend, dass Siedlerkolonialismus zwangsläufig in Richtung Eliminierung geht. Genau das war das Argument von Fayez Sayegh zum jüdisch-zionistischen Siedlerkolonialismus. Wolfe widmet sich, anders als Sayegh, auch der Frage des Völkermordes; Sayegh hatte wohl in seinen schlimmsten Träumen nicht erwartet, dass die Zionisten einen Völkermord durchführen würden, um ihre Ziele zu erreichen: ein Land, in dem es keine Palästinenser mehr gibt. Das Ergebnis der vergleichenden Untersuchung von Wolfe ist, dass die dem Siedlerkolonialismus inhärente Logik von Eliminierung nicht unbedingt zum Völkermord führen muss.
Die Eroberung von Land und dessen Umwandlung in Territorium unter zionistisch-israelischer Souveränität ist, wie schon Sayegh betonte, das spezifische Merkmal dieses Siedlerkolonialismus. Und im Prozess der Landgewinnung zerstört er systematisch, um die einheimische Bevölkerung durch Siedler zu ersetzen. Und zerstört werden nicht nur die Menschen, auch ihre Wohnorte, ihre Landwirtschaft, ja selbst die Namen ihrer Ortschaften und Regionen.
Herzl schrieb im »Judenstaat«: »Wenn ich an die Stelle eines alten Baumes einen neuen setzen will, muss ich zuerst demoliren und dann construiren.«.54 Meron Benvenisti wiederum berichtet von seinen Aktivitäten im Rahmen der Jugendbewegung seines Kibbutzes:
»Als Mitglied in einer der Pionier-Jugendbewegungen konnte ich selbst ›die Wüste zum Blühen bringen‹. Ich entwurzelte die uralten Olivenbäume von al-Bassa (also genau das Dorf, das 1938 in einem der schlimmsten Massaker zur Niederschlagung der Revolte 1936−1939 zerstört worden war), um Platz zu machen für einen Bananenhain. Denn das waren die Prinzipien meines Kibbutzes Rosh Haniqra, damit die Landwirtschaft von jetzt an nach den richtigen Plänen entwickelt würde.« Benvenisti berichtet weiter von den Aktivitäten seines Vaters, den er begleitete, als dieser das ganze Land durchwanderte, um überall neue Namen (anstelle der alten arabischen Ortsnamen) in die Landkataster einzutragen.55
Wolfe verweist auf zwei weitere wichtige Merkmale der Verbindung von Siedlerkolonialismus und Völkermord. Zum einen muss nicht unbedingt ein Staat als Voraussetzung für den Beginn völkermörderischer Taten vorhanden sein bzw. die Rolle des Staates ist nicht notwendigerweise verknüpft mit dem Prozess, der vom Siedlerkolonialismus zum Völkermord führt.56 Allerdings zeigt das Beispiel Israel seit Oktober 2023, dass der Staat und die staatliche Armee eine zentrale Rolle spielen. Zum Prozess, der eben dahin führte, mehr in den nächsten Kapiteln.
Das zweite wichtige Merkmal, das gerade für unsere Analyse von Relevanz ist, ist die notwendige Unterscheidung zwischen Massenmord und Völkermord.57 In diesem Zusammenhang ist die Arbeit von Raphael Lemkin bei der Herausarbeitung der Definition von Völkermord entscheidend. Völkermord wird nur gegen die Menschen verübt, die Teil eines »tribe«, also eines Stammes sind, was heißt, dass sie für immer Teil dieses Stammes, dieser Gruppe von Menschen, dieses Volkes oder dieser Nation sind. Das führt Wolfe zu einem neuen Begriff, nämlich »structural genocide«, also struktureller Völkermord oder Genozid. Er grenzt sich hier klar ab von Dirk Moses und dessen Definition von »genocidal moments«. Für Wolfe geht es um eine Struktur, durchaus äquivalent zur Analyse von Sayegh, auch wenn dieser in seiner Arbeit nicht bis zur Möglichkeit von Völkermord ging.
Für Wolfe ist abschließend folgende Entwicklung entscheidend: »Wenn Palästinenser zusehends entbehrlich werden, hören Gaza und die West Bank auf, Bantustans zu sein und verwandeln sich mehr und mehr in ›Reservate‹ (wie bei den Indianern in den USA, HB) (oder zum Beispiel in ein neues Warschauer Ghetto).«
Er macht damit eine klare Trennung zwischen Apartheid einerseits, Siedlerkolonialismus und strukturellem Genozid andererseits. Als Beispiele zur Herausbildung dieses Prozesses nennt er den Verweis von Palästinensern auf den südafrikanischen Helden Steve Biko: »Sie warfen Steine und starben dafür«. Und er zitiert Robert Fisk: »Die Todesstrafe ist inzwischen die Routinebestrafung für alle, die Steine auf Israelis werden … und sie wird nicht in Frage gestellt.«58
Fassen wir zusammen. Siedlerkolonialismus ist zweifellos der beste uns zur Verfügung stehende Begriff zum Verständnis israelisch-zionistischer Geschichte und Politik. Fayez Sayegh und sein Buch aus dem Jahr 1965 spielten für die Herausbildung dieses Ansatzes und für seine Anwendung auf Palästina und den Zionismus eine Pionierrolle. Patrick Wolfe nahm den Faden von Sayegh auf und trug zur Klarheit der Analyse durch die Prägung des Begriffs »Logik der Eliminierung« bei. Außerdem können wir auf der Basis seiner Arbeiten eine klare Unterscheidung treffen zwischen Massenmorden und Völkermord im Siedlerkolonialismus und durch den siedlerkolonialistischen Staat.
Schließlich weist Wolfe schon 2006, genau wie Moshe Machover, auf den Unterschied zwischen Siedlerkolonialismus und Apartheid und nicht zuletzt auf den Unterschied zwischen dem Apartheidsystem in Südafrika, wo der schwarze Arbeiter für die Wirtschaft essenziell ist, und dem Apartheidsystem in Israel hin, wo der palästinensische Arbeiter nicht nur nicht essenziell ist, sondern wo er schlicht ausgeschlossen und in letzter Logik eliminiert werden soll. Von daher sollten wir Apartheid in Israel als siedlerkolonialistische Apartheid definieren, mit der ihr eigenen Logik zur Eliminierung aller Palästinenser, egal zu welcher Klasse oder zu welcher sozialen Schicht sie gehören.
Eine aktuelle Analyse des israelischen Siedlerkolonialismus, die vor allem die Besonderheiten dieses historisch letzten siedlerkolonialistischen Beispiels herausarbeitet, legt Tariq Dana vor. Er zeigt »wie eine Kombination ahistorischer Narrative, religiöser Manipulationen, imperialistischer Interessen … zur Herausbildung eines historisch einmaligen siedlerkolonialistischen Projektes geführt haben. Israelischer Siedlerkolonialismus ist nicht nur eine Fortsetzung des Kolonialismus, sondern eine komplexe Anpassung an das Zeitalter der Dekolonisation im Globalen Süden nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei werden historische Narrative des Überlebens und der Rückkehr so manipuliert, dass auf ihrer Basis aktuelle Kolonisation und Eliminierung gerechtfertigt werden können.«59
Unterstützung des zionistischen kolonialen Projektes durch Großmächte: Von der Balfour-Erklärung zur Biltmore-Konferenz, 6.-11. Mai 1942
In seinen programmatischen Reden und Schriften betonte Herzl von Anfang an die Notwendigkeit der Unterstützung des zionistischen Projektes durch Großmächte. Er war schließlich erfolgreich, indem er durch die pro-zionistische Lobby in Großbritannien Unterstützung dafür erhielt.
Ben Gurion als Führer des Yishuv erkannte spätestens in den 1930er Jahren, dass das Ende der weltweiten Hegemonie Großbritanniens bevorstand. Aus diesem Grund konzentrierte er sich auf eine neue Weltmacht, die sich herausbildete, nämlich auf die USA.
»Der prägende Moment in der amerikanischen zionistischen Bewegung«60
An der Biltmore-Konferenz 1942 in New York nahmen sowohl Chaim Weizmann, Präsident der Zionistischen Weltorganisation und der Jewish Agency, als auch David Ben Gurion, Vorsitzender der Zionistischen Exekutive, teil. Außerdem waren sämtliche Vorsitzenden der zionistischen und pro-zionistischen Organisationen der amerikanischen jüdischen Gemeinde vertreten.
Diese Konferenz repräsentierte zwei historische Momente und führte zu einer langfristigen Transformation sowohl in der zionistischen Bewegung in Palästina und später in Israel als auch innerhalb der pro-zionistischen/Pro-Israel-Lobby in den USA.
Die zionistische Bewegung in Palästina beendete die Kooperation mit Großbritannien, stellte eine klare Forderung zur Kontrolle über das gesamte historische Palästina und marginalisierte zionistische Diplomaten wie z. B. Chaim Weizmann: »Diplomatie wurde obsolet – Gewalt und Stärke waren nun an der Tagesordnung.«61
Biltmore repräsentierte für die Lobby in den USA eine prägende Wende, die ihre Zukunft im Prinzip bis heute bestimmen sollte. Ein Zitat des Amerikanischen Jüdischen Kongresses fasst diese Wende folgendermaßen zusammen: »Die USA sind zum wichtigsten Zentrum zionistischer Aktivitäten geworden.«62 Nicht mehr Großbritannien, sondern die USA sollten von nun an die entscheidende Rolle für den Zionismus, für den 1948 gegründeten Staat Israel und für den israelischen Siedlerkolonialismus spielen.
Der Star der Konferenz war Abba Hillel Silver mit seiner Forderung nach Errichtung eines jüdischen Commonwealth im gesamten Mandatspalästina. Vor allem die Basis war absolut begeistert von ihm und von seinen Forderungen.63
Als Ergebnis der Konferenz errichtete die Jewish Agency im Mai 1948 ein Büro in Washington, das im Prinzip nichts weniger war als eine Botschaft. Gleichzeitig wurden von diesem Büro aus alle Lobbying-Aktivitäten in den USA koordiniert. Schon 1939 hatte sich die Jewish Agency als ein »foreign lobbying agent« beim Justizministerium (Department of Justice) registriert. Verantwortlich für das Büro war Nahum Goldmann.
Nach Biltmore wurde eine weitere Lobbying-Gruppe gegründet, der »American Zionist Emergency Council« (AZEC). Daraus entwickelte sich AIPAC – die wichtigste Organisation, die den Rahmen bildet für die Lobby, die sie anführt und die ihre Agenda dominiert.64
Als zweites Standbein bildete sich der christliche Zionismus in den USA heraus. Auf der einen Seite spielte Reinhold Niebuhr als Vater des »Christlichen Realismus« eine entscheidende Rolle. Auf der anderen Seite begannen die Christen in den USA (die christlichste Nation weltweit, so Pappe), dem Zionismus blind zu folgen. Im Kindergottesdienst lernten sie, dass die Juden das erwählte Volk waren. Sie mussten geschützt und unterstützt werden bis zum Wiederkommen des Messias.
Seitdem bildet, so die Argumentation von Ilan Pappe, der Christliche Realismus die ideologische Infrastruktur für die spätere Unterstützung Israels sowie die Brücke zwischen fundamentalistischen christlichen Zionisten und der neokonservativen Rechten.65
3 Der Brief wurde aus Pera, Istanbul (also vom europäischen Teil) geschickt und war auf Französisch verfasst. Das Original des langen, siebenseitigen Briefes befindet sich in den Zentralen Zionistischen Archiven in Jerusalem. Rashid Khalidi zitiert aus der digitalen Kopie des Originals in seinem letzten Buch. The Hundred Years’ War on Palestine, S. 4−8. Er hat mir diese digitale Kopie des Originals freundlicherweise zukommen lassen. Auch im Internet kann man den Originaltext inzwischen finden.
4 Die vollständige Antwort Herzls ist bei Walid Khalidi (ed.). 2005. From Haven to Conquest, S. 91−93, in englischer Übersetzung abgedruckt. Ich zitiere aus dem französischen Original, das im Internet zu finden ist, von mir ins Deutsche übersetzt.
5 Rashid Khalidi. 2020. The Hundred Years War on Palestine, S. 7.
6 Yusuf al-Khalidi (1842−1906) war ein prominenter Politiker im Osmanischen Reich. Rashid Khalidi (geb. 1948) ist ein US-amerikanischer Nahost-Forscher, der aus derselben Familie wie Yusuf al-Khalidi stammt.
7 Hierzu ausführlich Alexander Schölch. 1986. Palästina im Umbruch, v. a. S. 233−236. »Yusuf al-Khalidi war neben seinem Neffen Ruhi zweifellos einer der gebildetsten, intelligentesten und aufgeklärtesten Köpfe, die Jerusalem im 19. Jahrhundert hervorgebracht hat.«
8 Rashid Khalidi. 2020. The Hundred Years War on Palestine, S. 7.
9 Jürgen Mackert. 2024. »This is not Holocaust guilt – it’s entrenched German racist superiority«, in: MiddleEastEye, November 20. https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-not-holocaust-guilt-entrenched-racist-superiority
Joseph Massad. 2024. »Why Dutch support for Israel’s football hooligans has roots in colonial racism.«, in: MiddleEastEye, November 11. https://www.middleeasteye.net/opinion/dutch-support-Israels-football-hooligans-roots-colonial-racism
10 Plakette an einer Hauswand in Salzburg in der Kaigasse 2, Neue Residenz, Mozartplatz, von mir abfotografiert und hier wortwörtlich wiedergegeben. Dazu: https://www.stadt-salzburg.at/index.php?id56794; https://www.derstandard.at/story/975355/vor-einigung-ueber-herzl-gedenktafel-in-salzburg
11 Ilan Pappe. 2024. Lobbying for Zionism on both sides of the Atlantic. S. 1−16 und 94−126. Alexander Schölch 1986 (Neuauflage 1999, unverändert): Europa und Palästina 1838−1917, in: Helmut Mejcher (Hrsg.): Die Palästina-Frage 1917−1948, S. 13−47, hat eben darauf schon lange vor Pappe hingewiesen, allerdings nur kurz in einem bis heute wichtigen Buchkapitel und ohne diese Unterstützer als »zionistische Lobby« zu definieren.
12 Pappe. 2024, S. 37.
13 Pappe. 2024, S. 37: Das Zitat ist eine freie und zusammenfassende Übersetzung aus Pappe.
14 Natasha Metni Torbay. 2024. »En Israel, sept villages libanais annexés«. https://icibeyrouth.com/liban/315303. Dazu auch: Mary Turfah. 2024. »This is what they call it now«, in: ProteanMagazine 1. Februar, https://proteanmag.com/2024/02/01/this-is-what-they-call-it-now-2/. Die Familie von Mary Turfah stammt aus einem dieser Dörfer, aus Salha.
15 Pappe. 2024. Lobbying for Zionism, S. 54
16 Jürgen Mackert. 2024. »What is behind Germany’s complicity in Israel’s Gaza genocide«, in: MiddleEastEye, November 1. https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-israel-gaza-genocide-complicity-what-behind. Derselbe. 2024. »This is not Holocaust guilt – it’s entrenched German racist superiority«, in: MiddleEastEye, November 20. https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-not-holocaust-guilt-entrenched-racist-superiority. SIPRI. 2024. »How top arms exporters have responded to the war in Gaza«, October 1. https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2024/how-top-arms-exporters-have-responded-war-gaza. Das Bild ist teilweise widersprüchlich und nicht abschließend zu klären. Vgl. dazu einmal für die Zeit März bis August 2024: Anna Thalhammer und Uri Blau. »Scholz verspricht Israel Waffen – Scholz verbietet Israel Waffen«, Profil, 15. 9. 2024. https://www.profil.at/ausland/deutschland-liefert-seit-maerz-keine-kriegswaffen-mehr-an-israel/402948362. Dagegen ZDF über die Zeit seit August 2024: Mehr Ausfuhren genehmigt: Deutschland erhöht Rüstungsexporte an Israel. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/ruestungsexporte-ausgeweitet-deutschland-israel-100.html
17 Rashid Khalidi. 2020. The Hundred Year’s War on Palestine, S. 34−54.
18