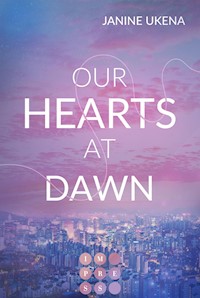12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sylt-Suspense-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Bist du bereit, deine Liebe für die Wahrheit zu opfern? »Vor uns das Rauschen des Meeres« ist der erste New-Adult-Roman der mitreißenden und romantischen Sylt-Suspense-Trilogie von Janine Ukena. Früher war Sophie jeden Sommer auf Sylt – bis zu dem Tag, an dem ihr Vater wegen angeblich illegaler Geschäfte verhaftet wurde und aus ihrem Leben verschwand. Noch heute quälen Sophie die Fragen, was damals wirklich geschah. Als ihr Vater stirbt und sie das Ferienhaus erbt, beschließt sie, zurückzukehren und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nur hat sie nicht mit Maximilian Rose gerechnet, dem Sohn eines reichen Hotelketten-Eigentümers. Als Mittel zum Zweck könnte er ihr bei ihrer Wahrheitssuche extrem weiterhelfen. Doch je näher sich die beiden kommen, desto schwieriger wird es für Sophie, ihren Plan durchzuziehen ... New Adult meets Suspense in diesem fesselnden und gefühlvollen Auftakt der Trilogie von Janine Ukena. Entdecke auch die weiteren Bände der spannenden New-Adult-Reihe »Die Sylt-Suspense-Trilogie«: - Band 2: Zwischen uns das Flüstern der Wellen - Band 3: Über uns das Tosen des Sturms
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Ähnliche
Janine Ukena
Vor uns das Rauschen des Meeres
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Bist du bereit, deine Liebe für die Wahrheit zu opfern?
Früher war Sophie jeden Sommer auf Sylt – bis zu dem Tag, an dem ihr Vater wegen angeblich illegaler Geschäfte verhaftet wurde und aus ihrem Leben verschwand. Noch heute quälen Sophie die Fragen, was damals wirklich geschah. Als ihr Vater stirbt und sie das Ferienhaus erbt, beschließt sie, zurückzukehren und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nur hat sie nicht mit Maximilian Rose gerechnet, dem Sohn eines reichen Hotelketten-Eigentümers. Als Mittel zum Zweck könnte er ihr bei ihrer Wahrheitssuche extrem weiterhelfen. Doch je näher sich die beiden kommen, desto schwieriger wird es für Sophie, ihren Plan durchzuziehen ...
New Adult meets Suspense in diesem fesselnden und gefühlvollen Auftakt der Sylt-Suspense-Trilogie von Janine Ukena.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Playlist
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Epilog
Danksagung
»For whatever we lose (like a you or a me)
it’s always ourselves we find in the sea.«
E. E. Cummings
Playlist
Atlantis – Seafret
Mastermind – Taylor Swift
Ich wünschte, du wärst verloren – Schmyt
Favorite Crime – Olivia Rodrigo
Echo – Berq
Matilda – Harry Styles
Zorn & Liebe – Provinz feat. Nina Chuba
Salzwasser – Sinu
Höhenangst – Schmyt
Glas – Nina Chuba
Mess It Up – Gracie Abrams
Family Line – Conan Gray
Rosarot – Lena & Linus
Goldmund – Jeremias
Rote Flaggen – Berq
Genug – Levin Liam
Reicht dir das – Provinz
The Archer – Taylor Swift
Es hört nicht auf – Jeremias
Start A Riot – Banners
Blame’s On Me – Alexander Stewart
Achilles – Berq
Logical – Olivia Rodrigo
Always, I’ll Care – Jeremy Zucker
Fine Line – Harry Styles
I Guess That Was Goodbye – Lyn Lapid
Alles war schön und nichts tat weh – Casper
Prolog
Die Nacht begann mit Küssen unter endlosen Sternen und endete mit einem Schuss, der die Zeit in ein Vorher und ein Nachher zerriss. So ohrenbetäubend laut, dass alles andere zu verstummen schien.
Es ist meine Schuld, wiederholt mein Kopf in Endlosschleife und lässt kaum einen anderen Gedanken zu. Die Lügen der Vergangenheit haben sich in dieser Nacht in die Wahrheit der Gegenwart verwandelt. Eigentlich sollte ich froh sein, denn genau dafür bin ich schließlich auf diese Insel gekommen. Für die Wahrheit. Um Antworten auf meine unzähligen Fragen zu erhalten, die ich nur hier finden würde. Wieso bin ich dann nicht glücklich, sondern fühle nur diese Leere, die mich innerlich betäubt?
Das blaue Licht des Polizeiwagens spiegelt sich in den vorbeiziehenden Fensterscheiben. Wie von selbst sinkt mein Kopf gegen das kühle Glas, weil das Adrenalin meinen Körper verlässt und ich dadurch unendlich müde werde.
Es ist vorbei.
Irgendwie kann ich es nicht glauben, und doch … Ich blicke auf meine Hände, auf denen sich noch feine Sandkörner befinden. Wie stille Beweise, dass ich mir das alles nicht eingebildet habe.
Wir waren am Strand.
Wir waren zusammen.
Und dann waren da nur noch eine Waffe und Blut.
Ich erinnere mich, wie ich hier angekommen bin. Am Bahnhof in Westerland, mit meinem Koffer und tausend Fragen, getrieben von Erinnerungen und etwas, das sich deutlich nach Angst anfühlte. Mir war von Beginn dieses Sommers an klar gewesen, dass jemand den Preis für all die Geheimnisse der Vergangenheit zahlen muss. Niemals hätte ich gedacht, dass ich zwischen all den Lügen und Intrigen auch Liebe und Hoffnung finden würde. Ich wollte niemanden verletzen, vor allem nicht ihn. Ich wollte keine Rache, keine Vergeltung. Ich wollte nur Antworten und einen Abschluss. Bis heute Nacht habe ich geglaubt, dass alles gut werden würde. Absolut naiv, jetzt weiß ich es besser. Diese Reise hat zu viele Abgründe offenbart, in denen wir jetzt alle untergehen. Am Ende läuft es auf nur eine einzige Tatsache hinaus, egal was ich mir einrede: Meine Suche nach der Wahrheit hat vielleicht einen Menschen umgebracht.
1. Kapitel
Sophie
Zwischen meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart liegen etwas mehr als drei Stunden Zugfahrt. Angespannt umklammere ich den Griff meines Koffers, während mein Blick über die Gleise des Hamburger Hauptbahnhofs wandert.
»Gleis zwölf. Einfahrt IC2374 nach Westerland, Sylt«, tönt es aus den Lautsprechern. Die monotone Stimme lässt die Panik, die durch meine Adern rauscht, kurz abebben. Irgendwie schaffe ich es, in den Zug einzusteigen, quetsche mich durch den schmalen Gang bis zu meinem reservierten Platz und lasse mich in den Sitz sinken.
Und weil ich mir definitiv zutraue, einfach wieder auszusteigen, schließe ich die Augen und blende alles aus. So lange, bis der Zug losfährt.
Drei Stunden, denke ich.
Okay, es sind etwas mehr als drei Stunden, aber diese Zeit kommt mir trotzdem viel zu kurz vor. Dafür, dass ich dann auf der Insel ankomme, die einmal mein Zufluchtsort war. Der Ort aller glücklichen Kindheitserinnerungen, bis … na ja, bis er es eben nicht mehr war. Drei Stunden, die mein altes und mein neues Leben voneinander trennen. Es könnten genauso gut ganze Welten dazwischenliegen.
Ich öffne mein in Leder gebundenes Notizbuch, das alle für mich so wichtigen Informationen und Unterlagen enthält: eine Liste der Personen, die ich kennenlernen muss, um von ihnen all das zu erfahren, was mir so lange verschwiegen wurde. Namen, die ich eingekreist und mit Details versehen habe. Orte, die ich besuchen muss. Erinnerungsfetzen, die ich nicht einordnen kann. Und dann den Brief, der mir offenbarte, dass mein Vater verstorben ist. All das ist jetzt fast ein Jahr her. Ein Jahr, in dem ich um einen Vater getrauert habe, den ich eigentlich schon seit meiner Kindheit nicht mehr hatte.
Er hinterließ mir zahlreiche Rätsel um sein Verschwinden. Einige Tagebücher, aus denen ich nicht schlau werde. Ein Haus auf Sylt im Wert von mehreren Millionen Euro und den Wunsch, endlich Licht in den Nebel der Vergangenheit zu bringen. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, in der dieses Haus mit Lachen und schönen Erinnerungen gefüllt war, zieht sich mein Herz schmerzhaft zusammen. Jetzt ist es vor allem eins für mich: der Ort, an dem mein Vater mich und meine Mutter verlassen hat.
Er war der erste Mann, der mich liebte, und der erste Mann, der mir das Herz brach – auf eine Weise, die niemals völlig geheilt werden kann.
Ich hatte diese Gefühle und Gedanken in eine Schublade gestopft, sie mit hundert Schlössern verriegelt. Doch dann wurden mit einem Schlag alle Wunden wieder aufgerissen. Es passierte an einem ganz normalen Dienstagmorgen. Einem Tag, der mit einer Tasse Tee, einem zufriedenen Lächeln und ein paar Skizzen für das neue Projekt anfing. Bis ich in den Briefkasten schaute und das Schreiben der Erbfolge öffnete. Mein Vater hinterließ mir eine unausgesprochene Bitte zwischen den mit schwarzer Tinte geschriebenen Zeilen, die er nur an mich gerichtet hatte.
Ein Geständnis, das Konsequenzen hatte.
Hinweise zu jenem Sommer, der alles veränderte. Zu Menschen, die sein Vertrauen ausgenutzt und ihn hereingelegt hatten.
Deren Namen befinden sich nun allesamt auf der Liste in meinem Notizheft.
Ich blättere darin weiter nach vorne und nicke zufrieden, weil ich bereits zwei Punkte abhaken konnte:
Ausführliche Recherche über Familie Rose
Organisation Aufenthalt auf Sylt
Am Ende des Sommers bin ich hoffentlich so weit gekommen, dass ich hinter die restlichen Punkte ebenfalls einen Haken setzen kann. Jetzt arbeite ich vorerst an Punkt drei:
Ankunft Sylt und keine Panik!
Leichter gesagt als getan.
Meine Augen huschen über die vollgeschriebenen Seiten, die auf meine Liste folgen, und bleiben an einem Namen hängen.
Leopold Rose.
Die Buchstaben habe ich mehrfach nachgezogen, sodass sie ganz fett und leuchtend erscheinen. Daneben habe ich eine kleine Rose gezeichnet. Das Wappen einer Familie, die so perfekt wirkt, dass sie allein für ihr makelloses Auftreten einen Preis verdient hätte. Aber jeder weiß, dass selbst die makelloseste Fassade Risse bekommen kann. Genau diese Risse will ich finden. Dafür komme ich nach so langer Zeit zurück.
Mit zittrigen Fingern fahre ich den kleinen Stammbaum nach, den ich ebenfalls in das Notizbuch gezeichnet habe.
Leopold Rose und Fiona Rose.
Maximilian Rose.
Er ist der Erbe des Unternehmens, das für meinen Vater den Untergang bedeutete. Der Sohn der Familie, die für all den Reichtum und Luxus steht, den meine Mutter so verabscheut. Und mein möglicher Schlüssel zu den Antworten, die ich mir so sehr wünsche.
Es kommt mir fast so vor, als würde ich schon alles über ihn wissen. Wahrscheinlich, weil ich das auch tue.
Maximilian, Maximilian, Maximilian.
Die Buchstaben haken sich in meinen Gedanken fest, wiederholen sich in Dauerschleife. Ein Name, der Wohlstand ausstrahlt, und nach ausführlicher Recherche weiß ich, dass er vermutlich niemals Geldsorgen haben wird. Dass er das Unternehmen übernehmen wird, ebenso wie die vielen Immobilien, die seiner Familie gehören. Ein Vermögen, das so groß ist, dass mir ganz schwindelig wird.
Das Internet verrät jede Menge über Menschen. Über die Suche nach seinen Eltern landete ich schließlich auf seinem Instagramprofil. @maxrose postet vegane Rezepte, Filmempfehlungen und Songtexte – unter anderem von Jeremias. Wenigstens beweist er damit guten Musikgeschmack. Sein Gesicht hält er nie für seine eigenen Beiträge in die Kamera, aber seine Freunde filmen ihn dafür umso lieber. Es gibt zahlreiche Fotos und Videos, auf denen er markiert wurde, und sie haben alle etwas gemeinsam: Sie sind auf Sylt entstanden. Als wären sein Gesicht und die Insel miteinander verbunden. In sein Leben in Hamburg habe ich dagegen wenig Einblick. Während meiner Recherche waren Instastories mit Standortangabe mein bester Freund, und nach einigen Wochen der aufmerksamen Beobachtung weiß ich zumindest, dass er in einer Eigentumswohnung in einem der besten Viertel Hamburgs wohnt. Jeden Sonntag geht er zum Stand-up-Paddling an die Alster und trinkt danach einen großen Kaffee im Brühwerk. Auch wenn er gerne kocht, besucht er mindestens drei Mal die Woche das VeganHouse, das sich in Laufweite seiner Wohnung befindet. Ein Post mit neuntausend Likes zeigt, dass er vor einigen Wochen seinen Abschluss in BWL gemacht hat. #quarterlifecrisis. Als würde jemand wie er eine Krise bekommen, schließlich werden ihm alle Türen im Leben durch Geld und Prestige offen gehalten. Sein ganzes Auftreten vermittelt diesen Eindruck. Der Haarschnitt, die Autos, sein Apartment, die Uhr an seinem Handgelenk und die gestärkten Hemden. Jedoch kommt es mir fast so vor, als gäbe es zwei Versionen: Sylt-Max mit zurückgekämmten Haaren und überteuerten Poloshirts und Hamburg-Max, dessen Rüstung gegen die Welt ausgeblichene Bandshirts und schmuddelige Nikes zu sein scheinen. Je mehr ich über ihn erfahre, umso neugieriger werde ich. Möglich, dass meine Suche etwas zu obsessiv ist, aber ich bin gerne vorbereitet. Dank seinem neuesten Beitrag und einer Nachfrage von @nick93 weiß ich auch genau, wann er heute auf Sylt ankommen wird. Eigentlich hatte ich ab Hamburg genau denselben Zug gebucht. Punkt vier in meinem Plan, ein »zufälliges« Treffen mit Max inszenieren und Eindruck hinterlassen, ist dank der deutschen Bahn jedoch grandios gescheitert. Dafür muss ich mir noch eine Alternative überlegen, aber nun sitze ich erst mal allein mit meinem überteuerten Smoothie im IC, während Max mir einen Zug voraus ist.
Das Vibrieren meines Handys reißt mich aus meinen Gedanken. Eine Nachricht von meiner Mutter, die fragt, ob ich schon angekommen bin. Als hätte ich ihr nicht dreihundert Mal gesagt, dass ich ihr schreiben werde. Und als wüsste sie nicht ganz genau, wie lange man von Hamburg nach Sylt fährt. Schließlich haben wir den Beginn des Sommers stets in Hamburg gefeiert und sind dann mit dem Autozug auf die Insel gefahren. Es kam mir immer magisch vor, mit dem Zug das Meer zu überqueren und dabei im Auto hinten auf der Rückbank zu sitzen.
Damals, als noch alles in Ordnung war und Geheimnisse nicht zum Alltag gehörten.
Ich seufze, greife in meinen Rucksack und hole die gedruckte Fassung des Manuskripts hervor, das mir erlaubt, diese Reise überhaupt zu machen.
»Kinderbücher lassen sich von überall illustrieren«,höre ich mich sagen. Mein Versuch, Herrn Klune zu überreden, mich mobil arbeiten zu lassen, ohne bei den wöchentlichen Besprechungen vor Ort zu sein. »Ich bin mir sicher, dass die neuen Eindrücke der Insel mir helfen werden, bessere Zeichnungen anzufertigen. Außerdem spielt die Geschichte doch auch auf einer Insel, oder?«
Ich grinse in mich hinein, immer noch erstaunt, dass ich es geschafft habe, meine Arbeit mit meiner Mission zu verbinden. Einige Sekunden später verliere ich mich in Randnotizen, die ich beim Lesen des Dokuments auf das dünne Papier kritzle. Beim Schreiben verschmiert die blaue Tinte des Kugelschreibers, weil ich mit dem Handrücken immer wieder darüberstreiche, bevor die Schrift trocken ist. Typisches Linkshänderinnenproblem. Ich kreise Worte ein, schreibe Stimmungen auf und notiere mir Farben. Meine Worte sind mitternachtsblau. Nach und nach male ich kleine Wolken neben die Buchstaben, weil mein Kopf sich genau dort während des Lesens befindet. Grobe Pinselstriche, feine Bleistiftlinien, ein Meer aus Farben. All das war meine Flucht aus der Realität.
Als ich mich bei Herrn Klune bewarb, war ich gerade achtzehn geworden. Er ließ mich während des engeren Auswahlverfahrens unzählige Illustrationen anfertigen. Zu einzelnen Wörtern, zu bestimmten Gefühlen und dann, in der letzten Runde, zu einer Kurzgeschichte.
»Frau Riffert, gibt es die perfekte Illustration für einen Text?«, fragte er mich schließlich mit ernster Miene, verschränkten Armen und einem Ton in der Stimme, der wie eine Probe klang.
Einige Sekunden dachte ich darüber nach und schüttelte dann den Kopf. »Kunst muss nicht perfekt sein. Sie muss kein Meisterwerk sein, solange sie nur etwas bewegt. Die Illustration sollte die Worte umarmen, sie leuchten lassen.«
Meine Antwort hing einige Atemzüge in der Luft, bevor er ganz langsam zu lächeln begann.
»Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Job«, erwiderte er kurz darauf, und ich begann zu weinen, weil es das erste Mal war, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie angekommen zu sein.
Die Erleichterung mischte sich mit dem Gefühl, gut genug für etwas zu sein.
Obwohl der Verlag seinen Sitz in Hamburg hatte, konnte ich in meiner Heimatstadt und absoluten Komfortzone Kiel bleiben.
Innerhalb weniger Jahre habe ich nun zahlreiche Kinderbücher illustriert, die allesamt eine Kindheit zeigen, die ich niemals hatte. Vielleicht bin ich deswegen so gut darin, diese Geschichten leuchten zu lassen. Es ist mein geheimes Talent, ich male mit Träumen und verschwommenen Erinnerungen. Statt im grauen Alltag zu ersticken, färbe ich meine Zukunft mit all den Farben, die das Leben für mich bereithält. Nur meine Gedanken behalten stets dieselben Grautöne.
Erneut vibriert mein Handy, was mich instinktiv danach greifen lässt.
@maxrose hat einen Beitrag hochgeladen, scheint mir entgegen. Seit einigen Tagen folge ich Maximilian mit meinem Künstlerprofil, auf dem ich nur einfache Skizzen teile. Wenn ich das hier richtig machen will, darf ich nichts verpassen, also habe ich jegliche Benachrichtigungen aktiviert. Von ihm, von seinem besten Freund @nick93 und auch von einigen Leuten, die alle viel zu reich und viel zu affektiert wirken. Alle Profile sind öffentlich, als wollten sie, dass ich zusehe.
Doch gerade lässt mich das Internet im Stich. Das Bild ist verpixelt, der kleine Kreis dreht und dreht sich, ohne zu laden. Ich stecke das Handy zurück in die Tasche und widme mich wieder dem Text, der jetzt mit Gedanken und Farben versehen ist. Meine Finger kribbeln, als wollten sie mir signalisieren, dass ich anfangen muss zu malen.
Tatsächlich habe ich schon zahlreiche Skizzen für dieses Projekt angefertigt, denn diese Geschichte lässt mich nicht mehr los, seitdem sie auf meinen Schreibtisch geflattert ist. Noch in derselben Nacht habe ich ein ganzes Portfolio mit ersten Illustrationen und Skizzen eingereicht, und am nächsten Tag hatte ich den Auftrag.
»Das Mädchen, das zu den Sternen sprang« war eine Geschichte über ein Mädchen mit einer Papierkrone und einem Herz aus Glas. Über ein Königreich, das auf den Meeresgrund gesunken war, sodass nur noch eine kleine Insel übrig blieb, auf der das Schloss des Mädchens stand.
Es ist düster, märchenhaft, und momentan erscheint es mir so, als würde ich an den perfekten Ort fahren, um die Illustrationen dafür anzufertigen. Ich blicke aus dem Fenster und verliere mich in den Farben des Himmels, die sich in meinem Augenwinkel neu zusammenmischen. Euphorieblau mit weißen Tupfern, das in ein blasses Fliederlila übergeht.
Immer und immer wieder wandern meine Gedanken zu dem, was mich wohl erwarten wird. In diesem Haus, auf dieser Insel. Wenn ich ehrlich zu mir bin, hoffe ich, auch endlich loslassen zu können, sobald ich die Wahrheit herausgefunden habe. Dafür bin ich nach Sylt zurückgekommen.
Um loszulassen. Um festzuhalten. Ein Widerspruch, der mein Leben bestimmt.
Der Zug ruckelt hin und her. Während wir Sylt mit jeder Minute näher kommen, frage ich mich, ob ich es durchziehen kann. Mein Plan für den Sommer erlaubt keine Gefühle, keine echten jedenfalls, und für ein schlechtes Gewissen ist kein Raum. Aber die Zweifel muss ich beiseiteschieben, sonst wird das nichts. Schnell verstaue ich das Manuskript in meinem Rucksack, ebenso wie mein Notizheft.
Im nächsten Moment wird die Ankunft in Westerland über Lautsprecher angekündigt.
»Willkommen auf Sylt, Sophie«, flüstere ich. »Willkommen zurück.«
2. Kapitel
Maximilian
Wenn du in einem brennenden Haus aufwächst, denkst du irgendwann, dass die ganze Welt brennt. Dass sie das nicht tut, habe ich erst verstanden, als ich mein Zuhause verlassen habe. Doch jetzt trennen mich noch ungefähr dreißig Minuten Zugfahrt von dem Gefühl, eingesperrt zu sein. Wochenlang habe ich mich mit meiner Therapeutin auf diesen Moment vorbereitet. Jetzt wird mir klar: Darauf kann ich mich niemals vorbereiten. Je näher ich der Insel komme, desto schneller schlägt mein Herz. Heute Morgen habe ich gedacht, dass ich es nicht schaffe. Wie betäubt habe ich in meinem Bett gelegen und den Zug verpasst, den ich mir ursprünglich gebucht habe. Nach einem Telefonat mit Nick habe ich mich schließlich doch noch aufgerafft. Lieber einen Zug später nehmen, als gar nicht zu kommen, oder?
Zur Ablenkung schaue ich zum hundertsten Mal auf den leuchtenden Infoscreen der Bahn, der anzeigt, wo der IC sich gerade befindet. Den Bahnhof in Husum haben wir bereits hinter uns, also bleibt nur noch eine Haltestelle in Niebüll bis zur Ankunft. BahnhofWesterland (Sylt) steht als Endstation auf dem Screen. Ein kurzer Schauer läuft mir über den Rücken, dann setze ich mich etwas aufrechter hin und schaue wieder aus dem Fenster. Bereits jetzt ziehen einige Reetdachhäuser an uns vorbei, die ich anfange zu zählen.
Vielleicht schaffe ich es dieses Mal.
Vielleicht wird es anders.
Vielleicht bin ich jetzt stark genug, um nicht zusammenzubrechen. Über meine naiven Gedanken lache ich kurz und ernte dafür einen skeptischen Blick der Dame, die mir gegenübersitzt.
Ich kann das.
Ich schaffe das.
Und selbst wenn nicht: Ich habe sowieso keine Wahl.
Nervös rutsche ich auf dem blauen Polster des ICs hin und her und starre auf die Dünenlandschaft, die nun draußen an uns vorbeirauscht. Im Sommer kehren irgendwann alle zurück auf die Insel, weil sie Heimweh bekommen. Sehnsucht nach Meeresluft und Freiheit. Heimweh – ein Wort, das bei mir eine ganz andere Bedeutung hat. Eine viel zu wörtliche, denn wenn ich nach Hause komme, tut es weh. Es tut weh, weil ich im Gegensatz zu meinen Freunden dieses Wort nicht mit Geborgenheit verbinde. Auch frei fühle ich mich dort nicht.
Stattdessen ist die Insel meine persönliche Hölle. Diesen Sommer komme ich nicht mit leeren Händen und einem Herzen voller naiver Hoffnung. Ich komme mit einem konkreten Plan für meine Zukunft, mit Erklärungen und einer Diagnose. Zurück in das Haus, in dem ich nie ich selbst sein durfte.
Du bist zu sensibel, Max.
Nimm nicht immer alles so persönlich.
Du bist so eine Dramaqueen.
Ein Mann weint nicht, verstanden?
Schluck es einfach runter, und mach weiter.
Sätze, die sich in meinem Kopf fest eingebrannt haben. Die mein Verhalten beeinflusst haben, seit ich ein kleiner Junge war. Ich schämte mich für all das, was ich war, und für das, was ich nicht war. Also suchte ich mir Anfang des Jahres Hilfe, um mich besser zu verstehen. Als das Wort Hochsensibilität das erste Mal in einer Therapiesitzung fiel, fühlte es sich beinahe wie ein Befreiungsschlag an. Eine Erklärung statt der üblichen Vorwürfe.
Dr. Lima sah mich über ihre Brille hinweg an, und obwohl in mir alles brodelte, riss ich mich zusammen.
So wie ich es gelernt hatte.
So wie ich es immer tat.
Die Worte hallten in meinem Kopf nach und klebten sich an längst vergangenen Momenten fest. Ein Herzschlag, ein Gedanke, ein Atemzug später, und ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen, sondern brach auseinander.
Eine durch Hochsensibilität ausgelöste Depression nannte Dr. Lima es. Dazu der anerzogene Perfektionismus, den mein Vater mir eingebläut hatte, bevor ich überhaupt laufen konnte.
Es waren Worte, die meine chaotische Gedankenwelt ein wenig besser erklärten und die ich jetzt wie treue Begleiter an meiner Seite weiß.
Manchmal fühlt es sich so an, als würde ein Gefühlsverstärker alles auf die maximale Stufe drehen, bis ich daran kaputtgehe. Irgendwie habe ich es mit der Zeit in den Griff bekommen, mir einen Dämpfer eingebaut und mein Fakelächeln perfektioniert.
Doch nun fahre ich zurück nach Sylt und hoffe, dass ich mich zwischen Wellenrauschen und der Ruhe der Dünen etwas wohler fühle. Dass der Fortschritt der Therapiesitzungen nicht verloren geht, sobald ich den Inselboden betrete. Ich halte mich an die Abmachung und an das Erbe, das ich niemals wollte und das wie ein Damoklesschwert seit meiner Geburt über meinem Kopf hängt.
BWL-Studium: check.
Das Sommerpraktikum bei meinem Vater: in Arbeit.
Und alles nur, weil der kleine Junge in mir immer noch seine Anerkennung will. Damit mein Vater mir bei meinen eigenen Träumen vielleicht entgegenkommen wird. Auch wenn die so absolut gar nichts mit seinen Vorstellungen für mein Leben zu tun haben.
Mir geht es besser als jemals zuvor, doch das bedeutet nicht, dass es mir tatsächlich gut geht. Eben nur besser als zuvor. Aber ich arbeite daran.
Wir arbeiten daran. Dr. Lima und ich.
Ein Zeichen von Schwäche, würde mein Vater über die Therapie sagen.
Ein Zeichen von Stärke, würde Nick dagegenhalten.
Mein bester Freund ist tatsächlich meine einzige Hoffnung, dass dieser Sommer auf Sylt keine komplette Katastrophe wird. Er und die Clique, die ich schon viel zu lange nicht mehr gesehen habe und die mir in der Vergangenheit wenigstens ein bisschen das Gefühl gab, hier eine Familie zu haben.
Plötzlich reißt mich ein lautes Klirren aus meinen Gedanken.
Hinter mir sitzt eine Gruppe von Frauen Mitte vierzig, die gleich nach dem Einsteigen kleine Aperolflaschen ausgepackt hat und nun jeden Schluck mit einem gesäuselten Stößchen ankündigt. Absolutes Klischee. Dass das eigentlich verboten ist, interessiert sie genauso wenig wie die Tatsache, dass das hier ein Ruheabteil ist.
Jetzt drängt sich ihr Gespräch immer weiter in meinen Fokus und macht mich mit jedem Wort, das nicht für meine Ohren bestimmt ist, nervöser. Es einfach auszublenden schaffe ich nicht. Stattdessen setze ich meine schweren Kopfhörer auf, lasse weißes Rauschen laufen und konzentriere mich auf meine Atmung.
Das klappt so lange, bis der Zug stark zu schwanken beginnt, weil wir die Schienen wechseln. Ich schiebe den linken Kopfhörer vom Ohr und lasse die Außenwelt wieder in meine Gedanken hineinströmen. Eine Durchsage des Zugführers kündigt an, dass wir in wenigen Minuten Westerland erreichen. Das Quietschen der Bremsen ist ungewöhnlich laut, als der Zug kurz darauf in den Bahnhof einfährt. Es ruckelt erneut, und ich versuche, meinen Fokus auf etwas anderes zu lenken. Doch die bereits ungeduldig im Gang stehenden Menschen tragen nicht dazu bei, meine Anspannung zu lösen.
Als ich mit der Menge aussteige, dringt kühle Luft in meine Lunge. Das Kreischen der Möwen kommt mir viel zu laut vor. Als einige Sonnenstrahlen mich treffen, schließe ich kurz die Augen, um mich zu konzentrieren. Einige Atemzüge lang wird es still. In meinem Kopf, in meinen Gedanken. Mein Herz nimmt wieder einen normalen Rhythmus auf, als ich mich auf die Inselluft konzentriere. Etwas, was ich in Hamburg stark vermisse.
Aus dem Augenwinkel nehme ich wahr, dass mich ein kleiner Junge anstarrt. Vielleicht, weil ich mitten in der Menge stehen bleibe, die Augen schließe und atme. Findet er mich komisch? Sitzt mein Hemd richtig? Ich streife sofort mit den Händen über den Stoff, blicke an mir herab. Die Nikes, die ich sonst in Hamburg trage, habe ich gegen schwarze Gucci-Slipper getauscht, statt eines oversized Shirts trage ich ein schlichtes, weißes Hemd mit Ralph-Lauren-Logo und eine beige Leinenhose. Es ist eine Verkleidung. Meine Alltagsklamotten hätten mir hier nur dumme Sprüche eingehandelt, auf die ich heute sehr gut verzichten kann. Allein dass ich mit dem Zug fahre, wird schon nicht gerne gesehen. Warum kommst du nicht mit dem Privatjet?, höre ich die Stimme meines Vaters in meinem Kopf. Alles an meiner Familie schreit privilegiert, und ich hasse es.
Nervös krame ich in meinem Rucksack, der es als einziges Überbleibsel meines früheren Outfits mit nach Sylt geschafft hat. Als ich meine Sonnenbrille finde, durchströmt mich Erleichterung, und dann tauche ich die Welt in Sepia.
Einige Augenblicke später betrete ich die Bahnhofshalle und bekomme sofort Kopfschmerzen. Normalerweise habe ich mich gut im Griff. In Hamburg habe ich mich sogar einigermaßen an die Geräuschkulisse gewöhnt. Dort fällt es mir leichter, mit all dem Trubel umzugehen, weil mein Herz in dieser Stadt ebenfalls leichter schlägt. Doch auf Sylt fühlt sich jeder Herzschlag, jeder Atemzug nach Arbeit an. Das liegt weniger an der Insel als an dem, was mich hier erwarten wird. Meine Hochsensibilität wird verstärkt, sobald ich gestresst bin, mich nervös oder unwohl fühle. Ich kann förmlich spüren, wie die Nervenzellen in meinem Gehirn heißlaufen.
Vielleicht bin ich weniger angespannt, wenn ich diese Ankunft erst mal hinter mir habe. Der Geruch von gebratenem Essen und Kaffee vermischt sich mit den Gesprächsfetzen der Menschen, die hektisch an mir vorbeigehen. Irgendwo weint ein kleines Kind, woanders telefoniert eine Frau auf Plattdeutsch und beschwert sich, dass sie niemand erwartet. Neid kommt in mir auf. Ich wünschte, mein Vater hätte nicht drauf bestanden, mich am Bahnhof in Empfang zu nehmen. Dann hätte Nick mich mit seinem Auto abgeholt, wir hätten die Musik aufgedreht, wären zum Strand runtergefahren, und ich hätte meine Gedanken sortieren können, bevor ich mich in die Höhle des Löwen begebe.
Während ich darüber nachdenke, analysiere ich die Menschen um mich herum. Mit meinem Scannerblick, wie Mama ihn nennt. Kleidung, Mimik, Gangart, Gespräche. Wohin gehen sie? Woher kommen sie? Tausend Fragen, die in meinem Kopf herumwirbeln.
Mit schnellen Schritten fliehe ich aus der Bahnhofshalle. Eine Gänsehaut macht sich auf meinen Armen breit, als ein kalter Windstoß mich trifft und meine Locken in alle Richtungen weht. Schnell fahre ich mit der Hand durch meine Haare, die längst mal wieder einen Schnitt vertragen könnten. Jetzt, wo ich nicht nur mein Studium, sondern auch die Ausbildung zum Koch abgeschlossen habe, schaffe ich es vielleicht mal wieder zum Friseur. Kurz lache ich auf, denn kaum bin ich auf dieser Insel, mache ich mir schon mehr Gedanken um mein Aussehen. Fängt ja gut an.
Sobald ich meinen Vater entdecke, wird mir noch kälter.
Als kleiner Junge wurde mir schnell klar, dass mein Vater nicht wie die anderen war. Statt auf dem Fußballplatz mit mir zu spielen oder mit mir zusammen Mathehausaufgaben zu machen, war er immer im Büro oder auf Geschäftsreisen. Wenn er doch einmal zu Hause war, dann nur um Vorwürfe loszuwerden und sich mit meiner Mutter zu streiten. Dafür habe ich jetzt keine Zeit, war der Satz, den mein Vater am häufigsten sagte. Dicht gefolgt von Dafür bezahlen wir Leute, als würde sich alles mit Geld regeln lassen. In gewisser Weise war das für ihn auch so, aber einen Vaterersatz konnte er mir nicht kaufen. Er wollte seine Ruhe, ich wollte seine Anerkennung. Wir waren wie zwei Gegensätze und meine Mutter die Mitte, die uns zusammenhielt.
Ich lernte etwas über den Börsenmarkt, über Aktienkurse und das Unternehmen, das ich eines Tages übernehmen sollte, noch bevor ich mit sechs auf das Internat in der Schweiz kam. Ab da konnte ich an einer Hand abzählen, wie oft wir uns sahen. Die Ferien verbrachte ich meist allein, während alle zurück in die Heimat fuhren. Wenn ich doch auf Sylt war, dann im Hotel meiner Familie, und selbst da kümmerten sich überwiegend die Angestellten um mich. Ich lernte schnell, dass seine Worte nur leere Versprechungen waren und sein Lächeln zu einer Show gehörte, in der er allein der Hauptdarsteller war. Ich habe alles darangesetzt, in diese Show zu passen, und ging daran kaputt. Aber das Bild nach außen war ihm stets wichtiger als mein Wohlergehen. Der perfekte Sohn war ich nie, auch wenn ich all seine Anforderungen erfüllte, und schließlich begriff ich, dass ich für ihn niemals genug werden würde. Das war nicht möglich.
Wenn ich daran zurückdenke, erfasst mich eine Welle von Bitterkeit. Ich bewunderte ihn so lange, bis ich begann, ihn zu hassen. Aber das ist eine andere Geschichte, an deren Konsequenzen ich mit Dr. Lima schon seit einer ganzen Weile arbeite.
Du kannst dich jederzeit bei mir melden, Max, hat meine Therapeutin in unserer letzten Sitzung vor meiner Reise gesagt. Eine Floskel, die ich schon so oft vernommen habe, dass sie ihre Wirkung verloren hat. Ein besorgter Ton klang in ihren Worten mit. Aber das ändert nichts daran, dass die Sitzungen über den Sommer pausieren – und das, obwohl ich sie hier am meisten brauchen würde.
Wie in Zeitlupe gehe ich auf meinen Vater zu. Er kommt mir nicht entgegen, sondern tippt stattdessen wild auf seinem Handy herum, ohne ein einziges Mal aufzuschauen. Es fühlt sich an, als hätte ich Gewichte an meinen Füßen. Wahrscheinlich wird er mir gleich vorhalten, was er alles verschieben musste, damit er mich abholen kann. Er wird Dankbarkeit einfordern und mich missbilligend anschauen.
Ich kann das. Ich wiederhole diesen Satz einige Male und hoffe, dass sich meine Angst damit manipulieren lässt.
Als ich nur noch wenige Meter von ihm entfernt bin, blickt er doch noch auf. Schon setzt sich das vertraute Lächeln auf mein Gesicht, das ich über all die Jahre perfektioniert habe und das falscher nicht sein könnte. Doch mein Vater würde es sowieso niemals bemerken, schließlich habe ich mein Fakelächeln vom Besten gelernt.
Wir begrüßen uns förmlich. Ein einfaches Nicken und ein leichtes Schulterklopfen, das eine Umarmung niemals ersetzen könnte.
»Willkommen zurück, mein Sohn«, sagt mein Vater mit desinteressierter Stimme.
»Schön, wieder hier zu sein«, lüge ich und lasse meine Augen umherwandern. »Ist Mama gar nicht mitgekommen?«
Mein Vater seufzt, als wäre das eine Antwort.
Schweigend laufen wir zu seinem Wagen, den er im Halteverbot geparkt hat. Da jeder weiß, wem dieses Auto gehört, kann er parken, wo er will. Keiner würde es wagen, ihn abzuschleppen. Ein leichtes Pochen macht sich hinter meiner Stirn bemerkbar. Ich weiß, dass er mich nur aus einem Grund in Empfang genommen hat. Damit die Menschen auf dieser Insel es sehen. Leopold Rose holt seinen Sohn vom Bahnhof ab. Herzallerliebst. Und dann können sich alle wieder über uns das Maul zerreißen, als wäre meine Familie der Inhalt ihres Klatschmagazins. Leider trifft das in gewisser Weise sogar zu.
»Trainierst du noch?«, fragt er mich, während ich den Koffer mit einem Schnaufen in den Kofferraum hebe.
»Gerade nicht. Ich musste …«, beginne ich.
»Ein Mann in deinem Alter sollte fit sein. Morgen früh gehen wir eine Runde laufen.« Keine Frage, ein Befehl.
Für eine Sekunde denke ich darüber nach, einfach wieder in den Zug zu steigen und zurück nach Hamburg zu fahren. Natürlich öffne ich stattdessen die Tür des Autos und lasse mich in den weichen Ledersitz fallen.
Keine Widerworte, alles wie immer.
Ich schlucke meine Wut hinunter. Zwar weiß ich jetzt endlich, dass meine Gefühle gerechtfertigt sind, ich weiß aber auch, dass Gefühle ihren Platz brauchen. Und den habe ich hier gerade nicht.
Maximilian, was würden denn die Leute denken?, höre ich die leise Stimme meiner Mutter, die neben meinem Vater beinahe wie ein Geist erscheint. Ich frage mich, warum sie mich mit ihm allein gelassen hat. Warum sie nicht mitgekommen ist, um mich zu begrüßen. Sofort machen sich Sorgen in mir breit, wenn ich daran denke, wie mein Vater manchmal sein kann. Ich mustere ihn unauffällig. Er trägt die Autorität wie einen gut gepflegten Anzug. Etwas, in das ich nie ganz hineingewachsen bin. Eine Charaktereigenschaft, die mir nie richtig passen wollte. Es ist die Art von Macht, die man eben bekommt, wenn einem die halbe Insel gehört. Mit jedem Blick, mit jedem Wort, einfach mit seinem ganzen Auftreten strahlt er das aus. Diese Autorität ist automatisch mit meinem Namen verbunden, und doch habe ich sie nie für mich angenommen. Auch wenn ich es eine Zeit lang versucht habe, weil ich dachte, dass es dann einfacher ist. Das Leben, meine ich. Die dunklen Gewitterwolken haben meine Gedanken trotzdem eingeholt.
»Ich habe ein Abendessen organisiert, um deine Rückkehr zu feiern. Die Lieks kommen auch.«
Allein wie er den zweiten Satz betont, so voller Genugtuung, macht mich schon wieder wütend.
Seit einigen Jahren liegt er mir in den Ohren, dass Laura und ich perfekt zusammenpassen würden. Dass es ein gutes Geschäft wäre, gut für das Hotel und gut fürs Image. Als würde es bei der Liebe darum gehen. Die Tatsache, dass Laura im letzten Sommer nicht nur mein Vertrauen, sondern auch mein Herz gebrochen hat, ist ihm egal. Genauso wie mein Zusammenbruch danach einfach von ihm vergessen wurde. Abgetan mit einem Reiß dich zusammen und einem Blick, der verurteilender nicht hätte sein können.
Mit einer Hand fahre ich mir durch die Haare und bemerke dabei, dass sie zittert.
»Wie schön«, gebe ich gepresst zurück. Dass ich später schon mit Nick, Jette und Erik in der Bar verabredet bin, lasse ich unerwähnt. Mach ihn dir nicht schon jetzt zum Feind, das passiert noch früh genug.
»Du hast morgen einen Termin in der Personalabteilung. Tim hat bereits alles organisiert, das sind nur Formalitäten.«
Ich nicke. »Klar.«
Während er mir erklärt, dass ich morgen früh mit größter Motivation im Hotel aufzutauchen habe, nicke ich nur noch stumm vor mich hin. Resigniert hole ich mein Handy hervor und tippe eine Nachricht an Nick, dass ich in der Hölle angekommen bin. Das Auto beschleunigt, wir fahren die L24 hoch, und ich lasse das Fenster herunter, als mein Vater sich eine Zigarette ansteckt, bevor er weiter und weiter und weiter redet.
Irgendwann schaffe ich es, dass seine Stimme in den Hintergrund rückt. Und während ich gedankenverloren aus dem Fenster blicke, lasse ich seine Worte vom Wellenrauschen in meinem Kopf übertönen.
3. Kapitel
Sophie
Ich bin hier.
Auf Sylt.
Am Bahnhof in Westerland, wo so viele Sommer angefangen haben.
Es ist fast zwanzig Jahre her, dass ich zuletzt hier war, und doch bin ich erstaunt, wie mein Kopf sofort all die Erinnerungen hervorholt. Alles scheint mir immer noch so vertraut.
Mit wackligen Beinen folge ich der Menge hinaus. Durch die Eingangshalle, deren Backsteinwände viel zu alt aussehen. Vorbei an den Worten Eingang,Ausgang,Buchhandlung und Presse in altdeutscher Schrift. Der Anblick der grünen Skulpturen auf dem Bahnhofsvorplatz löst eine Erinnerungswelle aus, die mich kurz Luft holen lässt. Ich bin wieder sechs Jahre alt.
»Papa, ich hab Angst vor den grünen Menschen«, sage ich und blicke zu ihm hoch. Ich wünschte, er würde meine Hand halten, weil Mama sie immer etwas zu fest drückt und mich jetzt hinter sich herzieht. Und auch wenn ich meine Lieblingssandalen anhabe, kann ich keine Schritte machen, die groß genug sind, um ihr zu folgen. Gemeinsam laufen wir über den Platz und bleiben erst stehen, als wir an einem der vielen Tische voller Erwachsener angekommen sind.
Kein einziges Kind. Onkel Leo ist auch nicht da, was mich traurig macht, denn er ist wenigstens lustig und schneidet komische Grimassen, wenn keiner außer mir guckt.
»Was soll das sein?«, frage ich und blicke erneut die Skulpturen an.
Mama seufzt bei meiner Frage laut auf. »Unser Babysitter hat abgesagt«, sagt sie entschuldigend in die Runde und antwortet nicht auf meine Frage. Erwartungsvoll blicke ich Papa an.
»Das ist Kunst, mein Schatz«, flüstert er mir zu.
»Reisende Riesen«, lese ich stolz von der Broschüre ab. Ich setze mich auf die Holzbank. »Wenn ich groß bin, will ich auch Kunst machen. Aber nicht so was. Ich will Bilder malen.«
»Das ist kein richtiger Beruf, Sophie«, sagt meine Mutter. Mit der gleichen tadelnden Stimme, mit der sie auch sagt: »Für solche Veranstaltungen ziehst du ein Kleid und ein Lächeln an.«
»Das ist ein wundervoller Wunsch«, widerspricht mein Vater, und ich grinse breit. Er ist immer auf meiner Seite.
Ein Mann rempelt mich im Vorbeigehen an, seine genuschelte Entschuldigung dringt kaum zu mir durch. Damals war es mir noch nicht klar, aber nach diesem Sommer würde mein Vater nie wieder an meiner Seite sein. Natürlich weiß ich nicht, ob diese Szene sich exakt so abgespielt hat. Aber ich romantisiere die wenigen Bruchstücke und Sätze der Vergangenheit, weil das alles ist, was mir bleibt.
Wieder hole ich tief Luft, straffe die Schultern und laufe auf ein Taxi zu, das am Straßenrand parkt.
Vom Bahnhof in Westerland fahren wir nicht lange nach Kampen. Von der Hauptstadt der Insel hoch in den Ort voller Kontraste, der Kampen mittlerweile für mich ist. Man kann sich für einen Spaziergang zwischen den Dünen entlang zum Roten Kliff entscheiden, das im Sonnenlicht leuchtet und einfach magisch aussieht. Aber man kann auch durch die Straßen voller exklusiver Boutiquen laufen, auf der Whiskeymeile feiern gehen und sich im Luxus verlieren. Wenn ich an Kampen denke, denke ich an das alte Fernglas auf der Uwe-Düne, an die vielen Reetdachhäuser, für die Sylt bekannt ist, und ich denke an die Spaziergänge zu den Leuchttürmen, die ich oft mit Papa gemacht habe. Aber jetzt gerade versuche ich, all das zu verdrängen, weil ich es sonst nicht aushalte.
Das Taxi beschleunigt, und mein Herz beginnt ebenfalls zu rasen, als wolle es mit der Geschwindigkeit des Autos mithalten. Ich schließe die Augen, rufe mir ins Gedächtnis, weswegen ich hier bin.
Alles ist geplant, alles ist durchdacht.
Zehn Minuten und sechzehn Euro später stehe ich vor dem Haus, das nun mir gehört. Es kommt mir zu groß vor, sofort fühle ich mich unendlich klein. Der Schlüssel liegt schwer in meiner Hand, als ich die Auffahrt hochlaufe. Mit dem Kopf im Nacken betrachte ich das Reetdach, dann den Vorgarten voller Hortensien und die weißen Fensterläden.
Mama hat mir bereits gesagt, dass sich jemand um das Haus gekümmert hat. Gedanklich mache ich mir eine Notiz, den Gärtner zu kontaktieren. Ausgeschlossen, dass ich diese Hortensien oder sonstige Blumen in unserem Vorgarten am Leben erhalte.
Ich besitze ein Haus.
Nicht irgendein Haus, sondern diesen Ort meiner Kindheit, von dem ich dachte, er wäre für immer verloren.
Mir wird schmerzhaft bewusst, dass dieser Teil es auch immer noch ist. Er ist mit meinem Vater gestorben, ohne dass ich genau weiß, wieso man ihn mir entrissen hat.
Tränen schießen mir in die Augen, die ich hastig wegblinzle. Wenn ich jetzt anfange, höre ich nicht wieder auf. Ich darf mir das nicht erlauben. Jedenfalls noch nicht jetzt.
Mit zittrigen Händen schließe ich die Tür auf. Der Geruch von Kindheit und Sommerferien schlägt mir entgegen und lässt mich schwindelig werden.
Es ist fast so, als würde ich das tiefe Lachen meines Vaters von den Wänden widerhallen hören. Vollkommener Quatsch, das weiß ich. Aber daran denke ich zuerst. Daran, dass sein Lachen wie das des Bären aus meiner liebsten Kinderserie klingt. Oder klang. Vergangenheitsform, weil er nicht mehr da ist. Ich denke an das Gefühl, wenn sich die ersten Wellen des Meeres nicht mehr kalt anfühlen, sondern angenehm sind. Wie das Wasser über meine Füße schwappt, ich die Zehen in den feuchten Sand grabe und tief Luft hole. Und bei jeder Erinnerung ist mein Vater da.
Meine Gedanken laufen, rennen, stolpern. Zwischen dem, was war, und dem, was hätte sein können. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr so richtig, wonach ich überhaupt suche. Nach mir selbst? Nach ihm? Einfach nach dem Gefühl, genug zu sein?
Ich bemerke, dass ich immer noch mit dem Koffer in der Hand in der offenen Tür stehe, und irgendwie schaffe ich es, einige Schritte in den Flur hineinzugehen. Die schwere Tür fällt hinter mir ins Schloss, und sofort kommt die nächste Erinnerung in mir hoch. Die Stimme meiner Mutter, die mich ermahnt, dass man Türen niemals zufallen lässt. Dass man sie bewusst schließen soll, weil es sonst zu laut ist. Türen bewusst zu schließen hat für mich jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommen. Eine, die ich damals nicht verstanden habe. Ich blicke mich um. Das Sonnenlicht strahlt durch die vielen Fenster hinein und lässt die Staubkörner in der Luft tanzen. Irgendjemand hat sämtliche Möbel mit weißen Tüchern abgedeckt. Wahrscheinlich Maren, die Sekretärin meines Vaters, die sich nach seinem Tod um alles gekümmert hat. Dachte sie, dass es so weniger wehtun würde, oder wollte sie einfach nur die Möbel schützen?
Ich blinzele.
Einmal, zweimal.
Es fühlt sich an, als würden meine Gedanken versuchen, die Vergangenheit und die Gegenwart zu verknüpfen. Verschwommen erkenne ich das Klavier, über dem ebenfalls ein weißes Tuch liegt. Maren hat mir gesagt, dass das Haus seit einiger Zeit leer steht. Wie in Trance beginne ich, die weißen Tücher von den Möbeln zu nehmen. Ich öffne alle Fenster, lasse frische Luft herein und hoffe, dass sie das Chaos in meinem Kopf etwas besänftigen kann. Als das nicht klappt, greife ich nach meinem Handy, lasse Berq über die Bluetoothbox laufen, und bereits nach den ersten Klängen entspanne ich mich etwas. Ironisch, wenn man bedenkt, worum es in seinen Liedern geht.
Mein Handy zeigt drei verpasste Anrufe meiner Mutter an. Wir geben ein gutes Team ab. Meine Mutter, die all die Jahre auf meinen Vater wartete und trotzdem nie über ihn sprach. Und ich, die an vergilbten Fotos in einem Album hing, die uns auf dieser Insel zeigten, und nie über etwas anderes redete. Nach einer kurzen Nachricht, in der ich schreibe, dass ich heil angekommen bin, wechsle ich zu Instagram. Maren hat mir das WLAN-Passwort zusammen mit dem Schlüssel und den Hausunterlagen überreicht.
Während meiner Aufräumaktion hat @maxrose neue Instastories hochgeladen. Mit einem Klick kann ich sehen, wie er in den Zug in Hamburg ein- und in Westerland wieder aussteigt.
Aufregung und Panik vermischen sich mit Adrenalin, weil wir uns bald begegnen werden. Ich muss nur noch einen neuen Plan dafür aufstellen.
Ganz ehrlich, ich weiß, dass ich in diesem Szenario die weibliche Version von Joe Goldberg bin. Dieses Gefühl ist alles andere als schön, und trotzdem kann ich nicht anders. Also klicke ich erneut auf seine Story, präge mir jedes Detail ein und ignoriere das mulmige Bauchgefühl.
Laut Instagram ist Max … zeitgleich mit mir angekommen?
Sofort halte ich das Video an, pausiere es und schaue irritiert auf die Zeitangabe. Schockiert stelle ich fest, dass ich mich nicht getäuscht habe. Die Uhrzeit stimmt mit meiner Ankunft überein. Wir saßen im gleichen Zug. Lautlos lache ich auf. Vielleicht habe ich mich doch versehen … In meinem Abteil war er nicht, beim Aussteigen habe ich ihn auch nicht gesehen. Allerdings habe ich auch nicht nach ihm Ausschau gehalten, und da wir Semesterferien und Sommerbeginn haben, war es mehr als voll.
Kopfschüttelnd widme ich mich den nächsten Stories, bevor ich mich zu sehr in Gedanken verrenne.
Er zeigt sein Elternhaus, sitzt dem Winkel nach auf dem Beifahrersitz und filmt es durch die Frontscheibe. Als Song ist Help! von den Beatles unterlegt, worüber ich kurz lachen muss. Max nutzt keine Filter, keine GIFs oder Emojis. Ich tippe erneut auf die Story, halte sie mit dem Zeigefinger an und inspiziere das Haus, das ich bereits auf meiner Karte von Sylt eingekreist habe. Die aktuelle Adresse der Familie Rose herauszufinden war dank Geotagging nicht schwer. Mit jedem Foto, das man macht, speichert man die geografischen Koordinaten des Standortes ab. Ein Blick auf ein Bild vom Haus, das @maxrose gepostet hat, und zack weiß ich, dass die Familie immer noch im selben Haus wohnt. Ich war schon mal dort. Früher, als unsere Väter noch Geschäftspartner waren und Leopold für mich Onkel Leo hieß. Dass Leopold einen Sohn hatte, war traurigerweise nie ein Thema gewesen. Jetzt weiß ich allerdings, dass Max einige Jahre im Internat war und ich ihn deswegen nie zu Gesicht bekam.
Es fühlt sich falsch an, all diese Informationen zu sammeln. Wenn ich könnte, würde ich einfach zu Leopold gehen und ihn bitten, mir die Wahrheit über Papa zu sagen. Doch ausgerechnet er selbst hat mich darum gebeten, es nicht zu tun. In seinen Tagebüchern, die ich zusammen mit einem Brief erhalten habe, bittet er mich um Vergebung und darum, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Aus den Einträgen weiß ich aber auch, dass Leopold vieles zu verbergen hat und niemals mit mir darüber sprechen würde. Mit meinen Eltern hat er es auch nicht getan, wieso sollte es bei mir anders sein? Eine direkte Konfrontation steht erst am Ende des Sommers auf meinem Plan. Wenn ich handfeste Beweise und vielleicht ein Druckmittel habe.
Ich klicke mich gedankenverloren durch Max’ Instafeed. Ich muss zugeben, es sieht schon sehr ästhetisch aus und setzt sich hauptsächlich aus Rezepten, Songtexten und Reisefotos zusammen, die aber laut Datum schon älter sind.
Die große Anzahl der Follower überrascht mich nicht. Die Freundesgruppe, mit der Max auf Sylt unterwegs ist, hat etwas Elitäres und polarisiert, selbst unbeabsichtigt. Natürlich wollen die Menschen wissen, was in deren Leben passiert. Kampen ist für Sylt das, was die Upper East Side für New York ist.
Sonnengebräunte Haut, Zahnpastalächeln und prall gefüllte Konten. Die vergangenen Sommer hat die Gruppe immer zusammen auf Sylt verbracht. Laura Lieks, Tochter eines Immobilienmaklers, hat mir durch ihr Storyhighlight HOME!<3 verraten, was die typischen Orte für ein Treffen der Rich Kids sind.
Brunchen in der Strandbar, danach durch die Whiskeystraße schlendern und den Abend mit einem überteuerten Wein in der Buhne 16 mit Ausblick auf den orangegelben Sonnenuntergang ausklingen lassen. Privatpartys am quasi eigenen Strandabschnitt, und wenn es da zu langweilig wird, macht man einen Ausflug auf teuren Booten über das Meer. Laute Musik, viel Alkohol und keine Sorgen. Während fast alle stets in die Kamera lächeln, sieht Max grimmig aus, sobald er gezeigt wird. Ich frage mich, wann er angefangen hat, zurück nach Sylt zu kommen. Etwas an ihm passt einfach nicht ganz ins Bild, und mir brennt es unter den Nägeln, herauszufinden, was er verbirgt. Ich zwinge mich, sein Instagramprofil wieder zu schließen, als ich merke, dass mein Puls anfängt zu rasen.
Ist okay, Sophie. Du weißt, was du tust. Du kriegst das hin.
Langsam gehe ich durch den Flur, bis ich vor dem alten Arbeitszimmer meines Vaters stehe. Es liegt hinter dem Esszimmer, direkt neben dem Bad. Die Fenster sind zum Meer ausgerichtet, der große Schreibtisch steht direkt davor. Ein Ort, der für mich magisch war. Voller Bücher und wie ich jetzt auch weiß: voller Geheimnisse, die er hier einschloss. Hier muss er so viele verzweifelte Nächte verbracht haben. Wo er all das Chaos und die Intrigen vor uns geheim hielt in der Hoffnung, dass er es irgendwie hinkriegen würde. Mit zittriger Hand stoße ich die Tür auf und sehe ihn vor meinem inneren Auge dort sitzen.
Mit seiner Brille auf der Nase, dem zerzausten Haar und Kaffeeflecken auf dem Hemd, das er hochgekrempelt hat. Tausende Bücher und Stapel von Zetteln, die mit dem Aufschwingen der Tür kurz aufwirbeln, weil ein Luftzug mit hineinkommt.
»Es gibt Abendessen, Papa«, höre ich mein Kindheits-Ich sagen.
»Ich bin sofort bei dir, mein Schatz«, antwortet er und lächelt mich an.
Das tat er immer. Ich will nicht wissen, wie oft er sich dazu zwingen musste. Schnell schließe ich die Augen, wische die Erinnerung weg, und als ich wieder ins Zimmer schaue, ist er fort. Langsam sinke ich auf den Schreibtischstuhl, der leicht unter meinem Gewicht knarzt. Mein Blick wandert zu den Bücherregalen, in denen hauptsächlich Fachliteratur steht. Buchrücken mit goldener Schrift, sein Diplom an der Wand und unser Familienfoto auf dem Schreibtisch. Es schmerzt so unendlich, dass die Zeit hier einfach stehen geblieben ist, während sich alles andere verändert hat. Er ist wirklich weg. Er kommt nicht wieder. Klar, er war schon lange kein aktiver Teil meines Lebens mehr, aber bisher war die Möglichkeit stets da, dass er eines Tages doch vor meiner Tür stehen könnte, um mir alles zu erklären. Warum er nach seiner Haftstrafe nicht zurück zu uns kam und warum er mich allein ließ, bis ich anfing, alles zu hinterfragen. Durch seinen Brief weiß ich nun, dass er sich selbst keine Wahl ließ, bis es dafür zu spät war.
Tränen rollen meine Wangen hinunter. Kinder sehen ihre Eltern als Helden, aber vielleicht war mein Vater gar nicht der Mann, für den ich ihn immer gehalten habe.
Die Trauer wird von Wut abgelöst. Mit schnellen Schritten laufe ich zu meinem Koffer, der noch im Flur steht, öffne ihn und krame den dicken Ordner heraus, in dem ich all die Artikel aufbewahre. Der Tag, an dem die Polizisten mit dem Durchsuchungsbefehl kamen, flackert vor meinem inneren Auge auf, als ich den Zeitungsartikel in der Hand halte.
Damals war ich zu klein, um zu verstehen, was das alles bedeutete. Ich erinnere mich, dass ich an jenem Abend weinte und den Polizisten anflehte, mich loszulassen. Mama stand stumm dabei, tat und sagte nichts. Ich weiß sogar noch, dass ich dem Polizisten meinen geliebten Teddy im Gegenzug für meinen Vater anbot und er mich nur anlächelte. Ein Lächeln, das nicht ehrlich war. Sogar mit sechs habe ich das erkannt. Ich erinnere mich an das Tanzen der blauen Lichter, die sich im Fenster spiegelten, an lautes Gebrüll und stumme Tränen.
Ein Polizist blieb bei Mama und mir, während sie das Haus durchsuchten. Auch das Arbeitszimmer meines Vaters, aus dem sie seinen Laptop mitnahmen. An diesem Tag verließen meine Mutter und ich die Insel und kehrten nie mehr zurück. Statt darüber zu sprechen und uns einander anzunähern, entfernten Mama und ich uns innerlich in der Folge immer weiter voneinander. Doch jetzt bin ich hier und stelle mich der Vergangenheit. Hoffentlich. Den Ordner fest umklammernd, laufe ich zurück ins Arbeitszimmer.
Ich streiche über das dunkle Holz des Schreibtisches und bilde mir ein, dass etwas von meinem Vater hier zurückgeblieben ist. Etwas, das mich vielleicht zusammenhält.
Das Zimmer hat etwas Tröstliches an sich. Der Ledergeruch des Sofas in der Ecke, das Holz des Schreibtisches und der Staub, der im Sonnenlicht tanzt, das durch das große Fenster hereinkommt. Mein Blick bleibt an einem Bilderrahmen an der Wand hängen, dessen Glas gesprungen ist. Mein Herz setzt einen Schlag aus, als ich erkenne, wer darauf zu sehen ist.
Papa, Mama, ich und Onkel Leo. Auch bekannt als Leopold Rose. Der Mann, der seinen Erfolg auf dem Untergang meines Vaters aufbaute.
Papa hält mir auf dem Foto die Hand vor die Augen, und ich grinse breit, obwohl mir gerade zwei Schneidezähne fehlen. Leopold hat den Arm um Papa gelegt. Sie sehen fast wie Brüder aus, wie beste Freunde. Ich frage mich, was passiert ist, dass er Papa so verraten hat. Seit Papas Verhaftung habe ich nie wieder was von Leopold gehört, obwohl ich weiß, dass er und Mama noch losen Kontakt halten.
Leider bringt mir diese Tatsache aber nichts, denn Mama war gegen meine Reise, und sie wäre auch strikt gegen mein Vorhaben hier auf der Insel. Sie würde mir niemals helfen. Ich glaube sogar, dass sie gar keine Antworten will. Vielleicht weil sie Angst davor hat. Vielleicht weiß sie aber auch mehr, als sie mit mir teilt. Schon lange vor Papas Tod habe ich damit aufgehört, sie nach ihm zu fragen. Um trotzdem an die Informationen zu kommen, werde ich mich in die Gesellschaft hier in Kampen einfügen. Maximilian Rose und sein reicher, exklusiver Freundeskreis sind ein guter Anfang. Von Papa habe ich genug Geld geerbt, sodass ich mich problemlos integrieren kann, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und sobald ich dieses Haus verkauft habe, bleibt genug für eine Eigentumswohnung in Kiel und ein gutes Startkapital für ein Atelier. Ein Neubeginn.
Meiner Mutter habe ich erzählt, dass ich mir auf Sylt eine kleine Auszeit nehme. Dass ich mich um unser Haus kümmere und zeitgleich mein neues Projekt fertigstelle. Zwei Fliegen mit einer Klappe, habe ich mit einem Lächeln gesagt, als wäre es nichts, obwohl es alles ist. Sie muss nichts über den Brief wissen, den Papa mir kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Wenn sie wüsste, was der Hauptgrund für mein Kommen ist, würde sie durchdrehen. Sie würde es nicht verstehen und versuchen, es mir auszureden.
Ich sitze im Schneidersitz auf dem Parkett des Arbeitszimmers, und sämtliche Kopien von Zeitungsartikeln, Fotos und Berichten liegen vor mir ausgebreitet. Das Tagebuch meines Vaters sieht abgewetzt und alt aus, jedoch ist es ein Teil von ihm gewesen und fühlt sich deswegen vertraut und irgendwie nach Zuhause an.
Bevor ich mich zu sehr in diesem Gedanken verliere, beschließe ich, den Strandabschnitt aufzusuchen, der sich hinter unserem Haus befindet. Etwas Meeresrauschen und kaltes Wasser werden mir bestimmt guttun.
Ich ziehe meine Schuhe aus, durchquere das Wohnzimmer und trete durch die große Doppeltür auf die Terrasse. Der Wind füllt meine Lunge, lässt meine Haare in alle Richtungen wehen, während ich den Privatsteg durch die Dünen hinunter zum Wasser laufe.
Ich bin dankbar, dass keine Menschen in der Nähe sind, und erinnere mich daran, dass meine Mutter immer gescherzt hat, wir hätten unser eigenes Stück Meer direkt vor der Haustür. Mein Blick wandert über die Dünen hinüber zum Anwesen der Familie Rose. Es befindet sich weit genug weg, um die Privatsphäre zu wahren. Gleichzeitig ist es nahe genug, um erkennen zu können, wer wann das Haus verlässt und wo noch Lichter brennen. Selbst aus der Ferne sieht es riesig aus und übertrifft unser Haus um zwei weitere Stockwerke. Außerdem gibt es ein Gästehaus. Über allem ragt der Turm des Anwesens empor, und ich erinnere mich an einen großen Balkon, der zum Meer hinausgeht.
Ob die Roses gerade in ihrem perfekten Garten sitzen, in dem ich früher manchmal gespielt habe, wenn Papa und Leopold Geschäftliches zu regeln hatten? Sicherlich trinken sie jetzt eine Flasche Château Pétrus, die Lippen schon ganz blau vom Wein, und sinnieren über belanglose Themen. Einige Augenblicke überlege ich, einfach zu ihnen hinüberzulaufen, doch das Risiko ist zu groß. Die Konfrontation mit Leopold muss wohlüberlegt sein. Die Chance auf Antworten kann ich nicht so kopflos angehen.
Ich löse meinen Blick und schaue hinaus auf den Horizont. Das Meer glitzert wunderschön durch die Sonnenstrahlen. Über mir kreisen die Möwen, bei deren Anblick ich mich erneut in der Vergangenheit verliere.
»Papa, warum sind die Möwen immer hier? Sie können doch überallhin fliegen, warum kommen sie immer wieder zurück?«
»Weil sie hier zu Hause sind. So wie du und ich.«
»Und Mama.«
»Und Mama«, wiederholt er meine Worte. »Würdest du nicht immer wieder zurück nach Hause kommen?«
Empört stemme ich beide Hände in die Hüfte. »Was ist das denn für eine doofe Frage! Natürlich!«
Er lacht, dann streicht er mir die Haare aus dem Gesicht.
»Kleines, ich muss morgen wieder weg. Aber egal, wo ich bin, gerade ist mein Zuhause genau hier.«
»Auf der Insel?«
»Nein, nicht hier. Da, wo du bist.«
»Und Mama.«
Sein Lächeln verrutscht etwas, als würde ihm etwas wehtun. Doch dann antwortet er: »Und Mama.«
Ich vergrabe die Zehen im feuchten Sand, und mit der nächsten Welle kommt die nächste Erinnerung.
»Ich verrate dir ein Geheimnis, okay?«, flüstert mein Vater meinem Kindheits-Ich zu.
Es ist schwül, doch das Wasser ist eigentlich noch etwas zu kalt, um darin zu baden. Etwas, was meinen Vater nie stört, weshalb ich vorgebe, dass es mich auch nicht stört. Ich will schließlich so stark sein wie er.