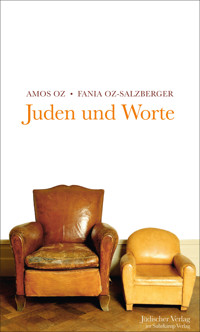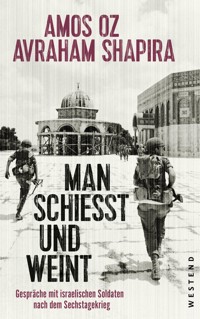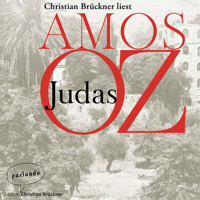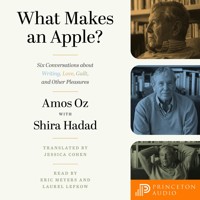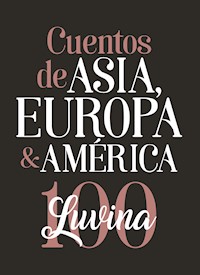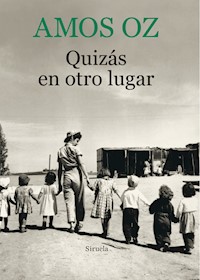16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
2014 setzte während der Publikation des Romans Judas eine Zusammenarbeit zwischen Amos Oz und der Lektorin Shira Hadad ein. Daraus entwickelten sich intensive Gespräche (die das neueste Buch des israelischen Autors in überarbeiteter Form druckt), in denen, ohne Tabus und falsche Scham, sein Leben und Schreiben zum Thema wird. Da die Lektorin sich nicht auf eine Rolle als Stichwortgeberin beschränkt, sind Kontroversen nicht ausgeschlossen, zumal die jüngere, weibliche Perspektive auf das Tun und Lassen des weltweit anerkannten Schriftstellers zu produktiven Provokationen führt.
Die Rolle des streitbaren öffentlichen Intellektuellen wird in diesen Gesprächen vor dem Hintergrund der privaten Erfahrungen beleuchtet. Wie durchdringen sich beide Sphären? Was führt zur Geburt des Schriftstellers unter neuem Namen angesichts des Selbstmords der Mutter? Wie hat man sich die konkrete Arbeit am Schreibtisch vorzustellen? Welche Veränderungen haben sich im Lauf der Jahrzehnte dabei ergeben? Wie kommt es zu den Stoffen? Kann Fiktion Änderungen auf dem privaten oder öffentlichen Feld hervorrufen? Welche Bedeutung haben erste und letzte Worte bei Romanen? Und so weiter und so fort.
In diesen Gesprächen erzählt Amos Oz von seinem Leben, von privaten und politischen Triumphen und Niederlagen, seiner Zeit im Kibbuz, diskutiert über den Feminismus und spricht über Humor und Fanatismus, über Literatur und Tod. Und der Leser erhält Antworten auf die Fragen, die er schon immer an die Literatur und die Beweggründe dieses Autors stellen wollte: Amos Oz für Anfänger und Fortgeschrittene.
Ein umfassendes Porträt des berühmten Autors und das Vermächtnis des Friedensaktivisten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
AMOS OZ mit Shira Hadad
WAS IST EIN APFEL?
Sechs Gespräche über Schreiben und Liebe, Schuldgefühle und andere Genüsse
Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer
Suhrkamp
Inhalt
Vorwort
Pfeildurchbohrtes Herz
Manchmal
Ein Zimmer für sich allein
Wenn sie dein Kind verhauen
Was kein Schriftsteller vermag
Die Ampeln springen längst ohne uns um
Anmerkungen
Vorwort
Im Frühjahr 2014, als ich das Buch Judas von Amos Oz lektorierte, begann unser Gespräch. Nachdem das Buch erschienen war, im Sommer desselben Jahres, entdeckten wir, dass unser Gespräch noch nicht abgeschlossen war. Wir trafen uns weiterhin bei Oz zu Hause und unterhielten uns über Bücher und Autoren, über Inspiration und Einflüsse, Schreibgewohnheiten und Schuldgefühle, Ehe und Elternschaft. Nach einigen Wochen zogen wir vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer um und legten auf den Tisch zwischen uns ein Aufnahmegerät.
Wir nahmen Dutzende von Stunden auf; aus ihnen entstand dieses Buch. Die Gespräche erscheinen hier nicht in der Reihenfolge, in der sie stattfanden, und nicht jedes Kapitel im Buch ist die Transkription nur eines einzigen Treffens. Da wir zu bestimmten Themen, die uns beschäftigten, immer wieder zurückgekehrt waren, erweiterten, kürzten und verbanden wir Teile aus verschiedenen Gesprächen. Im Laufe dieser gemeinsamen Arbeit wurden wir Freunde. Die Kapitel des vorliegenden Buches sind keine journalistischen Interviews, vielmehr das Ergebnis eines andauernden Dialogs, Ausdruck einer Freundschaft und Nähe, die über einen langen Zeitraum hinweg gewachsen sind.
Viele Themen haben wir überhaupt nicht berührt. Wir hatten nicht den Anspruch, dass dieses Buch »umfassend« sein müsse. Im Sommer 2017 erschien der Band Liebe Fanatiker – Drei Plädoyers. Dessen drei Kapitel überschnitten sich teilweise mit denjenigen Gesprächen, die einen eher politischen Charakter hatten, und wir beschlossen, sie aus diesem Buch herauszunehmen. Andere Teile, essayistischer gehalten als die hier abgedruckten, werden in einem weiteren Buch erscheinen. So bekam Was ist ein Apfel? die Gestalt eines persönlichen, biografischen Buches: ein mögliches Porträt von Amos Oz, so wie er sich mir in den letzten Jahren gezeigt hat.
Shira Hadad, Mai 2018
Pfeildurchbohrtes Herz
Was drängt deine Hand zum Schreiben?
Im Hof des Rechavia-Gymnasiums in Jerusalem stand ein Eukalyptusbaum. Jemand hatte in seine Rinde ein Herz geritzt, das von einem Pfeil durchbohrt wird, und links und rechts des durchbohrten Herzens stand »Gadi« und »Ruthi«. Ich erinnere mich, dass ich schon damals, da war ich vielleicht dreizehn, dachte: Das war bestimmt dieser Gadi und nicht Ruthi. Aber warum hat er das getan? Wusste er nicht, dass er Ruthi liebt? Wusste sie denn nicht, dass er sie liebt? Ich glaube, ich dachte schon damals: Vielleicht hat er selbst bereits irgendwo gewusst, dass das vorübergeht, dass alles vorübergeht, dass es mit dieser Liebe irgendwann aus sein wird. Aber er wollte etwas hinterlassen. Wollte, dass von dieser Liebe etwas bleibt, auch wenn sie selbst vergeht. Das ähnelt ein bisschen dem Drang, Geschichten zu erzählen oder zu schreiben: der Wunsch, etwas den Klauen der Zeit und des Vergessens zu entreißen; das ist das eine. Außerdem der Wunsch, einer Sache, die nie mehr eine zweite Gelegenheit bekommen wird, doch eine zweite Chance zu geben. Eine weitere Kraft, die die Hand zum Schreiben drängt, ist auch der Wunsch, dass etwas nicht ausgelöscht werden soll, so als sei es nie gewesen – und ich meine da nicht unbedingt persönliche Dinge, die ich erlebt habe. Mich zum Beispiel hat nie jemand angestellt, um auf dem Dachboden eines alten Gebäudes zu wohnen und mich stundenlang gegen Bezahlung mit einem behinderten alten Mann zu unterhalten, so wie Schmuel Asch es in Judas tut. Das ist mir nicht passiert. Aber es gab in Jerusalem Leute, die haben wie Gerschom Wald gesprochen. Es hat sie gegeben, und jetzt gibt es sie nicht mehr. Ich wollte, dass das Jerusalem dieser in Begeisterung entbrannten, hochgebildeten Leute nicht vergessen wird, dieser Leute, die mit einem Bein in [Joseph Chaim] Brenners Schriften standen und mit dem andern in der Bibel, mit einem Bein bei Ben Gurion, mit einem andern bei Nietzsche und mit wieder einem bei Dostojewski oder [Wladimir Zeev] Jabotinsky.
Hast du das Gefühl, dass sich deine Beweggründe fürs Schreiben mit der Zeit verändert haben? Oder bleiben sie grundsätzlich dieselben?
Ich weiß nicht, Shira. Ich glaube, das bleibt immer gleich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich frag mich fast nie nach meiner Motivation zum Schreiben. Wenn ich mich noch vor fünf Uhr in der Früh hier hinsetze, nach einem Spaziergang durch die leeren Straßen, mit meiner ersten Tasse Kaffee, da frag ich mich nie nach meiner Motivation. Da schreib ich einfach.
Aber fragst du, woher eine Geschichte kommt?
Ja, das schon. Manchmal frag ich, und nicht immer find ich eine Antwort. Ich erzähl dir etwas, was mit deiner Frage zusammenhängt: Ich habe mal ein russisches Gedicht von Anna Achmatowa übersetzt, allerdings aus der englischen Fassung von Stephen Berg, weil ich kein Russisch kann. Und dieses Gedicht hat genau, aber ganz genau mit deiner Frage zu tun. Ich hab es vor Jahren auf der Schreibmaschine getippt, in einer Zeit, als es noch keinen Computer gab. Das Gedicht endet so:
»Und manchmal sitz ich. Hier. Winde vom gefrorenen Meer
blasen durch meine offnen Fenster. Ich steh nicht auf. Schließe
sie nicht. Lass die Luft mich berühren. Erfriere.
Abenddämmerung oder Morgenlicht – derselbe glänzende Wolkenschein,
eine Taube pickt ein Weizenkorn von meiner ausgestreckten Hand,
und diese Weite, grenzenlos, die Weiße des Blatts auf meinem Pult –
ein einsamer, undeutlicher Trieb hebt meine Rechte, leitet mich,
so viel älter als ich, kommt, senkt sich
blau wie ein Lid, ohne Gott, und ich beginne zu schreiben.«
Das ist wunderschön.
Ich bin kein Übersetzer, aber dieses Gedicht wollte ich unbedingt aus dem Englischen übersetzen. Vielleicht ist es auf Russisch noch schöner, das weiß ich nicht.
Ab und zu frag ich mich schon, woher die Geschichten kommen, und habe keine richtige Antwort. Doch im Grunde weiß ich es ja, denn ich führe ja schon immer das Leben eines Detektivs. Das steht in Eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Ich belausche die Gespräche anderer, beobachte fremde Menschen; wenn ich Schlange stehe, im Ärztezentrum, auf dem Bahnhof oder auf dem Flughafen – da lese ich nie Zeitung. Statt Zeitung zu lesen, hör ich zu, was die Leute so reden, klaue Gesprächsfetzen und vervollständige sie. Oder ich schau mir ihre Kleider an oder ihre Schuhe – Schuhe erzählen mir immer besonders viel. Ja, ich schau mir die Leute an und ich höre zu.
Mein Nachbar im Kibbuz Hulda, Meir Sibahi, pflegte zu sagen: Bevor ich an dem Fenster vorbeigeh, hinter dem Amos schreibt, bleib ich immer kurz stehn, zieh meinen Kamm raus und kämme mich. So bin ich, falls ich in eine Geschichte von ihm eingehe, wenigstens gekämmt. Eigentlich ganz logisch, aber so funktioniert das bei mir nicht. Vielleicht könnte man es so sagen: ein Apfel. Nehmen wir einen Apfel. Was macht einen Apfel aus? Wasser, Erde, Sonne, ein Apfelbaum und etwas Dünger. Der Apfel ähnelt keinem dieser Dinge. Sie alle machen ihn aus, aber er ist ihnen nicht ähnlich. So ist das mit den Geschichten. Sie bestehen wohl aus der Summe der Begegnungen, der Erfahrungen und aus sehr viel Zuhören.
Mein erster Impuls ist der, zu erahnen, was ich empfinden würde, wenn ich er wäre oder sie: Was würd ich denken? Was würd ich wollen? Wofür würd ich mich genieren? Was zum Beispiel dürfte niemand auf der Welt über mich wissen? Welche Röcke würde ich tragen? Was würde ich essen? Solche Fragen haben mich schon früher begleitet, lang bevor ich anfing, Geschichten zu schreiben, in der Kindheit. Ich war Einzelkind, und ich hatte keine Freunde. Meine Eltern haben mich ins Café in der Ben-Jehuda-Straße in Jerusalem mitgenommen und mir ein Eis versprochen, wenn ich still dabeisitzen würde, während sie sich mit ihren Freunden unterhielten. Eis war in Jerusalem damals eine Seltenheit. Nicht weil es viel Geld kostete, sondern weil alle unsere Mütter durch die Bank – religiöse und unreligiöse, sephardische und aschkenasische – felsenfest glaubten, Eis mache einen roten Rachen, und das bedeutete Entzündung, und Entzündung bedeutete Grippe, und Grippe bedeutete Angina, und Angina bedeutete Bronchitis, und Bronchitis bedeutete Lungenentzündung und Lungenentzündung Tuberkulose. Kurz: Eis oder Kind. Und trotzdem haben sie mir einmal ein Eis versprochen, wenn ich sie niemals in ihren Unterhaltungen stören würde. Dabei haben sie da mindestens siebenundsiebzig Stunden ununterbrochen mit ihren Freunden geredet. Um nicht verrückt zu werden vor Einsamkeit, fing ich eben an, die Nachbartische auszuspionieren. Ich stahl Sätze aus Gesprächen, schaute, wer was bestellte, wer bezahlte, mutmaßte, in welcher Beziehung die dort Sitzenden zueinander standen, versuchte sogar, mir aufgrund ihres Aussehens und ihrer Körpersprache vorzustellen, woher sie kamen und wie es in ihrer Wohnung aussah. Das tu ich bis heute. Aber es ist nicht so, dass ich fotografiere, nach Hause geh, das Foto entwickle, und dann hab ich eine Geschichte. Unterwegs passieren noch viele Verwandlungen. So gibt es in Black Box zum Beispiel einen jungen Mann, der die Angewohnheit hat, sich mit der linken Hand, indem er sie umständlich hinter dem Kopf entlangführt, am rechten Ohr zu kratzen. Eine Frau hat mich mal gefragt, woher ich das hätte. Auch sie kannte jemanden, der sich mit der linken Hand auf diese Art am rechten Ohr kratzt. Ich sagte ihr, ich sei mir ziemlich sicher, dass ich das mal irgendwo gesehen und mir eingeprägt habe. Aber wo? Du kannst dich auf den Kopf stellen, ich weiß es nicht mehr. Das kam aus einer lang verschütteten Erinnerung, es kam nicht aus heiterem Himmel, aber ich habe keine Ahnung woher.
Lass es mich so sagen: Wenn ich einen Artikel schreibe, schreib ich in der Regel aus Wut: Der zentrale Beweggrund ist, dass ich über etwas wütend bin. Wenn ich aber eine Geschichte schreibe, ist einer der Gründe, die die Hand bewegen, Neugier. Eine Neugier, die ich nicht stillen kann. Ich find es wahnsinnig spannend, in die Haut eines anderen zu schlüpfen. Und Neugier ist, glaub ich, nicht nur eine zwingende Voraussetzung für jede intellektuelle Arbeit, sondern auch eine ethische Angelegenheit. Das ist vielleicht die moralische Dimension der Literatur.
Da bin ich ganz anderer Meinung als Abraham B. Jehoschua: Er rückt die ethische Frage in den Vordergrund des literarischen Schaffens: Schuld und Sühne. Ich verstehe die ethische Dimension anders: für ein paar Stunden in die Haut eines anderen zu schlüpfen und in seinen Schuhen durch die Welt zu gehen. Das hat ein eher indirektes moralisches Gewicht, nicht besonders groß, ich will nicht übertreiben. Aber ich glaube wirklich, dass ein neugieriger Lebenspartner ein etwas besserer ist als einer, der nicht neugierig ist; er ist auch als Vater oder Mutter ein bisschen besser. Lach nicht, ich glaube sogar, dass ein neugieriger Mensch auch ein besserer Autofahrer ist, denn er überlegt sich, was der Fahrer in der Spur neben ihm womöglich im nächsten Moment tut. Ich glaube, ein neugieriger Mensch ist auch ein besserer Liebhaber.
Du sprichst zu Recht von Neugier als von einer humanistischen Tugend. Aber es gibt auch eine andere, geradezu umgekehrte Neugier, etwa die eines Kindes, das einen Vogel zerlegt, um herauszufinden, wie er von innen aussieht. Kann deiner Meinung nach eine aus Neugier geschriebene Literatur, die den andern in seiner Armseligkeit darstellt und dabei an Sadismus grenzt, große Literatur sein?
Stimmt. Da hast du recht. Man darf nicht vergessen, dass es auch eine dunkle Neugier gibt. Man findet sie bei Kindern und bei Erwachsenen und auch bei Schriftstellern. Die Neugier von Menschen, die um einen Verwundeten herumstehen, um sein Leiden anzuschaun, und dabei eine gewisse Lust empfinden. Und es gibt Werke, in denen der Autor vom Bösen gefesselt und sogar verzaubert ist, etwa Othello von Shakespeare oder Reise ans Ende der Nacht von Céline; auch diese Werke besitzen eine moralische Dimension. Sie fordern den Leser, die Leserin heraus oder erwecken in ihm oder ihr eine Art moralische Antikörper.
Und in deinen Büchern? Gibt es da manchmal so eine dunkle Neugier? Ich denke schon.
Gewiss gibt es die. Zum Beispiel in der ausführlichen Schilderung vom Todeskampf des Helden in der Erzählung Der Weg des Windes. Oder in den Beschreibungen von Sadismus, Qualen und Folter in der Erzählung Dem Tod entgegen.
Heute bist du ja ein sehr bekannter Schriftsteller, die Leute erkennen dich sofort. Wird diese Sache mit dem »Kontakt zur Wirklichkeit« im Laufe der Zeit nicht immer problematischer?
Nein. An den Orten, an denen ich Menschen beobachte, kennt man mich nur selten. Wenn ich in ein Restaurant gehe, erkennen mich die Leute manchmal. In der Universität erkennen sie mich. In der Autowerkstatt oder in der Schlange im Ärztezentrum erkennen sie mich fast nie. Hin und wieder fragt jemand: Sind Sie nicht der aus dem Fernsehen? Waren Sie nicht mal Knessetabgeordneter? Das kommt vor, manchmal bei Taxifahrern, aber normalerweise erkennt man mich nicht. Und im Ausland sowieso nicht. Wenn ich in eine neue Stadt komme, geh ich in den letzten Jahren nicht mehr in die Museen, meine Knie tun mir weh. Ich besichtige auch keine Sehenswürdigkeiten, ich hab genug gesehen. Ich sitze draußen vor einem Café oder, wenn's kalt ist, in so einem Glaskasten vor einem Café. Da kann ich zwei, drei Stunden alleine dasitzen und fremde Leute beobachten. Es gibt nichts Spannenderes.
Und wenn du aus dem Café oder vom Ärztezentrum an den Schreibtisch zurückkehrst, hast du da feste Rituale, was das Schreiben angeht?
Weißt du, Shira, ich werde dir nicht alles in dieses Aufnahmegerät sagen. Ohne das Tonband würd ich dir vielleicht mehr erzählen. Aber auch nicht alles. Mein wichtigstes Ritual ist, dass jedes Ding seinen festen Platz haben muss. Immer muss alles an seinem Platz sein. Damit mach ich meiner Familie das Leben ziemlich schwer. Die ganze Zeit stell ich Dinge zurück an ihren Platz. Da beginnt einer bei uns seinen Kaffee zu trinken, Nily, meine Töchter, mein Sohn, die Enkel, sogar Gäste trinken ihren Kaffee, lassen ihn nur einen Moment unbeachtet, stehen auf und beantworten einen Anruf, und wenn sie zurückkommen, ist ihr Kaffee bereits im Ausguss gelandet, und die Tasse steht gespült umgekehrt auf dem Abtropfständer.
Nicht leicht, so in einem Haus mit Kindern zu leben.
Sie haben sich immer über mich geärgert. Alles, was offen rumsteht, wird sofort weggeräumt: Schlüssel, Dokumente, Briefe, Zettelchen. Alles, was rumliegt, kommt sofort erbarmungslos in eine Schublade.
Ja, ich sehe, wie vollgestopft deine Schubladen sind.
Hör zu, mein Vater war Bibliothekar, mein Schwiegervater war Bibliothekar, meine Schwägerin ist Bibliothekarin, meine Frau ist Archivarin. Was konnte da andres aus mir werden? Sogar meine Katze ordnet das Essen in ihrem Napf, und wenn sie es nicht tut, dann tu ich es.
Ich glaube nicht, dass ich beim Schreiben Rituale habe. Bei anderen würde ich das vielleicht als Rituale empfinden. Bei mir sind es schlicht Arbeitsgewohnheiten. Mein Tag beginnt früh. Ich habe nur selten mal nachts was geschrieben. Auch wenn ich nachts nicht schlafe, schreiben tu ich nicht. Erst am Morgen. Früher war ich absolut abhängig von Zigaretten. Konnte keine Zeile schreiben ohne Zigarette. Es ist sehr schwer gewesen, das Schreiben vom Rauchen zu trennen. Verdammt schwer, aber ich hab's überlebt.
Schreibst du mit der Hand oder auf dem Computer?
Ich schreibe Unmengen Konzepte mit der Hand, und dabei schreib ich nie von einem vorigen Konzept ab, sondern ich schreibe einen Absatz und leg ihn in die Schublade, schreib ihn nochmal ganz neu und tu ihn wieder in die Schublade, und dann schreib ich nochmal eine andere Version derselben Szene. Wenn in der Schublade vier, fünf, manchmal auch zehn Versionen liegen, hol ich sie alle hervor, leg sie nebeneinander auf den Tisch und ziehe aus jeder Version etwas heraus. Das ergibt die vielleicht endgültige Version, die ich dann selber mit zwei Fingern in diesen Computer hier tippe.
Und vor dem Schreiben machst du deine Morgenspaziergänge.
Ja, jeden Tag, außer es regnet in Strömen oder es ist ein so staubiger Tag wie heute, wo man nicht atmen kann. Das hilft mir, den Sachen die richtigen Proportionen zu geben. Was ist wichtig? Was weniger? Was wird in ein paar Tagen vergessen sein? Und was vielleicht nie? Ich geh noch vor dem ersten Kaffee etwas raus. Steh auf, dusche, rasiere mich und geh los. Um Viertel nach vier bin ich draußen, und Viertel vor fünf oder kurz vor fünf wieder zurück, da ist es draußen noch dunkel, und ich sitze schon mit einem starken Kaffee an diesem Tisch hier. Das sind meine Stunden. Das ist das ganze Ritual.
Bei Wisława Szymborska gibt es ein Gedicht mit dem Titel Vier Uhr am Morgen, da schreibt sie: »Um vier Uhr am Morgen geht's niemandem gut.«1Sie hat recht. Vier Uhr am Morgen ist furchtbar.
Liebe Frau Szymborska, wie schade, dass wir uns nie begegnet sind! Ich hätte Sie auf einen Kaffee eingeladen und Ihnen vielleicht etwas von dem Zauber dieser frühen Stunde gezeigt, und den Kaffee, den hätte ich Ihnen sogar ausgegeben. Für mich ist das keine Qual. Vier Uhr am Morgen fällt mir nicht schwer. Ich wache ganz ohne Wecker auf. Auch am Schabbat und an Feiertagen. Da ruft keiner an, Nily schläft, und wenn noch andre Leute im Haus sind, schlafen auch die. Das sind die Stunden, in denen mich keiner braucht. In Arad bin ich morgens vor Sonnenaufgang in die Wüste gegangen, weil die Wüste dort fünf Minuten hinter unserem Haus anfing. Hier in Tel Aviv geh ich manchmal in den kleinen Park oder einfach so durch die Straßen, weil es mich interessiert. Die Fenster sind dunkel, außer bei denen, die im Bad Licht brennen lassen. Viele Leute lassen nachts im Bad Licht brennen. Vielleicht glauben sie, das schreckt Einbrecher ab. Vielleicht lassen sie es aber auch an, falls das Kind nachts aufwacht. Oder sie glauben, der Tod kommt nicht, wenn in der Dusche das Licht brennt.
Einmal stand morgens um halb fünf eine Frau am Fenster und schaute ins Dunkel. Und ich stand da draußen und schaute sie aus der Dunkelheit an. Nein, nicht aus dem Grund, aus dem du denkst. Zumindest nicht nur. Ich betrachtete sie aus der Dunkelheit und fragte mich, was sie in diesen Stunden wohl erlebte. Danach entfernte sie sich vom Fenster und knipste das Licht aus, und vielleicht blieb sie auch dort stehn und schaute noch weiter ins Dunkel, und ich bin weitergegangen. Jedenfalls ging ich dort weg mit dem Anfang, mit dem Kern für eine Geschichte. Ich hab sie noch nicht geschrieben. Vielleicht werd ich sie schreiben, vielleicht auch nicht.
Außerdem kann ich auf diese Art manchmal dem Zeitungsboten »Guten Morgen« sagen. Vor ein paar Tagen hab ich im Park einen jungen Mann mit einem Hund gesehn, um vier Uhr früh! Er hat ihn nicht ausgeführt, sondern auf der Wiese einfach mit ihm gespielt, um vier Uhr früh. Er warf einen Stock, und der Hund brachte ihn zurück. Jetzt, wo es auf die Hohen Feiertage zugeht, seh ich manchmal auch einen Mann, der schon wahnsinnig früh in die Synagoge geht, zu den Bußgebeten, mit Tallittäschchen und Gebetsriemen. Dann sag ich »Guten Morgen« oder am Schabbat »Schabbat Schalom«, aber mehr nicht. Ich bleib nicht stehen, um mit Leuten zu reden. Nicht bei diesen Morgenspaziergängen.
Denkst du dabei über das nach, woran du gerade schreibst?
Ja, ich denke über das nach, was mich auf dem Schreibtisch erwartet. Denn fast immer bin ich ja irgendwo mittendrin. Dann überleg ich, wo war ich gestern stehngeblieben, als ich aufgestanden bin, und in welcher Richtung will ich weitermachen. Nicht immer geschieht das, was ich mir überlege, dann auch. Irgendwie hab ich meine Leute, meine Figuren immer mit dabei, wenn ich spazieren geh. Zum Beispiel Bracha, die Frau aus der Erzählung hataltalim scheli kfar afu ad Sin (Meine Locken sind schon bis China geflogen)2, oder ihren Mann, Mosche. Dieser Mosche spricht in der ganzen Geschichte nicht mehr als fünf oder sechs Worte, und er kommt letztlich ziemlich ekelhaft rüber. Auch körperlich ist er ziemlich abstoßend. Aber – und das ist es – ich weiß über ihn mehr. Ich weiß über meine Figuren viel, viel mehr, als was ich über sie geschrieben habe. Über alle. Auch über Hannah aus Mein Michael oder über Fima aus Der dritte Zustand. Über ihre Kindheit, ihre Eltern, über ihre erotischen Phantasien. Ich verwende nur nicht alles, was ich über sie weiß. Und während ich Meine Locken sind schon bis China geflogen schrieb, wusste ich sogar von der anderen Frau, die Mosche in Netanja gefunden hat. Ich hab das nicht in die Erzählung eingebaut, es war mir von Anfang an klar, dass es da nicht reingehört, aber ich wollte etwas genauer wissen, was er für ein Mensch ist, was er an ihr auszusetzen hat, an dieser Bracha, denn er hat ja was an ihr auszusetzen. Deshalb musste ich das alles wissen. Nicht für die Geschichte. Nur um genug Stoff zu haben, aus dem ich das Kleid zuschneiden kann. Ungefähr so funktioniert das.
Du hast nie über Kriege geschrieben, obwohl du in Kriegen mitgekämpft hast. Genauer gesagt, Kriege sind in deinen Büchern auf ganz unterschiedliche Weise präsent, aber es gibt keine Szenen, die auf dem Schlachtfeld spielen.
Das stimmt. Ich habe nie über Kriege geschrieben oder über Schlachtfelder. Ich hab es versucht, aber es ist mir nicht gelungen. Ich kann darüber nicht schreiben. Ich war zweimal im Krieg, im Sechstagekrieg im Sinai und im Jom-Kippur-Krieg auf dem Golan. Darüber kann ich nicht schreiben.
Hast du es versucht?
Ja. Ich habe versucht, darüber zu schreiben, eine Art Prosa, so eine Art Berichterstattung; es zu beschreiben, es überhaupt erst mal aufzuschreiben. Aber das hat nicht funktioniert. Noch nicht mal nur für mich selbst. Unter anderem, weil meine stärksten Erinnerungen an die Schlachtfelder diese Gerüche sind. Die kriegst du nicht rüber. Weder in der Literatur noch im Film. Das schafft nicht einmal Tolstoi in Krieg und Frieden in der Beschreibung der Schlacht bei Borodino oder Remarque in seinen Beschreibungen des Ersten Weltkriegs. Es kommt nicht rüber. Sogar S. Yishar in Ein arabisches Dorf oder in jemej ziklag (Die Tage von Zyklag) schafft das nicht. Und auch der Film nicht. Dieser entsetzliche Gestank kommt nicht rüber. Und ohne den stimmt es einfach nicht.
Nichts auf der Welt stinkt so wie ein Schlachtfeld. Brennendes Metall, brennendes Gummi, brennende Leichen und Munition, die explodiert ist, Kot und Urin, Rauch und Verwesung – das Schockierendste ist der Geruch. Der Gestank. Ja. Man kann sich vielleicht auf die Bühne stellen und sagen, Leute, Krieg stinkt, aber das bewirkt nichts. Die Sprache hat nicht genügend Wörter für Geruch. Du hast in letzter Zeit Eine Geschichte von Liebe und Finsternis ja nochmal gelesen. Da gibt es nichts über das Schlachtfeld. Gar nichts. Es gibt ein paar Stellen von der Zeit der Belagerung Jerusalems, als ich ein Kind war. Zwanzig Leute haben in unserer kleinen Kellerwohnung gewohnt, weil sie als Bunker für das ganze Haus diente. Sogar dort, diese Menschen, nicht mal Soldaten, sondern Zivilisten, Alte und Kinder, und alle ungewaschen, und alle verrichten da auch ihr Geschäft, dicht gedrängt in der kleinen Wohnung – wie es dort gestunken hat, das ist mein stärkster Eindruck aus dieser Zeit. Ich glaube, über diesen Gestank hab ich dort geschrieben.
Stimmt. Und du hast auch über den Gestank in eurer Wohnung geschrieben, in den Tagen nach dem Tod deiner Mutter, als dein Vater sich mit dir in der Wohnung eingeschlossen hat.
Es ist unmöglich, den Gestank eines Schlachtfelds rüberzubringen, da hab ich kapituliert. Aber es gibt doch zwei Dinge, die ich dir vielleicht erzählen kann, aus den allerersten Stunden des Krieges: Ich war im Sechstagekrieg in der Panzerdivision von Generalmajor Tal. Und ich war genau zu dem Zeitpunkt da, an dem am 5. Juni 1967 um acht Uhr früh, genauer gesagt um fünf nach acht, über Funk der Befehl »Rotes Tuch« kam, was bedeutete, sämtliche Funkkanäle einzuschalten, denn bis dahin war alles abgestellt, und dann hörten wir über Funk die Stimme von Tal: »Ab, marsch«. Das ist bereits ein Mythos geworden. Vielleicht fünfzig Panzer standen da auf einem kleinen Gelände, und alle diese fünfzig Panzer wurden im selben Moment angelassen. Ein unglaublicher Krach. Stell dir vor, fünfzig lärmende schwere Motoren. Und ich erinnere mich, ich sagte mir: Nein, nein, das ist noch nicht Krieg, das ist nicht echt, das ist es nicht. Und ich musste lange nachforschen und bohren, lang nachdem alles vorüber war, um zu verstehen, was mir da gefehlt hatte, damit ich es als wirklich empfinden konnte. Weißt du, was mir gefehlt hat?
Die Musik?
Genau! Denn wo hatte ich davor in meinem Leben Dutzende von Panzern zur Schlacht rollen gesehen? Im Film. Und da ist es immer von dröhnender Musik begleitet. Danach, auch das war am ersten Tag des Krieges, in den ersten Stunden, saß ich mit ein paar Leuten auf den Sanddünen; wir haben gewartet. Ich weiß nicht mal mehr, worauf wir gewartet haben. Und plötzlich explodierten direkt zwischen uns Granaten. Und ich schaue hoch und seh auf dem Hügel, vierhundert Meter von uns oder vielleicht auch nur dreihundert Meter entfernt, fremde Leute in gelben Uniformen, die einen Granatwerfer auf uns richten und auf uns feuern. Ich erinner mich, ich bin nicht erschrocken, ich hab nur gestaunt. Und ich war beleidigt: Was geht in diesen Leuten vor? Sind die total verrückt geworden? Spinnen die? Sehen die denn nicht, dass hier Menschen sind? Mein erster Impuls war nicht, mich flach hinzulegen oder wegzurennen oder zurückzuschießen. Nein. Mein erster Impuls war einfach, die Polizei anzurufen: Hier sind ein paar Irre, die schießen mit scharfer Munition auf uns. Dieser Wunsch, die Polizei zu rufen, war das letzte Normale, das letzte Logische, das mir während dieses Krieges passiert ist. Alles, was danach kam, war der reine Wahnsinn.
Einige deiner Bücher wurden verfilmt. Ist es nicht befremdlich für dich, sie anzuschauen?
Da steht dann so eine gläserne Wand. Es kommt mir bekannt vor, aber es ist nicht meins. Dan Wolman hat ja aus Mein Michael einen Film gemacht. Dieser Film ist würdevoll gealtert. Er hat ihn mit einem lachhaft minimalen Budget produziert, und trotzdem hält er sich ganz gut. Ich weiß noch, nach dem Film hab ich gesagt, das ist so schön und bewegend, aber es bleibt mir so fremd, als hätte ich ein Werk für Geige geschrieben und plötzlich wird es auf dem Klavier gespielt.
Stimmt es, dass du dich an Drehbüchern über deine Bücher nie beteiligt hast?
Ich bin mehrmals darum gebeten worden. Natalie Portman zum Beispiel wollte sehr, dass ich beim Schreiben des Drehbuchs für Eine Geschichte von Liebe und Finsternis mitarbeite. Ich hab mich geweigert. Ein Drehbuch zu schreiben ist meines Erachtens eine andere Kunst als meine, aber vielleicht ist der Unterschied doch nicht so groß, wie ich denke. Viele Leute schreiben heute ja Erzählungen und Romane im Präsens, als schrieben sie ein Drehbuch. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass diese Leute eigentlich wirklich ein Drehbuch schreiben wollen. Sie haben kein Geld zu investieren, aber im Grunde wollen sie einen Film machen und nicht Literatur. Vielleicht haben diese Autoren viele Filme gesehen und nur wenig Literatur gelesen. Ich sag nicht, dass es nicht wunderbare Werke gibt, die im Präsens geschrieben sind, auch in der Literatur, aber die natürliche Sprache der Literatur ist die Vergangenheit. Deshalb hängen auf Englisch »story« und »history« auch zusammen. Schriftsteller sind merkwürdig verquere Geschöpfe, sie kommen zur Welt mit nach hinten gedrehtem Kopf.
Ich erinnere mich an zumindest eine Erzählung,Beduinen und Kreuzottern, aus deinem ersten Buch,Wo die Schakale heulen,die du im Präsens geschrieben hast.
Ich versuche, mich zu erinnern. Eigentlich les ich meine Bücher nicht nochmal. Ich glaube, auch die letzte Seite der Erzählung Graben aus dem Buch Geschichten aus Tel Ilan hab ich im Präsens geschrieben. In Bezug auf die grammatische Zeit, in der eine Geschichte erzählt wird, bin ich nicht dogmatisch. Man kann eine Geschichte im Präsens erzählen, es gibt auch ein paar ganz gute Erzählungen, die im Futur geschrieben sind. Unter den frühen Erzählungen von Abraham B. Jehoschua gibt es, wenn ich mich recht entsinne, eine Erzählung, die zum Teil im Futur geschrieben ist, ich glaube, das ist in Angesichts der Wälder. – Hier, hier ist es: der letzte Satz der Erzählung jom scharav aroch (Langer, heißer Tag)3. Die ganze Geschichte ist im Präsens geschrieben, aber am Ende schwenkt sie ins Futur. Auch ich habe das im Grunde auf den letzten beiden Seiten von Mein Michael gemacht. Ich habe keine dogmatische Einstellung dazu, aber ich denke trotzdem, auch wenn die ganze Geschichte im Futur geschrieben ist, schaut sie auf die Vergangenheit. Nehmen wir Science Fiction. Angenommen, eine Geschichte spielt im Jahr 3000, in tausend Jahren, so wird da trotzdem stehen: Kapitän Nemo erwachte aus seinem Schlaf. Da wird nicht stehen: Kapitän Nemo wird morgens aufwachen. Das Wasser, in dem der Fisch, der Literatur heißt, schwimmt, ist nun mal das Tempus der Vergangenheit.
Liest du deine Bücher wirklich nicht nochmal, nachdem sie erschienen sind?
Eine Seite, die du geschrieben hast, nochmal lesen, das ist ein bisschen so wie deine eigene Stimme auf dem Tonband anhören: Es ist befremdlich, es macht mich verlegen. Wenn ich ab und zu ein Buch von mir aufschlage, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es deprimiert mich, weil ich sehe, dass ich es heute besser schreiben könnte, oder es deprimiert mich, weil ich spüre, dass ich nie mehr so gut werde schreiben können. Beides ist frustrierend, wozu soll ich mir das antun? Die einzige Ausnahme ist Allein das Meer