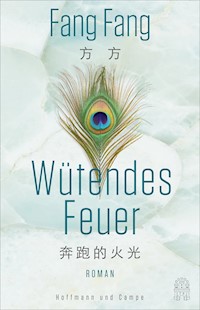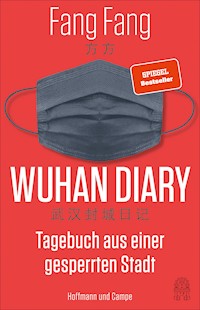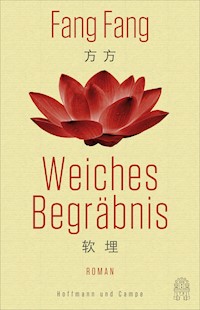
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Fesselnd wie ein Opiumrausch." Le Monde Wer China verstehen will, sollte diesen Roman lesen: In ihrem zuerst gefeierten, dann verfemten Roman rührt Fang Fang an die Traumata der chinesischen Seele. Als Weiches Begräbnis 2016 in China erscheint, wird der Roman als wichtigstes chinesisches Werk der letzten Jahrzehnte gefeiert und mit dem renommierten Literaturpreis Lu Yao ausgezeichnet. Doch als bei einer Parteizusammenkunft der Roman mit dem Vokabular der Kulturrevolution als "Giftpflanze" verbrämt wird, verschwindet das Buch vom Markt. Denn Fang Fang rührt darin an ein unverarbeitetes Trauma der chinesischen Gesellschaft, die Landreform nach 1948, als Millionen Chines*innen hingerichtet und in "weichen Begräbnissen", d.h. ohne Sarg, verscharrt wurden. In einem kleinen Dorf wird eine junge Frau halbtot aus einem Fluss gezogen, sie erinnert sich an nichts. Der Dorfarzt Dr. Wu rettet ihr das Leben, und sie beginnt ein neues: Sie wird Haushälterin des KP-Kaders vor Ort, heiratet ihren Retter Dr. Wu, und sie bekommen einen Sohn. Doch im Laufe der Jahre löst sich der schützende Kokon des Vergessens. Sie sind verdammt zu schweigen, denn das Schweigen schützt die Familie: auch dafür steht "weiches Begräbnis", die Erinnerung so tief zu begraben, dass gefährliches Wissen für immer verlorengeht. Im Schatten dieses Traumas wächst ihr Sohn auf – doch alles ändert sich, als er beginnt, die Vergangenheit zu erforschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Fang Fang
Weiches Begräbnis
Roman
Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann
Hoffmann und Campe
I. Abschnitt
1. Kapitel
Die Frau befand sich in ständigem Kampf mit sich selbst.
Sie war schon alt, sehr alt. Schlaff hing die Haut an ihr herab, nicht einmal eine ordentliche Runzel fand darauf Halt. Gesicht und Hals waren übersät von feinen Narben. Auf der kreideweißen Haut wirkten sie nicht wie von der Zeit gekerbt, sondern eher wie mit einem dünnen Pinsel Strich um Strich aufgetragen. Ihre Augen waren bereits trübe, doch wenn sie sich unverhofft weit öffneten, konnte man noch immer ein Funkeln darin entdecken.
Gewöhnlich starrte sie stumpf auf einen Fleck, als sei sie in Gedanken versunken und zugleich völlig teilnahmslos. Gelegentlich fühlten sich Passanten veranlasst, sie neugierig anzusprechen: »Großmütterchen, woran denken Sie?«
In solchen Momenten malte sich Verwirrung auf ihrem Gesicht, den Passanten anblickend, murmelte sie ein paar unverständliche Satzfetzen. Sie selbst hätte weder sagen können, was sie da vor sich hin gemurmelt, noch, ob sie überhaupt an irgendetwas gedacht hatte. Sie hatte nur die Empfindung, seltsame Dinge wollten mit Gewalt aus ihr hervorbrechen, als zerre etwas an ihrem Gedächtnis, womit sie um keinen Preis in Berührung kommen wollte. Sie leistete erbitterten Widerstand. Ihr Widerstand glich einem engmaschigen, undurchlässigen Netz, das Horden von Dämonen umschloss und fesselte, die jederzeit auszubrechen drohten. Ein Leben lang hatte sie gegen sie gekämpft, ein Leben lang dieses Netz mit sich herumgeschleppt.
Als ihr Mann noch lebte, hatte er sie einmal ermuntert, ihren Erinnerungen freien Lauf zu lassen. Vielleicht würde dabei etwas zum Vorschein kommen, das ihr Ruhe verschaffen würde. Um ihm zu Gefallen zu sein, hatte sie sich gezwungen, sich auf ihr Inneres zu konzentrieren, und sich bemüht, die Erinnerung in sich emporsteigen zu lassen. Doch fast im selben Moment wurde sie von einer Erregung überwältigt, als würde ihr ganzer Körper von tausend Nadeln durchschossen, es traf sie wie ein Stromschlag, ein Gefühl, als würden ihr die Glieder vom Leib gerissen. Schmerz und Erschöpfung hatten ihr nahezu den Atem geraubt. Verzweifelt hatte sie zu ihrem Mann gesagt: »Zwing mich nicht, mich zu erinnern. Ich kann es nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss sterben, wenn ich es nur versuche.« Er erschrak. Nach einem kurzen Schweigen hatte er gesagt: »Dann lass es bleiben. Versuch, dich zu beschäftigen, das wird dich ablenken.«
Sie hatte seinen Rat befolgt und sich Tag für Tag auf Trab gehalten. Tatsächlich ging sie keiner bezahlten Arbeit nach, sondern beschränkte sich auf die Aufgaben einer Hausfrau. Sie putzte und wischte unermüdlich, kein Körnchen Staub war in der Wohnung zu sehen. Wer immer ihre Wohnung betrat, konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken: »Mein Gott, bei euch ist es aber sauber!« Ihr Mann, ein Arzt, war mächtig stolz darauf gewesen.
Auf diese Weise war ihr Leben allmählich in geregelte Bahnen geraten.
So verging die Zeit. Wie Jahresringe aus einer undurchlässigen Folie legte sie sich Schicht um Schicht um ihre verdrängten Erinnerungen und deckte sie zu. Die Schicht wuchs Jahr um Jahr, wurde dicker und dicker und erstarrte zu einer festen Wand. Die in der Tiefe ihres Bewusstseins verborgenen Dämonen blieben fest dahinter eingesperrt.
Welcher Art waren sie? Sie hatte keine Ahnung.
Ihre Erinnerung begann mit dem Frühjahr 1952.
Eines Tages, viele Jahre später, war ihr Mann aus der Klinik nach Hause gekommen und hatte mit ernster Miene von der »Großen Kulturrevolution«1 geredet. Im Krankenhaus hatte eine Versammlung die andere gejagt, Leute hatten Wandzeitungen über ihn verfasst, worauf stand, in seinem Lebenslauf gäbe es dunkle Flecken. Von Angst gepackt, begriff sie die Bedeutung dessen, was er ihr berichtete, nicht. Bis er ihr irgendwann plötzlich erklärte, sie habe nichts zu befürchten. Er werde sie beschützen. Es sei für sie am besten, sich nie mehr an die Vergangenheit zu erinnern. Ihre schlimmsten Feinde seien nicht die Leute da draußen, sondern all die Dinge, an die sie sich nicht erinnere. Würde man sie fragen, solle sie sagen, sie wisse von nichts, so sei es am besten.
Sie hatte nicht begriffen, dass seine Worte als Trost und Ermahnung gemeint waren, sie hatten vielmehr Angstschauer in ihr ausgelöst. Ihr schien, als besäße er die Kontrolle über die in ihrem Inneren verborgenen und nahezu verschwundenen Todfeinde. Worum ging es bei alldem? Wusste er etwas, was sie nicht wusste? Bei diesem Gedanken schlug ihr ein eisiger Schreckenshauch entgegen. Und die Quelle des Schreckens befand sich an ihrer Seite. Tag und Nacht, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde.
Sie begriff, dass sie während all dieser Jahre den Mann, den sie innig liebte, zugleich zutiefst fürchtete.
Aber warum nur? Woher kam diese Empfindung, die sie mit Unruhe erfüllte und die sie nicht begriff? Verscheuchen ließ sich die Empfindung jedenfalls nicht.
2. Kapitel
Als man sie aus der reißenden Strömung des Flusses herauszog, hatte sie nichts am Leibe. Ihr Körper war vom Kopf bis zu den Füßen mit Wunden übersät. Der Mann, der sie gerettet hatte, erklärte, das Wasser habe sie vollständig gebleicht, nur das Haar sei schwarz geblieben, auf den ersten Blick seien die Wunden nicht zu erkennen gewesen. Zum Glück befanden sich mehrere Militärärzte zu Hausbesuchen im benachbarten Dorf, man brachte sie unverzüglich dorthin. Nach den ersten Notfallmaßnahmen schafften die Ärzte sie umgehend in die Klinik.
Erst über einen halben Monat später erwachte sie dort aus dem Koma. Als sie nach dem Aufwachen versuchte, auf die Fragen der Leute zu antworten, wurde ihr Blick plötzlich stumpf.
Woher sie käme? Aus welchem Dorf sie stamme? Wie alt sie sei? Wer zu ihrer Familie gehöre? Wie sie in den Fluss gestürzt sei? Ob das Boot gekentert sei? Oder ob irgendein schmutziger Kerl sie hineingeworfen habe? Ob sie im Wasser die Einzige gewesen sei? Die Fragen prasselten auf sie ein, mal klangen die Stimmen der Frager warmherzig und mitfühlend, mal schneidend und bohrend. Ihr Inneres wurde plötzlich von einem rasenden Schmerz erfasst. Sie krümmte sich auf dem Bett zu einem Knäuel. Stimmt, woher komme ich?, dachte sie bei sich. Wo bin ich zu Hause? Wie heiße ich? Wie bin ich in den Fluss gefallen? Keinerlei Eindrücke, keinerlei Erinnerung. Wieso kann ich mich nicht erinnern? Nicht einmal daran, wer ich bin? Sie begann zu schluchzen. »Ich kann mich nicht erinnern«, sagte sie.
Sie erinnerte sich wirklich nicht.
»Denk nach«, drängten sie die Leute. »Denk gründlich nach. Du wurdest aus dem Fluss gezogen. Fang damit an, vielleicht kommt dann die Erinnerung.«
Sie bemühte sich, dem Drängen der Leute nachzukommen, und dachte gewissenhaft nach. Als ihre Erinnerung ans Flussufer zurückkehrte, brach das Getöse des Wassers über sie herein wie Donner, in dessen Gefolge ein mysteriöser Schrecken in ihr aufstieg, so als hielten sich in den Wogen Dämonen verborgen, die, obgleich unsichtbar und ungreifbar, darauf warteten, wütend über ihren Körper und ihr Inneres herzufallen. Für einen Moment verlor sie die Kontrolle über sich, sie brach in Schluchzen aus, das sich zu wilden Schreien steigerte. Sie bekam einen hysterischen Anfall.
Einer der Ärzte namens Wu untersagte mit Strenge den Leuten ihre Neugier. Sie habe vermutlich ein Trauma erlitten. Statt sie weiter mit Erinnerung zu peinigen, sollten sie lieber dafür sorgen, dass sie wieder zu Kräften komme.
Daraufhin hörten die Leute auf, sie mit Fragen zu quälen, sie redeten nur mal offen, mal hinter ihrem Rücken in mitleidigem Ton über sie.
Es war ein herrlicher Frühling.
Die Bäume vor dem Fenster waren übersät mit rosafarbenen Blüten. Die Blüten der Aprikosenbäume entlang der Außenmauer bildeten eine von Weiß überquellende Reihe, die ins Weiße des Mauerputzes überging, sodass, aus der Ferne gesehen, Blüten und Mauerwerk miteinander verschmolzen. In noch weiterer Ferne bewegten ein paar Ginkgo-Bäume ihre tiefgrünen Blätter, ihre kräftigen Stämme verrieten nicht mehr, wann sie gepflanzt worden waren. Die Jasminsträucher in den Ecken des Gartens begannen zu verblühen, doch noch verströmten die gelben Blüten strahlenden Glanz. Die ganze Farbenpracht drang mit Macht in ihr Auge und überwältigte sie. Trotz der noch immer kühlen Winde zwitscherten die mit dem wiedergekehrten Frühling zu frischem Leben erwachten Vögel aus voller Kehle. Inmitten dieser Szenerie und eingehüllt von diesen Tönen fand sie allmählich zu innerer Ruhe.
Dies wurde zum Ausgangspunkt ihrer neuen Lebenserinnerungen. Sie befand sich in einer Kleinstadt Ost-Sichuans2.
Später hatte ihr der Chor der Krankenschwestern, die sich immer wieder gegenseitig ins Wort fielen, den gesamten Ablauf ihrer Rettung und Heilung berichtet. Sie erzählten, dass niemand geglaubt habe, sie würde überleben, als die Ärzte sie in die Klinik brachten. Einmal sei sie von mindestens drei Ärzten für tot erklärt worden, die Leichenträger hätten sie bereits zum Ausgang transportiert. Nur der aufmerksame Doktor Wu habe bemerkt, dass sich ihr Mittelfinger leicht bewegte, und darauf bestanden, sie zur weiteren Beobachtung in der Klinik zu behalten. Und tatsächlich sei sie ein paar Tage darauf aus dem Koma erwacht. Die Erzählungen bewirkten, dass sich der Vorgang ihrer Wiederauferstehung tief in ihr Gedächtnis einprägte.
Eine Person hatte im Ablauf der Geschehnisse eine Sonderrolle gespielt, und zwar Doktor Wu. Ihm verdankte sie ihr Leben. Ihre Wiedererweckung vom Tode und die Existenz dieser Person reichten aus, ihr den Geschmack am Leben wiederzugeben. In dieser kurzen Episode waren sämtliche Gefühls- und Geschmacksregungen vereint, das Saure, das Süße, das Bittere und das Scharfe. Das, so dachte sie, genügte ihr als Lebensbeginn.
Und so hatte sie alles, was ihrem Gedächtnis entfallen war, die Vergangenheit, an die sich zu erinnern sie mit unerträglichem körperlichen Schmerz peinigte, gründlich aus ihrem Leben verbannt.
Der Verzicht auf Erinnerung ist nicht unbedingt ein Verrat an sich selbst, man vergisst oft, um weiterleben zu können. Das hatte Doktor Wu zu ihr gesagt.
3. Kapitel
Verglichen mit anderen Personen vorgerückten Alters, die täglich in den Parks spazieren gingen oder sich an Gruppentänzen auf öffentlichen Plätzen beteiligten, hatte ihr die Zeit allzu gnadenlos zugesetzt. Gemäß ihrem Eintrag im Melderegister war sie nun Anfang siebzig. Doktor Wu hatte das Formular damals für sie ausgefüllt und ihr Alter anhand ihres Aussehens geschätzt. Als Geburtstag hatte er der Einfachheit halber den Tag ihrer Rettung aus dem Fluss eingetragen. Diese Daten begleiteten ihr späteres Leben.
Ihrem Aussehen nach wirkte sie weit älter als andere Frauen in diesem Alter. Sie selbst hatte, wenn sie in den Spiegel blickte, das Gefühl, eine von Sorgen und Kummer ausgezehrte Person zu sehen. An den abendlichen Gemeinschaftstänzen nahm sie nicht teil, und sie mied den Umgang mit Außenstehenden. Das untätige Alleinsein ohne Abwechslung und der Mangel an menschlicher Nähe waren ihr zur Gewohnheit geworden. Sie hatte weder Verwandte noch Freunde. Gelegentlich versuchten die alten Frauen der Nachbarschaft, von sich aus Kontakt mit ihr aufzunehmen, und kamen vorbei, um sie zu einem gemeinsamen Spaziergang zu überreden, ein bisschen Bewegung sei ein Garant für ein langes Leben. Sie lehnte ab.
Nicht dass ihr die Vorstellung eines langen Lebens unangenehm gewesen wäre, es war vielmehr das Gefühl einer Bedrückung, die so schwer auf ihrer Seele lastete, dass sie den Wunsch aufzustehen überdeckte. Sie zog es vor, in schweigsamer Einsamkeit sitzen zu bleiben. Bei klarem, sonnigem Wetter saß sie auf den Stufen gegenüber der katholischen Kirche des Huayuanshan-Viertels3. Hob sie den Blick, sah sie auf die graue Masse des Gebäudes. Die drei großen Schriftzeichen »Kirche des Herrn« gleißten im Sonnenlicht, aber sie nahm diesen Glanz nicht wahr. Ihr kam es so vor, als verblasste er jeden Tag mehr vor ihren Augen, dann war ihr wieder, als leuchte er Tag um Tag heller, um Tag für Tag wieder zu verblassen, wenn sie ihn betrachtete. Das erschien ihr bedeutungsvoll. Früher hatte ihr Mann sie gern zu Spaziergängen überredet, und sie waren oft diesen Weg gegangen. Von hier aus waren sie dann in die Tanhualin-Straße abgebogen.
Unterwegs erzählte ihr Mann immer von merkwürdigen Begebenheiten. Eine davon betraf auch die »Kirche des Herrn«. Er erklärte ihr, dass das Herrscherhaus der Qing-Dynastie den Bau von Kirchen in China ablehnte. Aber die Ausländer seien ganz versessen darauf gewesen und extra aus weiter Ferne hierhergekommen, um Kirchen zu errichten. Als sie nicht mehr ein noch aus wussten, habe ihnen ein Chinese einen hilfreichen Tipp gegeben. Er habe ihnen empfohlen, den Bau einer »Tempelhalle des Großen Königs« () zu beantragen. Nach erfolgter Genehmigung sollten sie einfach im Dokument dem Zeichen »groß« () einen horizontalen Strich und dem Zeichen »König« () einen Punkt aufsetzen, dann würde daraus eine »Kirche des Herrn« (). Die Ausländer hätten die Idee mit Begeisterung aufgenommen und den Bau einer »Halle des Großen Königs« beantragt. Angesicht der Tatsache, dass es sich nicht um einen Kirchenbau handelte, habe der kaiserliche Hof umstandslos die Bewilligung erteilt. Nach Erhalt des Dokuments hätten die Ausländer die beiden Zeichen entsprechend geändert. Als die lokalen Behörden die Angelegenheit überprüfen wollten, stand auf dem Bewilligungsdokument unmissverständlich »Kirche des Herrn«, und auch das kaiserliche Siegel fehlte nicht. Sie hätten sich sehr gewundert, die Sache aber auf sich beruhen lassen. Dass man sie hinterging, waren sie gewohnt, da sei es auf dieses eine Mal mehr nicht angekommen. Die Geschichte hatte sie so beeindruckt, dass sie beim Zuhören lauthals lachen musste.
Dass sie jetzt hier saß, hatte jedoch mit der Geschichte nichts zu tun, sondern mit der von einer Sträucherhecke umgebenen Statue der Madonna von Lourdes auf der Spitze eines aus Steinbrocken errichteten kleinen Hügels. Sie zu betrachten bereitete ihr Freude. Auf ihrem Gesicht spielte stets ein reines und stilles Lächeln. Bei jedem ihrer Spaziergänge waren sie zu ihr hingegangen und hatten eine Weile dort verweilt, um sie zu betrachten. Beim ersten Mal hatte sie gefragt: »Wer ist sie?« Dasselbe hätten die Leute die Madonna bei ihrem Erscheinen damals auch gefragt, hatte ihr Mann geantwortet, und sie habe geantwortet: »Ich bin die von der Erbsünde Unbefleckte.« Sie verstand nicht, was das bedeuten sollte. Ihr Mann hatte mit seinem Zeigefinger die Zeichen in ihre Handfläche geschrieben. »Was bedeutet das?«, hatte sie gefragt. Und er hatte geantwortet: »Das bedeutet, frei von der Erbsünde zu sein.«
Sie verstand ihn nicht, aber seine Worte hallten in ihrem Herzen nach. Erst als sie die Kirche hinter sich gelassen hatten und gemächlich ein Stück weiter spaziert waren, hatte er hinzugefügt: »Es muss uns immer bewusst sein, dass wir auf dieser Welt zu denen gehören, die von der Erbsünde unbefleckt sind. Du und ich.«
Sie begriff nach wie vor nicht. Schließlich sagte er: »Merk dir einfach, dass es sich um die Madonna von Lourdes handelt, das genügt. Sie kann deinem Herzen Ruhe schenken.«
Bis heute verstand sie nicht, was ihr Mann damit hatte sagen wollen. Doch seither genügte der Anblick der Madonna, um in ihrem Herzen tatsächlich so etwas wie ein Gefühl der Ruhe aufkommen zu lassen, sogar ein Gefühl des Wohlbehagens, das sich in ihrem Körper ausbreitete. Was bedeutet nur ›von der Erbsünde unbefleckt‹?, dachte sie.
Eine hanffarbene Katze mit dem fratzenhaften Gesicht eines kleinen Kobolds kam, jedes Mal, wenn sie hier saß, herbei, um sich lautlos an ihren Füßen niederzulassen. Das Tier betrachtete sie wohlgefällig aus seinen weit geöffneten Augen, manchmal streckte es sogar seine Pfote aus, um über ihre Beine zu streichen. Etwas im Blick der Katze löste in ihr ein Gefühl tiefer Vertrautheit aus. Oft streckte sie die Hand aus, um ihr den Rücken zu streicheln und sie zu beruhigen. Eines Tages war sie fortgeblieben. Sie hatte um sich geblickt, den Mund geöffnet und »Spatz! Spatz! Wo bist du?« gerufen. Tatsächlich kam die hanffarbene Katze herbeigerannt. »Wieso habe ich sie ›Spatz‹ gerufen?«, hatte sie sich beim Hinsetzen gefragt.
In diesem Augenblick saß sie im Sonnenlicht am Straßenrand, einen Flechtkorb zu ihren Füßen. Aufgeschichtet im Korb lagen mit Mandarin-Enten oder Lotosblumen bestickte Einlegesohlen, Stickereien, die sie eigenhändig angefertigt hatte. Warum sie das konnte, verstand sie selbst nicht. Sie erinnerte sich nicht, es je gelernt zu haben. Aber als sie die Einlagen in die Hand genommen hatte, hatte sie sofort gewusst, was damit zu tun war. Sie hatte vordem als Haus- und Kindermädchen in der Familie eines Professor Ma gearbeitet. Einmal im Winter hatte ihr die Hausfrau ein Paar getragene Baumwollschuhe geschenkt. Sie waren ihr zu groß, deshalb hatte sie sich ein Paar Einlegesohlen genäht. Ohne nachzudenken, selbst ohne auf den Faden zu achten, war unter ihren Händen die Stickerei einer Begonienblüte entstanden. Professor Mas Frau hatte die Einlagen hin und her gewendet und am Ende bemerkt: »Du hast geschickte Hände. Hast du das gelernt? Du hast eine künstlerische Ader.«
Statt sich darüber zu freuen, hatte dieses Lob sie mit der Wucht eines Steinwurfs getroffen und bis ins Mark erschreckt. Eine unerklärliche Panik hatte sie überfallen. An sämtlichen Orten, die sich ihrem Blick entzogen, witterte sie Gefahren. Ein fremdes Gesicht, ein unbekannter Laut ließen sie vor Angst zittern. Seit Jahren begleitete sie dieses Gefühl. Sie hatte danach keine Nadel mehr angerührt. Viele Jahre verbrachte sie im Hause Ma. Erst nach dem Tod von Professor Mas Frau und seiner Wiederverheiratung mit einer jungen Frau hatte ihr Sohn sie nach Hause geholt.
Ihr Sohn hieß Qinglin.
4. Kapitel
Ursprünglich hatte sie mit Qinglin in einem Mietshaus in einer schmalen Seitengasse der Tanhualin-Straße im Bezirk Wuchang gewohnt. Die Wohnung war ihnen zu Lebzeiten ihres Mannes zugewiesen worden. Viele Jahre verbrachten sie dort. Ihr Mann war jener Doktor Wu, der sie damals, als man sie aus dem Wasser zog, gerettet hatte. Sie liebte ihn über alles, er war nicht nur ihr Ehemann, er war zugleich ihr Lebensretter. Als sie aus dem Koma erwachte, war er die erste Person gewesen, die sie erblickt hatte. Der erste Mensch, den sie in ihrem neuen Gedächtnis gespeichert hatte.
Sie überlegte oft, wann genau sie sich in ihn verliebt hatte. War es beim ersten Anblick, oder geschah es, als sie sein Büro betrat? Sie wusste nicht mehr, aus welchem Grund sie dorthin gegangen war. Sie erinnerte sich nur, dass auf seinem Schreibtisch eine Ausgabe des Romans Traum der roten Kammer4 lag, die sie unwillkürlich in die Hand nahm, um darin zu blättern. Ohne sich dessen gewahr zu werden, murmelte sie dabei »Daiyu«. Die beiden Silben versetzten sie für einen Moment in Unruhe. Genau in diesem Moment betrat Doktor Wu das Büro. Als er sie im Buch blättern sah, trat auf sein Gesicht tiefes Erstaunen. Er nahm ihr den Roman aus der Hand, sah sie starr an, schien einen Moment zu zögern und sagte dann: »Lass niemand wissen, dass du lesen kannst. Das ist vermutlich besser für dich.« Sie sah ihn verständnislos an. Er fuhr fort: »Ich sage das nur, weil ich Angst habe, dass die Leute misstrauisch werden. Niemand weiß, woher du kommst, das sorgt für Spekulationen. Verstehst du?«
Sie verstand nicht recht, was er meinte, aber sie behielt seine Worte im Gedächtnis. Denn der Schrecken, den sie in ihr hervorgerufen hatten, verwandelte sich auf der Stelle in ein Gefühl von Wärme.
Wenige Tage später empfahl Doktor Wu sie der Familie von Herrn Liu, dem Politkommissar des Militärbezirks, als Kindermädchen und Haushälterin. Der Politkommissar Liu war ein verdienter Revolutionär, auch seine Frau arbeitete als Funktionärin. Doktor Wu begleitete sie bis zur Kreuzung an der Hauptstraße und sagte dort mit bedeutungsschwerem Nachdruck zu ihr: »Ich denke, dort zu arbeiten ist das Beste für dich, es macht alles einfacher und wird dir womöglich auf deinem Lebensweg helfen.« Wieder verspürte sie den Anflug innerer Wärme, und mit einem Mal begriff sie, dass Doktor Wus Worte eine für sie außergewöhnlich bedeutsame Botschaft enthielten. Zugleich lag in dieser Botschaft aber auch etwas, das sie als bedrohlich empfand.
Von Liebe zwischen ihnen konnte damals keine Rede sein.
Es vergingen viele Jahre, doch er und der Klang seiner Stimme blieben ihr unauslöschlich im Gedächtnis. Als der Politkommissar befördert und daraufhin versetzt wurde, zog sie mit der gesamten Familie nach Wuhan. Frau Peng, die Frau des Politkommissars, behandelte sie gut, ein so perfektes Hausmädchen habe sie noch nie gehabt, sagte sie. Sie kochte Essen für die Kinder, putzte die Wohnung und führte ein Leben ohne besondere Ereignisse, einfach und friedlich. Weder trat sie eine andere Stelle an, noch dachte sie an einen Ortswechsel, auch eine Ehe kam ihr nicht in den Sinn. Wechselten ihre Arbeitgeber den Ort, folgte sie ihnen, sie hatte keine anderen Erwartungen an das Leben.
In einem der darauf folgenden Jahre wurde auch Doktor Wu an einen anderen Ort versetzt, und er machte auf dem Weg zu seinem neuen Dienstort einen Abstecher, um seinen ehemaligen Vorgesetzten zu besuchen. Er war freudig überrascht, sie dort anzutreffen, und unwillkürlich entfuhr ihm die Frage: »Du bist noch immer hier? Wie geht es dir?«
Sie war tief bewegt, ohne zu verstehen, warum. Mit einem Zittern in der Stimme sagte sie: »Mir geht es gut, und das verdanke ich Ihnen.« Er sah ihr fest und lange in die Augen. Sie erkannte an seinem Blick, dass zwischen ihnen ein Geheimnis existierte, von dem nur sie beide wussten. Worin es bestand, wusste sie nicht, doch ihr Herz begann auf einmal heftig zu schlagen.
Doktor Wu aß an diesem Tag mit der Familie des Politkommissars zu Abend. Auf dem Tisch standen Speisen, die sie mit höchster Sorgfalt zubereitet hatte. Im Verlauf der Unterhaltung während des Essens überraschte Doktor Wu die Familie mit der Nachricht, dass seine Frau an einer Krankheit gestorben war. Frau Peng legte ihre Stäbchen beiseite und wischte sich die Tränen aus den Augen. Sie hatte zu Xiao Yan5, seiner Frau, in einer besonderen, geradezu schwesterlichen Beziehung gestanden, sie hatten einst gemeinsam eine lebensgefährliche Situation durchlebt.
Sie stand an der Seite und spürte, wie ihr Herz bei dieser Nachricht wild pochte.
Politkommissar Liu seufzte eine Weile, dann fragte er: »Und du bist jetzt allein?«
»Ja, allein.«
»Und du willst nicht wieder heiraten?«
»Man hat mir die eine oder andere Kandidatin vorgeschlagen, aber die rechte war nicht darunter.«
»Hör mal, du, ein ausgewachsenes Mannsbild, wie soll das angehen?«, sagte Politkommissar Liu. Dabei fiel sein Blick auf sie, und unwillkürlich deutete er auf sie: »Na, dann muss ich wohl den Heiratsvermittler spielen. Ihr seid doch alte Bekannte, und vom Alter her passt es auch.«
Doktor Wus Blick war dem Zeigefinger des Politkommissars gefolgt. Sie geriet in Panik und hätte sich am liebsten in ein Erdloch verkrochen, er dagegen sah sie mit einem Lächeln an. Und dieses Lächeln verriet ihr, dass ihm der Vorschlag gefiel.
So kam es, dass sie im gleichen Jahr die Familie des Politkommissars Liu verließ. Die drei Kinder der Familie, die sie großgezogen hatte, standen gemeinsam in der Tür und blickten ihr voller Wehmut nach, die Jüngste kämpfte mit den Tränen.
Sie wandte sich nicht um. Als sie auf den Arm des Doktors gestützt über die Schwelle ihrer Wohnung trat, war ihr erster Satz: »Warum wolltest du mich heiraten?«
Er lachte leise und sagte: »Ich hätte mir um dich Sorgen gemacht, wenn du einen anderen geheiratet hättest.«
Sie verstand, dass sich hinter seiner Antwort etwas verbarg, ohne recht zu begreifen, was er sagen wollte. Sie dachte einen Moment nach, dann entschlüpfte ihr unwillkürlich: »Das stimmt, hätte ich einen anderen geheiratet, wäre es mir genauso gegangen.«
Sie hatte kaum geendet, als eine unbestimmbare Angst in ihr aufstieg. Das Grau des Abends ging in Nachtschwärze über, mit zunehmender Dunkelheit verstärkte sich die Angst. Sie selbst hätte nicht sagen können, wovor sie sich fürchtete, aber die Angst wich nicht. Als Doktor Wu sie in die Arme schloss und sein Körper sich an ihren schmiegte, begann sie, am ganzen Körper zu zittern. Doktor Wu streichelte sie und flüsterte ihr zu: »Ich weiß. Ich weiß. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Keine Angst, es ist alles gut.«
In seinen Armen fragte sie sich: »Was heißt das? Was weiß er? Was versteht er? Was ist alles gut?«
In der Nacht hatte sie einen so entsetzlichen Albtraum, dass sie vor Schreck aufwachte. Am nächsten Morgen stand sie in aller Herrgottsfrühe auf. Doktor Wu beobachtete sie vom Bett aus und sagte: »Beunruhige dich nicht. Mach dir nicht so viele Gedanken. Ich werde dich beschützen. Ich habe dich geheiratet und hierhergebracht, weil ich weiß, wie du gerettet wurdest. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der deine Gefühle versteht. Du musst vor nichts Angst haben.«
Ein Tränenstrom brach aus ihr hervor, überwältigt von Gefühlen stürzte sie sich in seine Arme. Doch zur gleichen Zeit hatte sie ein Gefühl, als säße ihr ein feiner Stachel, scharf und vergiftet, im Rücken. Er folgte ihr, wohin immer sie ging, sie vergaß nie, auf der Hut zu sein, aus Angst, er könnte sie eines Tages stechen.
Von diesem Tag an hatte sie eine eigene Familie. Ihr Eheleben war voller Wärme und Glück, auch wenn sie eine ständige Unruhe begleitete, die sie nie verließ. Aber sie war nun keine Hausangestellte mehr, sondern eine Ehefrau in allen Ehren. Eine Rolle, die sie mit großer Befriedigung erfüllte.
Diese Gemütslage bestimmte ihr Alltagsleben. Sie stand täglich frühmorgens auf und bereitete ihm das Frühstück, sah ihm nach, wenn er die Wohnung verließ, um zur Arbeit zu gehen; wenn er zur Mittagspause aus der Klinik heimkehrte, stand das Mittagessen bereits auf dem Tisch; kehrte er nach dem Mittagsschlaf in die Klinik zurück, begann sie allmählich mit der Vorbereitung des Abendessens und wartete dann auf seine Rückkehr. Sie sorgte mit großer Aufmerksamkeit für ihn, achtete auf jede Kleinigkeit, die ihn betraf. Kleine Freuden mehrten sich in ihrem Herzen und begannen, die Unruhe daraus zu vertreiben. Vielleicht könnte ihr künftiges Leben so aussehen, dachte sie.
Sie wurde bald schwanger. Doktor Wu war überglücklich, und auch sie empfand eine freudige Erregung. Doch sobald sie allein war, kehrte die seltsame Furcht zurück. Sie überfiel sie häufig und in unregelmäßigen Abständen, es war ihr, als lauerten erneut die Dämonen aus den Wogen des Flusses in einem Hinterhalt, um sich plötzlich auf sie zu stürzen. Sie warteten auf eine Gelegenheit, jederzeit bereit, ihr den tödlichen Schlag zu versetzen. In dieser Zeit erreichte ihre Angst ein unkontrollierbares Ausmaß. Wenn sie auf eine Wand blickte, glaubte sie immer, dass sich dahinter etwas verbarg, sah sie Wolken, schien sich auch dahinter etwas zu verbergen, beim Blick auf Bäume meinte sie zu spüren, dass sich in den Blättern etwas versteckt hielt. Sie sah eine Lampe und glaubte, etwas werde daraus hervorbrechen, sobald sie ausgeknipst sei. Unerwartete Laute versetzten sie in Panik, plötzlich aufscheinende Farben versetzten sie in Panik, unbekannte Menschen, die sie besuchten, versetzten sie in Panik, den größten Schrecken bereitete es ihr, von Stille umgeben zu sein. Sie begriff nicht, woher diese Ängste kamen. Sie begriff nur, dass sie nicht von ihr abließen, als seien sie mit ihr geboren worden.
Doktor Wu unternahm täglich mit ihr einen Spaziergang zur Kirche, sie standen vor der Madonna von Lourdes. »Schau der Madonna in die Augen«, sagte er zu ihr. »Sie sagt dir: ›Keine Angst. Beunruhige dich nicht. Es ist alles in Ordnung mit dir.‹«
Der Blick der Madonna übertrug sich auf sie, und ihre Unruhe milderte sich. Doch sobald sie nach Hause zurückkehrte, stellte sie sich wieder ein. In seiner Ratlosigkeit brachte Doktor Wu sie zu einem Psychologen, den er über ihren Erinnerungsverlust informiert hatte. Der Psychologe vermutete, dass sie in der Vergangenheit einem extremen Trauma ausgesetzt gewesen sei. Um die Fessel zu lösen, müsse sie zunächst angezogen werden; wenn es ihr gelänge, sich zu erinnern, würde sich das Problem möglicherweise im Kern lösen.
Doch sie widerstand instinktiv der Erinnerung, denn sobald sie begann, nach Erinnerungen zu forschen, ergriff ihren Körper von Kopf bis Fuß ein seltsamer Schmerz, dem sie nicht standhielt. Doktor Wu sprach ihr gut zu: »Beiß die Zähne zusammen. Die Erinnerung wird dir bestimmt Ruhe verschaffen.« Wie einprogrammiert antwortete sie: »Wenn ich mich erinnere, packt mich die Unruhe noch mehr! Was soll ich dagegen tun?«
Doktor Wu verfiel eine ganze Nacht lang in Schweigen. Sie wusste, dass er die Nacht schlaflos verbracht hatte. Am nächsten Morgen sagte er: »Lassen wir’s. Wahrscheinlich ist komplettes Vergessen die beste Lösung.«
Und so kam es, dass sie unter ständigen Angstattacken ihren Sohn gebar. Am Tag der Geburt hatte sie das Gefühl, die im Hinterhalt verborgenen Dämonen wollten hervorbrechen. Sie starrten sie unbewegt an, während sie unaufhörlich zitterte. Den Krankenschwestern, die sie beruhigen wollten, wurde die Sache zu viel, sie riefen Doktor Wu herbei. Man gestattete ihm, neben ihrem Bett zu sitzen. In ihrer Benommenheit überkam sie das Gefühl, dass Doktor Wu selbst ein Dämon sei, und ihre Angst steigerte sich in blankes Entsetzen. Mit schriller Stimme schrie sie auf ihn ein: »Hau ab! Verschwinde!« Hörbar für alle erwiderte er: »Nur keine Angst, es macht mir nichts aus, ich habe keine Familie außer dir. Ich liebe dich.« Sie schien ihn nicht zu hören, es war, als sei sie bereits vom Blick des Dämons behext. Ihr hysterisches Schreien schallte durchs ganze Klinikgebäude. Der geburtshelfende Arzt und die Krankenschwestern begriffen nichts und sahen sie ratlos an. Eine der Schwestern sagte: »Was ist mit dir los, alle Gebärenden wünschen sich doch sehnlichst, dass ihr Mann neben ihnen ist?« Sie keuchte und beachtete sie nicht.
Kaum hatte Doktor Wu den Raum verlassen, kam ihr Sohn ohne Komplikationen auf die Welt.
Als er das Klinikzimmer wieder betrat, war Doktor Wu tief bewegt, in seinen Augen schimmerten Tränen. Er streichelte ihr Gesicht und sagte: »Ein wunderhübscher Sohn, dank dir. Danke, dass du meiner Familie einen Nachkommen gegeben hast. Hab keine Angst, was auch immer geschieht, du musst keine Angst haben.«
Ihr fehlte die Kraft zu antworten, Doktor Wu fuhr fort: »Du sollst verstehen, wie es in mir aussieht. Ich habe dich geheiratet, damit du in Ruhe und Frieden leben kannst. Solange ich da bin, brauchst du nichts zu fürchten.«
Vielleicht hatte dieser Trost eine außergewöhnliche Wirkung, jedenfalls ließ sich der Dämon, dessen Hervorbrechen sie ständig gefürchtet hatte, nicht mehr blicken. Der Sohn wuchs und gedieh von Tag zu Tag. Seine strahlenden Augen und sein kindlich unbefangenes Lachen leisteten den größten Beitrag zu ihrer inneren Ruhe. Sie hätte gern noch eine Tochter geboren, aber eine neue Schwangerschaft endete nach zwei Monaten mit einer Fehlgeburt, was beide sehr traurig machte. Wieder tröstete sie Doktor Wu: »Das macht nichts, ein Sohn ist genug für uns. Solange er gesund aufwächst, sind wir glücklich und zufrieden.«
Langsam verfloss die Zeit, nichts von dem, was sie befürchtet hatte, trat ein, der Dämon schien sich allmählich zu verflüchtigen.
5. Kapitel
Es trat etwas ein, womit sie nie gerechnet hatte: Ihr Doktor Wu würde sie nicht in ein gemeinsames Alter begleiten. Er starb unterwegs, als er die Wohnung verlassen hatte, um etwas zu erledigen.
Ein öffentlicher Bus aus Hankou wurde frontal von einem Zug angefahren, der die Stadt durchquerte. Die Kreuzung färbte sich rot von Blut. Unglücklicherweise befand sich auch Doktor Wu in diesem Bus. Als sie die Nachricht erhielt, erreichte sie, ihren Sohn im Schlepptau, nach mehrfachem Umsteigen die Unfallstelle. Im Gewirr aus Schreien und Weinen sah sie wild durcheinanderliegende Leichen und riesige Lachen von frischem Blut. Vor ihrem inneren Auge blitzte mit einem Mal eine ähnliche Szene auf. Und die verschwunden geglaubten Dämonen bäumten sich in diesem Moment vor ihr auf und drohten sich auf sie zu stürzen. Ihr gesamter Körper erbebte vor Angst, ihre Beine gaben nach, und sie sank in einem Kniefall zu Boden.
Qinglin begann zu weinen und nach Kräften an ihr zu zerren: »Mama, steh auf! Steh doch auf!«
In einem Moment panischer Anstrengung richtete sie ihren Oberkörper auf und schrie den Rettungskräften entgegen: »Kein weiches Begräbnis! Er soll kein weiches Begräbnis haben!« Nach diesem Aufschrei hatte sie das Gefühl, die Welt sei aus den Fugen geraten.
Qinglin umklammerte ihre Hand und zerrte an ihr, er begriff nicht, was sie da schrie. Nach der Beerdigung fragte er vorsichtig: »Mama, was ist ein weiches Begräbnis?« Sie sah ihn verständnislos an und antwortete kurz angebunden: »Weiches Begräbnis? Was für ein weiches Begräbnis?« Im Anschluss versank sie in völlige Abwesenheit.
Ihr war, als schwebten die beiden Worte hoch über ihr am Himmel. Auf ungreifbare Weise waren sie nah und zugleich unendlich weit entfernt. Dort in der Ferne sprach jemand laut, mit einer zugleich dröhnenden und greisenhaften Stimme. Sobald ihr Klang an ihr Ohr drang, überfiel sie der rasende Schmerz von unzähligen Stichen am ganzen Körper und raubte ihr die Kraft, Qinglin zu antworten.
Im Verlauf weniger Tage war ihr Doktor Wu, Vater ihres Kindes, aus einem quicklebendigen Menschen zu Asche verglüht, die in eine Urne aus Porzellan verpackt an einem Berghang begraben wurde. Von ihrem gemeinsamen Leben zeugte nur eine gerahmte Fotografie an der Wand, aus der herab er wie zu seinen Lebzeiten lächelnd und liebevoll auf sie sah. Wenn Qinglin außer Haus war, polierte sie oft die Fotografie, fuhr sanft mit der Hand über sein Gesicht und führte leise Selbstgespräche.
Eines Tages entdeckte sie beim Abwischen der Fotografie überrascht, dass die Angst, die sich in ihrem Inneren festgesetzt hatte, verschwunden war. Die lauernden Dämonen, die ihr überallhin folgten, waren, zugleich mit dem giftigen Stachel in ihrem Rücken, vom Mann, der ihr täglich Trost gespendet hatte, mit sich fortgenommen worden. Als habe Doktor Wus Tod gleich einem Windstoß alles fortgeweht, was ihr Angst eingeflößt hatte. Ihr Herz wurde ruhig wie ein spiegelglattes Meer. Von da an glich ihr Leben einer weithin offenen und friedvollen Landschaft.
Sie war verwirrt. Sie begriff nicht, wieso der Weggang des Menschen, der sie geliebt und den sie geliebt hatte, ihrem Inneren unendlichen Frieden gebracht hatte.
6. Kapitel
Nach der Beerdigung ihres Mannes versank sie in einen dreitägigen festen Schlaf. Sie war erfüllt von einem tiefen Wohlbehagen und hatte das Gefühl, seit langer, langer Zeit nicht mehr so gut geschlafen zu haben. Es war bereits Mittag, als sie aufstand. Sie zog die Vorhänge auf, strahlendes Sonnenlicht strömte ins Zimmer, der Glanz drang durchs Fenster bis in ihr Inneres. Die Helligkeit kam unerwartet, überfiel sie mit einem Schlag, sie spürte, wie sie sich im Nu in ihr ausbreitete. Sie hatte plötzlich die Empfindung, ihr Leben werde von nun an glatt und ohne Hindernisse verlaufen. Dieses Gefühl gab ihr mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein, als Doktor Wu es je vermocht hatte.
Qinglin war noch klein, das Leben musste weitergehen. Im gleichen Jahr verdingte sie sich wieder als Hausangestellte und Kindermädchen, etwas anderes hatte sie nicht gelernt. Zunächst erhielt sie eine Anstellung als Pflegerin im Krankenhaus, wo ihr Mann gearbeitet hatte. Die Frau von Professor Ma war die erste Patientin, die sie zu pflegen hatte. Professor Ma war damals noch kein Professor, und seine Frau brachte in der Klinik ein Kind zur Welt. Sie erhielt die gleiche ruhige und warmherzige Betreuung wie zuvor Doktor Wu und war sehr glücklich darüber. Beim Verlassen der Klinik erklärte sie, sie sei körperlich geschwächt, und außerdem verstünde sie nichts von der Pflege eines Kleinkindes, sie würde sich wünschen, dass sie als Kindermädchen in ihren Haushalt käme. Sie willigte ein. Der Umgang mit vielen Menschen war ihr zuwider, und das geräuschvolle Krankenhaus missfiel ihr. Bei dieser Beschäftigung blieb sie für viele Jahre. Sie zog das Kind der Familie Ma auf, wie sie auch Qinglin aufzog.
Qinglin bestand die Aufnahmeprüfung der Universität und ging nach Shanghai. Er studierte Architektur. Ihr Einkommen erlaubte es nicht, ihrem Sohn ein sorgenfreies Studium zu ermöglichen. Sie vermietete daher ihre Wohnung und ermöglichte ihm mit Hilfe ihres Lohns und der Mieteinnahme ein einigermaßen auskömmliches Studium. Qinglin war sich bewusst, was seine Mutter für ihn tat. Er arbeitete hart und schrieb ihr, er werde in Zukunft viel Geld verdienen und ihr eine große Wohnung kaufen. Sie freute sich über seine Absicht, ohne von der Aussicht auf eine große Wohnung sonderlich berührt zu sein. Sie war zufrieden, wenn es ihm gut ging.
Nach Abschluss des Studiums kehrte Qinglin nicht zu ihr zurück, weil ihr altes Wohnhaus abgerissen worden war und sie keine Möglichkeit gehabt hätten, zusammenzuwohnen. Außerdem hatte er den Ehrgeiz, Geld zu verdienen. Er entschloss sich, in den Süden zu gehen. Dort gebe es mehr Möglichkeiten, erklärte er seiner Mutter. Für sie wog jedes Wort ihres Sohnes schwer wie Gold. »Kümmere dich nicht um mich«, gab sie zurück. »Deine Mutter schämt sich, dass sie nicht für dich sorgen kann, mir genügt es, wenn du anständig lebst.«
Der ehrgeizige Qinglin war immer im Stress und kehrte selten nach Hause zurück. Er wechselte mehrfach die Firma, der Chef seines vierten Unternehmens stammte ebenfalls aus Wuhan und schätzte es, einen Landsmann bei sich zu haben. Er gab Qinglin zahlreiche Gelegenheiten, sich zu beweisen, und auf diese Weise verbesserte sich dessen Situation sehr rasch. Im Lauf der Zeit kaufte er im Süden eine Wohnung und heiratete. Anstelle einer aufwendigen Hochzeitsfeier unternahm er mit seiner Frau eine Auslandsreise. Bevor er die Reise antrat, kehrte er nach Hause zurück, um seiner Mutter seine Frau vorzustellen. Da seine Mutter keine eigene Wohnung besaß, blieb es bei einem gemeinsamen Essen im Hotel, wozu auch Professor Ma und seine Frau eingeladen wurden. Die Schwiegertochter war eine Schönheit, dem Ehepaar Ma begegnete sie überaus herzlich, ihr gegenüber benahm sie sich höflich. Ich bin schließlich nur eine Hausangestellte, dachte sie, was kann ich von ihr verlangen?
Professor Mas Frau starb an Krebs. Sie war in ihren schwersten Stunden an ihrer Seite, auch im Moment ihres Todes. Am Tag des Begräbnisses war Qinglin eilig nach Hause zurückgekehrt. Er mietete im Huayuanshan-Viertel eine winzige Wohnung und sagte zu ihr: »Mama, du musst dich nicht mehr abplagen, ich kann dich jetzt unterhalten. Aber um dir eine Wohnung zu kaufen, reicht mein Geld noch nicht. Ein paar Jahre musst du noch durchhalten. Jetzt kommst du erst mal hier unter.« Und er fügte hinzu: »Warte, bis ich zu Geld gekommen bin, dann kriegst du von mir eine perfekte Wohnung.«
Ihr war es völlig gleichgültig, ob er zu Geld kam oder nicht, sie bemerkte lediglich, dass er abgemagert war, sich auf seiner Stirn erste Falten zeigten und sein Gesichtsausdruck dem seines Vaters zu ähneln begann. Das machte sie traurig.
Qinglins Aufenthalt war kurz. Seine Lebenserfahrung hatte ihn gelehrt, praktisch zu denken und zu handeln.
Sie blieb allein in ihrer kleinen Wohnung zurück. Wenn heftiger Wind wehte, klapperten die Fenster. Durch die Wand konnte sie das Schnarchen und die im Schlaf gesprochenen Worte des Wohnungsnachbarn hören. Morgens bei Sonnenaufgang durchflutete Licht ihr stilles Zimmer. Beim Essen klang ihr das eigene Kaugeräusch wie das Dröhnen vorbeidonnernder Fahrzeuge in den Ohren. Es war ein kaltes und freudloses Dasein ohne Abwechslung und Anregung. Häufig sprach sie tagelang kein Wort. Ihre Welt reduzierte sich auf ihre Person. In der grenzenlosen Ödnis ihres Herzens existierte nur noch die Zeit.
7. Kapitel
Eines Tages wurde sie beim Einkaufen von einem unachtsamen Fahrradfahrer angefahren. Ihr Körper wurde zur Seite gestoßen, sie stürzte und prallte mit dem Kopf gegen einen Strommasten, Blut quoll ihr über die Stirn. Durch den Blutschleier sah sie am Straßenrand einen Bund Indisches Blumenrohr, daneben einen kleinen Straßenstand und darauf in einer Ecke ein Paar handbestickte Babyschuhe. Auf dem roten Stoff der Schuhe schwammen zwei goldfarbene Fischlein. Ihr Herz krampfte sich plötzlich zusammen.
Zum Glück war sie nur leicht verletzt. Die Haut über der Stirn wurde mit drei Stichen genäht, man verband ihren Kopf und schickte sie mit einer Begleitung nach Hause. Als Qinglin den Anruf ihres Vermieters erhielt, der ihn über den Vorfall informierte, erschrak er heftig und machte sich am selben Abend auf den Weg.
In ihrem Kopf tanzten unaufhörlich die beiden Fischlein, und immer wieder stieß sie die Worte hervor: »Die Fische, die Fische.« Qinglin vermutete, sie habe Appetit auf Fisch, und begab sich früh am nächsten Morgen auf den Markt, um ein paar lebende Karpfen zu kaufen.
Sie hatte sich inzwischen einigermaßen beruhigt. Als sie den Eifer ihres Sohnes bemerkte, verschwanden auch ihre Kopfschmerzen, sie machte sich an die Arbeit und schmorte für ihn Karpfen in Sojabohnenmus, Qinglins Lieblingsgericht.
Nicht ohne detaillierte Sicherheitsermahnungen und -vorkehrungen zu hinterlassen, machte sich Qinglin eilig auf den Rückweg nach Süden. Während sie seinem entschwindenden Rücken nachblickte, tauchten die kleinen goldenen Fische wieder vor ihren Augen auf. Sie wusste nicht, warum, aber sie empfand eine Art Erregung. Ungeachtet des Mullverbands an ihrem Kopf ging sie aus, um Sticknadeln, Garn und Stoffreste einzukaufen. Die Erinnerung an die bestickten Einlegesohlen, die sie im Hause von Professor Ma angefertigt hatte, lebte in ihr auf. Sie zeichnete den Umriss ihres Fußes auf Papier und schnitt mit rascher Hand die Stofffetzen zu Schuhsohlen zurecht.
Es war noch nicht spät am Tage, und die Sonne schien hell. Sie saß vor dem Fenster und machte den ersten Stich. Ihr kam es vor, als benötige sie tatsächlich ein Paar Einlegesohlen, aber mehr noch war es wohl ein Mittel, um ihrer inneren Leere zu entkommen. Sie stickte zwei kleine Goldfische auf die Einlegesohlen und empfand dabei einen nie gekannten inneren Frieden. Ihr war, als fiele dieses Glücksgefühl vom Himmel auf sie herab, als sei sie für diese Tätigkeit geboren. Nachdem sie das erste Paar fertiggestellt hatte, begann sie mit dem zweiten, und von da an hörte sie damit nicht mehr auf.
Sie stickte Päonien, Mandarin-Enten auch ein Qilin6. Die Zeit floss unter ihren Nadelstichen dahin. Sie wusste selbst nicht, wie viele Einlegesohlen sie bereits bestickt hatte, sie türmten sich an der Wandseite ihres Bettes. Ihr flaches Kopfkissen hatte sich durch zusammengeflickte Einlegesohlen ballonartig vergrößert. Am Ende fand sich in der engen Wohnung kein Platz mehr, daher kaufte sie einen Flechtkorb. Ich muss ein paar davon verkaufen, dachte sie.
So ging sie aus ihrer Wohnung und ließ sich gegenüber der Kirche nieder, um ihre Einlegesohlen zum Verkauf anzubieten. Nicht dass sie unter Geldnot litt. Sie hatte als Hausangestellte etwas zurückgelegt und extrem sparsam gelebt, auch Qinglin schickte ihr Geld, und zwar jedes Mal eine beträchtliche Summe. Sie hatte das Geld auf die Bank getragen und gedacht, er werde das Geld benötigen, wenn er dereinst eine Wohnung kaufen würde.
Täglich verkaufte sie ein oder zwei Paar, ein Rhythmus, der ihr behagte. Sie ging nur bei gutem Wetter aus, saß in der wärmenden Sonne, sah von Zeit zu Zeit zur von grünen Sträuchern umgebenen Madonna von Lourdes hin, sie fühlte ihre Blicke sich kreuzen und empfand ein Gefühl zufriedenen Wohlbehagens.
Nur fühlte sie sich, während sich diese Zufriedenheit in ihr ausbreitete, von irgendwelchen unbekannten Dingen verfolgt, die sie manchmal versteckt, manchmal direkt fühlbar umkreisten. Insbesondere wenn das Indische Blumenrohr rote Blüten trieb, spürte sie diese Dinge in ihrem Rücken. Sie mühte sich mit aller Kraft, ihnen zu entfliehen, aber sie blieben ihr hartnäckig auf den Fersen. Sie konnte spüren, wie sie sich bewegten und sie umflatterten, sogar mit ihr flirteten und sie verführen wollten. Sie dachte an den Schrecken, den sie früher empfunden hatte, schloss die Augen und sagte zu sich: »Ich drehe mich nicht um, ich gehe euch nicht auf den Leim. Ich fasse euch nicht an, ich will mich nicht erinnern. Ich will nicht wissen, woher ich komme, ich muss meinen Namen nicht wissen, und am wenigsten will ich wissen, aus welchen Menschen meine Familie bestanden hat. All das brauche ich nicht. Mir genügt es, dass meine Erinnerung mit Doktor Wu beginnt. Dass ich einen Sohn habe, der Qinglin heißt. Das Vergessen hat sein eigenes Recht, das hat auch Doktor Wu gesagt.«
Als Doktor Wu diese Bemerkung gemacht hatte, war er allerdings noch sehr jung gewesen.
8. Kapitel
Über viele Jahre hinweg führte diese Frau ein von Erschütterungen ungetrübtes Leben. Sie hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen, kaum jemand hatte Kontakt zu ihr. Sie hieß Ding Zitao.7
Den Namen hatte ihr Doktor Wu gegeben. Er hatte ihr erzählt, dass sie im Zustand von Bewusstlosigkeit und hohem Fieber gelegentlich das Wort »Dingzi« hervorgestoßen habe. Niemand verstand, was es bedeuten sollte. Als sie aus der Bewusstlosigkeit erwacht war, hatte er, als er ihren Krankenbericht ausfüllte, sie gefragt, wie sie heiße. Sie hatte den Kopf geschüttelt und erklärt, sie erinnere sich an nichts.
So notierte Doktor Wu im Krankenbericht unter ihrem Namen »Dingzi«. Es war damals Frühling, die Pfirsichbäume vor der Klinik trieben die ersten Blüten. Als er nach einer zweiten Silbe für ihren Vornamen suchte, wanderte sein Blick von ihr zu den Pfirsichblüten vor dem Fenster, und so notierte er ein »Tao«, Pfirsich. »Das Wort ›Dingzi‹ solltest du dir merken«, sagte er »vielleicht führt es dich eines Tages zu deiner Vergangenheit.«
»Du bist meine Vergangenheit«, dachte Ding Zitao. »Wozu brauche ich noch eine andere?«
II. Abschnitt
9. Kapitel
Es war ein trüber Tag, als Qinglin voller Vorfreude nach Hause zurückkehrte, um seiner Mutter eine Riesenüberraschung zu bereiten.
Kurz vor dem Ziel ließ er den Fahrer am Eingang eines Supermarktes halten, um seiner Mutter Obst mitzubringen. Luxusgüter wie Obst würde seine Mutter selbst nie kaufen, das wusste er.
Als er jedoch vor ihrer Wohnungstür stand, war er überrascht, dass sie nicht zu Hause war. Die Überraschung war begründet, denn in seiner Vorstellung lebte sie, soweit er denken konnte, zurückgezogen und ging selten aus. Nachbarn, die am Eingang zur Wohnanlage Mahjong spielten, teilten ihm widerwillig mit, er solle bei der Kirche nachsehen. Dort säße sie den ganzen Tag und verkaufe Einlegesohlen.
Qinglins Überraschung wuchs. Geld zum Leben hat sie doch genug, dachte er. Tatsächlich erspähte er von weitem seine Mutter gegenüber der Kirche sitzend, zu ihren Füßen einen Korb mit Einlegesohlen. In ihm stieg Ärger auf, er stürzte auf sie zu und sagte mit unverhohlenem Groll: »Mutter, was soll das, was machst du hier? Wenn du Geldprobleme hast, dann sag mir einfach Bescheid!«
Ding Zitao zuckte erschreckt zusammen, dann erkannte sie ihren Sohn, und ihr Schreck verwandelte sich in Freude. Ihr Sohn war für sie die Sonne, die ihr zu jeder Zeit und an jedem Ort das Herz erglühen ließ. Hastig sagte sie: »Geld fehlt mir nicht, ich habe nur nichts zu tun und vertreibe mir die Zeit. So zum Vergnügen, während ich ein Sonnenbad nehme. Sei nicht böse, schau her, habe ich alles selbst gemacht. Das macht mir einfach Spaß.«
Qinglin nahm ein Paar Einlegesohlen zur Hand und betrachtete das Muster und die handwerkliche Arbeit. »Das hat du selbst gemacht? Woher kannst du denn so was? Mein Gott, so was Schönes. Wieso habe ich dich das nie machen sehen?«
Ding Zitao freute sich: »Für dich habe ich auch ein Paar gemacht, aber ich befürchte, du findest das primitiv.«
»Wie kommst du auf diese Idee? Ab sofort kaufe ich meine Schuhe immer eine Nummer größer, dann kann ich deine Einlegesohlen benutzen.«
Sie lachte vergnügt: »Du willst mir eine Freude machen.«
Qinglin nahm den Korb auf: »Mama, Schluss mit Verkaufen. Lass uns nach Hause gehen.«
Er führte sie ein paar Schritte zu einer schwarzen Limousine. Als er Qinglin herankommen sah, sprang der Fahrer aus dem Auto und öffnete den Schlag. Qinglin wies auf den Rücksitz und sagte: »Steig ein, Mama!«
Ding Zitao war verwirrt: »Es sind doch nur ein paar Schritte, warum soll ich mit dem Auto fahren? Wessen Wagen ist das überhaupt?«
»Unser Wagen«, sagte Qinglin stolz. »Komm einfach mit«
Sie stieg ein. Ein paar Minuten später befand sich der Wagen inmitten des unendlichen Stroms der Fahrzeuge. Ding Zitao fühlte ein leichtes Schwindelgefühl. »Wohin fahren wir?«, fragte sie. »Wieder ins Restaurant?«
Bei jedem seiner Besuche führte Qinglin seine Mutter ins Restaurant aus. Damit sie beim Essen nicht den Anschluss an die Zeit verliere, sagte er. Dieses Mal sagte er jedoch: »Wir fahren nach Hause. Ich bringe dich nach Hause.«
»Was für ein Zuhause?«, fragte Ding Zitao verblüfft.
Er lachte: »Unser Zuhause, das Zuhause, wo Mama ab heute ihr Leben genießen wird. Die Wohnung in Huayuanshan haben wir gekündigt.«
Ding Zitao erschrak: »Und meine Kleider? Und was ist mit meinen Einlegesohlen? Der Vertrag mit dem Vermieter läuft doch noch bis Jahresende.«
Qinglin lachte: »Beruhige dich, Mama. Das wird alles geregelt. Den Transport deiner Sachen habe ich schon für morgen in Auftrag gegeben. Alles bis aufs letzte Staubkorn wird abgeholt, nicht einmal deine Essensreste im Kühlschrank und der Besen und die Putzlumpen aus der Küche bleiben zurück.«
Auch Ding Zitao musste lachen. Ist eben mein Sohn, dachte sie, bei jeder Gelegenheit einen Scherz auf den Lippen. Ich muss ihm folgen, egal, was er sagt.
Der Wagen bog in eine kleine Straße ein, die um einen See führte. Wasservögel flogen über die ausgedehnte Oberfläche. Die in der Ferne kerzengerade aufgereihten Bäume wirkten wie ein geschlossener Vorhang. Während sie gebannt auf die Szenerie blickte, entrollte sich in ihrem Kopf eine andere Wasserfläche. Auch darüber flogen Wasservögel, dichtes Schilf säumte das Ufer. Ein kleines Fischerboot ruderte aus der Ferne auf sie zu. Auf dem Boot standen Kormorane. Sie schüttelte das Bild von sich, Schilf und Boot verschwanden. Vor ihren Augen flogen noch immer Wasservögel über den See. Für einen Moment setzte ihr Herz aus, als überschlage sich etwas in ihr, ein Gefühl, das ihr Übelkeit bereitete. Das Ding, das sie früher umklammert hatte, schien sie nun auf unbestimmbare Weise zu umkreisen.
Der Wagen entfernte sich vom Seeufer und bog auf eine größere Straße ein. Vor ihnen zog sich nach wie vor die endlose Schlange der Fahrzeuge.
Ding Zitao schwenkte ihren Kopf hin und her, als wolle sie das Ding abschütteln, das sie einfach nicht loslassen wollte. »Wohin fahren wir?«, fragte sie.
»Nach Jiangxia. Zum Südsee8«, antwortete Qinglin. »Wunderschöne Gegend, frische Luft. Das wird dein Alterssitz.«
»Solange du nicht bei mir bist, ist es mir egal, wo ich meine alten Tage verbringe.«
»Unsere Firma erschließt in Jiangxia ein neues Wohngebiet, und ich bin als Projektleiter hierherversetzt worden. In Kürze werde ich mit meiner Mama zusammenwohnen.«
Ding Zitao war freudig überrascht: »Ist das wahr? Ist denn Baobaos9 Mutter damit einverstanden?«
»Sie ist damit einverstanden, hier zu wohnen. Sie will aber damit abwarten, bis Baobao die Aufnahmeprüfung für die Universität bestanden hat.«
»Ach so. Das ist ja großartig. Ich habe Sehnsucht nach unserem Baobao.«
»Das Kerlchen ist total unerzogen. Du wirst von deinem Enkel die Nase bald voll haben.«
»Werde ich nie. Von meinem allerliebsten Enkel werde ich nie genug haben.«
Qinglin lachte: »Da ist noch was, das du aushalten musst. Ich werde in Zukunft täglich abends heimkehren, um zu essen, was du gekocht hast. Das bedeutet, einen Tag Fleisch, einen Tag Fisch.«
Nun lachte auch Ding Zitao aus vollem Herzen. Qinglin war als Kind sehr anspruchsvoll gewesen, was das Essen betraf. Ihm stand der Sinn ständig nach Fisch und Fleisch. Als der Lehrer einmal die Schüler der Klasse gefragt hatte, wie sie sich ein glückliches Leben vorstellten, hatte er geantwortet: »Einen Tag Fisch essen und am nächsten Fleisch.« Die ganze Klasse hatte sich gekringelt vor Lachen. Der Lehrer hatte daraufhin Ding Zitao aufgesucht und ihr erklärt: »Bitte übertreiben Sie es nicht mit Ihrer Sparsamkeit, lassen Sie das Kind essen, was ihm schmeckt.« Damals lebte Ding Zitao von ihrem Gehalt als Kinder- und Hausmädchen, teures Essen konnte sie sich nicht leisten. Ihr blieb nichts, als Qinglin zu trösten: »Wenn du erwachsen bist, wirst du richtig Geld verdienen. Mama verspricht dir, dass sie dann Tag für Tag abwechselnd Fisch und Fleisch für dich kocht.«
Als sie wieder Luft bekam, sagte sie: »Das versteht sich. Mutter wird dir jeden Tag Fisch und Fleisch auf den Tisch stellen.«
Erneut lachend sagte Qinglin: »Ich weiß doch, worin das größte Vergnügen meiner Mama besteht.«
10. Kapitel
Als der Wagen schließlich in eine üppig mit Blumen und Bäumen bestandene, gepflegte kleine Wohnanlage einfuhr, deutete Qinglin durchs Fenster nach draußen und erklärte: »Das ist der Park der Anlage, hier kannst du Spaziergänge machen. Und das da ist das Gemeinschaftsgebäude, drinnen gibt es eine Bibliothek, man kann Schach und Karten spielen, es gibt auch ein Fitnessstudio.« Der Wagen umkreiste einen künstlich angelegten See mit einem Pavillon in der Mitte. Qinglin erläuterte: »Der Pavillon da ist sehr angenehm, auch die hölzerne Balustrade ist recht hübsch. Wenn es dir am Wasser gefällt, kannst du darauf herumspazieren. Aber bitte nur tagsüber, abends ist es hier zu dunkel, man muss vorsichtig sein.«
Schließlich hielt der Wagen vor einem Garten voller Blumen. Qinglin stieg aus, rannte um den Wagen herum, öffnete Ding Zitaos Schlag, beugte sich zu ihr herunter und sagte, seinen rechten Arm ausstreckend: »Fürstin, ich bitte.«
Sie stieg aus, tätschelte ihn und lachte: »Immer noch der alte Scherzbold, du wirst wohl nie erwachsen.«
Entweder hatte sie zu lange im Auto gesessen, oder sie war an Autofahrten nicht gewöhnt, und so fühlte sie sich noch schwindliger als zuvor. Kaum hatte sie ihn getätschelt, stolperte sie, sodass Qinglin sie erschrocken umklammerte und eilig in entschuldigendem Ton sagte: »Mama, jag mir keinen Schrecken ein. Du sollst es dir hier gut gehen lassen, du darfst dich nicht aufregen.«
Ding Zitao kam zu sich, fasste Tritt und lachte: »Das Autofahren macht mich schwindlig.«
Qinglin stützte seine Mutter, während sie den Garten durchschritten, bis sie an einem einstöckigen Haus aus roten Ziegelsteinen anlangten. Er deutete darauf und sagte: »Ma, was sagst du zu diesem Haus?«
»Sehr schön. Aber ist es nicht ein bisschen niedrig für ein Wohnhaus? Wie viele Familien können denn da drin wohnen? Die Firmen bauen doch heutzutage alle Hochhäuser.«
Qinglin lachte: »Das ist ein Einfamilienhaus, unser Zuhause. Dein Zuhause.«
Ding Zitao war sprachlos: »Mein Zuhause? Welches meinst du? Die ›Strohhütte des Ertragens‹ oder die ›Halle des dreifachen Wissens‹?«
»Wovon redest du? Was für eine Hütte, was für eine Halle?«
Ding Zitao zuckte zusammen. »Was für eine Hütte, was für eine Halle?«, wiederholte sie. »Der Eingang ist ganz anders als zur ›Strohhütte des Ertragens‹, und auch nicht wie der zur ›Halle des dreifachen Wissens‹.«
Verwundert fragte Qinglin: »Strohhütte des Ertragens? Und was für eine Halle? Wo sind die denn?«
Sie antwortete nicht, sondern sagte: »Das ist ja wie das Anwesen eines Großgrundbesitzers! Hast du keine Angst, dass man es dir wegnimmt und unter die Leute verteilt? Dass sie das Haus stürmen?«
Qinglin bekam einen Lachanfall. Nicht einmal der Fahrer, der Qinglins Gepäck in der Hand hielt, konnte das Lachen zurückhalten. Er sagte: »Tante10, Direktor Wu gehört nun mal zu den Großgrundbesitzern und Kapitalisten.«
Mit Mühe unterdrückte Qinglin sein Gelächter und sagte: »Mama, ob Großgrundbesitzer oder Kapitalist, von heute an bist du die Herrin dieses Anwesens, und deine einzige Verpflichtung besteht darin, dich darin glücklich und zufrieden zu fühlen. Wir sind im Jahr 2003, und Frau Ding Zitao hat ihre eigene Villa. Die Zeiten haben sich geändert, niemand wird hier auftauchen und deine Ruhe stören. Ich, Wu Qinglin, will, dass du die glücklichste und sorgloseste Mutter auf der Welt wirst.«
Qinglins Überschwänglichkeit gefiel Ding Zitao, doch weder lachte sie, noch zeigte sie übermäßige Freude. Stattdessen verriet ihr Ausdruck Ängstlichkeit. Ihr Blick fiel auf einen Bambusstrauch links neben der Eingangstür, seine Blätter waren leuchtend grün, und er trieb gerade neue Sprossen. In ihrem Hirn erscholl plötzlich eine Stimme: »Der Bambus vor dem Fenster, sein Jadegrün lässt sich in Worte nicht fassen.« Die Stimme eines Mannes und dahinter der Schatten eines Gesichtes. Unwillkürlich entfuhr es ihr: »Das stammt von Xie Tiao.«
»Mama, was sagst du da?«, fragte Qinglin.
Ding Zitaos Miene verriet Verwirrung: »Ich habe doch gar nichts gesagt.« Doch hatte sie das dumpfe Gefühl, gesprochen zu haben, aber was hatte sie nun eigentlich gesagt?
»Du hast von einem Xie irgendwas geredet, hab’s nicht richtig verstanden.«
»Ich habe den Bambus angeschaut, wie schön der aussieht. Und dann ist mir plötzlich eine Verszeile eingefallen: ›Der Bambus vor dem Fenster, sein Jadegrün lässt sich in Worte nicht fassen.‹«
Nie hatte Qinglin seine Mutter Verse rezitieren hören, unwillkürlich verblüfft sagte er: »Mutter, du bist wirklich umwerfend. Von wem stammt das?«
Ding Zitao wurde von Furcht gepackt, sie antwortete nicht. Von wem stammt das?, dachte sie. Wann habe ich das gelesen?
11. Kapitel
Das Wohnzimmer war riesig. In seiner Mitte stand ein braunes Ledersofa mit hölzerner dunkelbrauner Rückenlehne und geschnitzten Füßen. Das Sofa war geschwungen wie die Hüften einer attraktiven Frau, straff wie eine gespannte Saite. Als würde sie plötzlich angeschlagen, löste der Anblick des Sofas bei Ding Zitao einen Herzsprung aus. »Das ist unser Wohnzimmer«, sagte Qinglin.
In der östlichen Ecke des Raumes stand ein Bäumchen, das Ding Zitao als Glückskastanie11 erkannte. Ein gleiches Bäumchen hatte auch in der Wohnung von Professor Ma gestanden. In der nach Westen gerichteten Ecke stand eine mannshohe bemalte Porzellanvase. »Geschenk eines taiwanesischen Freundes«, erklärte Qinglin, »die mögen solche chinesischen Antiquitäten.«
Die Darstellung auf der Vase wirkte altertümlich. Erneut stockte Ding Zitaos Herz, als habe es einen Schlag erhalten. »Das ist doch ›Guiguzi steigt vom Berg herab‹12!«, sagte sie mit zitternder Stimme, mehr zu sich selbst. Sie verstand selbst nicht, woher ihre Panik rührte.
Qinglin war verblüfft: »Sogar so etwas weißt du?«
Ohne zu wissen, wie ihr geschah, stieß Ding Zitao hervor: »Natürlich, Papa hat das oft gemalt.«
Nie zuvor hatte sie Qinglin gegenüber seinen Großvater erwähnt, er wurde neugierig: »Du redest von meinem Großvater? Was war er denn von Beruf? Du hast mir nie von ihm erzählt.«
Ding Zitao erstarrte. Ja, tatsächlich, was für einen Beruf hatte ihr Vater? Und was war mit ihm geschehen? Während diese Fragen in ihrem Kopf umherschwirrten, fühlte sie innerlich einen stechenden Schmerz, am ganzen Körper brach ihr kalter Schweiß aus.
Qinglin spürte ihren ungewöhnlichen Gemütszustand. Er zögerte einen kurzen Moment und sagte dann: »Mama, du musst erschöpft sein. Von Großvater kannst du mir später erzählen. Gehen wir erst mal nach oben in dein Zimmer. Dort ruhst du dich bis zum Essen aus, und anschließend zeige ich dir das ganze Haus. Sonst verläufst du dich noch darin.« Wieder brach er in schallendes Gelächter aus.
Qinglin gehörte nicht zu den Menschen, die einfach grundlos draufloslachten. Er wusste selbst nicht genau, was mit ihm los war, spürte im gleichen Moment, dass sein Lachen gezwungen war.
Ding Zitaos Zimmer lag im ersten Stock, es war der am schönsten gelegene Raum in der ganzen Villa. Genau nach Süden gerichtet, mit Fenstern bis zum Boden, gesäumt von in Grautönen gemusterten Seidenvorhängen. Im Winter würde das Sonnenlicht den ganzen Raum füllen. Oder, wie Qinglin sagte: »So hell, dass es einen blendet. Du wirst sticken können, ohne deine Lesebrille aufzusetzen.«
Vom Fenster aus übersah man den ganzen Garten, dicht bepflanzt mit allerlei Blumen und Bäumen. Kampfer-, Magnolien- und zwei Ginkgo-Bäume reckten sich in die Höhe, darunter duckten sich Kamelien, China-Rosen und Gardenien. Einige Beete waren noch frei, und Qinglin forderte sie auf, sie so zu bepflanzen, wie ihr der Sinn stand, mit Blumen oder Gemüse.
Im Zimmer standen das Bett und eine Kommode. Das Bett war sehr groß, darüber war ein Seidenquilt gebreitet. Qinglin wusste, dass seine Mutter diese Art Bettdecke mochte, sie würde sich eher jeden Monat einen neuen Quilt zusammennähen, als eine traditionelle Steppdecke mit Überzug zu benutzen. Der Seidenquilt war mattviolett und übersät mit Päonienblüten im gleichen Farbton, ein prachtvolles Stück. Ding Zitao strich unwillkürlich darüber. »Wirklich schön, ich mag Päonien am liebsten«, sagte sie plötzlich. »Aber warum sind sie lila, in meiner Erinnerung sind sie rot.«
Qinglin lachte: »Hat es bei uns zu Hause jemals so eine Bettdecke gegeben? Die ist brandneu, habe ich gerade erst gekauft. Speziell für meine Mama.« Er spürte, wie Ding Zitao bei seinen Worten erschrak.
Sie murmelte: »So einen Bettüberzug wird man uns wegnehmen. Den mir Mutter geschenkt hat, hat man mir auch weggenommen. Sie werden kommen und uns alles wegnehmen, ob es uns passt oder nicht.«
Qinglin stieß ein Lachen hervor: »Hu Hansan13 kehrt nie wieder zurück! Alles meine Schuld, ich habe nur im Kopf gehabt, dich zu überraschen, und ganz vergessen, dass du an ein Leben in Armut gewöhnt bist. Jetzt bist du ganz verschreckt. Beruhige dich, Mutter, ich habe mein Geld auf ehrliche Weise verdient. Wenn ich dir eine Villa kaufe, erfülle ich nur meine Sohnespflicht, dir ein glückliches Alter zu bereiten. Du brauchst dir keinerlei Sorgen zu machen, wir sind hier zu Hause, es ist unser Haus. Du und ich, wir sind die Herren dieses Hauses.«
Ding Zitao nickte verwirrt. Sie hatte keine Ahnung, wovon sie gerade gesprochen hatte. Aber allmählich drang in ihr Bewusstsein, dass das Haus, welches sie gerade betreten hatte, nun ihres sein würde.
Ab jetzt würde sie ein eigenes Zuhause haben. Ein Geschenk ihres Sohnes. Sie hatte einen Sohn, der seine Mutter liebte, sie war eine glückliche Mutter.
12. Kapitel
Für den Abend hatte Qinglin ein köstliches Menü vorbereitet. Er ließ nicht zu, dass seine Mutter bei den Vorbereitungen half. Eine Hausangestellte, die er engagiert hatte, kümmerte sich um die Zubereitung, die Rezepte hatte ihr allerdings Qinglin vorgeschrieben. Er deutete auf die Angestellte und sagte zu seiner Mutter: »Sie heißt Dong Hong, und sie wird ab jetzt für dich sorgen.« Er wandte sich an die Haushälterin: »Dong Hong, ab jetzt ist meine Mutter Ihre Chefin, wenden Sie sich bei allen Entscheidungen an sie.«
Ding Zitao lächelte: »Rede keinen Unsinn, was soll ich für eine Chefin sein?«