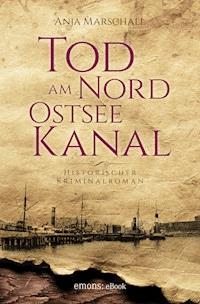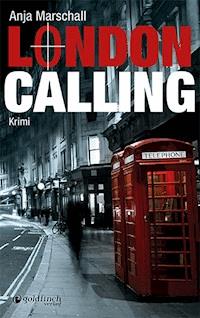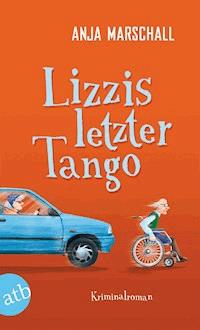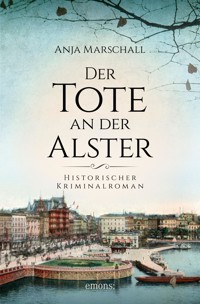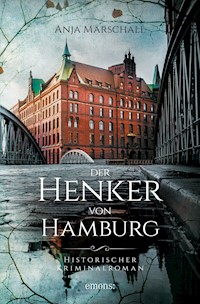9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maria, die im Altenheim lebt, erfährt, dass sie dieses Jahr zu Weihnachten zum ersten Mal keinen Besuch von ihrem verwitweten Schwiegersohn und ihren zwei Enkeln bekommen wird. Da sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, beschließt sie, aus dem Altenheim auszubüxen, um das Fest ein letztes Mal mit der Familie zu feiern. Gemeinsam mit dem in Ungnade gefallenen Engel Georg, den nur sie sehen kann, macht sie sich per Anhalter auf den Weg quer durch die Republik. Es wird eine Reise voller Überraschungen, kleiner Wunder und mit einem ganz besonderen Ende ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Maria, die im Altenheim lebt, erfährt, dass sie dieses Jahr zu Weihnachten zum ersten Mal keinen Besuch von ihrem verwitweten Schwiegersohn und ihren zwei Enkeln bekommen wird. Da sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, beschließt sie, aus dem Altenheim auszubüxen, um das Fest ein letztes Mal mit der Familie zu feiern. Gemeinsam mit dem in Ungnade gefallenen Engel Georg, den nur sie sehen kann, macht sie sich per Anhalter auf den Weg quer durch die Republik. Es wird eine Reise voller Überraschungen, kleiner Wunder und mit einem ganz besonderen Ende ...
Anja Marschall, geb. 1962 in Hamburg, arbeitete als Erzieherin, Pressereferentin, Journalistin, EU-Projektleiterin, Apfelpflückerin in Israel, Zimmermädchen in einem Londoner Luxushotel und Kioskverkäuferin an den Hamburger Landungsbrücken. Sie veröffentlichte mehrere Spannungsromane, von lustig bis historisch, kriminell bis hinterhältig. Tage voller Weihnachtszauber ist ihr erster Roman ohne Leiche. Anja Marschall lebt mit ihrer Familie in Schleswig-Holstein.
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch
Literaturagentur Lesen & Hören, Berlin
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wortfischen, Sylvia Gredig
Titelillustration: © iStockphoto: lisegagne| Timmary | by-studio | Anna Putina
Umschlaggestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2825-6
luebbe.de
lesejury.de
In der Stadt gab es Leute, die konnten sich noch daran erinnern, dass früher zu Weihnachten viel öfter Schnee gelegen hatte. Doch das war lange her. Stattdessen hatte man sich darin geübt, selbst im Nieselgrau ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Man hängte großzügig beleuchtete Girlanden über die Einkaufsstraßen und Lichterketten an die Häuser, die Schaufenster der Läden waren mit Watteschnee dekoriert, und im Supermarkt gab es Spekulatius im Angebot.
Nur noch zwei Tage trennten die Menschen vom Heiligen Abend. Und es gab noch viel zu tun.
Auch im örtlichen Krankenhaus am Rande der Stadt bereitete man sich auf diese besondere Zeit vor. Die Hausmeister hatten einen großen Adventskranz in der Eingangshalle aufgehängt, an dem bereits alle vier Elektrokerzen rhythmisch vor sich hin flackerten. Und neben der Portiersloge stand ein Teller mit Keksen und Mandarinen, von dem jeder sich bedienen durfte. Die Dame im Kiosk trug ein lustiges Rentiergeweih, das immer bimmelte, wenn sie den Kopf bewegte, und der Chefarzt hatte die Belegschaft für sechzehn Uhr zu einem kleinen Umtrunk gebeten.
Im zweiten Stock lag indes eine ältere Dame in Zimmer 209. Man hatte sie am Tag zuvor eingeliefert. Ihr Name war Maria Lindhorst, und sie wohnte im Seniorenheim Möwenstrand, nicht weit entfernt von der Klinik und nur eine halbe Stunde von der Hamburger City entfernt.
Soeben öffnete Maria Lindhorst die Augen.
Das diffuse graue Morgenlicht von draußen mischte sich mit der summenden Nachtleuchte über ihrem Kopf. Etwas piepte neben ihrem Bett. Ein anderes Etwas klemmte an ihrem Mittelfinger. Es hatte ein Kabel, das zu einem Gerät auf einem Ständer führte. Gelblich weiße Bettwäsche.
Das Nachthemd kannte sie nicht. Wer hatte sie ausgezogen? Wie war sie hierhergekommen? Sie erinnerte sich nur noch daran, dass ihr beim Spazierengehen übel geworden war. Dann Schwärze.
Gegenüber ihrem Bett entdeckte Maria ein hölzernes Kreuz. Darunter hing ein gerahmter Sinnspruch, den sie ohne ihre Brille nicht lesen konnte. Vom Flur hörte sie Geschirrklappern und Stimmen. Außer ihrem Bett gab es kein weiteres im Zimmer. Sie war allein.
Allein? Nein, nicht ganz.
Auf einem Stuhl am Fenster lümmelte eine Gestalt. Erst glaubte Maria, sie täusche sich, aber dem war nicht so. Dort saß tatsächlich ein Mann. Marias Blick ging von seiner Lockenpracht auf dem Kopf zu den blauen Augen und einem struppigen Vollbart hin zum weißen Nachthemd, welches ihm bis knapp über seine Knie reichte. Darunter lugten zwei haarige Beine hervor, die er übereinandergeschlagen hatte. Die Füße zierten zwei aufwendig gesteppte weiße Cowboystiefel mit Metallkappe an den Spitzen. Fragend sah Maria den Mann an, der sie seinerseits neugierig anschaute, während in seiner Hand ein mit Strasssteinchen verziertes Handy lag, das eher in die zarten Finger einer alternden Filmdiva gepasst hätte.
»Haben Sie sich im Zimmer geirrt?«, fragte sie den Fremden vorsichtig, dessen Anwesenheit sie sich nicht erklären konnte. Vielleicht war er ein Patient, der sich verlaufen hatte oder nur verschnaufen wollte.
Der Mann beugte sich ein wenig vor, wobei er sie noch prüfender musterte. »Es geht Ihnen wie?«, fragte er mit sonorer Stimme, ohne auf Marias Frage einzugehen.
»Nun, ich glaube, mir geht es so weit ganz gut, obwohl ich mir nicht erklären kann …«
»Schade«, murmelte er, lehnte sich zurück und sah auf das Display des Handys.
»Warum denn schade? Wäre es Ihnen etwa lieber, wenn es mir schlecht ginge?«
»Na ja, dann müsste ich nicht so lange warten.«
»Warten?« Maria fragte sich, worauf. Doch wohl kaum darauf, dass ihr Bett frei würde. Der Mann schlug jetzt die nackten Beine in den Cowboystiefeln andersherum übereinander, wobei er sorgsam darauf achtete, dass der Saum des Kleides nicht hochrutschte.
Langsam begann der Fremde, Maria zu beunruhigen. Vielleicht war er irgendwo weggelaufen und versteckte sich in ihrem Zimmer vor den Pflegern. Oder schlimmer noch: vor der Polizei. Ihr Blick huschte zur Tür. Das Klappern von Geschirr kam näher. Hoffentlich kam jemand herein, um das Frühstück zu bringen. Doch die Tür blieb geschlossen. Unauffällig tasteten Marias Finger nach der Klingel, die in Krankenhausbetten doch für Notfälle immer in der Nähe lag. Dabei ließ sie den Mann nicht aus den Augen.
»Weiter links«, murmelte der, ohne den Blick von dem Glitzerding in seiner Hand zu heben.
Maria zuckte zusammen. »Wie bitte?«
»Die Bimmel liegt weiter links.«
Ihre Finger krabbelten über das Betttuch nach links. Tatsächlich, da war der Alarmknopf. »Danke«, sagte sie mit trockenem Mund. Schnell drückte sie auf den Schalter. »Kennen wir uns?« Man musste mit Verrückten reden, hatte sie mal irgendwo gehört.
Er schüttelte den Kopf.
»Und warum sind Sie dann in meinem Zimmer?«
»Hab ich doch schon gesagt. Ich warte.«
»Ja, richtig, das sagten Sie.« Kurz schloss Maria ihre Augen. So kam sie nicht weiter.
Vor der Zimmertür waren Stimmen zu hören. Maria schöpfte Hoffnung. Endlich ging die Tür auf.
Jedoch stand keine Krankenschwester im Türrahmen, sondern Anna, die Pflegerin aus dem Seniorenheim Möwenstrand. Sie war viel netter als all die anderen Schwestern, denn Anna machte keine dummen Worte, wie: »Das können wir aber besser, nicht wahr, Frau Lindhorst?« Sätze dieser Art musste Maria sich zumeist beim wöchentlichen Töpfern anhören, wenn nach einer endlos langen Stunde ihr Tonklumpen noch immer nach einem Tonklumpen aussah statt wie eine Tasse oder ein hübscher Schwan.
»Da sind Sie ja!«, rief Anna und kam herein. Sie schloss die Tür hinter sich. »Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht, Frau Lindhorst. Wie geht es Ihnen?« Anna stellte die Reisetasche in ihrer Hand auf das Fußende des Bettes. »Ich habe ein paar Sachen aus Ihrem Zimmer mitgebracht.«
Sie öffnete den Verschluss und holte das silbergerahmte Bild von Ben, Frieda und Max heraus, das Maria sonst auf ihrer Anrichte im Seniorenheim stehen hatte. Anna arrangierte es jetzt auf dem Nachttisch neben Marias Bett.
»Was ist passiert, Anna? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.« Während Maria das sagte, nickte sie mit dem Kopf zum Fenster, um die junge Frau auf den eigenartigen Kerl im Nachthemd aufmerksam zu machen.
»Sie hatten einen Schwächeanfall beim Strandspaziergang. Wissen Sie noch?«
»Nun ja«, sagte Maria und nickte noch einmal zum Fenster hinüber. »Da waren Leute, die kamen, um zu helfen.«
Anna nahm von der Anwesenheit des Mannes keine Notiz. Und der schien sich, trotz des lächerlichen Hemdes, auch nicht vor Anna zu schämen, was Maria wiederum wunderte. Immerhin war Schwester Anna jung und hübsch.
»Es ist aber nichts Ernstes, meinte der Arzt eben«, fuhr Anna fort und packte weiter aus. »Sie müssen nur einen Tag zur Beobachtung hierbleiben. Ich habe Ihnen trotzdem frische Kleidung mitgebracht.«
Aus dem Augenwinkel sah Maria, wie der Kopf des Mannes hochschnellte. »Nichts Ernstes? Beobachtung? Das kann nicht stimmen«, grummelte er und begann, hektisch auf seinem Handy herumzutippen.
Maria fixierte noch einmal die junge Frau an ihrem Bett, wobei sie jetzt sehr energisch mit dem Kopf hinüber zu dem wirr vor sich hinmurmelnden Kerl nickte. »Wer ist das?«, raunte sie Anna zu. »Ich kenne ihn nicht.«
Anna folgte Marias Blick zum Fenster hinüber.
»Ich glaube, der hat sich verlaufen. Jedenfalls wartet er auf etwas. Will mir aber nicht sagen, auf was«, erklärte sie Anna leise.
Anna schaute zum Fenster. »Wer?«
»Na, der da.« Maria zeigte mit dem Finger zum Stuhl.
Zufrieden stellte Maria fest, dass nun auch Anna besorgt zu sein schien. Sie schaute zwischen Stuhl und Maria hin und her. Dann stellte sie die halb ausgepackte Tasche auf den Boden und setzte sich auf die Bettkante zu Maria, deren Hand sie in ihre nahm. »Alles gut, Frau Lindhorst. Das wird schon wieder.«
»Was meinen Sie damit?« Maria zog ihre Hand fort und zeigte noch einmal zu dem Irren hinüber, der weiter vor sich hin grummelte. »Sehen Sie ihn nicht? Da sitzt er doch!« Den Mann schien es nicht zu stören, dass die beiden Frauen über ihn sprachen.
Fürsorglich neigte Anna den Kopf zur Seite und lächelte. »Sie sind hingefallen. Erinnern Sie sich?«
»Ja, aber darum geht es doch nicht. Da ist ein Mann in meinem Zimmer.« Besorgt schaute sie Anna an, die nicht zu verstehen schien. Dann zog sie Anna am Revers ihrer Jacke dicht zu sich heran. »Und er trägt nur ein Nachthemd«, raunte sie in Annas Ohr.
Aus dem Augenwinkel sah Maria, wie der Kerl begann, das Handy in seiner Hand zu schütteln, als hoffe er, irgendetwas würde herausfallen. »Himmelherrgottsakramentnocheinmal!«, schimpfte er dabei.
Anna indes seufzte. »Vielleicht haben Sie sich den Kopf gestoßen, liebe Frau Lindhorst. So etwas passiert.«
Jetzt klang sie doch wie die anderen Pflegerinnen im Seniorenheim.
»Wir sollten es dem Arzt sagen«, schlug Anna aufgesetzt munter vor.
»Wird nicht helfen«, mischte sich der Fremde seinerseits ein.
Maria drehte sich zu ihm. »Warum hilft es nicht?« Sie spürte, wie Anna hinter ihr zusammenzuckte und nun ihrerseits zum Alarmknopf am Bett griff.
»Weil sie mich nicht sehen kann … und der Arzt auch nicht.«
»Nicht sehen? Warum?« Die Angst in Maria kroch höher. Anna musste doch bemerkt haben, dass außer ihnen noch jemand hier war!
Der Mann lachte nur.
Maria fuhr zu Anna herum. »Sie sehen ihn wirklich nicht? Nicht einmal ein bisschen?«
Anna schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, aber da ist niemand.«
»Sag ich doch«, murmelte der Typ.
Maria setzte sich abrupt auf. »Aber warum sehe ich Sie?«, fuhr Maria den Mann in schrillem Ton an.
»Weil Sie jeden Moment sterben werden.«
Das saß! Maria fiel in ihr Kissen zurück. Ihr wurde schwindelig. Sie spürte, wie ihr Herz zu rasen begann und die Ohren zu rauschen, als stünde sie bei schwerem Nordweststurm an der Küste.
Interessiert sah der Mann von seinem Handy auf.
Wie im Nebel spürte Maria Annas Hand, die ihre streichelte. Sie hörte Annas Stimme wie durch Watte. Eine Krankenschwester kam ins Zimmer geeilt, verschwand wieder, nur um kurz darauf mit einem Arzt an der Seite an Marias Bett zu treten.
Maria hörte, wie Anna ihn fragte, welche Medikamente man verabreicht hätte. Der Arzt horchte Marias Herz ab, während sie unaufhörlich zu dem Kerl im Nachthemd hinüberstarrte.
Ein kurzer Lichtschein in ihren Augen. Dann prüfte jemand ihren Blutdruck. 170 zu 110. Puls 99. Zu viel.
Der Verrückte hatte recht: Niemand sah ihn. Nur sie!
Maria hörte, wie Anna mit dem Arzt flüsterte. Sie wollte wissen, ob Maria dehydriert sein könnte.
Der Kerl auf dem Stuhl hob den Kopf. »Dehydriert? Unsinn.« Er stand auf und trat zu den anderen an Marias Bett. Die Hände auf den Rücken gelegt, wie ein Herr Professor, beobachtete er die Patientin, als sei sie eine alte Wurstscheibe, von deren Haltbarkeitsdatum er annahm, dass es längst überschritten sei. »Schmerzen im Brustkorb?«, wollte er im typischen Medizinerton wissen. »Wenigstens Schluckbeschwerden? Oder Lähmungen?«
Flehentlich blickte Maria zu dem richtigen Arzt, der auf der anderen Bettseite stand und gerade auf ihr Krankenblatt schaute. Dabei entdeckte sie zwei steile Falten auf seiner Stirn.
»Engegefühl? Brennt das Herz?«, wollte der Verrückte neben ihr wissen. Maria starrte ihn an, wobei sie den Mund zusammenkniff. Sie würde nicht antworten. »Ist Ihnen wenigstens übel?« Er beugte sich zu ihr herunter, um sie genauer zu begutachten. Maria drückte sich tiefer in ihr Kissen. »Fahl, eindeutig fahl. Und Angstschweiß haben Sie auch.« Zufrieden nickte er. »Na, dann können wir ja gleich los.«
Ängstlich schaute Maria ihn an, wie er sich zurück auf den Stuhl setzte. Für eine Fata Morgana fand sie ihn eindeutig zu überzeugend.
»Hat sie sich aufgeregt?«, wollte der Arzt, ein attraktiver Mittvierziger mit ersten grauen Strähnen im Haar, von Anna wissen.
»Und ob«, hätte Maria gerne gerufen und auf den Kerl am Fenster gezeigt. Immerhin drohte der ihr mit dem Tod!
Etwas aber sagte ihr, dass es besser war, den Mann mit dem Glitzerhandy nicht noch einmal zu erwähnen. Erschöpft schloss Maria die Augen. Sie musste wieder klar im Kopf werden. Sie würde einfach so lange die Augen zukneifen, bis der Kerl verschwunden war. Das war nur eine Frage der Geduld. Maria hörte, wie Anna leise etwas von reizunabhängiger Sinneswahrnehmung sagte und wissen wollte, ob der Blutdruck die Ursache eines hirnorganischen Psychosyndroms sein könne. Immerhin sei die Verwirrtheit ganz plötzlich aufgetreten.
Doch Marias Blutdruck schien dafür nicht hoch genug zu sein. Man wolle es mit einem leichten Beruhigungsmittel versuchen.
Ein Frühstück wäre Maria allerdings lieber gewesen. Dann aber hätte sie die Augen öffnen müssen, und das war das Letzte, was sie in diesem Moment tun wollte.
Vielleicht hatte Anna recht, und der Sturz war doch heftiger gewesen, als sie anfangs gedacht hatte. Allerdings spürte sie keine Schmerzen. Nirgendwo in ihrem Körper. Dennoch sah sie etwas, was offenbar für niemand anderen zu sehen war. Leise seufzte Maria. Ob sie tüdelig wurde?
Nach kurzer Beratung entschied der Arzt, die Patientin solle sicherheitshalber noch ein paar Tage zur Beobachtung bleiben. Zumindest seien die Befunde bei der Einlieferung ohne Ergebnis gewesen, was ein gutes Zeichen war. »Für eine Achtzigjährige sind Sie erstaunlich gut in Form, Frau Lindhorst«, erklärte der Arzt.
Vom Fenster hörte Maria ein unwilliges Schnaufen. »Gut in Form? Dass ich nicht lache. Glauben Sie ihm kein Wort. Alles Pfuscher, wenn Sie mich fragen. Bin ja schließlich nicht ohne Grund hier.«
Maria kniff die Augen fester zu.
Ob sie nun das Weihnachtsfest im Krankenhaus verbrachte oder im Seniorenheim, konnte ihr eigentlich egal sein. Einzig, dass hier ein unsichtbarer Verrückter saß, ließ ihr das Seniorenheim Möwenstrand erträglicher erscheinen.
Sie dachte an Ben. Er hatte gestern angerufen, um ihr mitzuteilen, dass es mit dem Weihnachtsbesuch in diesem Jahr leider nichts werden würde. Denn er und seine Verlobte Yvette wollten mit den Kindern gleich nach Heiligabend in den Skiurlaub fahren. Last-minute-Angebot, unschlagbar. Max und Frieda freuten sich aber schon darauf, die Oma im neuen Jahr besuchen zu können, sobald man wieder zurück sei.
Maria erinnerte sich, dass sie bei der Bank gewesen war, um Geld abzuheben, welches sie zu den Geschenken für die Kinder hatte legen wollen. Auf dem Heimweg hatte sie spontan beschlossen, einen kleinen Umweg am Elbstrand entlang zu machen. Und dann war sie einfach umgefallen.
Jemand verließ das Krankenzimmer. Voll Hoffnung öffnete Maria ihr rechtes Auge einen Spaltbreit, nur um zu sehen, ob der Stuhl am Fenster endlich leer war. Doch der Verrückte saß noch immer dort. Aufmerksam musterte er sie. Schnell kniff sie das Auge wieder zu.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Lindhorst«, hörte Maria Annas weiche, warme Stimme neben sich. »Vielleicht müssen Sie ja gar nicht bleiben, bis das Fest vorbei ist. Ich rede noch einmal mit dem Arzt. Es wäre doch gelacht, wenn Sie Weihnachten nicht mit uns zu Hause feiern könnten.«
»Nun machen Sie der armen Frau doch keine unnötigen Hoffnungen«, sagte der Kerl am Fenster. »Dieses Fest fällt für sie aus. Und alle zukünftigen auch. Daran gibt es nichts zu rütteln.«
Maria riss die Augen auf und fuhr hoch. »Halten Sie endlich die Klappe!«, brüllte sie Richtung Fenster.
Die junge Frau neben dem Bett erstarrte. Sofort tat Maria ihr Ausbruch leid.
»Was ist denn nur los mit Ihnen, Frau Lindhorst?«
Reiß dich zusammen, mahnte Maria sich. Wenn ich so weitermache, stecken die mich noch in die geschlossene Abteilung. Schnell nahm Maria die Hand ihrer Lieblingspflegerin. »Nichts, Kleines, es ist nichts. Ich bin nur schrecklich durcheinander. Kann mich an den Strandspaziergang ja noch erinnern, aber danach ist alles schwarz.« Maria versuchte, aufmunternd zu lächeln, obwohl sie sich ganz und gar nicht wohl in ihrer Haut fühlte. »Aber sicherlich haben Sie recht, Anna, ich muss mit dem Kopf aufgeschlagen sein.«
Jetzt, wo das Gespräch wieder in vernünftige und logische Bahnen kam, schien Anna sich wohler zu fühlen.
»Das wird alles wieder, Anna. Bestimmt«, bekräftigte Maria noch mal.
Sie sah der jungen Frau dabei zu, wie diese, mit noch immer gerunzelter Stirn, die Tasche weiter auspackte. Wäsche, Strümpfe, Zahnputzzeug und einige Zeitschriften.
Da drehte Anna sich um. In der Hand hielt sie Marias Portemonnaie, das im Schrank gelegen hatte. »Frau Lindhorst! Sollte man das nicht besser in einen Safe tun?«
Maria zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, ob es hier so etwas gibt. Ist ja kein Hotel.«
Anna trat an den Nachtschrank. »Gut, dann tue ich das Geld in die Schublade. – Dass Sie noch immer mit Bargeld bezahlen …« Sie schüttelte den Kopf. »Es gibt doch Kreditkarten.«
Maria wollte nicht mit Anna streiten. In dieser Hinsicht war sie nun einmal altmodisch. »Wie nett, dass Sie mir die Sachen gebracht haben, jetzt, wo ich doch noch hierbleiben muss«, sagte sie stattdessen. »Es wäre wirklich nicht nötig gewesen.«
»Sehe ich auch so«, kam es vom Fenster.
Maria zwang sich, nicht darauf zu reagieren, sondern den Blick weiter auf Anna zu richten, und ihr Lächeln um keinen Deut weniger dankbar wirken zu lassen, als die junge Frau es verdient hatte. »Wie gesagt, es wäre doch nicht nötig gewesen«, wiederholte sie.
Die Schwester kam zurück und reichte Maria eine weiße Tablette mitsamt einem Becher Wasser. Brav nahm Maria das Mittel, welches sie beruhigen sollte. Doch etwas sagte ihr, dass davon der Verrückte am Fenster nicht verschwinden würde. Währenddessen legte Anna die restlichen Sachen in den schmalen Schrank gegenüber von Marias Bett.
»Ich hole Sie vom Krankenhaus ab, sobald der Arzt es erlaubt, liebe Frau Lindhorst.« Maria nickte ergeben.
Da fiel Maria etwas Wichtiges ein. Abholen? Hatte der Kerl am Fenster nicht gesagt, dass er sie abholen wolle, sobald sie tot war? Wohin sollte es denn gehen? Nach oben oder nach …
Sie bekam einen Schreck, denn die Bravste war sie ja früher nicht gewesen. Der alten Schmittke hatte sie vor vielen Jahren absichtlich die Wäsche von der Leine gerissen und in den Matsch fallen lassen, weil die ihr den Müll vor die Tür gekippt hatte. Und dem Freddi hatte sie nicht erzählt, dass sein Freund Hans ihr damals in der Schule einen Kuss gegeben hatte, der viel besser war als der von Freddi. Das war irgendwann in den Fünfzigern gewesen. Aber, fragte sie sich, verjährte Gemeinheit im Himmel? Maria wusste es nicht.
»Ich will dann mal wieder los.« Anna erhob sich.
Maria erschrak. »Jetzt schon?« Sie wollte nicht mit dem da allein im Zimmer sein. »Bleiben Sie doch noch ein wenig, liebe Anna. Vielleicht bis zum Mittagessen?« Treuherzig schaute sie die junge Frau an.
Die lachte. »Das geht leider nicht, Frau Lindhorst. Mein Dienst fängt gleich an.« Sie machte den Reißverschluss ihrer Jacke zu. »Bevor ich gehe, rede ich aber noch mit dem Arzt, damit Sie schnellstmöglich nach Hause kommen können.«
Nur ungern ließ Maria Anna gehen.
Nach Hause, dachte Maria und schaute zur jetzt geschlossenen Tür hinüber. Wie schön das klang. Doch leider war das Seniorenheim für Maria alles andere als ihr Zuhause. Sie fühlte sich unter all den Alten seit dem ersten Tag fremd. Wie in einem Wartesaal. Und nun sollte sie das wenige, was sie dort hatte, auch noch verlieren?
Wütend schaute sie den schrägen Vogel vor dem Fenster an.
Sie sollte also sterben. Jedenfalls hatte sie den Kerl da drüben so verstanden.
Würde jetzt ein Blitz einschlagen und sie töten, damit der Typ sie mitnehmen konnte?
Sie wartete, aber nichts passierte.
Hm, dachte sie, wie lange es wohl noch dauern mochte. Irgendwann jedenfalls würde es so weit sein. Das war klar. Die Jüngste war sie nun wirklich nicht mehr. Da sollte man wohl jederzeit mit dem Tod rechnen, oder nicht? Bisher hatte sie wenig Gelegenheit gehabt, darüber nachzudenken, zumal sie Gedanken dieser Art schon immer unnütz fand. Der Tod kam eh, wann es ihm passte. Mit ständigem Nachdenken darüber konnte ihn niemand verhindern.
Maria blickte zu dem Mann am Fenster, der noch immer auf das Display seines Handys schaute. »Sie sind also der Tod, richtig?« Irgendwie hatte sie ihn sich anders vorgestellt. Aber was wusste sie schon. Sie war ja noch nie gestorben.
Er stöhnte auf. »Jetzt geht das wieder los.«
»Was?«
»Das Handeln. Alle wollen handeln. Noch ein Tag, bitte, bitte!«, äffte er. »Meine Frau, ich kann doch meine Frau nicht allein lassen. – Der Deal, erst noch den Deal machen, dann sterben, ja? – Warum heute? Warum nicht morgen?« Er warf die Hände der Zimmerdecke entgegen. »Himmel, wie ich es hasse.«
»Ich will aber gar nicht handeln. Ich bin alt. Irgendwann kommt nun einmal auch meine Zeit. Und heute ist genauso gut wie morgen, glaube ich.«
Der Mann schaute sie interessiert an. »Echt? Sie haben nichts dagegen? Sie wehren sich nicht? Kein Jammern? Keine Tritte gegen mein Schienbein? Keine Bestechungsversuche? Keine Tränen?«
Maria dachte an ihre Tochter Lea. Sie im Himmel wiedersehen zu können, das wäre wunderbar. Wie oft hatte sie sich genau das gewünscht. Andererseits, überlegte Maria, waren da auch noch Leas Kinder Max und Frieda sowie Leas Mann Ben.
Ach, wie gerne würde sie die drei noch einmal sehen, bevor … Wie alt waren die Kinder jetzt eigentlich? Sieben und vier. Genau. Max war im letzten Sommer zur Schule gekommen. Und Frieda, das Nesthäkchen, sah aus wie ihre verstorbene Mutter. Ihre Lea in klein. Maria seufzte.
Im Sommer hatte Maria nach Bayern fahren wollen, aber Ben und Yvette hatten gemeint, dass die lange Reise zu anstrengend für die Oma sei. Man würde mit den Kindern zu ihr in den Norden kommen. Maria hatte gewartet. Doch statt eines Besuchs bekam sie eine Postkarte aus Portugal. Und jetzt sollte es wegen des Skiurlaubs zum Fest auch nicht klappen.
Da fiel Maria ein, dass sie dieses Mal so oder so kein Weihnachten mehr feiern würde, sollte der schräge Vogel am Fenster die Wahrheit sagen. Das aber bedeutete auch, dass sie Ben und die Kinder nie wieder sehen würde.
Noch einmal seufzte sie. »Wann geht es los?«
Der Mann am Fenster zuckte mit den Achseln. »Das ist es ja, ich weiß es nicht.«
»Aber Sie wissen hoffentlich, ob ich nach oben oder nach unten komme, oder?«
»Was ihr Menschen immer denkt!« Er schüttelte verzagt den Kopf. Dabei strich er sich über den Bart.
In richtiger Kleidung und mit einem Besuch beim Friseur könnte er ganz passabel aussehen, dachte Maria für einen kurzen Moment.
»Es gibt keine Hölle«, erklärte er. »Wenn es sie gäbe, wäre ich sicherlich dort. Aber so viel Glück hatte ich leider nicht.«
Mit offenem Mund starrte Maria ihn an. »Sie wären lieber in die Hölle gegangen?«
»Natürlich, wenn es die Hölle gäbe, gäbe es dort bestimmt Whisky und man dürfte Poker spielen, ohne Ärger zu bekommen.« Er grinste süffisant. »Und andere Sachen dürfte man auch machen, von denen ich einer Dame aber nichts erzählen werde.«
»In Ihrem Alter?«, rutschte es ihr heraus, ohne recht zu wissen, wie alt er eigentlich sein könnte.
»Was soll das heißen?« Er sah an sich hinab. »Ich würde sagen, ich bin noch recht gut beieinander.« Mit beleidigtem Blick drückte er sein Kreuz durch und zog den Bauch ein, dabei rutschte das Hemd ein wenig über die Knie, was er sofort korrigierte. »Dass ich diesen Fummel tragen muss …«, er warf einen wütenden Blick gen Himmel, »das liegt nicht an mir. Es ist eine Art Uniform. Jeder Engel in der Abholung trägt das, haben sie mir gesagt.« Er zupfte am Saum des weißen Kleides, als könne er es so länger machen.
»Ist vielleicht etwas kurz geraten, oder? Gehen die nicht normalerweise bis zum Boden?«
Er grummelte wütend, dass ihm dies sehr wohl bewusst sei. »Wetten, dass da wieder dieser Gabriel hintersteckt«, vermutete er. »Der konnte mich noch nie leiden. Ich bekäme erst ein anständiges Outfit, wenn ich es mir verdient hätte, hat er gesagt. Das ist jetzt mindestens hundert Ewigkeiten her.«
»Verdient?«
Er nickte. »Ja, die haben mich nämlich strafversetzt. Zur Abholung! Sagte ich doch schon.« Er wedelte mit dem Glitzerhandy zu Maria herüber. »Und nun muss ich in diesem Fähnchen und mit so einem lächerlichen Telefonding in der Hand rumlaufen. Das ist doch demütigend! Absolut peinlich. Ich meine, auch ein Engel hat seine Würde.« Er stand auf und begann, im Raum auf und ab zu gehen. »Wissen Sie, wie das ist, wenn man zu jemandem geht, ihm sagt, er sei tot, und dann lacht der einen aus? Ja! Sie haben richtig gehört. Die lachen über mich! Nehmen mich nicht ernst. Wie soll ich da meine Arbeit ordnungsgemäß verrichten?« Er schlug mit der Faust gegen seine Brust. »Das schmerzt hier, kann ich Ihnen sagen.« Er blickte zum Himmel hinauf, wobei er die Hand jetzt zur Faust ballte und hochhielt. »Ich wette, das hast du absichtlich gemacht, Gabriel!«
Maria unterdrückte ein Grinsen. Einen richtigen Engel hatte auch sie sich anders vorgestellt.
»Ich meine, ich würde mich auch nicht ernst nehmen, wenn ich nicht schon längst tot wäre. Peinlich, sage ich nur.«
»Warum?«
Verwirrt sah er sie an. »Warum mir das hier peinlich ist?«
»Nein, warum Sie strafversetzt wurden?«
Er grummelte etwas in seinen Bart.
»Wie bitte?«
»Ich sagte«, und es klang eindeutig verärgert, »dass mich jemand verpfiffen hat.«
»Warum?«
»Himmel«, rief er aus, »nun fragen Sie doch nicht immer warum!« Maria öffnete bereits den Mund, um genau das ein weiteres Mal zu tun, als er ihr ins Wort fiel. »Ich habe mit den anderen ein bisschen Karten gespielt. – So, nun wissen Sie es.«
Maria legte den Kopf schief. »Ich nehme an, es war kein Mau-Mau.«
»Genau.« Er grinste unter seinem Vollbart. »Nennen wir es Unartiges-Engel-Mau-Mau.«
Fragend hob Maria eine Augenbraue.
»Na ja«, erklärte er weiter, »Poker ist im Himmel nicht erlaubt. Und dieser hinterhältige Gabriel hat mich beim Chef verpetzt.« Dann grinste er. »Aber die letzte Runde habe ich gewonnen.« Stolz blickte er auf seine Stiefel hinunter. »Passen wie angegossen.«
»Sie reden vom Erzengel Gabriel?«
Spontan verdüsterte sich sein Blick. »Der Typ wird eindeutig überbewertet, wenn Sie mich fragen. Ich meine, was macht der denn den ganzen lieben langen Tag?« Er starrte aus dem Fenster, hinaus in das Grau über der Stadt. »Aber ich hätte es schlechter treffen können, wissen Sie. Die hätten mich nämlich auch zur Registratur versetzen können!«
»Also war der … Chef nicht allzu böse mit Ihnen, oder?«
Der Mann drehte sich zu Maria um, die noch immer nicht sicher war, wen sie da vor sich hatte. Plötzlich brach die Sonne durch die regenschwere Wolkendecke. Ihre Strahlen schoben sich in das Krankenzimmer im zweiten Stock und umhüllten den Mann im Kleidchen wie ein Heiligen-schein!
Maria hielt die Luft an. Für einen kurzen Moment sah sie tatsächlich einen Engel dort stehen! Einen richtigen Engel.
»Ich sage Ihnen, Registratur, das ist die wahre Hölle! Stempel und Stempelkissen, Listen und Aktenschränke. Kein Licht! Nur Staub! Das ist eine Hölle der ganz unangenehmen Art.«
Ebenso plötzlich, wie die Sonnenstrahlen den Mann eingehüllt hatten, verschwanden sie wieder, als hätte man es sich da oben anders überlegt.
»Sie sind also ein Engel«, flüsterte Maria und vermutete, dass er keiner der Wichtigen seiner Profession sein könne. Keiner jener Engel, von denen man im Gottesdienst hörte oder die es als Schutzheilige zu etwas gebracht hatten, aber … irgendwie … vor ihr stand ein Engel. Sie lächelte. »Wie heißen Sie eigentlich?«
»Georg.«
»Georg? Wie der heilige Georg, der Drachentöter?«
»Nee, mit dem habe ich nichts zu tun, ich bin eher der Typ George Clooney.«
»Sie vergleichen sich mit George Clooney, dem Schauspieler?« Maria schüttelte ungläubig den Kopf.
Er nickte. »Frauen finden diesen Clooney sexyer als den Drachentöter, das können Sie mir glauben.«
»Hm, ähnlich sehen Sie ihm aber nicht«, gab Maria zu bedenken.
»Darum geht es doch überhaupt nicht.« Missmutig schaute er wieder einmal aufs Display. Das Gespräch schien dem Engel nicht zu gefallen.
Maria beobachtete ihn eine Weile, wie er so über das Handy gebeugt dasaß. »Nun hören Sie doch endlich auf, das Telefon anzustarren«, rief sie verärgert zu ihm hinüber. »Das mag heutzutage ja üblich sein, aber es ist höchst unhöflich.«
Georg, alias Clooney, trat mit wütendem Blick an ihr Bett. Erschreckt zuckte Maria zurück. Hatte sie ihn verärgert? Würde es jetzt losgehen?
»Hören Sie mal gut zu, Lady.« Er beugte sich zu ihr herunter, woraufhin sie sich tiefer in das Kissen in ihrem Rücken drückte. »Es liegt nicht an mir, dass wir noch hier sind, klar?«
»Woran dann?« Ihre Stimme klang eigentümlich kratzig.
Er riss das Handy vor ihr Gesicht. »Daran!«, rief er. »Die müssen mich anrufen und mir sagen, wohin ich Sie bringen soll.«
»Sie warten also auf einen Anruf von …«
»Genau!« Georg zeigte mit dem Finger zur Zimmerdecke. »Ohne Bimmeln kein Transport.«
Maria wusste nicht, ob sie sich freuen sollte, noch ein wenig Zeit auf Erden zu haben, oder ob es ihr lieber wäre, dass dieser verrückte Albtraum endlich endete.
Sollte sie allerdings noch Zeit haben, dann wäre es fein, wenn es bis zum Mittagessen dauerte, überlegte sie. Sie hatte nämlich Hunger, immerhin war das Frühstück ja für sie ausgefallen. Und mit knurrendem Magen in den Himmel auffahren, nur um dann eine ganze Ewigkeit Hunger zu haben, erschien ihr keine gute Idee.
Sie faltete die Hände und fixierte das Kreuz an der Wand, welches plötzlich eine neue Bedeutung für sie zu haben schien. »Gut, dann warten wir. Ich habe Zeit.«
Die Pille wirkte mit der Zeit. Ihr Herz raste nicht mehr so, und auch im Kopf machte sich eine gewisse Ruhe breit. Und so strichen die Minuten dahin, bis aus ihnen Stunden wurden. Das Mittagessen war besser, als sie es erwartet hatte. Wenigstens musste sie ihre letzte Reise nicht mit leerem Magen antreten.
Als das Tablett mit dem Geschirr abgeräumt wurde, schnarchte der Engel auf seinem Stuhl seit über einer Stunde sonor vor sich hin. Noch immer hatte sein Handy nicht geklingelt. Langsam begann Maria zu hoffen, dass die Sache mit der Abholung vielleicht nur ein Missverständnis sein könnte. Vielleicht hatte ja jemand in der Registratur einen Fehler gemacht. Menschen machten Fehler. Engel auch? Sie war sich da nicht sicher.
Seit Georg eingeschlafen war, dachte Maria über ihre vielleicht letzten Minuten nach. Und während sie so nachdachte, fiel ihr Blick immer wieder zum silbergerahmten Foto auf ihrem Nachttisch. Sie hatte ihre Enkel viel zu lange nicht mehr gesehen. Ob die Kinder sich noch an sie erinnerten? Vermissen würden sie die Oma aus Hamburg bestimmt nicht, wenn sie erst einmal … Vielleicht würden sie das Geld vermissen, welches Oma schickte. Aber ansonsten?
Familie sollte mehr sein, als Überweisungsformulare auszufüllen, dachte Maria traurig. Wie anders war es doch zu ihrer eigenen Zeit gewesen. Die ersten Jahre nach dem Krieg waren mager gewesen. Zu Weihnachten hatten sie alles Mögliche in die mickrigen Tannenzweige gehängt, Sterne aus Stanniolpapier, Talgkerzen und selbst gemachte Geschenke in altes Zeitungspapier eingewickelt. Das Papier wurde anschließend zum Anzünden des Ofens genutzt. Zusammen mit den Tanten und den Großeltern hatten sie dann am Heiligabend in der zugigen Stube gehockt und Lieder gesungen, gelacht und eine frisch geschlachtete Gans gegessen.
Und später dann, als es allen wieder besser ging und die Bäuche dicker wurden, da schlugen sie und ihr Vater im nahen Wald jedes Jahr eine prächtige Tanne, die Maria dann im Wohnzimmer für die Familie mit Glitzerkugeln und Lametta schmückte. Als Maria dann selbst eine kleine Familie hatte und mit Töchterchen Lea und Ehemann Hans in einer hübschen Wohnung am Hamburger Fischmarkt lebte, hielt sie es wie all die Jahre zuvor auch: Die ganze Familie wurde eingeladen, und am Heiligabend gab es Gänsebraten mit Rotkohl. Vor allem Onkel Heinz hatte es der kleinen Lea angetan. Mit den spannenden Geschichten von all seinen Reisen auf den großen Schiffen, die er als Kapitän befehligte, hatte er jeden Winkel der Welt bereist. Klein-Lea hatte ihn dabei mit großen Augen angesehen und beschlossen, sie wolle später auch zur See fahren. Manchmal aber konnte der Onkel nicht zum Fest kommen, weil er irgendwo auf dem Pazifik herumschipperte. Dann stellte Lea eine Kerze für ihn ins Fenster, damit er den Weg nach Hause fand. Selbst, als der Onkel irgendwo auf See geblieben war, wurde die Kerze zum Fest angezündet, denn auch als Engel sollte er sie finden.
Später studierte Lea und heiratete den schüchternen Ben, dessen erster Besuch bei seinen künftigen Schwiegereltern in die Weihnachtszeit gefallen war. Ben, der Mathematiker, der etwas linkisch neben seinem künftigen Schwiegervater auf dem Sofa saß und stotternd um Leas Hand angehalten hatte. Altmodisch, aber total romantisch, fand Lea, während sie und Maria an der Wohnzimmertür horchten. So glücklich war ihre Lea damals gewesen.
Dann kamen die Kinder zur Welt, und selbstverständlich wurde jedes Weihnachten mit der ganzen Familie zusammen gefeiert. Leas Tod aber veränderte alles.
Ein dunkler Schatten hatte sich seitdem auf alles gelegt, wie Staub auf die Seele. Doch nicht nur auf Marias Leben, sondern auch auf Bens und das der Kinder. Zu allem Überfluss aber schien es Maria, als wolle ihr Schwiegersohn plötzlich mit all den Dingen, die ihn früher glücklich gemacht hatten, nichts mehr zu tun haben. Er flüchtete sich in ein anderes Leben im weit entfernten Süddeutschland. Armer Ben.
Er hatte ihr gesagt, dass er alles tun würde, um den Kindern wieder eine Familie zu bescheren. Und dann kam Yvette.
Maria war Bens neuer Lebensgefährtin nur zweimal begegnet. Beim letzten Mal hatten sie sich gestritten. Seitdem kam Ben nur noch allein nach Hamburg.
Vielleicht hätte ich mich mehr zusammenreißen müssen, überlegte Maria. Immerhin war es doch seine Zukunft, in die sie sich eingemischt hatte. Ein unverzeihlicher Fehler, der nun dafür sorgte, dass sie von dieser Welt gehen musste, ohne ihre Familie noch einmal sehen zu können.
Ihr Blick glitt zum schnarchenden Engel hinüber, der das lächerliche Glitzerhandy fest in der Hand hielt.
Maria überlegte, während die Uhr über der Tür unbeeindruckt die Sekunden forttickte. Ein verwegener Gedanke huschte durch ihren Kopf. Und dieser Gedanke gefiel ihr, je länger sie darüber nachdachte.
Vielleicht hatte sie ja noch Zeit. Vielleicht blieben ihr noch ein paar Stunden. Mehr bräuchte sie gar nicht, um zu erledigen, was zu erledigen war. Sie starrte das Kreuz an der Wand an. Und der Chef würde doch bestimmt nichts dagegen haben, überlegte sie.
Ja, sie wollte es wenigstens versuchen! Was hatte sie schon zu verlieren?
Vorsichtig fummelte sie das Ding an ihrem Finger ab. Dann drehte sie sich langsam zur Seite, um die beiden Apparate neben ihrem Bett genau zu betrachten. On / off. Kein Problem. Sie schaltete erst den Piep-Automaten am Bett und dann den Kasten am Ständer aus. Sie wartete, ob irgendwo ein Alarm ausgelöst würde. Als nichts passierte, riss sie sich die Klebepflaster von der Brust. Sie horchte auf verdächtige Geräusche vom Flur. Dann schlug sie die Decke auf, ließ die Beine über den Rand des Bettes baumeln und holte tief Luft.
Verwegen, eindeutig verwegen, dachte sie. Und sie spürte, wie die Vorfreude ihre Lebensgeister wachrüttelte.
Auf nackten Füßen schlich sie zum Schrank. Ohne den Blick vom schnarchenden Engel zu lassen, öffnete sie leise die Tür, griff nach ihren Kleidern. Im Badezimmer zog sie sich eilig an. Vor dem Spiegel setzte sie noch ihren Hut auf. Kritisch betrachtete sie ihr blasses Gesicht. Sie war noch nicht wieder auf dem Damm. So viel stand fest.
Im Zug aber würde sie sich ausruhen. Acht Stunden bis München waren lang genug, um sich zu erholen. Ja, sie würde sich sogar die Fahrt in der ersten Klasse gönnen. Auch dieser Gedanke gefiel ihr.
So leise wie möglich schlüpfte sie aus dem Badezimmer, hielt inne, schlich noch einmal zurück zum Nachtschrank, wo sie das Foto und ihr Portemonnaie an sich nahm und in der Tasche verstaute, tapste dann auf Zehenspitzen zur Tür hinüber, die in den Flur führte. Sollte sie dem Engel noch eine Nachricht schreiben, damit er sich keine Sorgen um sie machte? Nein, entschied sie, dieser Georg machte nicht den Eindruck, als würde er sich um irgendjemanden Sorgen machen, außer sich selbst.
Kurz darauf stand Maria Lindhorst vor dem Krankenhaus im Nieselregen und winkte sich ein Taxi heran.
»Zum Hauptbahnhof, bitte.«
Die ganze Welt schien sich zwei Tage vor Weihnachten am Hauptbahnhof zu treffen. Jedenfalls war es ein derartiges Gedrängel und Geschubse, dass Maria ganz schwummerig wurde. Die Luft, erfüllt von schnarrenden Ansagen, die aus Lautsprechern über ihrem Kopf herausfielen, jedoch völlig unverständlich waren. Ringsherum Stimmen und Sprachen aller Art, Leute, die sich ein Hallo zuriefen oder ein Tschüss. Einfahrende und ausfahrende Züge, garstig quietschende Räder irgendwelcher Rollkoffer und hastig in ihren Rücken geworfene Entschuldigungen, wenn jemand sich allzu grob an ihr vorbeidrängte, um sie zu überholen.
Natürlich war die Schlange im DB-Laden so lang, dass es sinnlos war, sich anzustellen. Maria ging zu einem dieser toten Fahrkartenautomaten. Ratlos schaute sie das Ding an.
»Brauchen Sie Hilfe?«
Ein junges Mädchen von kaum mehr als fünfzehn Jahren stand plötzlich neben ihr. Sie trug eine gesteppte Winterjacke mit Fellkragen und wirkte auf Maria wie eines dieser wohlerzogenen Mädchen, die man früher mit Fräulein ansprach. Maria lächelte dankbar.
»Oh ja, bitte! Könnten Sie mir erklären, wie ich aus der Maschine eine Fahrkarte für die erste Klasse nach München bekomme?«
»Klar doch. Zahlen Sie mit Karte oder cash?« Das Mädchen, auf dessen langem blonden Haar eine weihnachtsrote Strickmütze mit Schneeflocken saß, machte sich an dem Gerät zu schaffen. Flink gingen ihre Finger über die Glasscheibe mit den Buchstaben darauf.
Angetan beobachtete Maria sie dabei. Die Jugend war nicht annähernd so schlimm, wie die Alten immer dachten. Und dieses Mädchen vor ihr war ein ganz besonders nettes Exemplar der übernächsten Generation.
»Welchen Zug möchten Sie nehmen?«
»Den nächsten, der abfährt.« Ein Tipp auf dieses Feld, ein Tipp auf das Feld.
»Hin und Rück?«
Maria zögerte einen Moment. »Ich denke, nur hin. Mehr ist nicht nötig«, sagte sie leise.
»Möchten Sie lieber am Gang oder am Fenster sitzen? Abteil oder Großraum?«
»Abteil. Und Fenster, wenn Sie haben.«
»Einhundertfünfundachtzig Euro neunzig. Sitzplatzreservierung inklusive.«
Maria kramte zwei Einhunderteuroscheine aus ihrem Portemonnaie. Kreditkarten mochte sie nicht, weil sie sich die Geheimnummer von den Dingern einfach nicht merken konnte. Und so fanden sich neben den beiden Hundertern für Frieda und Max noch einige andere Scheine sowie etwas Kleingeld in der Börse. Sie wollte dem Mädchen gerade die grünen Hunderter reichen, als ihr klar wurde, wo sie sich befand. Man hatte ja schon so viele schlimme Geschichten gehört.
»Das haben Sie ganz wunderbar gemacht«, sagte Maria und schob das Mädchen sacht zur Seite, um selbst die Geldscheine in den dafür vorgesehenen Schlitz zu schieben. »Ohne Sie wäre ich aufgeschmissen gewesen.« Der Apparat fraß den ersten Schein. Dann den zweiten. »Mein Name ist übrigens Maria Lindhorst. Ich bin auf dem Weg zu meinen Enkeln. Und wie heißen Sie?« Es ratterte in dem Automaten. Dann plumpste die Fahrkarte in das beleuchtete Ausgabefach sowie das Wechselgeld.
Das Mädchen zögerte einen kurzen Moment. »Saskia?«, sagte sie, schien sich selbst aber nicht sicher zu sein.
Maria wusste, dass die Kleine log. Doch das war in Ordnung. Man musste ja nicht jeder herumstehenden Oma erzählen, wie man wirklich hieß. Sorgsam steckte Maria die Fahrkarte in ihr Portemonnaie und holte einen Fünfeuroschein heraus, den sie dem Mädchen als Trinkgeld reichte.
Die aber schüttelte den Kopf. »Geht aufs Haus.«
»Sicher? Aber ihr jungen Leute könnt doch Geld im-mer gut gebrauchen.« Sie hielt ihr den Schein noch einmal hin.
»Ich habe es gern getan.«
»Sie sind wirklich sehr nett.« Zufrieden schob Maria Portemonnaie und Fahrkarte in ihre Reisetasche. »Ich finde übrigens, dass Jule besser zu Ihnen passt.«
Erschrocken sah das Mädchen sie an. »Woher wissen Sie …«
Maria nickte zum Handgelenk der Kleinen. Auf einem silbernen Armband stand der Name Jule. »Wenn das nicht der Name deines Hundes ist oder der deiner Freundin, dann schätze ich, könntest du so heißen.«
Eilig legte das Mädchen ihre Hand auf das Band. »Ist aber nicht mein richtiger Name.« Dann drehte sie sich um und lief davon.
»Entschuldige!«, rief Maria ihr nach. »Ich wollte nicht unhöflich sein.« Doch das Mädchen war schon in der Menge verschwunden.
Kopfschüttelnd tippelte Maria mit der Reisetasche in der Hand weiter.
Von hier oben, auf der Empore, sah die imposante Halle mit ihren weit geschwungenen Eisenträgern sehr elegant aus.
Die Gleise und die langen Bahnsteige mit den wartenden Zügen und den kleinen Leuten hingegen wirkten wie Spielzeug. Ein Blick auf ihre Armbanduhr sagte Maria, dass sie noch eine halbe Stunde Zeit hatte, bevor ihre Reise beginnen würde. Kurz dachte sie an den eigenartigen Engel in ihrem Krankenzimmer. Ob der schon bemerkt hatte, dass sie weggelaufen war? Vielleicht war er ihr sogar gefolgt!
Sie fuhr herum. Ihr Blick hastete über die Köpfe der Leute am Bahnsteig und hier oben auf der Empore. Erleichtert stellte sie fest, dass sie nirgends einen Mann im weißen Nachthemd in der Menge entdecken konnte. Vielleicht gelang ihr dieser kleine Coup ja.
Marias Zug fuhr von Gleis 8 los. Langsam stieg sie die Treppe zum Bahnsteig hinunter, denn die Rolltreppe lief mal wieder in die falsche Richtung. Leider fragte keiner, ob sie Hilfe bräuchte. So viele nette Jules gab es dann wohl doch nicht, dachte Maria und nahm vorsichtig Stufe für Stufe, wobei es mächtig in ihren Knien knackste.
Unten auf Gleis 8 angekommen, suchte sie einen freien Platz auf einer der Bänke am Bahnsteig. Sie ging am leeren Bahnwärterhäuschen vorbei, passierte einen Kiosk und vier besetzte Bänke, von denen leider niemand aufstand, um seinen Platz für eine alte Frau mit Arthrose in den Knien freizumachen.
Erschöpft stellte sie, ganz am Ende des Bahnsteigs zwischen Teil C und D, ihre Reisetasche ab, um den Mantel zu öffnen, denn ihr war warm geworden.
Da bemerkte sie im Augenwinkel einen Schatten hinter einem Pfeiler herbeispringen, die Tasche ergreifen und wie der Wind davonstürmen.
»Halt!«, rief Maria dem Dieb hinterher. »Die gehört mir!«
Sie sah noch die rote Strickmütze den Bahnsteig entlang stürmen und im Gewimmel der Menschen verschwinden.
❄
Unterdessen wachte Georg auf seinem Stuhl am Fenster auf. Er reckte und streckte sich, schaute kurz zu dem leeren Bett, wollte schon erzählen, welch wunderbaren Traum er gehabt hatte, als er mit einem Satz auf den Beinen war.
»Mist!«, rief er aus und fluchte, wie es Engel niemals tun sollten. »Wo sind Sie?« Er rannte ins Badezimmer. »Nur damit Sie es wissen: Verstecken gildet nicht!«, rief er und sah hinter der Tür nach. »Ich finde Sie eh, dass das klar ist.«
Auch im Schrank war die alte Frau nicht und unter dem Bett ebenfalls Fehlanzeige. Unschlüssig stand Georg im leeren Krankenzimmer. Hatte etwa ein anderer Engel seinen Job gemacht, während er schlief? Himmel! Das durfte nicht sein. Dieses eine Mal hätte es ohne Probleme gehen sollen. Nur dieses eine Mal! Diese nervige Alte stand zwischen ihm und der Registratur!
»Wo sind Sie?«, brüllte er. Als niemand antwortete, rannte er auf den Flur hinaus, schaute nach links und rechts. Nichts.
Sollte die Frau sich etwa abgesetzt haben?
Noch nie hatte er von einem Fall gehört, wo eine Abholung mit einer Flucht endete. Ein intensives Gefühl von Panik überfiel ihn. Da glaubte er, ein fernes Lachen zu hören. Er blickte gen Himmel. »Das ist nicht witzig!«