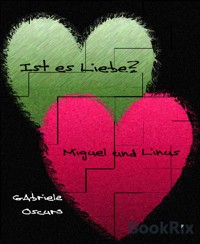3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In kalter Winternacht … ein zartes Licht erwacht … und Liebe füllt mein Herz … In fünf Geschichten lieben sich Bennet und Thomas, Felix und Johannes, Kai und Sascha, Fynn und Dennis sowie Martin und Konny zwischen Weihnachtsmärkten, Tannenbäumen, Weihnachtssternen, Adventskalendern und singenden Weihnachtsmännern. Es ist nicht immer leicht, braucht Geduld und manchmal muss man erst verlieren, was man liebt, um zu einem Happy End zu kommen. Überarbeitete Ausgabe 2020
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Weihnachtszeit - Zeit der Liebe
Gay Romance
Für all die Verrückten, die Spinner und die ewigen Romantiker, die an das Wunder der Liebe glauben.BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenBennet und Thomas
„Frohe Weihnachten, Herr Glasow!“ Zum gefühlt hundertsten Mal steckte jemand den Kopf in sein Büro und rief fröhlich, in Erwartung der kommenden Feiertage, diese Worte. Genervt hob Bennet den Kopf, doch die Tür war schon wieder geschlossen. Einen Moment lauschte er den Geräuschen, den Stimmen, den trappelnden Füßen und schlagenden Türen. Eine Aufregung wie in einer Grundschule, dachte er, schüttelte den Kopf und wandte sich wieder den Zahlen auf seinem Bildschirm zu.
„Zeit, Schluss zu machen.“
Bennet sah auf und Rudolf Seifert stand im Türrahmen. „Nur noch …“, setzte er an, der weißhaarige Chef des Steuerbüros schüttelte jedoch den Kopf.
„Das ist sicher nichts, das nicht bis nach Weihnachten warten kann“, unterbrach er ihn. „Thomas wird Sie bestimmt erwarten.“
Bennet sah auf die Uhr. 15:10 Uhr. Verdammt! Er sprang auf und während er seine Aktentasche packte, spürte er Rudolf Seiferts Blick auf sich.
„Ich schätze Sie sehr, Bennet, und würde auf keinen Fall auf Ihre Arbeit verzichten wollen, Sie sollten jedoch von Zeit zu Zeit weniger an die Firma und mehr an Ihr Privatleben denken.“ Ihre Blicke begegneten sich. Lag dort Mitleid in den rauchblauen Augen?
Bevor er antworten konnte, schob ihn der andere aus dem Zimmer. „Frohe Weihnachten, Bennet. Und vergessen Sie für ein paar Tage einmal die Arbeit.“
Die Arbeit vergessen, wie sollte das gehen? Bennet saß in der überfüllten Straßenbahn und fuhr nach Hause. Unweigerlich gingen seine Gedanken zu seinem Vater. Wenn man etwas gut machen will, dann musste man es mit dem Herzen machen, hatte dieser immer gesagt. – Und Manfred Glasow war erfolgreich in seinem Beruf und konnte seiner Familie alles bieten. Gerade ihm musste er beweisen, dass er ebenfalls erfolgreich sein konnte, dass er kein Versager war, nur weil er …
Sein Handy klingelte. Thomas. Mist. „Ich bin gleich da“, sagte er, bevor der Andere etwas sagen konnte, in der Hoffnung, dem erwarteten Ärger zuvorzukommen.
„Du kannst dir Zeit lassen. Der Schlüssel liegt im Briefkasten. Ich denke, ich habe alles mitgenommen, was mir gehört. Wenn du irgendetwas vermisst, dann kannst du mich über Markus erreichen. Das Handy schicke ich dir gleich zu.“
Er wollte etwas sagen, sein Mund war jedoch nicht in der Lage, das Chaos in seinem Kopf zu sortieren.
„Ich wünsche dir, dass du irgendwann begreifst, dass Arbeit nicht alles ist, dass das Leben aus mehr als beruflichem Erfolg und Geld besteht. Dass du verstehst, das Menschen mehr brauchen, als Geschenke und dass du jemanden findest, der dein Herz berührt. – Leider bin das nicht ich. Lebe wohl, Bennet.“ Die Stille im Apparat verriet ihm, dass Thomas aufgelegt hatte.
Es dauerte ein paar Sekunden – oder waren es Minuten – ehe das Gesagte von seinem Kopf in vollem Umfang verarbeitet worden war. Thomas hatte ihn tatsächlich verlassen. Seit Wochen drohte er damit, beschwerte sich über seine Überstunden, seine vielen Termine, seine – wie Thomas sie nannte – Besessenheit. – Aber, dass er wirklich gehen würde …
Die Bahn hielt an seiner Station, er sprang auf und stürmte hinaus. Heute Morgen war doch alles noch in Ordnung, oder? Mit schnellen Schritten ging er die Straße entlang, beachtete nicht die buntgeschmückten Fenster um ihn herum. Vor der Hausnummer 7 blieb er stehen und starrte auf das Klingelschild. Glasow/Meier stand dort, allerdings war jetzt Thomas‘ Namen durchgestrichen. Wütend kramte er in seinen Taschen nach dem Schlüssel. Verdrängte die Erinnerungen an ihre vielen Gespräche, die von Thomas mit dieser Drohung beendet wurden. Nie hätte er geglaubt, dass er ihn ausgerechnet zu Weihnachten verlassen würde. Thomas war ein Weihnachtsfanatiker. Ihre – Seine Wohnung sah aus, wie das reinste Weihnachtsparadies. Weihnachtsmänner, Schneemänner, Kugeln, Kerzen, Tannenzweige und Lichterketten. Abgerundet mit der ständig laufenden Weihnachtsmusik. Thomas, der als Kindergärtner arbeitete, hatte dekoriert, gebacken und versucht, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Mit schlechtem Gewissen musste Bennet zugeben, dass diese Versuche oft genug von seinen ätzenden Sprüchen, seiner schlechten Laune oder seinem Arbeitspensum unterbunden wurden.
Verdammt, wo befand sich sein dämlicher Schlüssel bloß? Erneut durchsuchte er alle Taschen seines Mantels. Dann erinnerte er sich: Der Schlüssel befand sich in seinem Parka, der oben an der Garderobe hing.
Vor lauter Verzweiflung klingelte er bei sich und bei Familie Gerber, die gestern schon nach Köln gefahren waren, Verwandte besuchen. Natürlich öffnete niemand. Dabei musste er nur an seinen Briefkasten kommen!
Wie konnte Thomas ihn zu Weihnachten verlassen? Zwei Jahren zuvor waren sie sich auf einer Weihnachtsfeier bei seiner Schwester Judith zum ersten Mal begegnet.
Judith! Sie besaß auch einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Er nahm das Handy heraus und rief sie an. Nach dem gefühlten hundertsten Tuten teilte ihm eine seelenlose Stimme mit, dass der Teilnehmer zurzeit nicht zu sprechen sei. Verdammt! Warum besaß sie überhaupt ein verdammtes Handy, wenn sie nie darüber zu erreichen war?
Missmutig machte er sich auf den Weg zum Taxistand. Tommy. Er dachte an seine großen, in den letzten Wochen – Monaten – beständig vorwurfsvoll blickenden, dunkelbraunen Augen. Weil er zu spät nach Hause kam, Termine absagte, nach einem langen Arbeitstag zu müde war, um mit zu Tommys Freunden zu gehen, nicht eingekauft oder Geschenke besorgt hatte, wenn sie eingeladen waren … wenn Tommy eingeladen war und ihn mitnahm. Es waren ausnahmslos Tommys Freunde, zu seinen Einladungen, von Kollegen oder Kunden, kam Tommy meistens nicht mit, da er sich bei den oft geführten Fachgesprächen überflüssig fühlte. Bennet musste zugeben, dass diese fast immer geschäftlich waren, oft steif und unpersönlich.
Am Taxistand befand sich kein einziges Fahrzeug. Bennet ging weiter, die Straßenbahnhaltestelle war nicht weit entfernt. Zwar hatte er wenig Lust sich erneut in die vorweihnachtlich volle Bahn zu drängen, aber die Alternative wäre zu Fuß zu gehen und die schied angesichts seines Schuhwerks aus. Während er auf die nächste Verbindung wartete, wanderten seine Gedanken zu Tommy.
Seit er vor über einem Jahr bei ihm eingezogen war, erwartete Tommy ihn fast immer abends, wenn er nach Hause kam. Häufig trat er aus der Küche, in der er das Essen für sie vorbereitet hatte, in den Flur, die schulterlangen Haare verwuschelt und mit einem Lächeln auf den Lippen, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Oft war aus diesem Kuss mehr geworden.
Die ersten Monate zumindest, dann kam er immer später nach Hause und Tommy erwartete ihn nicht mehr. Manches Mal so spät, dass Tommy schon ins Bett gegangen war, da er am nächsten Morgen früh aufstehen musste. Irgendwann begannen sie, darüber zu streiten. – Nein, er hatte sich nicht gestritten. Tommy versuchte, mit ihm zu reden, und er blockt ab. Im Verlauf der Diskussion schrie Tommy ihn an, wütend, enttäuscht und frustriert, ob seiner Gleichgültigkeit.
Vor ungefähr zwei Monaten fing Tommy an, ihm mit Auszug zu drohen. Eine Aussage, die er zu diesem Zeitpunkt nicht ernst nahm und auf Tommys Wut schob. Zum einen harmonierten sie ihm Bett perfekt, zum anderen bot er Tommy ein sehr gutes Leben, die große Wohnung, zweimal im Jahr eine Urlaubsreise, Essen gehen so oft sie wollten.
Dafür jedoch musste das Geld verdient werden und er etwas leisten. Tommy sah das anders, er wäre mit weniger zufrieden, wenn er dafür mehr von ihm hätte und sie mehr Zeit miteinander verbringen würden.
Erfolg bedeutete nun mal, sich mit Leib und Seele zu engagieren. Wenn man etwas gut machen wollte, dann musste man es mit dem Herzen machen. Und er wollte seinem Vater beweisen, dass er gut, erfolgreich sein konnte, dass er kein Loser war, weil er schwul war. Tommy verstand das nicht, er meinte, Bennet müsse seinem Vater nichts beweisen. Egal, was er tun würde, sein Vater würde ihn trotzdem nicht akzeptieren.
Die Bahn kam, voll mit Menschen und widerwillig quetschte Bennet sich hinein. Eingehüllt in den Duft eines schweren Parfums und den Ausdünstungen eines ungewaschenen Körpers, konnte er nur an Tommy denken. Ausgerechnet zu Markus war er gegangen. Markus, Tommys bester Freund, konnte ihn, Bennet, sowieso nicht leiden und räumte ihrer Beziehung von Anfang an nie viele Chancen ein. Und er selbst verdächtigte Markus immer, dass er eigentlich mehr von Tommy wollte, als nur Freundschaft. Gleich einer besorgten Glucke kümmerte er sich dauernd um Tommy. Jetzt hatte er freie Bahn, in Tommys geliebten Weihnachtstagen, konnte er ihn trösten und ins Bett locken.
Die Vorstellung schoss heiß durch seinen Kopf. Tommy in den Armen eines anderen. Sich selbst fand Tommy nie gut aussehend, zu klein, zu dick, zu durchschnittlich, zu unattraktiv. Dabei war er genau richtig. Die richtige Größe um sich in Bennets Arm zu schmiegen, nicht so dünn, dass er Angst haben musste, ihn zu zerbrechen, aber auch nicht dick oder gar fett. Seine herrlichen Locken, die ihm immer wieder ins Gesicht fielen, seine nutellabraunen Augen, die so viel mehr sagen konnten, als Worte. All das hatte er verloren. Sehnsucht und Schmerz krochen durch seinen Körper, seinen Geist. – Und Eifersucht, wenn er daran dachte, dass Markus tröstend seinen Arm um ihn legte.
In der Innenstadt wechselte die Bahnfüllung, Menschen ohne Pakete und Tüten stiegen aus, Menschen mit Paketen und Tüten stiegen ein. Die nächsten fünf Stationen, bis er endlich aussteigen durfte, unterhielten zwei kleine, aufgeregt quietschende Kinder und ihre genervten Eltern die Bahn lautstark.
Bennet sah sich um. Warum wollte Judith unbedingt hier leben? Die Häuserwände waren mit Graffiti besprüht, Müll lag herum, alles war dreckig und grau. Mit schnellen Schritten ging er durch enge Straßen, vorbei an einer Gruppe Kids, die ihn misstrauisch beäugten. Musik drang durch offene Fenster hinaus, ein Hund bellte und ein Kind heulte. Durch die Torzufahrt, in welcher immer ein dumpfer Uringestank hing, über den Hinterhof und in die vierte Etage, natürlich ohne Fahrstuhl. Ein Weihnachtskranz mit Rentier hing an der Holztür. Bennet drückte auf die Klingel. Nichts. Lauschend legte er sein Ohr an die Tür und konnte keinen Laut hören. Verdammt! Wieder versuchte er, Judith anzurufen. Diesmal meldete sie sich. Laute Geräusche im Hintergrund.
„Judith? Ich stehe hier vor deiner Tür, ich brauche meinen Ersatzschlüssel“, sagte er.
„Bennet? Was ist los? Ich kann jetzt hier nicht weg“, hörte er undeutlich.
„Wo bist du?“
„Im Regenbogenhaus“, antwortete sie.
Das hätte er sich denken können. Judith arbeitete als Sozialarbeiterin im Regenbogenhaus, einem Jugendtreff.
„Ich komme zu dir.“
Vier Treppen wieder runter, an dem Typ eine Etage tiefer mit seiner Bulldogge vorbei und wieder hinaus. Weiter in dieses Viertel, in dem Bennet mit seinem braunen Kaschmirmantel und seiner ledernen Aktentasche auffiel wie ein bunter Hund. Noch mehr dreckige Straßen, ein Mann schwankte ihm entgegen, fiel fast in seinen Arm und blies ihm seine Alkoholfahne ins Gesicht, um ihm dann fast auf die Schuhe zu kotzten. In dieser Gegend war Weihnachtsdekoration die Ausnahme, hier und da ein greller Stern, manchmal in allen Farben blinkend, oder ein Rentier. In einem Fenster hing etwas, das wohl ein Engel sein sollte, aber mehr Ähnlichkeit mit einer pummeligen Biene besaß und in einem anderen Fenster eine Kerze mit zwei Weihnachtskugeln, die im Querformat unter Garantie an einen erigierten Penis mit Hoden erinnern würden.
Endlich erreichte er das Regenbogenhaus. Vor ein paar Jahren war das Gebäude in einer gesponserten Aktion bunt angemalt worden, inzwischen konnte man den namensgebenden Regenbogen unter all dem Graffiti nicht mehr erkennen. In der Eingangshalle hing ein riesiger roter Weihnachtsstern. Jugendliche standen herum, betrachteten Bennet abschätzend, als dieser eintrat. Der Lärm war ohrenbetäubend und er ging suchend durch die Räume, bevor er in der Küche auf Judith traf. Die blonden Haare mit einem Gummi gebändigt, stand sie einem jungen Mann gegenüber und schien sich mit ihm zu streiten.
„Nein, Philip, so geht das nicht. Du kennst die Spielregeln, wenn du hierbleiben willst, dann halte dich daran.“
„Aber diese Penner …“
„Nein, keiner ist hier ein Penner. Morgen ist Heiligabend und jeder der möchte, hat das Recht herzukommen.“ Ihr Ton duldete keinen Widerspruch und der Junge wandte sich mit verkniffenem Gesicht ab. Judith drehte sich zu Bennet um und strahlte ihn an. „Schön dich zu sehen, Bruderherz.“ Sie schloss ihn in die Arme und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Ein Duft von Zimt und Vanille ging von ihr aus und erst jetzt sah er den hellen Mehlfleck auf ihrer Wange.
„Ich brauche deinen Schlüssel“, sagte er, nachdem sie ihn wieder losgelassen hatte.
„Du brauchst deinen Schlüssel, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist mit Tommy?“ Bennet konnte nicht verhindern, dass er zusammenzuckte.
„Oh, nein. Du hast es vermasselt. – Was hast du getan, Bennet? Der Junge liebt dich. Wie hast du geschafft, dass er aufgibt? Hast du wieder die Arbeit über alles gestellt? Immer erst der Job und dann dein Partner?“ Judith stemmte ihre Hände in die Hüften. „Du bist ein Idiot, Bennet!“
„Hör auf. Was erwartest du von mir? Dass ich meinen Job aufgebe? Warum kann er nicht verstehen, was die Arbeit mir bedeutet.“ Bennet wich dem blauen, vorwurfsvollen Blick seiner Schwester aus. „Wir haben dadurch alles. Wir können zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen, die Wohnung …“
„Wann wart ihr denn das letzte Mal im Urlaub? Wann hast du das letzte Mal ganz spontan etwas für Tommy getan?“ Immer noch starrte Judith ihn an.
„Ich habe …“, begann er und überlegte. „Ich habe ihm im letzten Monat das Handy gekauft, das er sich gewünscht hat und wir waren essen.“
„Du kaufst und bezahlst. Das will Tommy aber nicht, er will dich. – Auch wenn ich nicht weiß, wieso.“ Ein Kurzzeitwecker schrillte und Judith öffnete die Backofentür. Der Geruch von Keksen erfüllte die Küche.
„Da du nichts Besseres zu tun hast, hilfst du mir und Emiola beim Kekse backen.“ Judith nahm das Blech aus dem Ofen. Erst jetzt sah Bennet das kleine, dunkelhäutige Mädchen, das in der Ecke stand.
„Judith, ich bin dazu bestimmt nicht …“
„Du kommst ohne mich nicht in deine Wohnung, also hilf mir, dann sind wir schneller fertig.“ Mit einem Lächeln wandte sich Judith der Arbeitsfläche zu, auf der Teig ausgerollt war.
Zehn Minuten später stand Bennet mit aufgekrempelten Ärmeln und einem Geschirrtuch als Schürze vor dem Bauch neben der dreizehnjährigen Emiola und stach Kekse aus.
Emiola stammte aus Nigeria. Vor sechs Monaten kam sie mit ihrer Mutter, zwei Schwestern und ihrem kleinen Bruder in Deutschland an. Ihr Vater war kurz zuvor bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen. Das erzählte sie Bennet nebenbei beim Kekse backen. Nachdem sie das nächste Blech in den Ofen geschoben hatten, stieß Nesrin zu ihnen. Nesrin war ebenfalls dreizehn Jahre alt und kam aus Syrien. Zusammen verpackten sie die ersten, ausgekühlten Kekse in kleinen Plastikbeuteln.
„Judith, haben wir morgen einen Weihnachtsbaum?“ Ein kleiner, blonder Junge stand in der Tür zur Küche. Hinter ihm drängten sich mehrere Kinder.
„Ich weiß es nicht“, antwortete Judith. „Herr Röttger, der uns einen spenden wollte, ist noch nicht gekommen.“ Sie zuckte bedauernd mit den Schultern. „Wir werden aber auch ohne Baum feiern. – Denkt dran, ihr könnt eure Familien mitbringen. Wir haben genug Essen und Trinken für alle.“
„Du bist Heiligabend hier?“, fragte Bennet sie.
„Ja, wir haben nicht genügend helfende Hände.“ Mit einer mehlbestäubten Hand strich sie eine widerspenstige Locke aus ihrem Gesicht. „Morgen kommen viele Leute aus dem Viertel her. Weil sie fremd hier sind, keine Familie oder Freunde haben, weil ihre Familien nicht als solche existieren oder weil sie nicht genug zu essen haben und froh sind, sich hier satt essen zu können.“
„Die Kinder sind nicht alle christlichen Glaubens?“, erkundigte sich Bennet mit einem Seitenblick auf die beiden Mädchen, die kichernd weitere Kekse ausstachen.
„Nicht alle, aber das spielt keine Rolle. Bei uns ist der Gedanke, der hinter Weihnachten steht, wichtiger als die Konfession.“ Sie lächelte ihm zu. „Ich glaube, die nächste Ladung Kekse ist fertig.“
In den folgenden zwei Stunden lernte er verschiedene Kinder kennen. Den fünfzehnjährigen Fjodor aus der Ukraine und seine Freund Wladimir. Florian und Kevin, die in dieser Gegend aufgewachsen waren. Chantal, Janine und Annika, die ebenfalls in diesem Viertel geboren waren.
Alle halfen bei den Vorbereitungen für den nächsten Tag. Der schmächtige Julian, dessen Schwester Merle Bennet die ganze Zeit auf Schritt und Tritt folgte, genauso wie der grobschlächtige Alexander, dem er lieber nicht im Dunkeln begegnen wollte.
Ihnen allen war gemeinsam, dass sie seine Schwester liebten und sich auf den nächsten Tag freuten. – Obwohl keiner von ihnen großartige Geschenke erwartete, kaum einer auch nur einen Tannenbaum. Diese Gegend war in diesem Punkt eher nüchtern. Hier im Regenbogenhaus versuchten ein paar Leute, neben Judith noch zwei andere Sozialarbeiter und vier Ehrenamtliche, ihnen einen besonderen Tag zu gestalten.
Judith und ihre Arbeit beeindruckten Bennet, das sagte er ihr auch auf ihrem Weg nach Hause.
„Komm doch einfach morgen vorbei“, sagte sie beim Abschied. „Dann bist du mit deinen trüben Gedanken nicht allein.“
Zuhause angekommen wurde ihm bewusst, dass Tommy wirklich fort war. Offene Schränke, leere Regalbretter … in der ganzen Wohnung fehlte seine Anwesenheit, die Wärme, die er verströmt hatte. In dem leeren großen Bett konnte er nicht schlafen, daher nahm er die Zudecke und legte sich auf das Sofa, begann über Judiths Worte nachzudenken. Was würde er verpassen? Einsam zu Hause hocken, den verdammten Weihnachtsbaum anstarren und sich nach Tommy sehnen. Denn schon Minuten nachdem er die Wohnung betreten hatte, wusste er, dass die Wohnung ohne Tommy kalt und trostlos war. Nur noch Wohnraum, kein Zuhause mehr.
Gegen Mittag rief er daher Judith an. „Super. Du weißt nicht zufällig, wo wir einen Weihnachtsbaum herbekommen? Von Herrn Röttger und seinem Baum gibt es keine Nachricht.“
Bennet dachte nicht lange darüber nach, sondern packte seinen von Tommy liebevoll geschmückten Baum in den Wagen und brachte ihn in das Regenbogenhaus.
Wieder herrschte ein unglaublicher Lärmpegel. Zusammen mit Fjodor und Julian trug er den Weihnachtsbaum in die Halle und richtete ihn wieder etwas her. Auch wenn er dafür weder einen Blick noch ein Händchen hatte.
Um 17:00 Uhr war das Haus voll. Robert, ein fünfzigjähriger ehrenamtlich Tätiger, las mit seiner tiefen Stimme eine Geschichte vor. Nicht die Weihnachtsgeschichte, aber die Moral, die dahinterstand, ähnelte dieser sehr.
Anschließend wurde das Essen ausgegeben. Mehrere Liter Suppe, Brot und Aufschnitt, Käse und Würstchen und gestiftete Salate. Dazu wurden reichlich Kaffee und Tee ausgeschenkt. Bennet gab Suppe aus, räumte Geschirr ab, spülte, da der Geschirrspüler schon seit Monaten kaputt war und wischte Tische ab. Zwischendurch hörte er sich Geschichten an.
Geschichten von Familienmitgliedern, die nicht mitfeiern konnten, weil sie weit weg in der Heimat waren, freiwillig oder unfreiwillig; Freunde, die gestorben waren, an Hunger, Terror oder Krankheiten; Vätern die im Gefängnis saßen. Von Kindern, deren Familien nie Weihnachten feierten, weil Drogen und Alkohol sowie die Jagd danach das Leben beherrschten.
Nach dem Essen, einige waren schon wieder gegangen, holte jemand eine Gitarre vor und begann Lieder zu spielen. Weihnachtslieder aus unterschiedlichen Ländern, traurige Volksweisen oder laute Protestlieder.
Bennet saß zwischen Judith und Emiola, die ihm an diesem Tag nicht von der Seite wich. Judith legte ihm den Arm um die Schulter und lächelte ihn an. „Dies ist das Herz von Weihnachten“, rief sie über den Refrain und er konnte spüren und in den Gesichtern der Menschen um sich herum sehen, was sie meinte.
Es war spät, ehe sie alles aufgeräumt hatten. Die Füße taten ihm weh und das Herz. Tommy hätte der Abend gefallen, dachte er und das Ziehen in seinem Herzen wurde größer.
„Du kannst hier schlafen, wenn du willst“, sagte Judith, als sie vor ihrer Tür angekommen waren. „Es sind genug Sachen von dir oben.“ Eine Zeit lang, vor seiner Begegnung mit Tommy, wohnte er fast bei Judith, eine Beziehung in den Knochen, die nach allen Regeln der Kunst gescheitert war und einem Ex-Partner, der ihn zeitweise stalkte.
Bennet überlegte kurz und nickte. Was sollte er alleine zu Hause?
Judith wärmte einen schweren Rotwein mit Gewürzen auf und Bennet ging unter die Dusche. Was würde Tommy gerade machen? Er war bei Markus, würde der ihn anbaggern? Wären sie zusammen im Bett? Allein bei dem Gedanken wurde ihm schlecht. Tommy, der sich im Arm eines anderen Mannes, in Markus‘ Arm, gehen ließ. Sein Gesicht, wenn er sich fallen ließ, ganz dem anderen auslieferte und nur genoss, was er bekam. Seine Gedanken wanderten weiter, zeigten ihm Bilder von Tommy in ihrem Bett, lachend nach einer Kissenschlacht. Am schönsten war Tommy, wenn er lachte. Die Grübchen, das Strahlen der Augen und …
Seine Tränen vermischten sich mit dem Wasser. Er dachte daran, wie oft sie sich in den letzten Wochen gestritten und er Tommys Wunsch nach mehr Zeit für einander, mit harschen Worten abgebügelt hatte. Verletzend war er gewesen in seiner Argumentation von Arbeit und Erfolg. Bewusst verletzend, um die Diskussion zu beenden. Hier unter Judiths Dusche schämte er sich und wünschte sich verzweifelt, nie ein Wort davon zu Tommy gesagt zu haben.
Es klopfte an der Tür. „Alles okay, Ben?“, fragte Judith. Hart schluckte er und stellte die Dusche ab.
„Ja, ich bin gleich bei dir“, antwortete er rau. Beim Abtrocknen betrachtete er sich in dem wandhohen Spiegel, der neben der Tür hing. 28 Jahre alt, 1,79 Meter groß, 74,5 Kilo schwer, blonde Haare, grün-graue Augen. Nichts schlecht, aber auch nichts aufregend. Durchschnitt. – Nicht für Tommy, ging ihm durch den Kopf, für Tommy warst du immer etwas Besonderes, etwas Einmaliges. Das konntest du in seinem Blick sehen und in seinen Zärtlichkeiten spüren.
Durch seinen Stolz, wenn sie zusammen, oft Hand in Hand, spazieren oder einkaufen gingen, alltägliches oder außergewöhnliches machten. Wieder drückten Tränen hinter seinen Augen. Er entwickelte sich offensichtlich zu einer Heulsuse, dachte er zynisch, Zynismus schien seinem Herz jedoch egal, sein Schmerz war gigantisch und aus Solidarität schmerzte der Rest seines Körpers inzwischen mit.
Die Tür ging auf und Judith sah hinein. Ohne Worte nahm sie einen Bademantel vom Haken und wickelte ihn ein, nahm ihn in den Arm und hielt ihn, während die Tränen sich selbstständig machten. Sie sagte nichts, gab ihm Trost, bis die Tränen versiegten und streichelte ihm dann eine Strähne aus dem Gesicht. „Der Glühwein ist fertig“, sagte sie nur und ging. Seufzend zog Bennet sich eine Jogginghose und ein Sweatshirt an.
Kein Wort verlor sie über Tommy und auch Bennet schnitt das Thema nicht an, verdrängte es. Sie sprachen über die Kinder, ihre Familien, ihre Schicksale. Über Judiths Arbeit, die ihr so viel bedeutete.
„Kommst du morgen wieder mit?“, fragte sie, nachdem sie den Wein geleert hatten und auf dem Weg ins Bett waren. „Wir öffnen um 10:00 Uhr.“
Bennet warf einen Blick auf die Uhr, schon 3:30 Uhr, trotzdem nickte er. Sie beugte sich vor und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. „Danke und schlaf gut, kleiner Bruder.“
Er sollte dankbar sein, denn was erwartete ihn zu Hause, außer Leere und Verzweiflung.
Schon um 10:00 Uhr waren wieder viele Kids im Regenbogenhaus. Einige nutzten die Möglichkeit, im Keller zu duschen, einige waren dankbar für das Frühstücksangebot. Andere saßen nur herum und wirkten auf Bennet gelangweilt. Warum waren sie hier?
„Sie sind cool, Brüderchen. Sie brauchen einen Ort, zu dem sie gehen können, genau wie die anderen, aber sie dürfen dies nicht zeigen“, sagte seine Schwester auf seine Frage. „Normalerweise wird eine Menge an Beschäftigung angeboten, es gibt eine Band, ein Zeichen- und Malkurs, Kochen, Backen, Selbstverteidigung, Boxen, Lesen und Schreiben. Je nachdem, was für Leute, außer uns bezahlten Mitarbeitern, bereit sind, ihre kostbare Freizeit für die Kids zu opfern.“
Er wusste, sie bezog diese Aussage nicht auf ihn und doch traf sie ihn. Noch nie hatte er private Zeit für soziale Projekte geopfert.
„Seit Jo da ist, versuchen wir, ein Nachbarschaftsprojekt auf die Beine zu stellen. Die Kinder helfen den älteren oder hilflosen Bewohnern in der Umgebung beim Einkaufen, sauber machen, Spazierengehen und Ähnlichem. Wird bisher erstaunlich gut angenommen.“
„Wer ist Jo? War er gestern auch da?“, fragte Bennet und eine leichte Röte zog sich über Judiths Gesicht.
„Nein, gestern besuchte er seine Mutter. Aber vielleicht kommt er heute“, antwortete sie, geschäftig an einem Fleck herumreibend. Bennet musste grinsen. Seine große Schwester war verliebt – oder zumindest auf dem Weg dahin.
Jo kam am Nachmittag und Bennet konnte Judith gut verstehen. Groß und gut gebaut, mit einem umwerfenden Lachen machte er auf Bennet Eindruck. Sein ganzes Wesen war offen und freundlich. Trotzdem konnte er sich unter den Jugendlichen Respekt verschaffen. Einen kleinen Streit zwischen zwei jugendlichen Hitzköpfen beendete er schnell und ruhig.
Sie kamen ins Gespräch und ehe er es sich versah, wusste der andere, dass er schwul war, Tommy ihn verlassen und er bei Judith Unterschlupf gefunden hatte.
„Du bist homosexuell?“ Nachdenklich sah Jo, der eigentlich Joachim hieß, ihn an. „Wir haben hier ein paar Kids, die haben Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Sexualität. Vielleicht könntest du ja mal ein Workshop zu dem Thema anbieten.“
„Zum Schwulsein?“, fragte Bennet ungläubig.
„Ja. Wie merke ich, was los ist? Wie gehe ich damit um? Warum bin ich, wie ich bin? Wie akzeptiere ich mich selber? Irgendwie so etwas.“ Jo lächelte ihn offen an.
„Ich hätte dich warnen müssen, Jo versucht jeden und alles einzuspannen“, sagte Judith, die zu ihnen getreten war.
„Hey, das ist nicht wahr. Aber du weißt selber, dass Sexualität immer eine Frage für die Kids ist. Die eigene, die anderer, alles was abweicht von gesellschaftlichen Normen. Oder auch nur die Unsicherheit, was ist mit mir los, warum bin ich so und ist das normal?“ Jo sah sie an und Bennet bemerkte, ihr Erröten.
„Ich denke darüber nach“, antwortete er. „Ich weiß nicht, ob ich das kann.“
„Bekennst du dich zu deinem Schwulsein?“, fragte Jo.
„Ja. – Also ich verstecke mich und meine Gefühle nicht“, erwiderte Bennet.
„Ist es für dich normal? Fühlst du dich krank, pervers oder abartig?“
„Nein! Auf keinen Fall. Ich habe mir meine Sexualität nicht ausgesucht. Seit ich das erste Mal einen Ständer bekommen habe, denke ich an Männer, nicht an Frauen! Es ist normal!“
„Siehst du, genau das müssen die Kids lernen.“ Zufrieden lächelte Jo ihn an. „Denk darüber nach.“
Wenn er noch mit Tommy zusammen wäre, würde er nicht einen Moment zögern. Tommy hätte gewusst, wie er mit den Kids darüber sprechen musste. Bei sich selber zweifelte er daran.
Tommy. Schon kreisten seine Gedanken wieder um ihn.
Das Regenbogenhaus schloss um 20:00 Uhr. Er lud Judith und Jo auf eine Pizza zum Italiener ein.
„Kinder sind unsere Zukunft. – Dieser Spruch ist wahr, wie nur irgendwas. Und nun sieh dir an, was wir mit ihnen machen. Wie wir sie behandeln. Nicht alle, jedoch viel zu viele, um dies zu ignorieren.“ Jo sah ihn an und er erinnerte Bennet an Tommy. Eine Schmerzwelle durchzuckte sein Herz.
„Du hast sie gesehen, die Kinder, die ins Regenbogenhaus kommen. Sag mir, wie vielen von ihnen möchtest du deine Zukunft anvertrauen?“ Jo wartete gar nicht erst auf eine Antwort. „Wenn du ehrlich bist keinem. Also ich möchte sie keinem anvertrauen, aber ich möchte helfen, dass aus ihnen Erwachsene werden können, denen ich meine, unsere Zukunft anvertrauen kann.“ Er trank einen Schluck aus seinem Weinglas. „Bildung, schulische und gesellschaftliche, ist ein Stück auf dem Weg dahin. Es geht nicht darum, dass sie alle unbedingt ihr Abitur machen und studieren sollen, aber sie sollen eine fundierte und gute Ausbildung erhalten, die ihnen ermöglicht, Menschen, Situationen und Entwicklungen zu beurteilen.“ Seine Hand legte sich auf Bennets. „Sie müssen zum Beispiel lernen, dass es mehr als eine Art von Sex, von Zusammenleben, von Familie gibt. Dass Homosexualität nicht ausgesucht, sondern angeboren wird. Du entscheidest nicht, auf wen dein Körper reagiert, wer dich anturnt und wer nicht. Das ist einfach so. Manche Männer stehen auf Frauen, manche auf Männer und mache auf beide Geschlechter.“ Darauf folgte eine Pause. „Und du kannst ihnen das sagen. – Sag ihnen, dass es nicht schlimm ist, schwul zu sein. Dass du keine Wahl hast, wer dich anmacht und dass man sich dafür nicht schämen muss.“
„Hör auf, Jo, du überforderst ihn.“ Judith legte ihre Hand auf Jos Arm. „Ben hat gerade zwei Tage Regenbogenhaus hinter sich.“
„Sehr witzig, Schwesterchen“, brummte Bennet. „Ich denke darüber nach. Viel besser als ich, könnte Tommy das.“
In der nächsten Stunde unterhielten sich fast nur Jo und Judith, Bennet hing seinen Gedanken hinterher. Seinen Gedanken, die sich um Tommy drehten. Irgendwann hielt er dieses Hamsterrad im Kopf nicht mehr aus, entschuldigte sich, ging hinaus und rief Markus an.
„Ja?“, brüllte eine Stimme ins Telefon. Amerikanische Weihnachtsklassiker liefen lautstark im Hintergrund.
„Markus? Ich muss Tommy sprechen“, sagte er.
„Bennet? Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist“, antwortete Markus. Lachen war zu hören. War das Tommy?
„Bitte, ich muss ihn sprechen.“ Sein Herz schlug viel zu laut und zu schnell. Was wollte er überhaupt sagen?
„Okay, warte kurz.“
Das Lachen und die Musik wurden lauter. Mehrere Stimmen. Ein Lachen, das er unter tausenden erkannt hätte, ließ den Schmerz in seiner Brust hart zuschlagen. Ohne es zu bemerken, biss er sich auf den Fingerknöchel, versuchte lauschend Worte zu erkennen, hörte jedoch nur Gebrabbel.
„Ja?“ Tommy.
„Tommy?“ Idiotisch, er wusste genau, wer dort war.
„Ben?“ Das Lachen verschwand aus der Stimme.
„Tommy, ich muss mit dir reden“, fing er hektisch an. „Du musst dich mit mir treffen, bitte. Ich war … ich bin ein Idiot und du hattest …“
„Komm schon, Süßer, keine Zeit zum Telefonieren. Du schuldest mir einen Kuss“, sagte auf einmal eine tiefe Stimme. Zu dicht, um nicht mit Tommy gesprochen zu haben.
Wenn jemand einen Eimer Wasser auf ihm ausgekippt hätte, hätte der Effekt nicht schlimmer sein können. Eine Sekunde blieb ihm die Luft weg. Die Geräusche, die sein Ohr erreichten, wollte er nicht analysieren.
„Oh, entschuldige, ich wollte dich natürlich nicht stören. Oder dir den Spaß verderben. Oder dich vom Küssen abhalten.“ Eifersucht, Wut und Schmerz strömten wie ein giftiger Cocktail durch seine Adern. „Verzeih mir. Wird nie wieder vorkommen.“ Er legte auf und stellte das Handy ab. Zorn und Trauer ließen die Tränen laufen und er ging mit schnellen Schritten die Straße herunter, brauchte Bewegung, hätte gerne gebrüllt, geschrien, gegen die Mülltonnen getreten. Bis zur nächsten Kreuzung brauchte er, ehe ihm klar wurde, dass er keine Jacke anhatte. Egal. Was spielte jetzt überhaupt noch eine Rolle? Keine achtundvierzig Stunden und Tommy tröstete sich mit einem Anderen.
Gerade wollte er umdrehen, da sah er eine Gruppe junger Männer. Ihre Bewegungen ließen ihn stehenbleiben. Sie traten etwas … jemanden. Panisch zerrte er das Telefon wieder aus der Hose, schaltete es an und rief die Polizei, während er sich der Gruppe laut rufend und schreiend näherte. Vier junge Männer, sie sahen auf, bemerkten, dass er auf sie zu lief und in das Handy brüllte. Blitzschnell drehten sie sich um und rannten weg.
„Ja, Heinrichplatz. Beeilen sie sich und bringen sie einen Krankenwagen mit.“ Neben dem jungen Mann, der fast noch ein Junge war, ging er auf die Knie. Lange Haare, schmale Figur. Blut im Gesicht, auf dem Boden, auf der Kleidung. Das Handy klingelte in seiner Hand, während er begann, mit dem Jungen (er sah verdammt jung aus) zu reden, der leise stöhnte. Ohne auf das Display zu achten, nahm er das Gespräch an, ging davon aus, wieder mit der Polizei zu reden. Vielleicht wollten sie sich vergewissern, dass er kein Spinner war.
„Sie müssen sich beeilen. Hier ist überall Blut“, flüsterte er in den Hörer, während er sich seinen Pullover über den Kopf zog und vorsichtig unter den Kopf des Jungen schob.
„Blut? Ben? Was ist passiert?“ Tommys aufgelöste Stimme.
„Nichts, was dich interessiert“, sagte er und drückte ihn weg, sofort wieder von Eifersucht überrollt. Ehe es erneut klingeln konnte, schaltete er das Handy wieder aus.
Blaulicht. Sirenen. Sanitäter tauchten in seinem Blickfeld auf, kümmerten sich um den Jungen. Jemand legte eine Decke um seine Schultern. Ohne dies zu beachten, verfolgte er die Bemühungen des Notarztes. Die Helfer legten den Jungen auf eine Trage, fixierten seinen Kopf. Die blonden Locken waren rot vom Blut. Er hatte das Gesicht am Nachmittag im Regenbogenhaus gesehen. Ein Schluchzen entkam ihm.
„Ben? Oh, Gott, Ben.“ Ein Arm legte sich um ihn, drückte ihn. Judith. Er sah sie an und ihm wurde schwindlig. Eine Hand führte ihn und er setzte sich.
„Ja, ich bin bei ihm. Es geht ihm …“ Judith zögerte. „Er ist nicht verletzt. – Ja. – Ich weiß nicht. – Mache ich.“
„Wenn das Tommy war, dann nimm zur Kenntnis, dass ich ihn niemals wiedersehen will.“ Eine Welle Übelkeit überkam ihn und er übergab sich.
Judith und Jo brachten ihn ins Krankenhaus. Er wurde von einem Arzt untersucht und bekam eine Spritze. Dort bleiben wollte er auf keinen Fall. Die Polizei stellte ihm Fragen, die er bereitwillig beantwortete. Leider konnte er nicht viel aussagen, nur dass es vier junge Männer gewesen waren. Einer davon blond und groß, die anderen etwas kleiner und dunkelhaarig. Sonst nichts. Abgespielt hatte sich das Ganze in einer Seitenstraße, keine Laternen in unmittelbarer Nähe, darum bemerkte er das Geschehen auch erst zu spät und anschließend waren sie sofort weggelaufen.
Der Zustand des Jungen war schlecht, die Ärzte wussten nicht, ob er durchkommen würde. Mehrere Tritte hatten seinen Kopf getroffen. Er hörte zufällig, wie ein Arzt dies einem Polizisten mitteilte.
„Das ist Akin“, sagte Jo leise neben ihm zu Judith. Sie saßen in dem ungemütlichen Wartesaal auf Plastikstühlen. Die Schwester holte ihm ein leichtes Beruhigungsmittel für die Nacht. Etwas, mit dem er schlafen könnte.
„Du kennst ihn?“, fragte Bennet und hob den Kopf.
„Ja, er kommt oft ins Regenbogenhaus. Sein Vater hat ihn rausgeschmissen, weil er schwul ist.“ Jo sah ihn an und Bennet hielt sich die Hand vor den Mund, rannte auf die nächste Toilette.
Als er zurückkam, saß Tommy neben Judith. Er wollte etwas sagen, aber ihm fehlte die Kraft dafür, stattdessen wandte er sich ab und ging einfach.
„Ben.“ Eine Hand legte sich auf seine Schulter.
„Lass mich, Tommy, ich habe heute keine Kraft mehr dafür. Geh und vergnüge dich.“ Mit einer müden Geste wischte er die Hand von seiner Schulter.
„Du glaubst wirklich, dass ich mich mit einem anderen vergnüge, zwei Tage nachdem ich ausgezogen bin? Nachdem ich dir gesagt habe, dass ich dich liebe?“ Tommy stellte sich in seinen Weg. „Du bist ein Idiot, Benny.“
„Ich…“ Bennet hob den Kopf, sah in die sanften Augen und spürte nur Sehnsucht nach Trost in Tommys Umarmung. Vorsichtig legte Tommy die Arme um Bennet und er erwiderte die Geste, zog ihn an sich. Alles löste sich auf, wurde zu Schmerz, zu Tränen.
„Lass uns nach Hause fahren“, raunte Tommy in sein Ohr, nachdem die Tränen erschöpft versiegten.
„Kommst du mit?“
„Ja.“ Über Bennets Kopf hörte er Tommy mit Judith sprechen, war aber zu erschöpft, um zuzuhören. Sanft wurde er in ein Auto geschoben und angeschnallt. Tommy stieg auf den Fahrersitz und stumm fuhren sie nach Hause. – Doch es war nicht mehr ihr zu Hause.
„Wirst du gleich wieder fahren?“, fragte er leise.
„Nur, wenn du mich wegschickst“, antwortete Tommy.
„Ich habe dich niemals fortgeschickt“, sagte er.
„Nein, ich weiß, aber du hast mich auch nicht gehalten.“
Die Wohnung war kalt – oder kam ihm das nur so vor?
„Du gehst jetzt in die Badewanne. Ich koche uns einen Tee.“ Energisch schob Tommy ihn in das Badezimmer, verschloss den Abfluss und ließ Wasser ein.
„Tommy?“
„Hm.“ Die dunklen Haare fielen in das Gesicht und Tommy pustete eine Locke nach oben.
„Ich will nicht, dass du wieder gehst. Ich bin ein Vollidiot. Ich …“
„Nicht jetzt, Ben“, sagte Tommy und streichelte ihm durchs Gesicht. „Wir reden später.“
„Kommst du mit in …?“
Tommy lächelte und ein warmer Funke zündete in seinem Inneren. „Ich komme dir gleich die Haare waschen.“
Tommy gab nach Schokolade duftendes ÖL in das Wasser, das ihn mit seiner Wärme einhüllte und Bennet schloss die Augen, lauschte auf die Geräusche aus der Küche. Wenn es in seiner Macht lag, würde er Tommy nie wieder gehen lassen.
Die Tür öffnete sich, träge hob er die Lider, sah Tommy an. „Komm“, bat er flüsternd und tatsächlich streifte dieser seine Sachen ab und kam zur Badewanne herüber.
„Rutsch ein Stück nach vorne“, verlangte er und Bennet gehorchte, spürte mit geschlossenen Augen, wie Tommy sich hinter ihn in die Wanne setzte. Arme legten sich um seine Brust, zogen ihn nach hinten, bis sein Kopf an Tommys Schulter lag. Schon oft lagen sie zusammen in dieser großen Badewanne.
Sanft streichelten ihn Tommys Hände, seine Arme, seine Brust und er ließ sich in dieses vertraute Gefühl fallen.
„Wer war der Kerl?“, fragte er träge.
Tommys leises Lachen spürte er im Rücken. „Irgendein Freund von Markus. Den ganzen Abend hat er dumme Sprüche gemacht und mich genervt. Ein Vollidiot mit einer gehörigen Portion Feuerzangenbowle im Blut.“ Die Hände strichen jetzt an seinen Seiten entlang. „Hast du wirklich geglaubt, ich verlasse dich und schmeiße mich dem Nächstbesten an den Hals?“
„Nein. – Ich weiß nicht, ich war überfordert und dieser Kerl im Hintergrund, du so weit weg …“
„Wird sich irgendetwas ändern, Ben?“
„Ja. – Ja!“ Bennet drehte den Kopf, sodass er Tommy ansehen konnte. „Ja, denn ich will, dass unsere Beziehung gut wird und darum werde ich mich ab jetzt von meinem Herzen leiten lassen. – Wenn du etwas gut machen willst, …“
„… musst du es mit dem Herzen machen“, ergänzte Tommy. „Und das ist nicht mehr dein Job? Dein Erfolg?“
„Was nützt mir der verdammte Erfolg, wenn ich dich nicht habe? Wenn ich keinen Menschen habe, mit dem ich ihn teilen kann? Oder will, weil der einzige Mensch, den ich so sehr liebe, dass ich ihn mit ihm teilen will, mich wegen dieses Erfolges verlässt.“ Bennet streckte die Arme nach oben, legte sie Tommy um den Hals. „Du hast Recht, Erfolg im Beruf, Geld ist nicht alles. Eigentlich ist es nichts, ohne dich.“ Sanft zog er Tommy zu sich herunter und küsste ihn.
„Ich liebe dich, Bennet“, flüsterte Tommy gegen seine Lippen. „Ich weiß nicht, wie ich ohne dich weitergelebt hätte.“ Seine Hände wanderten weiter, streichelten Bennets Oberschenkel hinab, an der Innenseite wieder hinauf, über seine Leisten, seinen Bauch, weiter über die harten Brustwarzen, an den Seiten wieder hinunter. Enervierend langsam, zärtlich, während sein Mund ihn küsste, vereinnahmte, eroberte. In seinem Rücken konnte er Tommys Erektion spüren, die sich langsam an ihm rieb.
„Schlaf mit mir, bitte“, flüsterte er leise. „Ich muss dich spüren.“
Nicht das erste Mal, dass sie Sex in der Wanne hatten und nie war dies einfach, doch er brauchte Tommy jetzt sofort und so nahe und intensiv wie möglich. Das Wasser mit dem duftenden Öl erleichterte Tommy das Eindringen. Sie ließen sich Zeit, zögerten das unvermeidliche Ende hinaus, bis es unerträglich wurde und Bennet sich hinkniete, damit Tommy ihn hart nehmen konnte. Tommys Arme zogen ihn hoch, seine Hand umfasste Bennets Erektion, pumpte ihn im Tempo seiner Stöße, bis er mit einem lang gezogenen Stöhnen kam. Tommy folgte ihm fast augenblicklich.
Völlige Ermattung erfasste Bennet, selbst das Aussteigen aus der Badewanne war ihm fast zu viel. Tommy brachte ihn in das Schlafzimmer, kuschelte ihn in das Bett. „Ich bin gleich bei dir“, flüsterte er und bevor Bennet etwas sagen konnte, verschwand er. Irgendwann schmiegte sich der Körper von hinten gegen ihn, ein Arm zog ihn an Tommys Brust und er schlief ein.
Die Jungen traten immer wieder nach dem Bündel, das auf dem Boden lag. Bennet schrie, brüllte, sie sollten aufhören, doch sie hörten nicht, lachten ihn aus und traten immer wieder auf das Bündel am Boden ein. Hektisch versuchte er, sie zu erreichen und kam ihnen kein Stück näher. Immer schneller wollte er laufen, aber seine Beine wurden immer langsamer …
„Ben! Benny! Alles ist gut. Ich bin bei dir. Alles ist vorbei“, flüsterte Tommys Stimme beruhigend. – Tommy? War er wirklich hier oder war das ein Traum? Hatte er ihn nicht verlassen?
„Benny.“
Tommys Stimme und Bennet öffnete die Augen. Das Licht der Nachttischlampe war gedimmt, im gelblichen Schein konnte er Tommy erkennen. Kein Traum.
„Du bist da!“
„Ja. Und ich gehe auch nicht weg“, versprach Tommy.
„Niemals?“
„Benny …“
„Ja, ich weiß. – Ich liebe dich.“
„Ich liebe dich auch, Bennet Glasow.“
Obwohl sie erst spät ins Bett gekommen waren, wachte Bennet an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag früh auf. Langsam drehte er sich um und sah auf Tommys Wuschelkopf. Es wurde warm in seiner Brust, ein Grinsen machte sich in seinem Gesicht breit und er fühlte sich glücklich. Wow, nie hätte er geglaubt, dass sich Glück so intensiv anfühlen könnte. Er durfte Tommy nicht verlieren, nichts war wert, dieses Gefühl zu verlieren. Vorsichtig rutschte er näher, vergrub seine Nase in den Locken, atmete den vertrauten Geruch ein. Ohne die Möglichkeit etwas dagegen tun zu können, legte er die Hand auf Tommy Seite, er musste ihn berühren, spüren, fühlen. Sein Arm schob sich um Tommys Bauch und er rückte ganz nah an ihn heran, hatte das Gefühl, ihm nicht nahe genug zu kommen.
„Hm, was wird das?“, fragte Tommy verschlafen, er konnte jedoch sein Lächeln hören.
„Ich muss dich berühren, fühlen, dich ganz dicht an meiner Haut spüren“, flüsterte er durch die Locken in sein Ohr, schob sie beiseite und küsste die weiche Haut.
Tommy rekelte sich, drückte sich dicht an ihn. „Ganz dicht ist noch etwas näher“, sagte er rau und dieser Klang allein ließ Bennet aufstöhnen. Ja, es ging noch näher, auch wenn er bis eben nicht Sex im Kopf hatte, war er sofort bereit. Seine Hand tastete nach der Tube, die immer auf dem Nachttisch lag, während sein Mund sich an jenem Punkt im Übergang zwischen Hals und Rücken bei Tommy festsaugte, der diesen verrückt machte. Handy, Nachttischlampe, ein Stift ertasteten seine Hände, nicht aber diese verdammte Tube.
„Hier.“ Tommy hielt ihm das Gleitgel über die Schulter hin. „Andere Seite“, fügte er keuchend hinzu. Bennet musste schmunzeln und öffnete den Verschluss mit einem klackenden Geräusch.
„Komm schon“, forderte Tommy ungeduldig.
„Langsam, Baby“, raunte er und versenkte sich fast gemächlich in Tommy, dessen Becken ihm entgegenkam, doch er wollte jeden Moment genießen. Zwei Tage lang hatte er befürchtet, dies nie wieder zu bekommen, und nun musste er dieses Geschenk zu würdigen wissen, auch wenn Tommy anderer Meinung war.
Nicht lange und sein eigenes Verlangen ließ ihn das Tempo steigern, seine Faust legte sich um Tommys Erektion, sodass er mit jedem Stoß hineingetrieben wurde. Tommys Keuchen ging in diese kleinen, wimmernden Töne über, die ihn in einen Rausch und über die Klippe trieben. Er spürte, wie Tommy im selben Moment abhob und presste ihn dicht an seinen Körper.