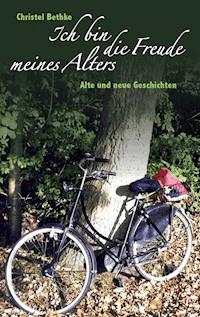Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen an eine Kindheit in Ostpreußen und an die Flucht 1945 stehen hier neben Eindrücken von Reisen in dieses heute polnische oder russische Land. Mit diesem Buch will Christel Bethke das Wissen um die Vergangenheit wach halten und an nachfolgende Generationen weitergeben. Aber sie verharrt nicht in Erinnerungen, sondern setzt Erlebtes und Gesehenes immer wieder in Beziehung zum Lebensalltag in unserer Zeit. Stimmen zu dem Buch: »Ihr Buch hat mich sehr berührt ... denn schreiben, liebe Kollegin, können Sie.« Ralph Giordano »Hier habe ich einige Kostbarkeiten gefunden!« Arno Surminski »Heute, an diesem grauen Sonntag, habe ich Ihr Buch gelesen, mit großem Vergnügen und innerer Bewegung. Ihr Talent, Brücken zu bauen zwischen Ihrer Heimat von einst und dem unglücklichen Kaliningrader Gebiet, zwischen Ihrer Erfahrung und der Enkel-Generation, finde ich faszinierend. Auch erzählerisch gefallen mir Ihre Geschichten sehr! Danke.« Ulla Lachauer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Etliche dieser Geschichten wurden erstmalig im Ostpreußenblatt veröffentlicht und erscheinen hier in zum Teil überarbeiteter Form.
Die Verse von A. Achmatowa auf S. → sind entnommen aus: A. Naimann: Erzählungen über Anna Achmatowa. S. Fischer Verlag, 1992
Inhalt
Melde
Winter auf dem Platz
Wenn die Tante aus Paris kam
Reise aufs Land
Ein weites Feld
Der kleine Koffer
Goldene Zeiten?
Tilsit – in Sibirien?
Erinnerungsfoto für den alten Baumeister
Der Gang und die Wiese
Geschenkte Tage
Die verlorene Zeit
Erzähl doch was von früher
Verdunklung
„Ich geh aus und du bleibst da ...“
Bärlauch aus Steinort
Der Stein
Stunde Null?
„Hans, ich seh dich noch ...“
Sonnenblumen im Winter
Zusammenhalt
Der Stammbaum
Das rote Organdykleid
Hochzeit auf dem Schloss
Das „Lange Haus“
Am Ort des Geschehens
Einer blieb da
Schau den weißen Wolken nach
Schummerstunde
Zarter Flieder
Brot und Kartoffeln
Wörter, die keiner mehr kennt
Toi, toi, toi
Uns geht es doch gut, oder?
Aus alten Töpfen kommen die besten Suppen
Das Wundertier
Oma Edith
Wunder der Märchen
Ein Herz aus rotem Stein
Besuch bei Tante Minna
Licht und Schatten
Hiergeblieben
„Meine“ Tonkuhle
Blick zurück
Aus Nuscht kleine Zwerge backen oder der 90. Geburtstag
Ein Kindersommer
Rin inne Kartoffel, raus ausse Kartoffel
Das „Abenteuer“ Allenstein
Sonne auf Ruinen
Wirtschaften ist eine ganz besondere Kunst
Nichts ist vergessen
Katze, Kind und Königsberg
Wenn ein köstlicher Duft durchs Haus zog
Der Ring schließt sich
Eigene Wege gehen
Schnittchen oder doch exotisch?
Mutterliebe und Kalorien
Setz dich vernünftig hin
Und niemals schweigt sie still
Euch geht’s doch gut!
In alten Fotoalben gekramt
Brauchst noch’n bisschen Kohle?
Oma hat das Tütenprinzip
Pusterchen
Sie bangt sich all wedder
Blücher und die Kaschuben
Ein Traum in Lila
Sing ein Lied
Heimatmuseum
Alte Freundschaft
Wir leben noch
Für meine Großmutter
Berta Priedigkeit
Seitenportal des Scheremetjew-Palastes in St. Petersburg Inschrift im Wappen:
Deus conservat omnia „Gott bewahrt alles“
Hier wohnte in einer Kommunalwohnung fast 50 Jahre lang Anna Achmatowa, russische Dichterin
Ich betret’ die verlassenen Häuser,
Einst jemandes warmes Nest.
Still ist’s, nur weiße Schatten
Über fremde Spiegel huschen.
Was ist das im Nebel dort ...
Sind’s die längst vergessenen Minuten, neu?
Anna Achmatowa
Straße nach Barten
Melde
Für meine Großmutter
Wieder spielen Kinder
im schwarzen Dreck am Zaun.
Derselbe Zaun, derselbe Dreck:
fremd vertraut.
Wo Du gegangen bist,
geht jetzt eine andere
nach Melde in den Garten
und wird die Tiere damit füttern.
Ob die Tiere Dein Locken
verstehen und kommen würden?
Oder sprechen sie – wie auch die Kinder –
eine andere Sprache?
Du würdest staunen
über Deine Wirtschaft
und Dir Dein Kopftuch
bis über beide Augen ziehn.
Winter auf dem Platz
Im Winter wurde es still auf unserem Platz. Die Pumpe war mit Stroh umwickelt. Die Linden, die sie umstanden, hatten ihre Blätter verloren. Nur in den Astspitzen der Krone hielten sich noch ein paar, die man für Vögel hätte halten können. Die aber waren schon lange fort.
Das Federvieh stand frierend am Fuß seiner Leiter, hatte zum größten Teil seine Federn verloren, und es erübrigte sich, sie zu „befühlen“. Es war kalt geworden. Der Schnee lag hoch, und die Kinder hatten hier und dort einen Engel in ihn gelegt. Stocksteif ließen sie sich rückwärts fallen und modellierten mit ausgebreiteten Armen die Flügel in die weiße Pracht. Nun war auch die Zeit, wo sie sich hinter einer Hausecke versteckten, wenn sich das Herannahen eines Pferdeschlittens durch Glöckchenklang ankündigte. Unbemerkt vom Kutscher stellten sie sich rasch auf die Kufen und ließen sich so ein Stück mitnehmen. Meistens gab es eins mit der Peitsche gedroht oder übergezogen. Aber niemals wäre den Kindern in den Sinn gekommen, dass sie selbst – eingehüllt in Pelze – im Schlitten sitzen könnten. Sie pressten für sich mehr als genug Freude und Vergnügen aus ihrem Da-Sein.
Da gab es den See, auf dem sie Glitschen anlegten und mit ihren Holzschuhen beschorrten. Mit Staunen betrachteten sie die Dicke des flaschengrünen Eises, die sie an Rissen und Sprüngen sehen konnten. An der Pferde schwemme konnten sie sich fast nicht mehr an den Sommer erinnern, wenn die Knechte mit ihren Schützlingen nach einem langen Arbeitstag in das kühle Nass ritten, bis nur noch Pferdekopf und Reiter zu sehen gewesen waren. Jetzt kamen die Knechte mit Schlitten und Sägen auf den gefrorenen See gefahren. Sie mussten den Eiskeller ihrer Herrschaft füllen und dazu sägten sie Löcher in das Eis, das sie in Stangen zerteilt auf dem Pferdeschlitten den Schlossberg hinaufschafften. Gespannt sahen die Kinder zu, wie die Pferde mit ihren mit Lumpen umwickelten Hufen sich abmühten. Es kam aber vor, dass doch eins von ihnen ausrutschte, und die Kinder wussten nicht, was sie mehr fürchteten: den fluchenden, auf die Pferde eindreschenden Kutscher oder das Tier selbst, das mit verdrehten Augen, Schaum vor dem Maul, sich bemühte, wieder auf die Beine zu kommen. Besorgt sahen sie in das Loch im Eis und achteten darauf, dass es auch wirklich mit Stangen gesichert wurde. Sie wussten, dass unten der Wassermann auf seine Lilo-Fee wartete.
In dieser Zeit hing vor fast jedem Haus am Platz ein geschlachtetes Schwein an der aufgerichteten Leiter, das seinen aufgeschlitzten Bauch dem Vorübergehenden präsentierte. Der sah sofort mit fachmännischem Blick, so im Vorübergehen, die Dicke des Speckes und verglich sie mit dem des eigenen Schweins. Aber beim Schlachten zeigte sich so etwas wie Solidarität unter den Platzbewohnern. Wenn Schinken und Speckseiten in der Pökelbrühe schwammen und das Fass zufriedenstellend abgedeckt war, machte man sich an das Kochen der Würste, für die jeder sein eigenes Rezept hatte. Sie wurden in dem Sud gegart, in dem man das Fleisch für die Sülze gekocht hatte und die an sich schon gehaltvoll genug war. Trotzdem ließ man zwei oder drei Würste absichtlich verkochen. Schließlich wollte man sich nicht lumpen lassen, denn es war Sitte, dass sich die Nachbarn in mitgebrachten Kannen von der Wurstsuppe holten. Das ging reihum. Jeder holte sich von jedem – schon allein, um zu schmecken und festzustellen, dass die eigene Suppe doch die beste war.
Mauersee
Der Schnee fiel in diesen Wochen ständig und türmte sich oft bis zum Fenster hoch. Morgens musste erst ein Weg bis zum Stall und Tor geschaufelt werden. Die Kinder bauten sich Gänge in den Schnee und, wo er hoch genug war, einen Unterstand. Sie bauten sich Wälle, formten sich Munition aus Schnee, bildeten Parteien und befeuerten sich gegenseitig. Auch zu einer Schneeballschlacht fanden sich immer welche zusammen. Der Schnee ließ die Abende nicht dunkel werden, und noch spät hörte man auf dem Platz die Stimmen der Schlittschuhläufer vom See ...
Wenn die Tante aus Paris kam
Eine Erinnerung an unbeschwerte Kindertage in der Heimat
Wenn der März kam, den See mit Sprüngen wie ein Netz überzog und das Bersten des Eises wie Kanonenschüsse zu hören war, begannen wieder neue Spiele. Der über den Winter festgetretene Schnee, der jetzt einer ranzigen gekochten Schwarte glich, wurde mit kleinen Kanälen durchzogen, in denen das schmelzende Wasser abfließen konnte und auf dem die Kinder kleine Papierschiffchen fahren ließen. Sie schufen Inseln, bauten Brücken, und wenn sie von der Mutter gerufen wurden, waren sie klitschnass und hatten bestimmt mit einer Tracht Prügel zu rechnen. Aber was machte das schon, wenn morgen wieder solch ein Tag kommen würde?
Die Sonne wurde mit jedem Tag wärmer, meterlang hingen die Eiszapfen an den Dachrinnen und mussten abgeschlagen werden, damit sie nicht zu schwer wurden und die Dachrinnen herabrissen. Die restlichen Schneeflächen auf dem Platz glichen zum Bleichen ausgebreiteter Wäsche, wurden aber mit jedem Tag kleiner.
Das Federvieh sammelte sich in der schon wärmenden Sonne am Giebel und versuchte sich einzuscharren. Auch die Kinder trafen am Zaun zusammen und versuchten, mit dem Absatz ein Loch in den noch nicht eisfreien Erdboden zu drehen. Jeder hatte sein Murmelsäckchen mit und wer keines besaß, hatte seine Schätze in einem alten Strumpf. Erst aber musste getauscht werden, schließlich konnte man nicht gleich mit einer Glasmurmel, die hundert kleine Tonmurmeln wert war, beginnen! Ein neues Klippche wurde geschnitzt und das „Tennis für Arme“ konnte beginnen.
Auch die Tante aus Paris kam auf Besuch mit ihren wunderschönen Sachen. Sie öffnete ihr Reisegepäck und holte seidene Tücher daraus hervor, Kleider, Schmuck und viele andere herrliche Sachen, von denen die Kinder nur träumen konnten. Sie spielten Uhrenverkauf und Schuhverkauf. Sie hatten nichts und hatten doch alles, denn es gab weder Schuhe noch seidene Tücher, weil all das nur in ihrer Phantasie bestand.
„Hochzeit“ am Langen Haus
Gegen Abend, wenn es dunkel wurde, fürchteten sie sich trotz gegenteiliger Beteuerung vor dem „Schwarzen Mann“, und wenn sie sich versteckten, hatten sie ganz einfach Angst und waren gerettet, wenn sie „frei“-ge schlagen wurden und atemlos das „Mal“ erreichten. Es war eine Ur-Angst in ihnen, sie glaubten noch daran, dass einem das Gesicht beim Fratzen schneiden vor dem Spiegel stehenbleiben würde, wenn „die Uhr schlägt“, dass die Tiere in der Johannisnacht miteinander sprechen konnten und dass derjenige, der „den Namen des Herrn unnützlich geführt“ hatte, sofort bestraft wurde.
Sie lebten wie die Wilden, und wenn man sie gefragt hätte, in welchem Jahrhundert sie lebten, sie hätten es nicht gewusst. Und war das nicht auch egal, wenn sich der Tag endlos dehnte und doch das Jahr im Nu vergangen war?
In diesen Wochen bekam der Stall einen neuen Kalkanstrich, der gesäuberte Schweinestall war mit sauberem Stroh aufgeschüttet und wartete auf seinen neuen Bewohner. Mutter und Kinder gingen zum Markt, und sachkundig wurde ein Ferkel, das die Grundlage ihrer Ernährung für den nächsten Winter bedeutete, ausgesucht. Das kleine Schwein wurde in einem Sack nach Hause getragen, und die Kinder sahen zu, wie es sich grunzend im Stroh einrichtete, und überlegten sich einen Namen für den neuen Hausgenossen.
Die Mädchen waren über den Winter so gewachsen, dass sie jetzt Kleider mit angesetzten Streifen trugen. Wer Glück hatte, hatte einen „zwischen“ gesetzt bekommen; erst war ein Streifen von Rock und Ärmel abgeschnitten worden und dazwischen wurde meistens ein andersfarbiger Stoffstreifen gesetzt. So entstand etwas Gewolltes, ein neues Kleid! Brauchten sie jetzt auch, die Mädchen, und nicht alle nahmen mehr an den Spielen teil. Manche gingen kichernd zu zweit Arm in Arm und tuschelten hinter vorgehaltener Hand, von den kleineren verspottet und verlacht. So nahm das Jahr, ohne zu stocken, seinen Lauf ...
Fünfzig Jahre später, nachdem die Kinder ins „Leben geworfen“ worden waren, kamen sie als Erwachsene einzeln oder zu zweit zurück, von weit her, um den Platz aufzusuchen, der immer noch in ihren Träumen geisterte. Aber es gab keinen Platz mehr, es gab keine Pumpe mehr, es gab auch keine Linden mehr. Und wenn nicht die Kinder am Zaun, der nur noch aus verrotteten Latten bestand, genauso wie sie einst gespielt hätten, sie hätten es nicht glauben können, dass dies all das war, was sie bewahrt hatten und das einmal Wirklichkeit war ...
Reise aufs Land
„Spitzenmäßig“, sagt Frank, während er den Inhalt des Korbes untersucht, der neben ihm auf der ausgebreiteten Decke steht, auf der er und seine Großmutter Platz genommen haben. Er öffnet die verschiedenen Päckchen, die Dose, in der er seinen Lieblingskuchen entdeckt; alles ist, wie er es gern hat, und als er die Tüte mit den Kirschen öffnet, bekräftigt er noch mal zufrieden, „Astrein!“
Zu dem Ausflug mit seiner Großmutter kam es, weil sie das erste Auto, das er sich nach Erhalt des Führerscheins kaufen durfte, mit „gesponsert“ hat. Heute hatte er sie nun damit ab geholt, um es vorzuführen und sie auf Wunsch statt über die Autobahn über „die Dörfer“ gefahren. Als er sie, schon auf ihn wartend, vor dem Hause mit der zusammengerollten Decke unter dem Arm und dem Korb gesehen hatte, hatte er nur die Augen verdreht. Nun aber fand er die Idee, draußen zu picknicken, nicht schlecht, wie er beteuerte.
Von Dörfern allerdings war nicht viel zu sehen gewesen. Jeder kleine Ort hatte alles Dörfliche entfernt und glich wie ein Ei dem anderen. Nichts von schnatterndem Wassergeflügel am Dorfteich, nichts von sich im Dreck suhlenden Schweinen, kein krähender Hahn auf dem Mist. Statt dessen alles wie neu, gestern erst entstanden. Manchmal hatte sie ein aufgegebener Hof an das erinnert, was sie als dörflich bezeichnen würde.
Frank ist in einen Feldweg eingebogen, hat im Schatten eines Baumes nah an einer abgemähten Wiese geparkt, auf der das fertige Heu eingeschweißt in Ballen auf den Abtransport wartete. Die Großmutter sitzt mit dem Rücken an den Baumstamm gelehnt und muss lachen, als ihr einfällt, dass sie, als sie zum ersten Mal diese runden weißen, in Folie eingepackten Dinger in unregelmäßigen Abstän den auf dem Feld liegen sah, das Ganze für ein modernes Kunstwerk gehalten hatte. Als Frank sie fragend ansieht, erzählt sie ihm das. Aber der hört gar nicht richtig zu, sondern deutet mit dem Kopf und vollem Mund auf sein Auto und sagt: „90 PS.“ Vielleicht weil es nach Heu duftete, trotz der Ballen, und ihr die eigene Heuernte in den Sinn kommt, sagt sie: „Wir hatten acht PS.“ Frank blickt sie verdutzt an und sie erzählt, dass sie zu Hause acht Pferde hatten, die alle bei der Heuernte eingesetzt wurden und dass dabei jede Hand gebraucht wurde. Sie erinnert sich an das Dengeln der Sensen, an das in Schwaden fallende Gras, an die Mädchen, die hinter den Schnittern wegharkten, es ausbreiteten, am Abend zu langen gewölbten Reihen harkten, um es morgens wieder auszubreiten, bis es trocken war und eingefahren werden konnte. „Wie umständlich“, meint Frank und deutet auf den Trecker, der wie ein riesiger Käfer auf einem benachbarten Feld seine Runden dreht, „der Bauer kann heute alles allein machen.“ Er spuckt einen Kirschkern so weit wie möglich auf die abgemähte Wiese.
Brücke über die Omet
Ob es heute nun besser ist, mag die Großmutter nicht entscheiden. Sie erinnert sich aber gern an das Heu machen von damals, an die acht PS, die zu zweit als Gespann vor jeden Leiterwagen gespannt wurden, um die Ernte einzubringen. Sie denkt an die in der Sonne verbrannten Arme und Gesichter, an die weißen Kopftücher, die den Kopf vor der Sonne schützen sollten. Zum Weiterfahren während des Aufstakens hatten sich immer Jungen gefunden, während der Knecht – sie mochte das Wort gar nicht recht in den Mund nehmen – den Mädchen das hochgereichte Heu von der Gabel nahm und geschickt plazierte. Wenn genug geladen war, drückte er es mit einem Holzbalken nieder, der vorn und hinten mit Stricken festgezurrt wurde. Wie schön war es gewesen, da oben zu sitzen, bis zur Scheune mitzufahren, wo sie das duftende Heu hoch bis ins Dach füllten.
Aber in manchen Jahren gab es auch Sorge, wenn das Wetter schlecht war, das Gras auf den Wiesen verdarb und zugekauft werden musste. Zuschuss gab’s nicht, wie es heute ständig zu hören war.
Wie kam sie nur darauf? Lag es am Trecker, der da drüben einsam seine Bahnen zog? Am Duft? Wie wenig Vieh auf den Weiden zu sehen war! Nur am Gatter standen einige PS, die aber nicht zum Arbeiten gehalten wurden, vielmehr dem Vergnügen dienten. Ob sie abends auch zur Schwemme geritten wurden? Spät war es an diesen Tagen immer geworden, und man hörte Stimmen bis in die Nacht, die kaum dunkel werden wollte. In dieser Jahreszeit hatte es immer viel Arbeit auf dem Land gegeben, und trotzdem waren alle heiter und zufrieden gewesen.
Mit ihren acht PS waren ihre Eltern auch auf den Treck gegangen. Bis ans Haff hatten sie sogar die beiden kriegsgefangenen Russen begleitet, die bei ihnen auf dem Hof gearbeitet hatten. Ihre Mutter hatte sogar von „unseren Russen“ gesprochen. Was aus denen wohl geworden war?
Die Großmutter rückt sich zurecht. Was ihr da aber auch alles in den Sinn kommt! Sie blickt auf ihren Enkel, der jetzt die letzten Kirschen verdrückt. Ob der wohl den Hof hätte übernehmen wollen? Schließlich ist er der Enkel eines Grundbesitzers, das heißt Urenkel, berichtigt sie sich in Gedanken. Na, das will sie ihn lieber nicht fragen. Genug jetzt, sie sieht ihrem Grundbesitzer in spe schon an, dass er am liebsten seine PS wieder in Gang bringen will. Er hilft ihr beim Zusammenlegen der Decke, sammelt den Abfall in den Korb, und während sie zum Auto gehen, fragt er plötzlich: „Ist das weit bis dahin, wo ihr gewohnt habt?“
„Na ja“, meint sie, „damals dauerte es acht Wochen, bis wir hier waren, heute schaffst du es vielleicht an einem Tag, wenn du früh losfährst. Jetzt, wo die Tage lang sind.“
Wie schön wäre es, denkt sie, könnt ich ihm alles das zeigen, was es nicht mehr gibt. Sie weiß, dass mit ihr die letzte Erinnerung stirbt an das, was einmal war. Ob es ihn überhaupt gegeben hätte, wenn der Krieg nicht gekommen wäre? Was für ein weites Feld, denkt sie und lässt sich in die 90 PS fallen und vom Urenkel eines Bauern anschnallen – „Das machen wir wieder mal“, meint der, und sie nickt.
Ein weites Feld
Wanda war alt geworden. Fraglich, ob sie noch einmal die Reise überstehen würde. Wie oft hatte sie sich nicht gesagt, nur noch dieses Mal, dann werde ich zufrieden sein. Es hatte nicht genügt. Sie war nicht satt zu kriegen. Lag es daran, dass sie am Stadtrand wohnte und auf ihren Wegen nah an Feldern vorüberkam? An Feldern, an die sie sich in fünfzig Jahren nicht gewöhnt hatte. Wie scharf und blechern standen die Blätter vom Mais. Den hatte es zu Hause nicht gegeben, damals, als Wanda ein Kind war. Wenn jemand vom Meer erzählte, das er gesehen hatte, und von seinen Wellen, sah Wanda den Wind, der über die weichen Kornfelder strich und am Horizont mit dem Himmel verschmolz. Manchmal hatte das Kind mit dem Wind gesprochen, und er hatte seine Worte mitgenommen. Wo waren sie geblieben? Sie waren zurückgekommen und hatten Wanda erreicht, als sie schon wieder einmal ohne Ruhe war.
Ausgeschlossen, dass sie die Reise machen könnte, auch wenn sie in der letzten Nacht geträumt hatte, sie sei zielstrebig und eilig unterwegs gewesen, als ob sie irgendwo erwartet würde. Plötzlich hatte sie eingehalten und sich gefragt, wohin sie denn wolle und wer sie erwarten könnte.
Sie hatte gewartet. Irgendwie hatte sie gedacht, es käme wieder zu einem Leben dort, was sie Heimat nannte. Hatte sie deshalb so lange ausgehalten? Und nun stellte sich heraus, dass sie vergebens gewartet hatte?
„Immer dieser Mais“, brummte Wanda, als sie sich er schöpft an einem Feld niederließ, das sie gerade noch auf ihrem Gang durch den Nachmittag erreichen konnte. Sie erinnerte sich da ran, dass sie, wenn sie mit dem Vater unterwegs war, ihm auf dem Gang durch die Felder die Getreidearten aufzählen musste: Da war die Gerste mit den langen Grannen, leicht zu erkennen, Weizen, kurz und kompakt, Roggen für „unser Brot“ war schon schwieriger, leichter wieder der Hafer, der ihr fliederartig erschien. Und der Geschmack der Körner, auf denen man ewig herumkauen konnte und der nur entfernt an Brot erinnerte.
Wanda fasste nach einem Kolben Mais hinter sich und löste einige Körner heraus und schob sie sich in den Mund. Mais, Maisbrot, na, lieber nicht weiterdenken, denn das war auch ein weites Feld.
Der kleine Koffer
„Nehmen Sie doch bitte den Koffer wieder mit“, sagt der junge Mann in Weiß, der die Tür jetzt schließt, hinter der ich einen mir sehr vertrauten Menschen zurücklassen muss. Ja natürlich, der Koffer. Aber wohin damit? Nichts war in diesem Moment überflüssiger auf der Welt als sein Inhalt. Nie mehr würde seine Besitzerin etwas davon brauchen. Sie war auf die letzte Reise gegangen. Reise fertig war sie schon lange gewesen.
In der letzten Zeit hatte es noch zwei kurze Krankenhausaufenthalte gegeben, fast wie Zwischenübernachtun gen, und da – ich hatte sie begleitet – fand ich es gut, dass man nicht lange nach Utensilien dafür suchen musste. Sie hatte immer den kleinen Koffer fertig gepackt stehen. „Das“, sagte sie, „habe ich im Krieg gelernt, wenn es hieß, bei Fliegeralarm in den Keller zu gehen. Man nimmt den Koffer und geht.“ Sollte ich auch einführen, denke ich, denn die Jüngste bin ich nicht mehr. Ob ich diesen Koffer dafür nehme?
Es ist der „kleine Koffer“, wie sie ihn nannte. Aus Leder, schwer, noch leer reißt er einem fast den Arm aus der Schulter – oder sind es die Erinnerungen, die ihm so viel Gewicht geben? Die Ecken mit harten Lederkappen genietet, scheint er kernfest und für die Dauer. Er war für Zwischenübernachtungen gedacht, wenn das große Gepäck schon vorausgeschickt worden war bei großen Reisen, deren Zeugen als Zertifikate ihre Wände tapezierten. Doch reichte ihre Erinnerung in der letzten Zeit viel weiter zurück, gingen bis in ihre Kindheit, bis nach Hause. Da war von Reisen durch den Korridor ins Reich zu hören, später als junge Krankenschwester in umgekehrter Richtung, von Flucht und Vertreibung hatte sie erzählt, vom Verlust der Geschwister, von Danzig, von ihrer Besessenheit schon damals, reisen zu wollen.
Ich erinnere mich an ihre Erinnerungen, die mit mir vergehen werden. – Warum erinnern wir uns ganz besonders stark im Alter an das Vergangene, an die Kindheit? „Weil wir da geborgen waren“, hatte sie mir einmal gesagt, als wir davon sprachen.
Es ist nicht der erste Koffer, den ich wieder mitnehmen muss. Dieser rührt mich besonders. Vielleicht, weil ich inzwischen selbst alt genug geworden bin und gelernt habe, zu lauschen und zu verstehen. Ich habe begriffen, dass, wenn mein Koffer mitgenommen werden muss, nicht nur meine Erinnerungen vergessen werden, sondern auch die, von denen mir berichtet wurde. Die Erinnerung von uns Flüchtlingen an das, was uns Heimat war und was die nachfolgenden Generationen – und die gibt es längst – nicht mehr verstehen. Vielleicht ist das ja auch ganz gut so ...
Goldene Zeiten?
Heute war es spät geworden. Sie hatten sich gar nicht trennen können.
Schön waren diese Treffen des Heimatkreises immer, auch wenn es mit der Zeit immer weniger Teilnehmer gab. Einige waren im Pflegeheim, andere schon gestorben, und die jungen Leute wollten sich nicht mehr dafür begeistern. Aber diejenigen, die treu kamen, freuten sich sehr auf diese Zusammenkünfte. Bernsteinklunker von nicht zu geringem Gewicht bekundeten ihr Herkunftsland. Die Klunker waren nicht ererbt, Gott bewahre, alles erstanden auf den unzähligen Reisen, die nach dem Krieg in die Heimat geführt hatten.
Heute hatte ein Gast einen Diavortrag gehalten. Er hatte Bilder von der Nehrung gezeigt und vom Samland, so wie es früher war. Behaglich gerührt, im Bewusstsein ihrer jetzigen Sicherheit, hatten sie den Nachmittag sehr genossen.
Die meisten von ihnen hatten es nach der Flucht ganz gut getroffen. Viele hatten Einheimische geheiratet und die Mischung hatte sich bewährt. Nicht nur die Alten hatten die Ärmel hochgekrempelt, sondern auch ihre Kinder. Fast alle bewohnten ein eigenes Haus, Garten natürlich dabei, und den Enkelkindern sah man an, dass ihre Eltern genug verdienten, um den Sprösslingen eine modern gestaltete Kindheit zu bescheren. Jedes Familienmitglied besaß ein Auto, mit dem es ständig unterwegs war.
Lotte, die zum Treffen war, räumt ihren Geschirrspüler aus. Sie hatte gestern Besuch gehabt, und es hatte Kaffeegeschirr gegeben und eine verdorbene Tischdecke. Kein Problem heute mehr. Wie gut sie es hatten! Doch niemals hatte Lotte die alte Lebensform vergessen können, und wie schwer es ihre Eltern im Alter hatten.
Keine Rede heute mehr von „großer Wäsche“, die am Vorabend eingeweicht werden musste, auf dem Herd im Kessel gekocht, gespült im Wasser, das von der Pumpe herbeigeschleppt werden musste. Im Winter war das Trocknen der Wäsche schwierig, und sie wurde längst nicht so oft gewechselt wie heute.
Allein schon die tägliche Körperpflege – wenn man das Waschen in der Schüssel, die auf einem Stuhl stand, so nennen konnte. Das Stück Seife daneben, das Handtuch über der Lehne, Baden, einmal in der Woche in der Zinkwanne, die auf zwei Stühlen stand. Den Kessel mit heißem Wasser auf dem Herd, Dampf, der die Fenster beschlug und Visionen an eine Sauna weckte. Trotz heißen Wassers blieb der Rand der Wanne kalt, und der Insasse mochte nicht gern damit in Berührung kommen. Wenn heißes Wasser nachgegossen wurde, musste man die Beine anziehen, damit sie nicht verbrüht wurden. Das Feuer im Herd war schwer zu halten, schwer anzumachen, vor allem wenn das Holz nicht ganz trocken war. Am besten wurde es in der Ofenröhre dafür präpariert. Wollte es nicht brennen, pusten, pusten ...
Lotte räumt das Geschirr in den Küchenschrank. Was ihr da bloß für Gedanken kamen!
Während sie ins Badezimmer geht, denkt sie an das Klo, zu dem man über den Hof in den Stall gehen musste. Nachts stand der Topf unterm Bett, in das man im Winter bibbernd kroch und mit angezogenen Knien auf die Zudecke wartete, die die Mutter am Kachelofen wärmte. Morgens musste erst der Weg zum Stall und zum Tor durch den Schnee freigeschaufelt werden. Mit der Stalllaterne zum Füttern der Tiere in den Stall, nachdem das Futter im Eimer gemischt war. Noch heute hatte Lotte den Geruch von heißen zerquetschten Kartoffeln, Kleie und Drank in der Nase und noch das Geräusch im Ohr vom Schneiden der Brennesseln und der Melde, die ebenfalls verfüttert wurden.
Straße nach Barten
Wer von ihnen wusste das nicht mehr? Alle erinnerten sich daran, dachte Lotte, denn sie hatten oft davon gesprochen. Trotzdem tun wir so, als wäre es das Paradies gewesen. Stimmt das denn? War es das wirklich gewesen? War es das, wonach sie sich sehnten, wenn sie mit Tränen in den alten Augen das Lied von den dunklen Wäldern zum Abschied gemeinsam sangen? Doch wohl nicht.
„War früher wirklich alles besser?“, hatte neulich die kleine Enkelin Lotte gefragt, und die hatte sich erst besinnen müssen. Könnten sie denn, sie, die sich an Telefon, Gefriertruhen, Kühl schränke, Waschmaschinen, überhaupt jede Art von Elektrogeräten in der Küche gewöhnt hatten, sich noch ein anderes Leben vorstellen? Mit welcher Selbstverständlichkeit bestiegen sie ein Flugzeug, sie, die noch den ersten Zeppelin bewundert hatten. Und sie bekamen feuchte Augen beim Singen der alten vertrauten Lieder? Komisch.
Sie muss lachen, wenn sie an das Zeitungspapier denkt, das schön gerade geschnitten auf einem Haken neben dem Plumpsklo hing. Gab es damals überhaupt schon Papierrollen für diesen Zweck? Vielleicht, aber Sparen war die zweite Natur des Menschen gewesen, nicht immer notwendig, aber wissen konnte man ja nie. – Für sie, die Kinder, hatte es höchstens mal fünf Pfennige für Bonbons gegeben. Sie kauften dafür lieber Gruschel, das war der Rest aus dem Bonbonglas, weil es davon mehr gab für das Geld.
Wer also kann diese Frage – Lotte meint, es sei die Frage schlechthin – ohne Vertellchens beantworten. Die bleiben ohne hin in unserer Erinnerung bestehen, sollten aber nicht verfälschen. Gewiss, es mag Höhergestellte gegeben haben, die mit Personal wirtschafteten und doch auch sparsam waren, wie schon Marion Gräfin Dönhoff in ihrem Buch „Kindheit in Ostpreußen“ schildert. Was war nur in ihnen, denkt sie, so ambivalent, dass sie nicht eindeutig zu sagen vermochten, wir haben es doch gut? Nein, wir schleppen den schweren Sack der Erinnerung mit uns. Waren sie früher wirklich geborgener, wie die Freundin neulich meinte? Aber worin geborgener? – Na, bei diesen Gedankengängen ist sicherlich nicht an Schlaf zu denken. Sie wird gleich noch mal die Freundin anrufen und danach fragen ...
Tilsit – in Sibirien?
Wenn der Enkel mit der Großmutter in Gedanken auf Reisen geht
„Tilsit“, überlegt Frank und schiebt sich dabei noch einen zusammengerollten Kartoffelflinsen in den Mund, „liegt das nicht in Sibirien?“ Kann er vielleicht auch nicht wissen, denke ich und sage, dass Tilsit heute Sowetsk heißt, weil auch Städte im Laufe von Jahrzehnten ihren Namen ändern können. Aber für ihn liegt auch Sowetsk in Sibirien.
Ich muss auf die Flinsen in der Pfanne aufpassen, sie rechtzeitig umdrehen, damit sie diesen knusprigen, braunen, filigranartigen Rand bekommen, wie Frank ihn liebt an den Kartoffelflinsen seiner Großmutter. Ich frage mich, ob der Teig auch ausreichen wird.
Luisenbrücke in Tilsit