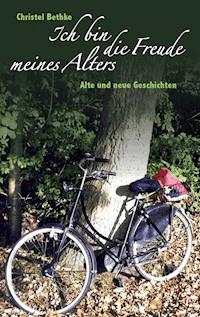
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christel Bethkes Gedichte und kurze Geschichten mäandern zwischen dem Gestern und dem Heute. Sie erzählen in natürlichen, sinnlichen Bildern vom Alltag des Alterns und von menschlichen Merkwürdigkeiten, von denen manche sich auch vom Älterwerden nicht aufhalten lassen. Die Autorin kommentiert das Leben, das sie täglich um sich herum beobachtet, ebensowie ihre Erinnerungen an alte Geschichten mit lebenskluger Toleranz. Das macht ihre Texte über Generationengrenzen hhinweg lesenswert. Christel Bethkes Geschichten und Reflektionen über das Leben im Alter, sind lesenswert für alle, die schon älter sind oder es noch werden möchten. 15 Fotos dokumentieren und beschreiben Ihre Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Plagiat
Der Bauer hat sein Land verkauft
Sage nicht
Das Wiedersehen
Die Bushaltestelle
Trommeln
Mit zweiundachtzig
Das Alter
Unten steht der Leichenwagen
Die Tilsiterin
Zu Hause trösten schon die Wände oder alles hat seine Zeit
An einem Sonntagmorgen
Narziß
Was man nicht kennt, vermißt man nicht
Nach Hause kommen
Nimm drei, bezahl zwei
Eros und Geschlecht
Frühling in der Stadt
3 alte Frauen (4)
Kriminaltango
Sommerweg
Der Neurotiker
Eckbank in Rot
Lungern
Das Treffen oder der helle Wahnsinn
Du hast es wiedermal geschafft
Dodo
Besuch bei Ludwig Hohl
Gleichgültig
Schöpferische Möglichkeiten ohne Ende
Nachts auf dem Balkon
Bornhorst
Bücher
Traum
Ein Brief an den Verlag
Bei Thalia
Vielleicht doch lieber Seebestattung
Bilderbuch
Kein Ort für unsere Trauer
Frühe Kindheitserinnerungen
Ein Tag im Mai
Merkwürdig
Zeitungsinserat
Austherapiert
„Wenn du denkst, es geht nicht mehr ...“
Erfolgserlebnisse eines Vormittag:
Die Eintänzerin
„Luna Beef“
Mademoiselle Bethke oder man wird ja träumen dürfen
Schön ist solch ein Morgen
Stein oder nicht Stein
Im ICE
Empfehlung
Wen der Herbst nicht will, den holt der April
Am 4.10.2012
Eigener Herd ist Goldes wert
August 2011, morgens mit dem Rad nach Zwischenahn
Wie geht es dir?
Das Leben der Hühner ist rot
Der Großzügige
Wehe wehe, wenn ich auf das Ende sehe
Mister Mint
Warum fragte ich nicht?
„Man darf gespannt sein“
Träumen kann man doch
Darf ich fragen wie alt Sie sind?
Oma
Rentner-Da-Sein
Unglaublich oder vor lauter Licht sieht man die Sterne nicht
Oktober
Was sich die Schwachköpfe
...
Was es heute gibt
Engel bringt das Gewünschte
Tapferkeit
Alte Heimat, Neue Heimat oder ich hatte immer Angst
Auch dafür muß gedankt werden
Alle Jahre wieder
Schlaflos
Das zieht sich hin
Silberner Tag
Erinnerungen
Erfolgserlebnis heute Vormittag:
Wir fahren nach Ajonken
9. September 2012
Frau Schwendimann will kämpfen
Briefe nicht erwünscht
4.5.2013 Glück
Sonne
Der Angsthase
Nachwort
Spät erst erfahren sie sich:
bleiben und stille bewahren
das sich umgrenzende Ich.
Gottfried Benn
Plagiat
Mein Leben besteht nur
aus Literatur.
Die große und die kleine
Liefern mir die Steine
zum Überlebensbau.
„Ich bemerke wieder einmal,
daß kein Buch den lebendigen Menschen ersetzen kann“,
Albert Speer in Spandauer Tagebuch
Der Bauer hat sein Land verkauft
Der Bauer hat sein Land verkauft,
Er holt die Milch jetzt in der Tüte.
Er hält gar keine Tiere mehr
Und spricht von „Freizeit“, meine Güte!
Und seine Frau, die Bäuerin,
Hält sich nun fit for fun:
Sie joggt, spielt Golf und sonstnochwas,
Hat auch ein neues Outfit an.
Auf ihrem weiten schönen Feld
Stehn neue Immobilien.
Sie haben jetzt ’ne Menge Geld
Und machen „Auszeit“ auf Sizilien.
Das alte Haus, mit Stall und Scheun’,
Es mußte Neuem weichen,
vom Giebel „achtzehnhundertzehn“
Ließ niemand sich erweichen.
Zweihundert Jahr Vergangenheit,
Gelebtes Leben, hier am Ort.
So ist das mit dem Zahn der Zeit,
Was bleibt, ist nur das Wort.
Sage nicht
Sage nicht, das Glas ist schon halb leer
Und nicht, morgen wird es regnen
Wenn wir spazieren gehen werden.
Sage nicht, gestern war ich dort um diese Zeit
Und morgen werde ich woanders sein.
Laß uns im Heute doch verweilen.
Im Glase funkelt rot der Wein
– vielleicht ein achtel noch –
Wir wollen ihn genießen.
Das Wiedersehen
In der Nähe des Bahnhofes beobachtete ich folgende Szene, die mir beim Weiterfahren verschiedene Gedanken in den Sinn kommen ließen: Ein Mann, offensichtlich von dort kommend, denn er zog einen Koffer hinter sich her, und ein Kind von entgegengesetzter Seite, strebten eilig aufeinander zu. Vielleicht hatte das Kind, es war ein kleines Mädchen, sich verspätet und nicht mehr rechtzeitig geschafft, beim Eintreffen des Zuges den Erwarteten zu begrüßen. Jedenfalls war ersichtlich, wie sehr sie sich freuten, sich wieder zu sehen. Das letzte Stück Weges wäre fast auch noch der Vater gerannt: der Koffer bleibt stehen, die kleine Tochter liebevoll begrüßt, umarmt und sich immer wieder drückend und Fragen stellend (hoffentlich nicht gleich nach der Schule!), ziehen sie nun den Koffer hinter sich her nach Hause.
Ernst Barlach hat eine Skulptur geschaffen, die er Das Wiedersehen nennt und die mich immer wieder sehr berührt. Sie zeigt zwei Frauen, eine davon alt und ge krümmt, sich berührend. Sich wiedersehen, eine herzbewegende Angelegenheit ist das.
Was war das früher immer für eine große Begebenheit, wenn Besuch kam und auch wenn er wieder fort mußte. Telefon gab es nicht im Haus und Briefe zeigten auch nie an, wie es denn wirklich um einen stand. Hat sich Mutter verändert, der Vater? Wie geht es ihnen wirklich? Hat er sich von seiner Krankheit erholt?
Im Zusammenkommen der Menschen hat sich seit damals auch etwas verändert. Vielleicht sieht man sich öfter, aber nicht intensiver.
Also erstmal die Ankündigung. Da muß natürlich alles auf Vordermann gebracht werden: das Haus gesäubert,das Gastzimmer, so vorhanden, hergerichtet, gebacken muß werden, ein Speiseplan erstellt, nachdem man sich der Lieblingsspeisen des Gastes erinnert hat, Blumen auf den Tisch mit der frischen gestärkten Decke und natürlich Großer Bahnhof. Alle Mann hin und den Be such abgeholt. War mit großem Gepäck zu rechnen, mußte der Handwagen mitgenommen werden, denn auch ein Auto gab es nicht und von einem Taxi ist mir ebenfalls nichts bekannt, das bestellt werden konnte. Wie denn auch, eher konnte schon bei Onkel Priedigkeit Pferd und Wagen ausgeliehen werden.
Ganz anders heute. Viele kleine Reisen, die auch in acht Tagen um die Welt führen können, sind gefragt. Schließlich möchte man die Große Mauer begangen haben, auf einem Kamel bis an die Pyramiden geritten sein. Auf einem Elefanten durch den Regenwald wäre auch ganz schön und überhaupt, das Leben ist viel zu kurz, trotz Brückentagen und geschickter Urlaubsplanung, um sich alles einzuverleiben.
Damals kam man, um eine Weile zu bleiben, um wieder mal vereint zu sein. Klar wird man da vom Zug abgeholt und wenn er langsam einfährt, schon Ausschau halten aus welchem Coupé der Erwartete aussteigen wird. Dann erste verstohlene Bestandsaufnahme. Hat er sich verändert? Wenn ja, inwiefern. Schließlich schickte man nicht dauernd Fotos von sich und gemailt wurde auch nicht.
„Das Herz muß wissen, wann es da sein soll“, heißt es im Kleinen Prinzen. Wie wahr. Im Zeitalter des Autos und der Flugzeuge ist man ständig „Überraschungen“ ausgesetzt. Und das Herz kann erst da sein, wenn es schon zu spät ist, und man fragt sich, ja war das denn nun wirklich wahr oder nicht. Dann fallen einem erst die Antworten ein zu Fragen, die gar nicht gestellt wurden.
Zeit, Abschied zu nehmen. Der Besuch geht zu Ende, der Koffer ist gepackt, Proviant für unterwegs hergerichtet, zusätzlich noch ein Pappkarton mit nahrhaften Dingen für den Städter bereitgestellt. Der Handwagen aus dem Stall wird mit einer Wolldecke ausgelegt, um den guten Lederkoffer zu schonen und schon geht es los: einer zieht und einer schiebt; wenn es bei Urban den Berg runtergeht, muß gebremst werden, und viel zu früh für den Großen Bahnhof, der wieder abgehalten wird, ist man da. Dann aber, wenn das Gepäck verstaut, der Platz belegt ist, wird das Fenster heruntergelassen und gewinkt, wenn zur Hand, mit einem Taschentuch, das der Zurückbleibende ganz bestimmt aus seiner Manteltasche gezogen hat und so lange flattern läßt, bis der Zug die letzte Kurve genommen hat. Leere, Traurigkeit bleiben zurück. Dann aber wird sich gerafft und der gemeinsamen Zeit gedacht, die hinter einem liegt und die so wichtig war und ist im Leben. So halten wir es heute noch und das Tuch, das Taschentuch, ist ganz wichtig: es sollte nach Möglichkeit weiß sein und frisch entfaltet werden.
Louise und ich in Bad Pyrmont (1968)
Die Bushaltestelle
Als ich vor einiger Zeit im Heim Besuche machte, sah ich, dass man eine Haltestelle für Busse davor eingerichtet hatte. Prima, dachte ich, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Da kann ich, wenn es im Winter mit dem Rad zu gefährlich wird, direkt mit dem Bus bis vor die Tür fahren. Alles ist da: eine Bank, ein durchsichtiges Häuschen, Fahrplan, ein Papierkorb für die entwerteten Fahrscheine und das Halteschild.
Heute ist eine riesige Maschine im Garten damit be schäftigt, einen neuen Weg einzurichten, der sich mir zu nächst nicht recht erschließen will. Schade eigentlich um die alten Büsche, die der Umwandlung zum Opfer gefallen sind. Soll das ein Rundweg werden oder zwei? Eine Art von Acht, so etwas wie eine Endlosschleife? Ich lasse mir das vom zu wenigen Personal erklären. Es stimmt, der Weg soll die Kranken daran hindern „auszubüxen“ wie mir der Pfleger erklärt. Einmal drin, muß der Wegführung gefolgt werden. Mir fällt der Hamster ein, der in seinem Rad unentwegt läuft und läuft und läuft. Oder ist das ein anderes Tier?
Auch mit der Bushaltestelle stimmt etwas nicht. Nie wird hier ein Bus ankommen oder abfahren. Und das soll zum Wohle der Kranken sein? Der Verwirrten, die mir gar nicht so verwirrt scheinen, wenn man sich mit ihnen unterhält. Immer bekomme ich eine ausführliche Antwort wenn meine Frage die richtige ist. Seltsam ist das alles. Du sollst auf einen Bus warten, der nie kommen wird, und du sollst deine Runden drehen wie im Gefängnis. Wenn man nicht schon verwirrt ist, hier kann man es werden.
Albert Speer, Hitlers großer Architekt, muß zwanzig Jahre im Spandauer Gefängnis absitzen und weiß als in telligenter Mensch, er wird verrückt werden, wenn er sich keinen Plan macht. Ihm kommt die Idee mit der Weltum wanderung im Gefängnisgarten. Er rechnet sich aus wieviel Kilometer er täglich schaffen kann, nachdem er die Länge des Weges im Garten ausgerechnet hat. Als Architekt fällt ihm das nicht schwer. Auch berechnet er Zeitzonen, winterliche Verhältnisse in den jeweiligen Ländern, durch die er kommen wird, ein und steckt sich Routen ab. Er läßt sich Material über die Strecken, die er durchwandern wird, bringen und studiert es. Jeden Tag notiert er sich die gewanderten Kilometer. Am 6. August 1955 heißt es „Flimmernde Hitze über der Pußta ... aus unserem Kräuterbeet riß ich eine Zitronenmelisse aus und zerrieb die Blätter zwischen den Fingern, der intensive Geruch verstärkt die Illusion von Fremde, Wanderung und Freiheit.“ Am 2. Dezember 1956 befindet er sich dreihundertdreiundfünfzig Kilometer vor Kabul: „Rech ne damit, daß ich, wenn keine Schneestürme auftreten, Mitte Januar in der Hauptstadt von Afghanistan ankommen werde.“
Am 24. Februar kommt es fast zur Katastrophe. Er ist inzwischen in nächster Nähe der Beringstraße, die zweihundertsiebzig Kilometer breit und bis Mitte März zugefroren ist, und er rechnet sich aus, daß, wenn er sein Tempo steigern könnte, er sie zu Fuß überqueren könnte, denn ein Wärter, der von dort stammte, hatte ihm erzählt, daß sie zufriert und er somit der erste Mitteleuropäer wäre, dem es gelänge. Im ganzen, erzählt er seinem Mit häftling Rudolf Hess, habe er bis dahin 78 514 Runden gedreht oder aber 21 201 Kilometer bis „hierher“ zurückgelegt. Der beunruhigt sich und fragt: „Halten Sie das nicht für beängstigend. Ist das nicht eine Manie?“ Speer beruhigt ihn damit, daß er sich in guter Gesellschaft befinde. Von Ludwig dem Zweiten wird berichtet, daß er manchmal abends in den Marstall ging, sich auf einer Karte die Stra ßenentfernung von München nach Schloß Linderhof ausrechnen ließ, sich aufs Pferd setzte und Runde um Runde die ganze Nacht über die Bahn abritt. Der Adjutant mußte ihm zurufen: „Jetzt sind Euer Majestät in Murnau, jetzt in Oberammergau und jetzt treffen Euer Majestät in Linderhof ein!“
Irgendwie, denke ich manchmal, hängt alles zusammen. Alles ist etwas irre. Das ganze Leben. Und Umwege sollen ja angeblich die Ortskenntnis erweitern. Abends, beim Nachrechnen, muß Speer feststellen, daß sie sich während des Gesprächs auf der Behringstraße befanden. „Wie leicht hätte ein Unglück passieren können, man kann nicht vorsichtig genug sein“, notiert er.
Weil ich heute erschöpft bin, setze ich mich, bevor ich nach Hause fahre, zu einer älteren Frau auf die Bank an der Bushaltestelle. Sie hat ihre umgehängte Tasche auf dem Schoß und macht sie unentwegt auf und zu. Auf meine Frage, wohin, sagt sie, sie will Eis essen fahren. Bei der Hitze, denk ich, ist das eine gute Idee. Ich habe sie im Haus schon öfter gesehen und seit es diese Haltestelle gibt, sitzt sie hier jeden Tag, erzählte mir der Pfleger. Sie hat den Riemen der Tasche wie beim Koppelzeug schräg über Rücken und Bauch und unwillkürlich muß ich an einen Brotbeutel denken, in dem die eiserne Ration eines Soldaten war. Und siehe da, jetzt holt sie ein flaches Päckchen aus der Tasche und wickelt ein Brot aus. Nachdem sie das Papier sorgfältig in den Papierkorb getan hat, beginnt sie zu essen.
Jetzt kommt noch ein möglicher Fahrgast und setzt sich zu uns. Alles das geschieht wortlos. Was ist das nun alles, ist das gut oder trostlos? Müßte ich hier sein, kommt mir in den Sinn, ginge ich nicht auch hierher, um zu warten? Was hat man nicht schon in seinem Leben gewartet! Von we gen, das Herz muß wissen, wann es da sein soll, wie esim Kleinen Prinzen heißt. Das ist ja vom Warten schon so müde, daß es den Augenblick verpaßt, wenn es da sein soll, das heißt, wenn der Bus endlich kommen sollte. Wird die Welt, in der wir leben, durch unsere Träume nicht doch verändert und lebbarer? Wir wollen doch nicht nur aufgehoben sein, sondern leben.
Das letzte Stück unserer Straße, bevor sie in die Bundes straße mündet, es sind vielleicht hunderzwanzig Me ter, war immer ganz besonders sauber. Jedes bißchen Unrat, Papier und Plastik wurde von einer alten Frau aufgesammelt. Dreimal mindestens am Tag trat sie aus ihrem Haus und sorgte für Ordnung. Jahrelang ging das so und auch der daneben laufende Graben gehörte dazu. Im letzten Jahr, als es Herbst wurde und die Blätter fielen, be gann ihre Sisyphusarbeit. Die Blätter! Die wirbelnden, fallenden Blätter. Sie konnte sie nicht schnell genug sammeln und in ihre Ecke tragen, schon waren sie wieder auf und davon. Einmal stieg ich vom Rad und sie führte mich an den Ort ihrer Niederlage und ihren Augen war anzusehen, daß sie die Welt nicht mehr verstand. Schade.
Mir fiel ein, wie besessen ich immer alles gemacht hatte und manchmal heute noch. Gestrickt wie eine Irre, dabei wollte schon längst keiner mehr die Pullover und So cken haben. Dann danach das Häkeln! Spitzen für Tisch de cken! Teurer Stoff wurde gekauft, Bielefelder Leinen, und die ganze Spitze eingearbeitet und drumherum ge näht im Spezialgeschäft für ganz teures Geld. Wäre es nicht schön zu wissen, man wird nicht mehr sein, aber eine solche Decke überdauert einen und wird zum Familienerbstück? Puste kuchen, wo sind die Erbstücke geblieben? Die Heiß manglerin meinte mal, das macht sie heute nicht mehr. Die setzen gleich ihren Kaffeebecher auf den Tisch, ohne Decke. Und eigentlich haben sie auch recht, bei den Mangelpreisen.
Dann das Sammeln der Beeren im Herbst. Wieviel Gläser Gelee und Marmelade gekocht. Nichts davon für mich und ob die anderen das mochten und zu schätzen wußten, bleibt auch fraglich, denn der Geschmack der Nachkommen hat sich auch den Neuerungen angepaßt.
Mein Badesee ist neunhundert Schwimmzüge lang, hin und her also eintausendachthundert. Mache ich nur die Hälfte, wenn es zu kalt ist, mache ich nur ... Fängt die Badesaison erst an, fällt es mir schwerer, mal nicht zu gehen. Ich müßte mal ausrechnen, wo ich am Ende des Sommers angekommen sein könnte. Vielleicht in der Adria? Hoffentlich gibt es da keine Haie!
Man muß doch immer aufpassen wie ein Luchs, um noch die Kurve zu kriegen. Aber vielleicht wird manch einer auch von seinen Zwängen zusammengehalten. Hat das noch kein Schlaukopf ergründet? Wenn nein, warum nicht. Fest steht, daß der Tag Struktur haben muß, Kontur, und Arbeiten ohne Auftrag ist am allerschwersten. Vielleicht müßte ein naher Mensch heute nicht den Rundweg gehen, hätte er in der Krise den Pinsel wieder in die Hand genommen. Das sind Geheimnisse unseres reifen Lebens.
Ich hatte mir immer vorgestellt, daß, wenn ich jemals im Gefängnis landen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ich anfangen würde, die Bibel abzuschreiben. (Ich muß also mit einer längeren Haftzeit gerechnet haben.) Denn das hatte ich schon früh begriffen, irgendwie muß es einen festen Plan geben im Tagesverlauf, wenn einem die Freiheit verwehrt ist, der nicht ganz sinnlos ist. Bis heute ist es Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Auch darin Glück gehabt.
Uns wird beigebracht, immer globaler zu denken. Lotte, die im Laufe ihrer immer stärker werdenden Gebrechlichkeit in verschiedenen Seniorenwohnanlagen lebte, weil das auch zur Kostenfrage wurde, machte mich einmal darauf aufmerksam: „Sehen Sie hier irgendwo einen Heimbewohner mit ausländischen Wurzeln?“
Ich war verblüfft und es stimmte. Auch in anderen Heimen nicht, die ich zum Besuch aufsuche. Obgleich der Anteil, wie ich auch in unserem Viertel feststellen kann, unserer ausländischen Mitbürger gestiegen ist, sieht man dort keine. Was machen die mit ihren Alten und Kranken? Zurück in ihre Dörfer? Oder pflegen sie die zu Hause? Werden die weniger dement? Fragen über Fragen, die sich hier stellen und manchmal stelle ich mir vor, wie das wäre, das noch vorhandene „Potential“ zu nutzen. Zurück in die Zukunft.
Ich las einmal ein Buch, der Titel Zwei alte Frauen (weiß ich aber nicht mehr genau). Die beiden wurden von ihrem Stamm ausgesetzt, weil die Karawane weiterziehen mußte, und wenn die Wölfe näher kommen, wirft man einen vom Schlitten. Der Stamm kämpfte ums Überleben und so kam, was kommen mußte. Die beiden berappeln sich, besinnen sich auf ihre alten Traditionen. Überlebensmethoden, die sie noch von ihren Vorfahren in Erinnerung hatten, werden so wieder fit und haben, als sie durch Zufall ihren alten Stamm treffen, der am Verlöschen ist, die Genugtuung, ihn zu retten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Aber das wollen wir ja alles gar nicht. Rette sich, wer kann. Aber wir, das letzte Aufgebot, nochmal in die alte Heimat? In Großmutters Garten etwas pflanzen und ernten? Ein Feuer im Herd machen, sie fragen, was habt ihr mit euren Alten und Kranken gemacht?
Kommt jetzt der Bus? Nein, nur jemand vom Pflegepersonal kommt nachsehen, ob nicht jemand „ausgebüxt“ ist. Zum Nachtisch gibt es heute Eis, hören wir, also ist ein Ausflug zu dritt nicht mehr nötig.
Trommeln
Vor fünf Tagen stand das Getreide noch auf dem Halm, heute ist das große Feld abgeerntet und ein Trecker hat bereits an einem Ende mit dem Pflügen begonnen. „... ist das Feld einst abgemäht,/ die Armut durch die Stoppeln geht, sucht Ähren,/ die geblieben ...“, heißt es in einem Gedicht von Clemens Brentano.
Daran hielten wir uns immer. Ob wirkliche Armut dahinter stand, glaube ich nicht und auch nicht, dass es mit dem Krieg zu tun hatte. Es gehörte einfach dazu wie das Beerenlesen und das Pilzesammeln im Herbst. Ob wir Kinder dabei eine wirklich große Hilfe waren? Am liebsten war mir die Pause mit der Vesper und dem mitgenommenen Saft in den Krucken, zu dem man auch wieder für Nachschub sorgen mußte. Wenn die Zeit da war, dann mußte in den Beerenwald gegangen werden, denn das wußten wir, kam man zu spät, bestrafte einen das Leben mit einem leeren Eimer. Wir waren nicht die Einzigen, die schon früh loszogen, es war Ferienzeit und das gehörte dazu. Großmutter hatte für jeden eine Halbschürze ge näht, die vorn doppelt war, also eine große Tasche bildete. Da hinein kamen die gesammelten abgeschnittenen Ähren. Die Schere, mit der das gemacht wurde, hing an einem Band, das um die Taille ging. Alles ohne Schutzmaßnahmen!
Die Felder waren belebt, Zurufe gingen hin- und herüber, Kinder versuchten, auf den Stoppeln barfuß zu laufen. Hitze. Aber dann unter den Chausseebäumen die Rast im Schatten. Auswickeln der Flinsen und zum Saft vertilgen, bißchen ausruhen, bis die Großmutter ihr weißes Baumwolltuch zurecht rückte und hoch geht’s. Wer dachte schon beim Liegen im Gras an die mörderischen Zecken! Irgendwie haben wir ja alles überlebt, vielleicht rührt ja diese oder jene Macke daher.
Auf den Feldern wurden die letzten Hocken eingefahren und die Hungerharke, die danach eingesetzt wurde, ließ hoffentlich noch was zum Sammeln übrig. Heute nichts davon, nichts zu sehen und nichts zu hören. Erntezeit! und keine Menschenseele auf den Feldern, die, zugegebenermaßen, weitgehendst von Maisfeldern abgelöst worden sind. Stellenweise fährt man wie durch Kanäle, links eine Mauer aus Mais, rechts eine, die jeden Weitblick verbieten und die Welt enge werden läßt. Schade.
Nur ab und zu donnert ein Riesentraktor so nah an einem vorbei, dass man fast im Graben landet, und wenn man nicht rechtzeitig nach der Mütze faßt, reißt der Sog sie mit fort.
Nicht nur auf den Feldern ist es leer, auch die Wege und Landstraßen. Heute begegnet mir nicht ein einziger Mensch, weder zu Fuß noch mit dem Rad. Ja, wo sind die denn nur! Nur einmal war ein Trupp der „jungen Alten“ unterwegs in buntem Outfit und mit Helm ausgerüstet, wie für die Tour de France. Mit großem Hallo bilden sie ein Spalier und die kleinen Feiglinge machen die Runde. Ich danke huldvoll und summe beim Weiterfahren vor mich hin „Kinder ist das Leben schön, ohne ins Büro zu geh’n.“ Irre diese Zeit. Auch mit den Tieren ist es schlecht bestellt. Man riecht sie nur. Kaum eine Kuh ist auf der Weide, Geflügel schon gar nicht. Höchstens die Pferde, die gehobenen Ansprüchen dienen, haben es auf ihren Koppeln gut.
Mein Großvater vertrat die Ansicht, der Bauer sei der wichtigste Mann im Staate. Das leuchtet sofort ein: ohne ihn keine Grundnahrungsmittel, wie Brot und Kartoffeln. Der heutige „Agronom“ könnte einem fast leid tun. Ganz allein sitzt er wie ein Pilot in seinem Cockpit auf seinem Traktor, ein Riesending. Ob er in seinem Glaskasten Klimaanlage hat? Musik? Sicherlich hat er aber Computersteuerung, denn die Furchen, die er zieht, sind wie mit dem Lineal gezogen. Am 28. Juli gibt es eine „Maisfeldfete“, las ich unterwegs ans Feldkreuz angeschlagen. Im merhin, und ein anderer hat einen Irrgarten angelegt, der für fünf Euro Eintritt bald begangen werden kann.
Eigentlich fand ich es heute zum ersten Mal be drü ckend, so allein. Auch die Dörfer, durch die ich fuhr, waren sooo leer. Nicht weit vor den Toren der Stadt hat ein Mensch das Gebot der Stunde erfaßt: er ließ einen Teich in der Wiese ausheben, schaffte zwei Entenpaare und Gänse an und auch ein paar Ziegen und kleine Hängebauchschweine und eröffnete ein Landcafé. Was das wohl wird, fragte ich mich. Es wurde, sein Plan ging auf. Er hat sein Angebot um „Elsässer Flammekuchen“ erweitert und ein Eselchen bereichert seinen Minizoo. An Wochenenden und Feiertagen parkt Auto an Auto und auch an Werktagen herrscht Betrieb. Die Gänse hatten gebrütet und seit Ewigkeiten sah ich erstmals wieder Güsselchen. Ideen muß man haben.
Wir waren in keiner Krise, als wir Ähren suchen gingen. Übrigens gingen wir auch über die abgeernteten Kartoffelfelder. Nachstoppeln nannte man das. Nein, sie machten das, weil nichts umkommen durfte. Nach heutigen Maßstäben lagen wir bestimmt unter der Armutsgrenze, doch wir fühlten uns nicht so, das hätte uns auch schwer gekränkt! Ganz im Gegenteil, wir fühlten uns reich, wir lebten ganz und gar mit und in der Natur. Welche Fülle lag in diesen Erntemonaten, wenn die Spillen fast vor Süße an den Bäumen platzten, die ersten Klaräpfel reiften. Und in den Wald mußte auch noch gegangen werden.
Es ist ein Deutscher, der in Athen Tipps für die Krise gibt: ein Fahrrad und Kartoffeln im Keller horten. Das könnte von mir stammen, ich würde aber noch ergänzen und raten, über die abgeernteten Reisfelder zu gehen und liegengebliebene Ähren zu sammeln. Gibt es nicht beim Griechen Reis und Lamm? Für die Siesta unter den Olivenbäumen wäre ein Fläschchen Retsina zu empfehlen.
„In der Armut beginnt die Philosophie“, behauptete neulich in einem Interview ein Grieche, der aus der Stadt zurück aufs Land gezogen ist, um sich wieder um seine alten Olivenbäume zu kümmern und begeistert ist vom einfachen Leben. Wenn das alle machen würden, bedürfe es der Marktwirtschaft nicht mehr, meinte er. Ist das so? Und was dann?
Als das Telefon für uns bezahlbar wurde, das ist nun vierzig Jahre her, wurde es sofort in Aktion gebracht. Was die Pfadfinder sich nicht alles zu besprechen hatten! Ich fragte meinen damals zwölfjährigen Sohn: „Sag mal, was würdet ihr eigentlich ohne Telefon machen?“ Er: „Trommeln, Mutti, wir würden trommeln.“ Beruhigend, wie?
Mit zweiundachtzig
Der Schuß ist noch nicht losgegangen,
Da stehen die Betreuer heute schon parat.
Wie kommt es,
Daß du ohne „seelischen Beistand“
So alt geworden bist?
Dabei wäre er bitter nötig gewesen,
In Situationen, die unerträglich waren.
Zum Beispiel als ihr in der Kindheit
Zu Bettnässern und Stotterern wurdet.
Ihr verlassen wurdet.
Als die Russen kamen,
Als die Mutter nur um den Verlorenen trauerte
Und dich vergaß.
Als du unbedarft
Die Flucht nach vorn antratest
Mit 36 zum ersten Mal das Wort Orgasmus hörtest
Von Tuten und Blasen keine Ahnung, bis heute nicht.
Wo bleibt die Seelsorge,
Wenn der alte Mensch abgeschoben wird
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Wo sie ohne ihn „sicherer sitzen“ würden?
Wo aber kommt immer wieder die Energie her,
Die dich aus der Tiefe nach oben trägt
Und dich selbst zum Betreuer werden läßt.
Ist das Gott?
Das Alter
Es dauert
bis man sich kennt,
nicht mehr in die Irre rennt
und das Gespür
für den „bess’ren Sinn“
sich entwickelt hat.
„Wer die Nachtigall stört“
hieß ein Film deiner Jugend,
nach dessen Hauptdarsteller
wähltest du den Vater deiner Kinder.
Wann hat man begriffen,
dass der Andere,
den man zu lieben glaubt,
sich gestört fühlt?
Hand auf der Schulter:
„Was hast du denn,
wird schon wieder.“
Ja, was hat man denn?
Weiß man das?
Nichts davon weiß man,
es bleibt Unterschwelliges,
nicht zu deuten,
unbefriedigend
und so dunkel.
Aber wenn du dich
freigeschwommen hast,
erhebst du dich
über dich selbst hinaus
und gliederst dich ein
in den Club
der Seligen
der Glücklichen
der sich Sehnenden
der sich Gestört-Fühlenden.
Unten steht der Leichenwagen
Unten steht der Leichenwagen,
Nein, noch nicht für mich bestimmt.
Eine andre wird hinausgetragen,
Deren Stimme man nicht mehr vernimmt.
Meine will noch immer singen
Vom Leben hier und jetzt,
In Tönen, die verwehn und klingen
Immerfort bis ganz zuletzt.
Zuletzt wird wieder Anfang sein,
Wird schließen sich der Ring.
War es ein Traum? War’s Wirklichkeit?
Das Leben ist ein seltsam Ding.
Die Tilsiterin
für Erika
Das Telefon klingelt: „Ich weiß niemanden, den ich darum bitten könnte, nur Dich.“
Es ist die Tilsiterin, die, wie ich gehört hatte, sehr sehr krank sein sollte. Irgendwie waren wir auseinander ge kommen, aber nie aus dem Sinn. Um was es sich handle, will ich wissen. „Ich würde so gerne noch einmal Spirkel mit Schmandsoße essen und Kartoffelbrei.“
Na klar, mache ich das. Es soll mir eine Ehre und Ver gnügen sein. Gleich auf das Rad und zum Fleischer gefahren. Schön durchwachsener Schweinebauch muß es sein, und weil ich es noch in Erinnerung habe, dass sie es am liebsten paniert als Schusterkotelett ißt, lasse ich die Scheiben etwas klopfen. Also paniert in die Pfanne und nach dem Braten darin gleich die Schmandsoße machen. Kartoffelbrei wie er sein muß: mit heißer Milch und etwas Muskatnuss.
Damit alles warm bleibt, in Tücher packen und dann los. Es sind ungefähr zwanzig Minuten mit dem Rad. Schon bevor ich läute, geht der Türöffner. Sie hat mich also kommen sehen. Oben empfängt sie mich in der offenen Tür und ich versuche, mir meine Betroffenheit nicht anmerken zu lassen. Aber wir kennen uns zu genau und müssen uns nichts vormachen. „Wie der Dalai Lama“, versucht sie zu scherzen und nimmt die Perücke ab, die sie nach der Bestrahlung tragen muß, weil ihr die Haare ausgegangen sind.
Nun aber erst das ersehnte Gericht. Während sie ißt, gehe ich auf den Balkon, der das Ausmaß ihrer Erkrankung zum Ausdruck bringt: keine einzige Pflanze in den Kästen, kein Topf, keine Polster auf den Stühlen, die zu sammengestapelt in der Ecke stehen, keine Decke auf dem Tisch. Trostlos. Das war immer ihr schönstes: der Sommer auf dem Balkon. Alles fand auf ihm statt, vom Frühstück bis zum Schlummertrunk.
Jetzt kommt sie. Statt der Perücke hat sie einen Turban auf, der ihr sehr gut steht. Während des Krieges hatten die Frauen aus einem Schal sich solche Kopfbedeckungen gezaubert. „Es war wunderbar“, sagt sie, „ich kann das Essen auf Rädern nicht mehr sehen. Schon vom Geruch wird mir übel.“ Sie hat abgenommen, sie, die immer unter ihrer Vollschlankheit litt, hat jetzt das „ideale Gewicht“, wie sie ironisch sagt. Wir sehen uns an und es gibt nichts zu sagen. Als ob die letzte Krankheit das eigentliche Wesen des Menschen sichtbar macht, so kommt es mir vor. Ich verspreche wiederzukommen und das Versprechen halte ich bis zum Schluß.
Während ich langsam nach Hause fahre, sind meine Gedanken noch ganz bei ihr und ich denke dies und das. Wie sie damals zusammen mit ihrem Mann in diese von ihr so geliebte Wohnung zog. Eine Seligkeit, eine Wohnung für sich allein. Zwei Dauerflüchtlinge wollten seß haft werden! Wie begeistert sie war, wie verliebt in das Leben, erst zu zweit und auch dann noch, als sie allein bleiben mußte. Mit welchem Genuß sie wirtschaftete! Nie habe ich einen Menschen erlebt, der das einfache Dasein mehr genießen konnte als sie. Mit welcher Freude und Appetitlichkeit sie sich den Genüssen des Lebens hingeben konnte. Immer proper, und man verstand vielleicht, was Goethe mit dem Dunstkreis meinen mochte, in dem man sich „satt weiden konnte“. Und sie wußte, denke ich, dass es eine Gnade war, so beschaffen zu sein.
Einmal sagte sie mir in der letzten Zeit, als wir darauf zu sprechen kamen: „Und das alles muß mit mir enden.“ Wirklich, ewig schade.
Weihnachten. Sie, weiß beschürzt in der duftenden Küche. Auf dem Herd im ovalen Bräter der Karpfen in brauner Butter, daneben die schlesischen Weißwürste für Walterchen. Fühlte sich jemand im Haus an solchen Tagen einsam, hier war er willkommen. Früher, selbst erfahren. Sie spürte am Telefon, wenn mir nicht besonders war. „Setz dich auf’s Rad und komm. Ich koch uns was.“ Leib und Seele sind eine Einheit, ein „per Tritt“, wie sie es zu nennen pflegte. Ob das „Wasserpolnisch“ ist?





























