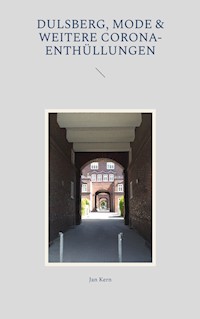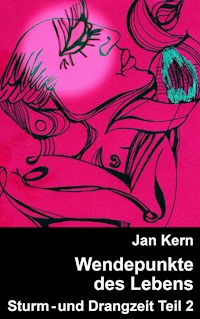Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rene Krügers Leben verlief eher wie eine ständige Berg- und Talfahrt, begleitet durch Verluste, Niederlagen und Enttäuschungen. Nun zieht er schriftlich schonungslos Bilanz über seinen bisherigen Werdegang. Er erhofft sich dadurch endlich den Durchbruch als Autor zu schaffen und somit den entscheidenden Wendepunkt des Lebens zu erreichen. Doch hat er tatsächlich eine reale Chance?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. Kapitel
Gedankenversunken blickte ich aus dem Fenster meines Wohnzimmers. Der Blick in den Hinterhof versprach verheißungsvoll neue Hoffnungen. Der Wonnemonat Mai kam dabei zu seiner vollen Entfaltung. Der graublaue Schleier des Winters wich der strotzenden Kraft der Sonne. Die trostlose Dunkelheit gehörte daher vorerst der Vergangenheit an. Und die Bäume trugen wieder ihr gewohntes Blätterkleid. Trotz all dieser guten Voraussetzungen, wusste ich nichts mit mir anzufangen. Eine erschreckende Antriebslosigkeit hinterließ bei mir merklich ihre Spuren. Eine Negativität setzte sich in meinem Gehirn fest. Dagegen konnte ich nichts machen. Ein Gefühl der Machtlosigkeit?
Unwiderruflich drang mir ins Bewusstsein, dass einiges in meinem Leben schiefgelaufen sein musste. Brachte mich diese Erkenntnis weiter? Schwer zu sagen. Zumindest war ich an einen Punkt angelangt, wo ich Teile meines bisherigen Lebens in Worte zu skizieren beabsichtigte. Bei diesem Prozess des Brainstormings wollte ich mich stets bemühen, ehrlich zu sein, vor allem mir selbst gegenüber. Zugegebenermaßen entlarvte sich dieses Vorhaben als ein schwieriges Unterfangen. Dennoch stellte ich mich dieser Herausforderung. Dabei erwies es sich als besonders problematisch, den richtigen Anfang zu finden.
Zu Beginn möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist René Krüger. Mittlerweile näherte ich mich der Mitte meines Lebens an. Offen gesagt, wusste ich nicht, wo ich jetzt genau stehe. Unsere Gesellschaft erlebte ich meist nur als Kriegsschauplatz, brutal und rücksichtslos. Waffenstillstand gab es kaum. Und Frieden war für mich bisher leider nur ein Wunschtraum geblieben. Ständig begab ich mich auf das Schlachtfeld und kämpfte um das nackte Überleben. Meistens habe ich gewonnen oder erzielte zumindest ein Teilerfolg. Jedoch musste ich auch notgedrungen einige Niederlagen akzeptieren.
Momentan fühlte ich mich des Kämpfens müde. Ein Anzeichen von Lebensmüdigkeit? Alles erschien mir irgendwie sinnlos. Woher sollte ich meine Motivation nehmen, weiterzumachen? Ich irrte ziellos durch meine Gedanken und fand den Weg nicht mehr. Dabei verharrte ich immer mehr in der Orientierungslosigkeit. Eine traurige Erkenntnis, der ich mich nun stellen musste.
Jetzt aber der Reihe nach. Zurzeit war ich wieder einmal arbeitslos. Übrigens schon zum dritten Mal in meinen Leben. Zweimal musste ich mich arbeitslos melden, weil ich ein Studium aus Gründen der Geldknappheit beendete. Und ein weiteres Mal wurde ich arbeitslos, weil mich die Firma wegen schlechter Auftragslage auf die Straße setzte. Finanziell bestand eine Abhängigkeit von Arbeitslosengeld II. Manchen ist es besser bekannt unter den Begriff Scheiße IV. Dieser Ausdruck beschreibt inhaltlich am Besten, was er tatsächlich verkörpert, nämlich ein Häufchen bürokratischen Stuhlgang, der den Bedürftigen von Staat angeboten wird, nur um die Illusion zu erwecken, dass es doch ein Instrument gegen die Armut in unserem Land gibt.
Mit dem Austragen des Hamburger Abendblattes verdiente ich mir bisher 160 Euro hinzu, um materiell besser über die Runden kommen. Dies entsprach genau den Betrag, den mir der Staat bei einem Einkommen von 400 Euro zugestand. Der Rest wurde von den staatlichen Leistungen abgezogen. Im Klartext bedeutete es, dass ich nur 40 % meines Lohnes behalten durfte. Ist diese Vorgehensweise des Jobcenters leistungsgerecht und sozial ausgewogen? Diese Frage muss sich der Leser dieser Zeilen selbst beantworten.
Zu den Fakten konnte ich nur ergänzen: Für den Zuverdienst musste ich bisher sechs Tage die Woche um 3.15 Uhr aufstehen und bei Wind und Wetter die Zeitungen an die Kunden verteilen. Dabei durfte ich mindestens fünfzehn Stunden pro Woche unterwegs sein. Bei schlechtem Wetter, wie beispielsweise bei Schnee und Eis, kamen noch unbezahlte Überstunden hinzu. Ein hartes Brot, was aber zurzeit meine materielle Existenz absicherte.
Heutzutage ist es nur selten üblich, dass jemand längerfristig einen Arbeitsplatz sicher hat. Dieses Glück genießen meist nur Beamte. Wer in unserer Zeit für drei bis vier Jahre einen Job inne hat, muss sich damit zufrieden geben und kann sich sogar glücklich schätzen. Die hohe Fluktuation am Arbeitsmarkt wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte zur bitteren Alltagsrealität in unserer Gesellschaft.
So gesehen, konnte ich zu mir selbst sagen: „Willkommen im Klub“.
Denn mit meiner Lebensgeschichte lag ich voll im Trend und blieb daher in diesem speziellen Punkt zumindest gesellschaftskompatibel.
Es wurde schnell erkennbar, dass ich mir solche Situationen nicht unbedingt selbst aussuchte. Vielmehr gewann ich den Eindruck, dass sich die Situationen mich aussuchten. Meine Vergangenheit ebnete mir keinen gradlinigen Verlauf, sondern repräsentierte eher eine waghalsige Berg- und Talfahrt. Häufig kam ich mir vor wie in einer Achterbahn, wo ich im Rausch der Geschwindigkeit durch alle Höhen und Tiefen, gelegentlich auch kopfüber, davonraste, ohne das Geschehen wirklich kontrollieren zu können. Diese Tatsache machte mir enorme Angst. Und es grenzte an einen Wunder, dass ich mich nicht bisher ständig übergeben musste, obwohl mir oftmals zum Kotzen zumute war und sich ein gewisser Brechreiz nicht immer vermeiden ließ.
Wie kann ich mich am besten beschreiben? Wer bin ich? Was bin ich? Immer stärker reifte in mir der Wunsch, ein Teil meiner Lebensgeschichte aufzuschreiben. Dabei ließen sich unbequeme Wahrheiten nicht vermeiden. Sie wurden zu einem wesentlichen Bestandteil meines Ichs. Konnte mich diese Tatsache überfordern? Ich musste es auf mich zukommen lassen. Nun offenbarte sich mir der einzige Weg, um wieder aus dem Dilemma meines Lebens herauszukommen.
Allgemein ist festzustellen, dass ich vielseitig bin. In meinen bisherigen Leben füllte ich unterschiedliche und abwechslungsreiche Funktionen aus. Dazu gehörten Industriekaufmann, Philosoph, Kunstmaler, Dichter, Hurenstecher, Lebens- und Überlebenskünstler und Krankenhauspatient. Darüber hinaus würde ich mich als beruflichen Versager und als gescheiterte Existenz bezeichnen. Insgesamt also ein Allroundtalent in jeder Hinsicht. Die Aufzählung machte mir deutlich, dass ich eigentlich über ausreichend Intelligenz und Lebenserfahrung verfügte, um in dieser absonderlichen Gesellschaft überleben zu können. Dennoch gelang es mir nicht, die Misere meines Daseins zu beenden. Vermutlich lag es daran, dass ich mich diesem gesellschaftspolitischen System nicht anpassen und unterordnen konnte. Es widersprach meiner inneren Natur. Nach meiner persönlichen Auffassung leben wir in einer kranken und nahezu unheilbaren Gemeinschaft. Ihr bisheriges angebliches Erfolgsrezept lautet: Etwas sein, etwas mehr Schein und sehr viel Schwein.
Jeder kocht dabei sein eigenes Süppchen. Und Solidarität ist in diesem Zusammenhang meist ein Fremdwort, das für viele Menschen unbekannt ist. Kein Wunder also, dass es keine wesentlichen Fortschritte in der gesellschaftlichen Ordnung gibt. Die Schuld nur bei den Politikern zu sehen, wäre sehr einfach. Die Politiker sind letztlich nur unser eigenes und erschreckendes Spiegelbild. Jeder von uns sollte stattdessen lieber den Dreck vor der eigenen Haustür kehren. Solange dies allerdings nicht passiert, bleibt alles wie es bisher war.
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass unsere Gedanken frei sind. Jedoch, sind sie es tatsächlich? Oder werden sie durch unsere Gesellschaft und Umwelt beeinflusst beziehungsweise manipuliert? In jedem Fall sind sie von unserer Lebenssituation abhängig. Diese Aussage, so denke ich, hat Allgemeingültigkeit. Nach meiner Lebenserfahrung ist es eine feststehende Tatsache. Sie lässt sich weder leugnen noch ignorieren. Zu diesem Thema verfasste ich ein Gedicht.
Die Gedanken
Der Prozess des Denkens beginnt mit der Geburt eines jeden
einzelnen Menschen.
Die Situationen des Alltags nehmen mehr und mehr Besitz von
unseren Gedanken ein.
Unsere Gedanken sind nur noch ein Spiegel der Umwelt.
Daher frage Dich selbst: „Wessen Gedanken sind es?“
Die Gedanken können die Freiheit nicht mehr erlangen.
So erkenne nun die Illusion Deines Lebens!
Im Zusammenhang mit diesem Gedicht spielten mir häufig meine Gefühle den einen oder anderen bösartigen Streich, geprägt durch Angst und Selbstzweifel. Gefühle präsentierten sich rückblickend vielfach als Ausdruck einer Überforderung. Dabei kam es immer wieder zu Verwirrungen meiner Empfindungen. Ständig war ich im Gefühlschaos hin- und hergerissen. Ein Wechselspiel zwischen Vernunft und Gefühl kam irgendwann zum Ausbruch. Ein regelrechter Zweikampf zwischen meinen Verstand und meinen Emotionen ist entbrannt. Wer wird gewinnen? Bisher war dieses Duell noch nicht entschieden. Es blieb also weiterhin spannend.
Was könnte das Motiv für das Schreiben sein? Vermutlich wollte ich mich besser begreifen lernen. Somit entwickelte sich der heutige Tag als eine Art Selbstauslöser für eine spezielle Therapieform. Ich begann nun, endlich wieder einen Sinn in meinem Dasein zu erkennen. Dies hilft mir hoffentlich, meinen inneren Tiefpunkt zu überwinden.
„Vielleicht werde ich sogar meine unerträglichen und lästigen Depressionen los“, hoffte ich zumindest. „Sonst bekomme ich mein Leben nicht mehr in den Griff“, überlegte ich weiter.
Mein seelisches und nervliches Gleichgewicht geriet ins Wanken. Momentan empfand ich mein Leben als erbärmlich. Liebe entlarvte sich als trügerische Illusion. Und mein Alltag wurde begleitet von Bitterkeit und Traurigkeit. Ich verspürte nicht einmal Lust auf Sex. Das Leben fickte mich täglich. Meine künftigen Aufzeichnungen repräsentieren für mich diesbezüglich die ideale Möglichkeit, mich gedanklich auszukotzen.
Zwischenzeitlich vergingen fast unbemerkt mehrere Stunden an Zeit. Nun saß ich immer noch im Wohnzimmer meiner spartanisch eingerichteten Wohnung und zog mithilfe meines Notebooks schonungslos Bilanz über meine ruhmreiche Vergangenheit. Neben mir auf dem Tisch stand ein Glas mit Rum-Cola. Dies benötigte ich, um meine schwachen Nerven zu beruhigen. In Notsituationen ist es eines meiner Lieblingsgetränke. Gelegentlich missbrauche ich dieses widerliche Gesöff, um besser durch den Tag zu kommen. Jedoch als Alkoholiker würde ich mich dennoch nicht sehen. Ich kann jederzeit mit dem Trinken aufhören. Der beste Beweis dafür ist, dass ich phasenweise über mehrere Monate keinen einzigen Tropfen Alkohol anrühre. Ein wahrer Trinker braucht dieses Ritual nahezu täglich. Sonst hat er Entzugserscheinungen, die er nicht mehr beherrschen oder kontrollieren kann. Dies ist meines Erachtens der entscheidende Unterschied. Trotzdem musste ich höllisch aufpassen, dass ich nicht die Kontrolle verliere. Diese Gefahr durfte ich keineswegs unterschätzen. Welche fatalen Konsequenzen Alkohol haben kann, wenn man nicht aufpasst, musste ich schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Unter Umständen hätte es sogar mein Leben kosten können. Zweifelsfrei musste ich in diesem Zusammenhang meine Lektion lernen.
Allerdings stellte ich mir hierbei auch die Frage: „Habe ich tatsächlich zu viel getrunken? Oder hat mir irgendjemand bei einer Party eine verbotene Substanz ins Getränk getan“?
Diese Frage muss eventuell an anderer Stelle meiner Aufzeichnungen beantwortet werden. Momentan würde es mich überfordern. Darum verschwendete ich vorerst keinen weiteren Gedanken daran.
Eigentlich sollte ich als gelernter Kaufmann in der Lage sein, eine Bilanz zu erstellen. Jedoch ging es bei dieser Bilanz nicht um nüchterne Zahlen, sondern um Gefühle. Diese Tatsache drang augenblicklich immer stärker in mein Bewusstsein ein. Darüber hinaus kann diese Lebensbilanz auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Einige Erinnerungen sind nur noch schematisch in Bruchstücken vorhanden. Andere wiederum sind mir gegenwärtig, obwohl sie zeitlich lange zurückliegen. Hierbei handelte es sich um Schlüsselerlebnisse, die mein Leben bewusst oder unbewusst stark geprägt und beeinflusst haben. Oftmals sind es entscheidende Wendepunkte des Lebens. Diese werden fortan meine künftigen Aufzeichnungen dominieren, soviel sei an dieser Stelle gewiss.
Wohin mich das Abenteuer des Schreibens hinführen wird, blieb abzuwarten. Zumindest erkannte ich wieder einen Lichtblick am Horizont. Die Antriebslosigkeit verschwand. Darauf konnte ich aufbauen und sagte zufrieden: „Gute Nacht“.
2. Kapitel
Nach einen ausgiebigen Frühstück setzte ich mich an das Notebook und eröffnete meine Lebensbilanz mit meiner Ankunft auf einen Planeten namens Erde. Zielort des Reisetrips: Bundesrepublik Deutschland, Stadt Hamburg, Stadtteil Barmbek, Krankenhaus Finkenau. Der Zeitpunkt des Ereignisses war Montag, der 15. Juli 1968 zwischen 6.30 Uhr und 7.00 Uhr morgens. An die präzise Uhrzeit dieses wagemutigen Vorhabens kann sich niemand genau erinnern. Nicht einmal meine Mutter kann es. Hingegen an die tragischen Umstände meiner Ankunft konnte sie sich sehr gut entsinnen. Bekannt ist, dass meine Landung im wahrsten Sinne des Wortes eine schwere Geburt repräsentierte. Nach den Angaben meiner Mutter, die ich ab sofort Hanna nennen werde, verlief es hochdramatisch und alles geriet unter starken Turbulenzen. Ich bin im Geburtenkanal steckengeblieben und verfügte über keine Chance, aus eigener Kraft herauszukommen. In diesem Augenblick schnappte ich wahnsinnig nach Luft und drohte zu ersticken. Mein Körper lief blau an, weil mein Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde. Der Countdown für die Lebensrettung lief währenddessen unnachgiebig weiter.
Für das nähere Verständnis der Leser muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass eine Rettungsaktion mithilfe des Kaiserschnittes damals noch niemand kannte. Daher bin ich das Ergebnis einer sogenannten Zangengeburt. Alles geschah im Wettlauf gegen die Zeit. Fast wäre mein Geburtstag auch mein Sterbetag gewesen. Glück oder Pech gehabt? Eine Frage, die mir schon mehrfach in diesem Zusammenhang gestellt habe. Eindeutig beantworten kann ich sie mir bis heute nicht.
Ist der Verlauf meiner abenteuerlichen Geburt symbolisch oder sogar charakteristisch für mein ganzes bisheriges Dasein? Zumindest leicht hatte ich es meistens nicht in meinem Leben. Eine Folge der schweren Geburt wurden die schmerzhaften Krämpfe, unter die anschließend litt. Erst starke Medikamente brachten meine Krämpfe allmählich zur Ruhe. Ich kam zu Beobachtung auf die Wachstation des Krankenhauses. Der Neurologe der Station bezeichnete meinen Zustand als zerebrales Krampfleiden mit epileptisch-ähnlichen Anfällen. Bei stärkeren Anfällen verlor ich die Kontrolle über meinen Körper. Es zeigten sich die gleichen Symptome, wie bei meiner Geburt. Der Körper verkrampfte sich total und verfärbte sich blau. Die Anfälle zeigten keine erklärlichen Auslöser. Sie blieben ein Rätsel und kamen überraschend und völlig unerwartet, wie ein Blitzschlag. Meine Eltern mussten mich in bestimmten zeitlichen Intervallen schnell ins Krankenhaus bringen, da sonst akute Lebensgefahr für mich bestand. Für sie eine schwierige und sorgenvolle Zeit. An ihrer Stelle hätte ich ehrlich gesagt die Rollen nicht unbedingt tauschen wollen. Es lastete eine große Verantwortung auf ihren Schultern, die nur wenige tragen können.
Vor allem wenn einer der Stationsärzte zu Hanna sagt: „Entweder Ihr Sohn stirbt oder er wird ein Idiot“.
Mit dieser Aussage der Mediziner wollte sich Hanna nicht abfinden und noch weniger anfreunden. Stattdessen vertraute sie auf ihre Intuition als Mutter. Auf eigene Verantwortung nahm sie mich gegen das Anraten der Ärzte mit nach Hause. Bei ihr entstand das Gefühl, dass ich im Krankenhaus nicht mehr gut aufgehoben war. Ab sofort wurde unser Balkon über mehrere Monate mein Kinderzimmer draußen im Freien. Nur zu den Mahlzeiten holte mich Hanna in die Wohnstube. Sie vertrat die Auffassung, dass frische Luft gut für meine Gesundheit sei. Bei jedem Wetter befand ich mich unter dem Freilichthimmel. Mein Immunabwehrsystem wurde gestärkt und zeitweilig verringerten sich sogar die Krämpfe. Rückblickend würde ich sagen, dass meine Mutter mit ihrem intuitiven Handeln mir vermutlich das Überleben absicherte. In dieser Hinsicht habe ich ihr viel zu verdanken. Dies ist auch meines Erachtens ein Beleg dafür, dass der Instinkt einer Mutter eine wunderbare Einrichtung der Natur ist. Ich würde sogar behaupten wollen, dass er den meisten hochintellektuellen Wissenschaftlern in Sachen Sozialkompetenz überlegen ist. Vielleicht mag es für einige eine gewagte These sein, aber meine Lebensgeschichte ist der beste Beweis für die Richtigkeit meiner Argumentation.
Trotz der kontinuierlichen Sauerstoffzufuhr brauchte ich weiterhin meine Medikamente gegen die Krämpfe. Als Hanna das Rezept dafür in der Apotheke in der Brucknerstraße einlösen wollte, weigerte sich Herr Lose die Tabletten herauszugeben.
„Frau Krüger, das Medikament kann ich Ihnen für Ihren Sohn nicht aushändigen“, gab er ihr mit Besorgnis zu verstehen.
„Warum nicht“, fragte Hanna verwundert.
„Für einen Säugling ist es nach meiner persönlichen Auffassung zu stark. Der Arzt muss sich vertan haben“, untermauerte der Apotheker seinen Standpunkt.
Herr Lose hielt es für ein Versehen, dass ein Säugling ein so heftiges Medikament verschrieben bekommt. Das Medikament, welches ich etwa bis zum elften oder zwölften Lebensjahr einnehmen musste, hieß übrigens Zentropil. Im Krankenhaus wurden sämtliche Drogencocktails ausprobiert, um mein Krampfleiden unter Kontrolle zu bringen. Diesbezüglich bekam ich die Rolle eines menschlichen Versuchskaninchens zugedacht. Ich möchte gar nicht wissen, welche Experimente die Ärzte mit mir durchführten, um die richtige Arznei zu finden. Einfach gruselig an dieser Stelle, wieder an dieses Kapitel meines Lebens erinnert zu werden, aber ich konnte es nicht ignorieren. Es gehörte einfach dazu. Letztlich half nur Zentropil gegen meine Anfälle. Erst als mein damaliger Kinderarzt Dr. Heinz Reimer die Richtigkeit des Rezeptes bestätigte, wurden Hanna die Tabletten ausgehändigt.
„Der Kinderarzt hat es mir bestätigt, dass es sich hierbei um das richtige Medikament handelt. Trotzdem habe ich immer noch eine gewisse Skepsis“, meinte Herr Lose bei der Übergabe.
Die Vorsicht des Apothekers erwies sich als verständlich und zeugte von großem Verantwortungsbewusstsein. Zwar konnte Zentropil meine Krämpfe unter Kontrolle bringen, aber es benebelte auch meinen Verstand. Auf meine Mitmenschen wirkte ich oftmals geistesabwesend und vielfach auch seltsam oder sonderbar. Diese Tatsache machte mich in dieser ehrenwerten Gesellschaft zum Einzelgänger und Außenseiter. Meist gab es nur wenige oder gar keine Freunde in der Schule. Hänseleien blieben für mich an der Tagesordnung. Oftmals musste ich mir Beschimpfungen anhören, wie z. B. „Du Idiot“, „Bist du geistig behindert“ oder „Du Spastiker“. Diese Form der Diskriminierung fraß mich innerlich auf und machte mich rasend vor Wut. Ich entwickelte einen massiven Hass auf die Menschheit. Diese Ablehnung richtete sich auch gegen mich selbst. Denn meine schulischen Leistungen schienen die Werturteile meiner Mitschüler zu bestätigen. Sie reichten gerade aus, um nicht sitzenzubleiben. Und die Versetzung von der zweiten in die dritte Klasse erfolgte laut Vermerk im Zeugnis nur aus pädagogischen Gründen. Häufig standen in den Zeugnissen auch Kommentare wie „unaufmerksam im Unterricht“, „schlampige Heftführung“, „leicht reizbar“ oder „arbeitet im Unterricht nur mit, wenn ihm das Thema interessiert“. Durch solche Statements fühlte ich mich wie ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. In meiner Schulzeit wurde mir als Kind die menschliche Würde genommen. Mein Selbstvertrauen erreichte in diesem Lebensabschnitt seinen ersten emotionalen Tiefpunkt.
Meine damalige Klassenlehrerin Frau Barbara Kiel, die mich in der zweiten Klasse unterrichtete, wusste überhaupt nicht, wie sie mit mir umgehen sollte. Sie war schlichtweg überfordert. Statt sich Hilfe von einem Profi zu holen, machte es sich die sogenannte schulische Spitzenkraft lieber einfach und bequem, indem sie versuchte, mich loszuwerden. Und solche Lehrer werden nach dem Studium auf die Menschheit losgelassen? Für mich zweifelsfrei ein bahnbrechender Skandal, der leider nie öffentlich gemacht wurde. Die Schule entlarvte sich für mich daher oftmals als ein Käfig voller Narren, der von der Gesellschaft viel zu ernst genommen wurde. Ich kann es keineswegs nachvollziehen, dass solche unfähigen Leute für die spätere Zukunft eines Kindes prägend und mitentscheidend sind. Nach meinen persönlichen Empfinden handelt es sich vielmehr um eine globale Katastrophe, die unsere Wertegemeinschaft viel zu stark kontrolliert und beherrscht. Über die massiven Schäden, die solche Missstände verursachen, möchte ich erst gar nicht vertiefend nachdenken müssen. Die Lehrer sind nicht immer ausreichend auf ihre Aufgaben im Beruf vorbereitet. Ein trauriges und erschreckendes Fazit. Übrigens: Schadensmeldungen, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, werden in den Medien selten veröffentlicht. Warum? Eine berechtigte Frage, die für mich unbeantwortet bleibt.
Zu meiner Mutter sagte Frau Kiel: „Ihr Sohn ist nicht einmal für die Sonderschule geeignet“.
Hanna empörte sich über diese Anmaßung.
„Es ist eine Unverschämtheit, was Sie sich herausnehmen. Wie können Sie es wagen, solche Sachen über meinen Sohn zu sagen? Bei Ihnen ist er nicht gut aufgehoben. Ich werde dafür sorgen, dass René die Schule wechselt“.
Die Lehrerin zeigte sich äußerlich von Hannas Empörung unbeeindruckt.
„Dies ist eben meine Meinung als Pädagogin. Und ich glaube kaum, dass ein Schulwechsel zu einer Verbesserung der schulischen Leistungen führen wird“.
„Wir werden sehen“, sagte Hanna am Schluss des Gespräches mit fester Entschlossenheit.
Sie ließ klar durchblicken, dass sie nichts von ihrem Vorhaben abbringen wird. Die Lehrerin schwieg. Sie konnte nichts entgegensetzen.
Aus Hannas Sicht disqualifizierte sich Frau Kiel mit dieser Äußerung als Musterpädagogin und nahm mich von der Schule in der Brucknerstraße herunter, um mich woanders wieder einzuschulen. Ich kam auf die katholische Schule St. Sophien in der Elsastraße.
Heutzutage frage ich mich allerdings, warum mich Hanna ausgerechnet dort eingeschult hat. Denn wir repräsentierten keinen kirchlichen Haushalt. Die Erziehung meiner Eltern verfügte über kein typisches christliches Gütesiegel. Die Religion spielte bei uns zuhause nicht einmal eine kleine Nebenrolle. Hanna trat aus der Kirche aus, um keine Kirchensteuer zahlen zu müssen. Und mein Vater Heinrich wurde nie getauft. Zumindest blieb es so in meiner Erinnerung. Hanna hoffte vermutlich insgeheim auf christliche Nächstenliebe. Vermutlich ging sie davon aus, dass in dieser Schule das soziale Miteinander stärker gefördert wird. Eine andere Erklärung für ihre Entscheidung fand ich nie. Jedoch sah die Realität leider anders aus. Ich bekam sogar das Gefühl, dass dort die Hänseleien noch stärker zunahmen. Das Gebet vor dem Unterricht und die gelegentliche Mitgestaltung einer Schulmesse konnten von dieser Tatsache nicht ablenken.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an das Jahr 1977. Ich kam in die Kindertagesstätte der katholischen Schule, wo die Kids nach dem Unterricht bis 17.00 Uhr hingehen konnten. Dort gab es Mittagessen, die Schüler konnten ihre Hausaufgaben machen und anschließend spielen. Zweifelsfrei eine große Entlastung für berufstätige Eltern. Für mich repräsentierte dieser Ort allerdings nicht unbedingt immer ein gewünschtes Heimspiel.
Denn in dieser Einrichtung riefen mir regelmäßig einige Kinder zu: „Du Idiot“.
Oder auch: „Du Spastiker“.
Also die bewährten Klassiker der verbalen Gewalt, die ich bereits schon aus der vorigen Schule kannte. Diese Form des Mobbings verletzte meine Gefühle zutiefst. In meinem maßlosen Zorn schubste ich zwei der Anstifter, sodass sie zu Boden fielen. Anschließend stieß ich zwei längliche Sitzbänke mit meinen rechten Fuß um. Doch die Kinder wollten mich trotzdem nicht in Ruhe lassen und stichelten mich weiter mit ihren bösartigen Worten. Bei mir stauten sich die Aggressionen, und ich ging wie ein Amokläufer auf sie los, in der Absicht, sie zu verprügeln. Frau Schmidt, die Leiterin dieser Einrichtung, versuchte mich zu bändigen. Jedoch ich schleuderte sie mit aller Kraft gegen einen Tisch. Dabei holte sie sich an Arme und Beine blaue Flecken. Danach schnappte ich mir meine Jacke und meine Schultasche und ging kommentarlos nach Hause, damit die Situation nicht weiter außer Kontrolle geriet.
Am nächsten Tag entschuldigte ich mich bei Frau Schmidt für die Blessuren, die ich ihr zugefügt habe. Sie akzeptierte zwar meine Entschuldigung, aber die Angelegenheit bekam trotzdem einen bitteren Beigeschmack. Es wurde nur eine einseitige Schuldzuweisung vorgenommen. Die Kinder, die mich tags zuvor provozierten, kamen ungeschoren davon. Sie wurden nicht einmal zur Rede gestellt. Dies prägte mich ein Großteil meiner Schulzeit. Mein Vertrauen in gewisse gesellschaftliche Institutionen wurde zunehmend erschüttert. Gleichzeitig entwickelte ich einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ungerechtigkeiten kann ich bis heute nicht ertragen. Vielleicht bin ich sogar ein Gerechtigkeitsfanatiker.
Meine schulischen Leistungen besserten sich nicht. Bis einschließlich der vierten Klasse erhielt ich Unterricht bei meiner Klassenlehrerin Frau Erika Frank. Sie wirkte nicht nur streng, sondern auch verbiestert und verbissen. Keine Freundlichkeit oder Herzlichkeit ließ sie in ihren Gesichtszügen erkennen. Vielmehr verfügte sie über die Ausstrahlung einer hässlichen Vogelscheuche. Wahrscheinlich befand sich nie ein Mann an ihrer Seite. Bestenfalls verheiratet mit ihrer Kirche und der Schule. Wer nimmt schon so eine Frau? Ich gehe davon aus, dass sie ein Kruzifix als Dildo benutzte, um sich sexuell abzureagieren.
„Was sollte sie sonst machen? Selbst ist die Frau“, dachte ich später rückblickend.
Dieser Teil meiner Fantasie erscheint mir durchaus realitätsnah zu sein, weil die Katholiken ohnehin einen Hang zur Perversion haben, ausgelöst durch eine verklemmte und scheinheilige Sexualmoral. Nach meinen persönlichen Empfinden müssen sie in dieser Angelegenheit als absolut unheilbar eingestuft werden.
Die Verkörperung der christlichen Nächstenliebe in Gestalt von Erika Frank vertrat eine ähnliche Meinung, wie meine vorige Klassenlehrerin Frau Kiel.
Zu meiner Mutter sagte sie: „René schafft die Anforderung an unserer Schule nicht. Daher empfehle ich Ihnen auf eine Sonderschule zu geben“.
Hanna erwiderte verärgert: „Dies kommt überhaupt nicht infrage. Mein Sohn bekommt Nachhilfeunterricht, wenn er Probleme in einem Fach hat. Mit einer Abschiebung auf einer Sonderschule machen Sie es sich sehr einfach“.
„Ich mache es mir nicht einfach“, wehrte sich Frau Frank energisch.
„Ich möchte nicht, dass mein Sohn auf einer Hilfsschule verblödet. Deshalb lasse ich es nicht zu, dass er dorthin kommt“, gab Hanna meiner damaligen Klassenlehrerin mit Nachdruck zu verstehen.
„Also gut“, lenkte Frau Frank ein, „probieren wir es mit Nachhilfeunterricht in lesen und schreiben“.
Hannas Entschlossenheit verdankte ich es letztlich, dass ich nicht auf einer sogenannten Sonderschule abgeschoben wurde. Dieses Beispiel zeigt mir deutlich, dass niemand zu allen Ja und Amen sagen muss, nur weil es sich um eine kirchliche Einrichtung handelt. Nur um Missverständnisse an dieser Stelle zu vermeiden, muss auch gesagt werden, dass es für staatliche Institutionen genauso gilt. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant erkannte schon frühzeitig, dass ein Großteil der Menschheit unter einer selbstverschuldeten Unmündigkeit leidet. Eine erstaunlich zutreffende Erkenntnis, wenn man in diesem Kontext bedenkt, dass dieser moderne Freigeist selten seine Heimatstadt Königsberg verlassen hat. Kein Bürger sollte jemals eine Selbstverdummung zulassen. Dieser Verantwortung sollte sich jeder von uns bewusst sein und sich entsprechend zur Wehr setzen, wenn die Situation es erfordert. Die Konsequenzen könnten sonst fatal sein. Ich möchte es mir im Kopf nicht ausmalen müssen, was aus mir geworden wäre, wenn Hanna keine Gegenwehr geleistet hätte. Ihr Durchsetzungsvermögen verdankte ich es, dass ich einmal pro Woche Nachhilfeunterricht in lesen und schreiben bekam. Die lange Bahnfahrt nach Altona machte sich gut bezahlt. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.
Meine Nachhilfelehrerin, dessen Name mir momentan entfallen ist, sagte zu mir: „Du bist der beste Nachhilfeschüler, den ich je gehabt habe. Du machst große Fortschritte“.
Diese Aussage machte mich megastolz und baute mich seelisch auf. Zum ersten Mal entwickelte ich so etwas wie Ehrgeiz und Motivation. Ich machte weiter meine Fortschritte in lesen und schreiben, auch wenn sie sich nur unwesentlich in den Schulnoten niederschlugen. Trotzdem musste ich meine Klassenlehrerin Frau Frank überzeugt haben. Immerhin kam ich nicht auf die Sonderschule.
Die Fortschritte im Nachhilfeunterricht änderten allerdings nichts an den Hänseleien in der Schule. Weiterhin wurde ich ausgelacht und als Idiot und geistig behindert verspottet. Wut und Zorn kamen bei mir immer wieder hoch, ähnlich wie bei dem von mir zuvor geschilderten Erlebnis im Kinderhort. Ich entwickelte eine zunehmende Feindseligkeit gegenüber meinen Mitschülern in Form von Aggressionen. Es wurde jeder verprügelt, der mich verbal attackierte. Dafür eignete ich mir sogar Kampfsport an, um in einer Prügelei nicht das Nachsehen zu haben. Nicht selten hatte ich es bei meinen Auseinandersetzungen mit zwei oder drei Gegnern gleichzeitig zu tun. Allein haben sie sich meist nicht getraut, sich mit mir anzulegen. Diese Form der Feigheit ist häufig charakteristisch in unserer Gesellschaft. Nur in Gruppen fühlten sie sich stark. Erbärmlich würde ich heute rückblickend sagen. Jedoch ausgerechnet solche Leute machen später Karriere in unserer Wertegemeinschaft. Eine erschreckende Tatsache.
Den Kampfsport lernte ich von einem Schulkollegen afrikanischer Herkunft, der auch Mitglied in einen entsprechenden Verein war. Mit ihm blieb ich in der Grundschulzeit für ungefähr zwei Jahre befreundet. Er hieß Robin mit Vornamen und hatte das gleiche Alter wie ich. Im Laufe der Jahre entfiel mir der Nachnahme meines Kumpels, weil der Kontakt nach dem Ende der vierten Klasse abrupt abbrach. Unsere Wege trennten sich. Zu meiner Ausbildung gehörte Judo, Karate und ein wenig boxen.
Robin sagte im Bezug auf dem Kampfsport: „Die Ausbildung dient nur dazu, sich zu verteidigen, nicht anzugreifen“.
Ich erwiderte: „Ich will mich nur verteidigen. Ich werde immer von mehreren Jungs auf dem Schulhof geärgert. Dagegen will ich mich im Notfall wehren können“.
„Das ist in Ordnung. Ansonsten dürfte ich dir diese Dinge nicht zeigen“, erklärte mir mein damaliger Kumpel, der diese Regel sehr ernst nahm.
Mit meiner Antwort konnte ich ihn zum Glück überzeugen. Schnell lernte ich, mich zu wehren. Übungsort wurde die Tagesstätte der katholischen Schule. In dieser Einrichtung gab es einen größeren Raum mit Sportmatten. Für Robin und mich das ideale Übungsgelände. Ich wurde zwar kein voll ausgebildeter Kampfsportmeister, aber ich lernte genug, um der Gewalt auf dem Schulhof entgegentreten zu können. Dieses Ergebnis erforderte viel Training und Disziplin, aber es lohnte sich. So wurde ich vom Opfer zum Täter. Was sollte ich sonst alternativ machen? Die Lehrer hatte ich prinzipiell sowieso immer gegen mich. Daher konnten sie für mich keine vertrauensvollen Ansprechpartner sein. Aus diesem Grund blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf dem Platz zu behaupten. Sonst wäre ich der Dauerprügelknabe meines Jahrgangs geworden. Darauf verspürte ich verständlicherweise keine Lust. Als Erwachsener änderte sich meine Meinung zu diesem Thema nicht. Warum auch? Nur auf diese Weise konnte ich mir Respekt verschaffen. Für mich damals die einzige Möglichkeit, den Schulalltag zu überleben. Es galt stets das Gesetz des Stärkeren. In diesem Zusammenhang möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ich verabscheue sogar jede Form der Gewalt. Trotzdem ließ sie sich nicht immer vermeiden. Hanna musste oft wegen meiner Prügeleien beim Schulleiter erscheinen, um mich gegen die Ungerechtigkeit der Lehrer zu verteidigen. Ständig kämpfte sie gegen die Ignoranz und Kleingeistigkeit der Lehrkörper. Dies erforderte viel Mutterliebe, Energie, Hartnäckigkeit und innere Stärke. Über diese Eigenschaften verfügte Hanna, zumindest in jüngeren Jahren, in Überfluss.
Egal, ob ich tatsächlich der Schuldige war oder nicht, ich bekam grundsätzlich immer die Schuld zugesprochen.
Ich befand mich quasi immer auf der Anklagebank und erhielt automatisch das Grundsatzurteil: „Rene´ ist schuldig. Die Verhandlung ist geschlossen“.
Nie wurde eine richtige Untersuchung durchgeführt. Keine Chance auf Verteidigung. Aus welchem Grund auch? Für die Musterpädagogen erwies das Kurzverfahren als schneller und bequemer. Ihr Berufsalltag ließ sich dadurch deutlich angenehmer gestalten.
Ihr Motto hieß: „Warum sich das Leben schwer machen, wenn es auch leichter geht“?
Solche Verhaltensweisen würde man normal nicht in einem demokratischen Rechtsstaat vermuten, sondern eher in einer diktatorischen Bananenrepublik oder in einem Nazi-Regime. Hierbei grenzt es an einen Wunder, dass ich nie einen sogenannten Blauen Brief bekam. Vermutlich bin ich mehrfach knapp daran vorbeigeschlittert. Zum näheren Verständnis muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass der Blaue Brief damals ein Schulverweis bedeutete. Ich will mich keineswegs als reinrassiges Unschuldslamm darstellen, aber der leibhaftige Teufel in Menschengestalt stellte ich auch nicht dar, auch wenn mich einige so sehen wollten.
Auf der katholischen Schule Lämmersieth machte mein späterer Klassenlehrer Herr Prahl in der sechsten Klasse in meinem Zeugnis den Vermerk: „René ist als gemeingefährlich einzustufen“. Hanna erboste sich über die Formulierung meines Klassenlehrers und beschwerte sich beim Schulleiter in seinem Büro. Sie ließ sich kurzfristig telefonisch einen Termin geben.
„Ich möchte, dass diese Formulierung aus dem Zeugnis meines Sohnes verschwindet. Dies schadet seiner Zukunft und wird der Sache auch nicht gerecht“, sage sie sehr entschlossen nach einer höflichen Begrüßung.
Sie kam gleich zum Thema, um ihren Anliegen Nachdruck zu verleihen. Der Schulleiter zeigte sich äußerlich unbeeindruckt.
„Wieso“, erwiderte er, „Ihr Sohn neigt nun mal zu Gewaltausbrüchen. Das ist allgemein bekannt. Dies hat er sich selbst zuzuschreiben. Die Formulierung bleibt unverändert im Zeugnis stehen. In dieser Angelegenheit diskutiere ich nicht weiter mit Ihnen“.
Zum ersten und einzigen Mal fühlte sich Hanna gegenüber der schulischen Institution machtlos und musste sich gezwungenermaßen geschlagen geben. Der scharfe Ton des Rektors blieb unmissverständlich. Enttäuscht und frustriert verließ sie den Raum. Das Ergebnis des kurzen Gespräches belastete meine Mutter emotional, weil sie befürchtete, dass ich eventuell durch so eine Formulierung später keinen Ausbildungsplatz bekommen würde.
Vor kurzem bemerkte ich beim Sortieren der alten Zeugnisse, dass ausgerechnet das soeben erwähnte Dokument in meiner Sammlung fehlte. Dieser Umstand rief mir schlagartig in Erinnerung, dass ich es damals wutentbrannt zerrissen habe. Die Bemerkung im Zeugnis traf mich tief, weil ich sie als schreiende Ungerechtigkeit empfand. Zunächst wurde ich von meinen Mitschüler verbal und körperlich angegriffen, sowie auch emotional verletzt. Und mein Klassenlehrer fiel nichts Besseres ein, als mir verbal zusätzlich einen unfairen und schmerzhaften Tritt zu verpassen. Für diesen Tritt in die Magengrube hätte ich ihm am liebsten die Schnauze poliert. Als ich diese Wut auf meinen Klassenlehrer verspürte, erreichte ich gerade das zwölfte Lebensjahr. Erschreckend, aber ein unvermeidbares Gefühl bei dieser Sachlage. Die Ungerechtigkeit machte mir erneut arg zu schaffen. Ich empfand abgrundtiefen Hass auf die Gesellschaft. Zum Glück konnte ich mich in letzten Moment emotional noch bremsen, nicht zum Amokläufer zu werden, weil ich sonst mit viel größeren Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hätte. Ich wäre möglicherweise in einem ausweglosen Teufelskreislauf geraten, der für mich voraussichtlich sogar eine kriminelle Laufbahn bedeutet hätte. Vermutlich müsste ich mir von sämtlichen Seiten blöde Sprüche anhören wie z. B. „Hier haben wir den ultimativen Beweis. René neigt zu Gewaltausbrüchen. Er ist eine Gefahr für die Gesellschaft“.
Dieses Makel müsste ich für den Rest meines Lebens mit mir herumschleppen und wäre irgendwann eine unerträgliche Last für mich geworden. Diese Realität drang mir durchaus ins Bewusstsein. Darum schaffte ich es, mich zu beherrschen und nicht endgültig die Kontrolle zu verlieren.
Meine Erfahrungen in der Schule zeigten mir deutlich, dass Menschen grundlegend ablehnend allen Personen gegenüber eingestellt sind, die anders sind als sie selbst. Ich entsprach zweifelsfrei nicht den Normenvorstellungen der Gesellschaft. Diese Realität machte den meisten Menschen Angst. Deshalb waren Schüler und Lehrer häufig gleichermaßen mir feindlich gesinnt und machten mir das Leben unerträglich schwer. Genau diese Tatsache spiegelt sich in der sogenannten christlichen Wertegemeinschaft wieder. Die Kirche predigt gerne Toleranz, lebt aber lieber Intoleranz. Dieser Widerspruch ist charakteristisch für unsere ehrenwerte Gesellschaft. Vor dieser Realität sollte sich niemand verschließen.
Ich bekam durch die Kriegszustände in der Schule Albträume. In einen dieser Traumwelten befand ich mich in einer Schneelandschaft irgendwo in einem Wald. Draußen dunkelte es bereits. Ich versuchte die Orientierung wiederzufinden. Plötzlich hörte ich ein unerwartetes Geräusch, das mir Angst machte. Es war das Bellen und Kläffen mordshungriger Wölfe. Die Raubtiere kamen mir im Rudel bedrohlich nahe. In Panik versetzt, rannte ich davon.
„Kann ich den Wölfen entkommen“, fragte ich mich in dieser schwierigen Situation.
Mein Adrenalin- Spiegel stieg. Gleichzeitig hörte ich, dass mein Herz immer schneller schlug. Das Geräusch nahm ich mit zunehmender Lautstärke in meinem Ohr wahr. Mein Atem wurde immer schwerer. Fast bekam ich das Gefühl, dass mir förmlich die Luft wegblieb.
„Ich habe keine Kraft mehr“, dachte ich und blieb für einen kurzen Moment stehen.
Meine Augen suchten nach einer rettenden Fluchtmöglichkeit. Sie entdeckten einen Schlitten, der im Schnee stand. Ich nutzte ihn für die Flucht. Ich raste damit auf einen tödlichen Abgrund zu. Schlagartig wurde ich vor dem Aufprall mit dem Schlitten aus meinem Traum gerissen und wachte schweißgebadet in meinem Bett auf. Wie sollte ich diesen Traum deuten beziehungsweise verstehen? Handelte es sich hierbei um eine Flucht vor dem Schulalltag, der für mich als Kind das gesellschaftliche Leben symbolisierte? Oder war es eine Flucht vor meinen eigenen Aggressionen? Vielleicht sogar beides? Eindeutig beantworten kann ich es mir bis heute nicht. In meiner Kindheit erzählte ich niemanden von diesem traumatischen Erlebnis. Ich wollte es einfach nur vergessen. Letztlich konnte ich es nur für eine gewisse Zeit verdrängen. Durch meine aktuelle Schreiberei kehrte es wieder in mein Bewusstsein zurück. Nun konnte ich es nicht mehr ignorieren. Darum hielt ich es hier schriftlich fest. Was ich am Ende daraus machen würde, wusste ich ehrlich gesagt noch nicht. Zunächst ließ ich es so stehen.
Meine Aggressionen baute ich aber nicht nur durch körperliche Gewalt ab, sondern beispielsweise auch durch Sport. Häufig spielte ich mit fremden Kindern außerhalb der Schule Straßenfußball. Zusätzlich fuhr ich viel Fahrrad, spielte gern Tischtennis und vereinzelnd probierte ich auch Basketball aus. Im Verein wollte ich allerdings nie Sport treiben, da ich außerhalb der Schule keine zusätzlichen Hänseleien wollte, die man heutzutage den neumodischen Begriff „Mobbing“ zuordnet. Ich befürchtete, dass dies mich komplett emotional überfordern würde.
Und die letzte Möglichkeit für mich Aggressionen abzubauen, wurde die Kunst. Schon als Kind liebte ich das Malen und das Zeichnen. Es eröffnete mir die ideale Möglichkeit, in eine andere und neue Welt abzutauchen. Vorzugsweise zeichnete ich Tiere aus Sachbüchern ab. Hingegen Menschen wurden selten mein Motiv, was sicherlich auch daran lag, dass die meisten von ihnen mir eher negativ begegneten. Tiere sah ich daher als die besseren Menschen. Beim Zeichnen entwickelte ich schon früh als Kind einen Hang zur Perfektion.
Paul Klee pflegte über das Medium zu sagen: „Zeichnen ist die Kunst, die Striche spazieren zu führen“.
Mit dieser Aussage hat der deutsch/schweizerische Künstler absolut recht. Sie beschreibt genau dass, was ich als Kind oder Jugendlicher empfand. Ich fühlte mich bei meinem kreativen Schaffensprozess in eine andere Welt versetzt, die mir eindeutig besser gefiel als der normale Alltag. Es tat meiner Seele gut. Ich konnte meine Sorgen für eine Weile vergessen. Wenn meine Zeichnung meinen hohen Ansprüchen allerdings nicht genügte, wurde ich regelrecht wütend und zerriss sie in meinen Zorn. In diesen Momenten entwickelte ich durch meine Unzufriedenheit wieder einen Hass auf mich und die Welt.
„Scheiße. Scheiße. Scheiße. Das ist noch nicht gut genug“, fluchte ich häufig in solchen Situationen.
An manchen Tagen stapelten sich die zerrissenen Kunstwerke neben mir auf dem Fußboden. Innerlich bekam ich das Gefühl, nicht aufhören zu können. Ich entwickelte eine totale Besessenheit, das Bild nach meinen Vorstellungen und Ansprüchen zu gestalten. Es packte mich eine enorme Schaffenswut, die ich selbst nicht mehr kontrollieren oder bremsen konnte. Als Kind bewegte ich mich am Rande der nervlichen Überforderung. Dies bemerkte auch Hanna. Sie versuchte, mich zu beruhigen.
Daher sagte sie immer zu mir: „René, mache erst einmal eine kleine Pause! Dann gelingt dir auch das Bild“.
Offen gesagt, fiel es mir schwer, mich zu bändigen, da ich mich in diesen Augenblicken wie ein emotional verletztes Raubtier fühlte. Der innere Schmerz, möglicherweise doch zu versagen, konnte ich kaum ertragen. Dennoch befolgte ich, wenn auch eher unwillig, ihren Ratschlag. Und meistens behielt sie recht. Nach einer kleinen Pause von ungefähr zwanzig bis dreißig Minuten versuchte ich es noch einmal mit der Zeichnung meines Motivs. Eine längere Pause wollte ich mir häufig nicht zugestehen. Dafür empfand ich eine zu große innere Unruhe. Trotzdem genügte meist diese kurze Unterbrechung. Anschließend entsprach das Bild meinen Vorstellungen, und meine seelischen Wunden fingen wieder an zu heilen. Mein Selbstvertrauen kehrte zurück. Dieses Ritual wiederholte sich in bestimmten zeitlichen Intervallen mit auffälliger Regelmäßigkeit.
Hanna wollte mich künstlerisch fördern. Sie glaubte an mein malerisches/zeichnerisches Talent. Daher machte sie mir als Teenager einen überraschenden Vorschlag.
„Möchtest du ein Mal- oder Zeichenkurs machen? Wir bezahlen es. Du kannst später auch die Kunstakademie besuchen“.
„Nein, lieber nicht“, erwiderte ich, „mein Talent reicht dafür nicht aus“.
Ich spürte, die Angst zu versagen. Eine Ablehnung wäre für mich damals, schwer zu verkraften gewesen. Mein Selbstvertrauen in dieser Zeit würde ich eher als labil beschreiben. Diese Tatsache wurde mir erst jetzt bei meinen Aufzeichnungen wieder bewusst. Darüber hinaus entdeckte ich zu diesem Zeitpunkt meine Berufung als Künstler noch nicht. Für mich stellte es nur eine willkommene Abwechslung von grauenhaftem Schulalltag dar. Hanna hatte mich in dieser Situation zu nichts gedrängt und überließ mir die Entscheidung. Sie wusste, dass sich solche Dinge nicht erzwingen lassen. Vermutlich dachte sie, dass der Moment für diese Entscheidung noch nicht gekommen war.
Meine erste bewusste Erfahrung mit der Kunst machte ich bereits als dreijähriger Knirps. Ich verewigte mich an der Tür und an den Wänden meines Kinderzimmers. Stolz nahm ich Hanna vor dem Frühstück bei der Hand und führte sie in mein Zimmer, um ihr meine Meisterwerke zu präsentieren.
Mit voller Zufriedenheit verkündete ich: „Guck mal Hanna! Hab ich schön gemacht“.
Zu meiner damaligen Enttäuschung musste ich als kleiner Junge feststellen, dass Hannas Begeisterung sich stark in Grenzen hielt. Heute kann ich es natürlich verstehen, vor allem wenn ich bedenke, dass ich einen Kugelschreiber als Bildträger einsetzte. Die Reinigungsarbeiten stufte ich später als sehr aufwendig und mühsam ein. Erstaunlich in diesem Zusammenhang blieb die Tatsache, dass Hanna zumindest äußerlich die Ruhe bewahrte. Andere Mütter wären in dieser Situation vorwurfsvoll und schimpfend gewesen.
Neben der Malerei entdeckte ich zeitweilig auch meine Leidenschaft für das Schreiben. Ich schrieb beispielsweise zwei oder drei Horrorhörspiele und einen James Bond-Roman. Zugegebenermaßen kann man die Versuche als Spielerei eines Teenagers betrachten, aber trotz allen verfügten die Texte über ein paar brauchbare Ansätze. Für Erstlingsarbeiten eines Jünglings kann man sie sogar als akzeptabel beziehungsweise annehmbar einstufen. Wenn ich sie allerdings als Buchautor in reiferen Jahren geschrieben hätte, wären sie klar und eindeutig als Rohrkrepierer zu betrachten. Insgesamt blieben die Texte zu konstruiert, beinhalteten Logikfehler und besaßen einige sprachliche Mängel. Irgendwann kam ich zu der Erkenntnis, dass diese schriftlichen Versuche keine Meisterwerke darstellten, zerriss die Seiten der literarischen Ergüsse und warf alles in Papierkorb. Später ärgerte ich mich über mein Handeln, da ich zumindest Teile der Texte für andere Geschichten hätte verwerten können. Schade, aber lässt sich nicht ändern.
Mein einziger kleiner Trost: „Die Vernichtungsaktion war zumindest konsequent“.
Andere Texte von mir blieben oftmals unvollendet. Als ich elf oder zwölf Jahre alt war, begann ich beispielsweise eine Detektivgeschichte zu verfassen, die im 19. Jahrhundert spielte. Die Hauptfigur verfügte rein zufällig natürlich über Ähnlichkeiten mit Sherlock Holmes. Ich liebte solche Krimikost und fasste den Entschluss, selbst als Autor tätig zu werden. Es fehlte mir zu diesem Zeitpunkt leider die Ausdauer und die Disziplin, um dieses Werk zu vollenden. Auch andere Geschichten schrieb ich nicht fertig.
Durch die zunehmend höheren schulischen Belastungen, Berufsausbildung und Studium blieben die Neigungen zu malen und zu schreiben irgendwann nahezu komplett auf der Strecke. Ich fand nur selten Zeit und Gelegenheit, mich der Kunst zu widmen. Meist nur noch im Rahmen des Schulunterrichtes. Meine Talente lagen lange Zeit brach.
Dass ich Talent in der Malerei habe, bezweifelte ich nie. Zweimal wurden mir in der Schule Bilder aus meiner Kunstmappe gestohlen. Ein eindeutiger Beleg für meine künstlerische Begabung. Der erste Diebstahl dieser Art ereignete sich 1980.
Meinen Klassenlehrer Herrn Prahl legte ich meine Bilder aus der Kunstmappe vor und sagte zu ihm: „Es wurden Bilder aus meiner Mappe geklaut“.
„Das interessiert mich nicht. Ich kann nur die abgelieferte Leistung benoten. Für jedes nicht vorhandene Bild bekommst du die Note sechs“, gab er mir unmissverständlich zu verstehen.
Die angekündigte Zensierung zog er hart und konsequent durch. Beschreiben würde ich diesen Möchtegernlehrer als autoritäres Arschloch alter Schule, der nur noch wenige Jahre bis zu seiner Pensionierung arbeiten musste. Ich erhielt in bildende Kunst nur die Note schwach ausreichend oder sogar mangelhaft. So genau weiß ich es nicht mehr. Ich gewann fast den Eindruck, dass mein Klassenlehrer seine helle Freude daran verspürte, mich schlecht benoten zu können. Ich sah es als ultimativen Beweis an, dass er mich nicht ausstehen konnte. Schließlich war er auch derjenige der mich im Zeugnis als gemeingefährlich einstufte. Über die Einstellung dieses Mannes zu meiner Person, ärgerte ich mich. Ich fühlte mich ungerecht behandelt und konnte nichts dagegen tun. Eine innere Wut kam in mir hoch, die ich nur mit viel Mühe zügeln konnte. Ein Gefühl der Ohnmacht entstand. Es wurde mir bewusst, dass ich die schlechte Note notgedrungen und zähneknirschend akzeptieren musste. Mittlerweile müsste dieser Mann verstorben sein oder auf die 100 zugehen.
Dass ein Lehrer solche Vorfälle auch anders handhaben kann, zeigte mir das zweite Beispiel. Es ereignete sich in meiner Zeit auf dem Wirtschaftsgymnasium. Es muss im Sommer 1990 gewesen sein. Wieder einmal wurden mir Bilder aus der Mappe gestohlen. Diesmal bekam ich nicht gleich für jedes nicht vorhandende Bild gleich die Note sechs.
Mein Kunstlehrer Herr Wolf sagte zu mir: „Du hast eine Woche Zeit, die Bilder nachzuliefern. Du kannst sie im Lehrerzimmer abgeben“.
Zugegegeben, die Zeit erschien mir knapp bemessen, aber dennoch empfand ich es als faire Chance, die ich versuchte zu nutzen. Die Bilder, die ich zuhause nachträglich anfertigte, erreichten wegen des geringen Zeitfensters nicht die gleiche Qualität wie die Ursprungsbilder, aber immerhin erhielt ich dafür die respektable Note 3+. Wegen meiner motorischen Störungen, die meinen Anfällen zu verdanken habe, brauchte ich mehr Zeit, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Jedoch stand sie mir nicht zur Verfügung. Ein großer Maler oder Graphiker ohne dieses Handicap hätte vermutlich ein besseres Ergebnis in dieser Zeitspanne erreicht.
Meine Probleme mit den Lehrern in der Schule blieben mir über mehrere Jahre erhalten. Erst ab der 7. Schulklasse wurde es allmählich besser. Frau Margot Lackner, damals eine Frau um die dreißig, war der erste Lehrkörper, der mich fair behandelte. Sie verfügte über ein selbstbewusstes Auftreten und lässt sich ihrer Lebenseinstellung sowohl als konservativ als auch als modern beschreiben. Dies spiegelt sich darin wieder, dass sie sich einerseits ein begeisterter Charlie Chaplin-Fan entlarvte, aber andererseits Konrad Adenauer verehrte.
Der Filmstar Chaplin stellte in seinen Filmen die sozial- und gesellschaftskritischen Aspekte seiner Zeit dar, während der Politiker Adenauer meines Erachtens für einen fast diktatorischen Führungsstil stand. Diesen Widerspruch konnte ich nie wirklich verstehen. Jedoch spielte diese Gegensätzlichkeit für mich keine große Rolle. Entscheidend erschien mir vielmehr die Tatsache, dass sie für uns Schüler eine Lehrerin mit Leib und Seele in Erinnerung blieb, die ihren Beruf liebte, was heutzutage eine Seltenheit darstellt. Bei ihr bekam ich das Gefühl, dass sie mir gegenüber keine Vorurteile hegte und pflegte. Dies empfand ich als eine sehr angenehme Abwechslung. Es erhöhte auch meine Chancen, endlich bessere Noten zu erhalten. Als ich von ihr mein erstes Zeugnis erhielt, konnte ich in mehrfacher Hinsicht stolz auf mich sein. Ich erhielt in einigen Fächern die Note zwei, und mein Notendurchschnitt betrug 2,7.
Darüber hinaus stand als Vermerk im Zeugnis: „René fördert mit seinen guten Allgemeinwissen oftmals den Unterricht“.
Zuvor kannte ich so ein Lob von Lehrern überhaupt nicht.
Auch gegenüber meiner Mutter äußerte die Lehrerin am Telefon: „Ihr Sohn bringt sich gut in den Unterricht ein. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Er schafft es“.
Für mich repräsentierte es das erste echte positive Highlight in meiner Schullaufbahn. Meiner Klassenlehrerin verdankte ich, dass ich schulisch endlich die Kurve bekam. Dieses Ereignis machte mich ein Stück selbstbewusster. Zusätzlich entstand bei mir der Eindruck, dass ich bei den Katholiken nicht mehr als der Antichrist eingestuft wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde mein Ehrgeiz geweckt. Nach dem Hauptschulabschluss holte ich alle anderen Schulabschlüsse wie Mittlerer Reife, Fachabitur und Allgemeine Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg nach. Später probierte ich es sogar zweimal mit einen Studium an der Hamburger Universität.
Worauf ist der Anstieg meiner Leistungskurve noch zurückzuführen? Ein weiterer Grund dafür ist sicherlich, dass ich seit dem 7. Schuljahr kein Zentropil schlucken musste. Der Kinderneurologe Dr. Helmut Klein entschied, dass dieses Medikament nicht mehr notwendig ist, um meine Anfälle unter Kontrolle zu halten.
Als Kind wurden ungefähr alle drei Monate meine Anfälle untersucht. Das Beste an diesen Untersuchungstagen? Das Horrorszenario Schule blieb mir erspart, was ich fast wie ein Miniurlaub genoss. Es wurde ein sogenanntes EEG gemacht. Mein Gehirn wurde auf Unregelmäßigkeiten untersucht. Die Wahrscheinlichkeit der Anfälle ließ sich daraus ableiten. Dafür wurde ich am Kopf mit Elektroden versehen. Mit elf Jahren wurde bei mir von Dr. Klein festgestellt, dass sich meine Werte deutlich verbesserten, sodass nun die Dosis des Medikamentes stufenweise verringert werden durfte. Für Hanna und mich eine wundervolle Nachricht.
Zu Hanna sagte Dr. Klein in meiner Anwesenheit: „Ich hatte eine Patientin, die ähnlich wie Ihr Sohn diese Anfälle hatte. Sie machte ihr Abitur und hatte angefangen zu studieren. Es ist daher nicht auszuschließen, das René dies auch schafft“.
Mit dieser Aussage behielt er recht. Für mich ist dies auch heute noch wie ein Wunder. Keine Anfälle mehr. Keine Medikamente, die ich dagegen nehmen muss. Und meine schulischen Leistungen verbesserten sich fortan deutlich.
Ein zusätzlicher Grund, warum ich mit den schulischen Anforderungen besser zurechtkam, lag daran, weil ich einen gewissen Ehrgeiz entwickelte. Ich las eine Reihe von Sachbüchern mit der Thematik Natur, Zoologie, Geografie und Geschichte. Auf diese Weise eignete ich mir ein gutes Allgemeinwissen an. Ich wollte einfach nicht mehr als Idiot oderVolltrottel gelten. Diesen Negativstempel wollte ich unbedingt loswerden. Lange Zeit hatte ich Probleme, ihn zu beseitigen. Nun kam endlich der erwünschte Erfolg. Ich empfand es als Balsam für meine Seele. Ein Raum ohne Bücher war für mich in dieser Zeit, wie ein Körper ohne Seele.
Zusammenfassend kann ich an dieser Stelle sagen, dass ich während meiner gesamten Schulzeit sehr gemischte Gefühle entwickelte, die mich emotional instabil machten. Darum ging ich später nie zu irgendwelchen Klassentreffen, zu denen ich eingeladen wurde. Ich wollte einen Schlussstrich unter meiner Vergangenheit ziehen. Eine schwierige Zeit, die ich rückblickend nicht vermisse, aber zu meinen Leben dazugehörte. Eine Art Hassliebe zur Schule entstand in meiner Kindheit/ Jugend. Die Schulzeit prägte mich in unterschiedlicher Weise, positiv wie negativ. Nach siebzehn Jahren sah ich mit großer Erwartung das Ende meiner Schulzeit entgegen und war heilfroh, dass ein neuer Lebensabschnitt für mich begann. Mit diesen abschließenden Worten beendete ich für heute das Schreiben und ging zu Bett.
3. Kapitel
Beim Schreiben wurde mir heute bewusst, dass ich die Schulzeit nur aus dem Grund überlebte, weil ich Eltern hatte, die mich stets unterstützten. Zugegeben, es war nicht alles Gold, was glänzte, aber trotzdem erinnere ich mich an ein gut behütetes Zuhause. Aufgewachsen bin ich bei meinen Eltern Hanna und Heinrich Krüger. Beide wurden 1935 in Hamburg geboren. Meine Großeltern lernte ich leider nie kennen. Dies gehörte zu den wenigen Dingen, die ich daheim vermisste. Dafür habe eine Schwester namens Christina, die knapp fünf Jahre vor mir zur Welt kam. Mit ihr durchlebte ich einige Höhen und Tiefen. Die geschwisterliche Beziehung prägte ein Großteil meines Lebens. Ständig konfrontierten wir uns mit unseren unterschiedlichen, teilweise sogar gegensätzlichen Lebensauffassungen und Philosophien. Trotzdem hielten wir in Not- und Krisensituationen immer zusammen, weil wir gelernt haben, uns trotz unserer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Ein mühsamer Reifeprozess, der letztlich half, dass wir miteinander zurechtkamen. Wir sind im Laufe der Jahre erwachsen geworden. Auf diese Weise schufen wir uns ein familiäres Fundament.
Wie kann ich mein Elternhaus am Besten beschreiben? Meine Eltern führten eine harmonische Ehe, und es gab daher selten Streit. Und wenn gestritten wurde, ging es meist nur um die Erziehung von uns Kindern. Dadurch empfand ich mein Zuhause meist als einen Ruhepol, um dem nervenaufreibenden Schulalltag weiterhin gewachsen zu sein. Ich genoss das Gefühl, dass ich meine Seele baumeln lassen konnte. Einfach ausgedrückt, ich fühlte mich in den eigenen vier Wänden geborgen und gut aufgehoben.
Als Kleinkind behielt ich trotz meiner Anfälle eine gewisse Unbeschwertheit und Fröhlichkeit. Immer, wenn meine Eltern die Musikanlage in der Wohnung aufdrehten, was häufig bei uns zuhause geschah, lief ich als Dreijähriger tanzend im Kreis und freute mich des Lebens. Diese kindliche Unschuld ging leider spätestens mit Beginn der Schulzeit allmählich verloren. Die Lebensfreude kam bei mir immer seltener zum Vorschein, eine erschreckende Tatsache, die mir nun durch das Verfassen meiner Memoiren wieder ins Bewusstsein drang.
Daher nahm ich das Glas Rum-Cola in die Hand und sagte zu mir selbst: „Prost. Soll sich der Teufel um meine Gesundheit kümmern“.
Ein Schluck aus dem Glas sollte mir helfen, meinen Kummer über die Vergangenheit zu ertränken. Gedanklich entwickelte sich dabei der Plan in meinem Kopf, einen autobiografischen Roman zu schreiben. Ich wollte die Idee, endlich Erfolg als Künstler zu haben, nicht aufgeben. Ursprünglich sollten die Aufzeichnungen nur dazu dienen, mich selbst zu therapieren. Dieses Ziel wollte ich zwar weiterhin beibehalten, aber ab sofort strebte ich auch wieder danach, den Durchbruch als Schriftsteller zu schaffen. Zwei Fliegen konnte ich jetzt mit einer Klappe schlagen. In dieser Gewissheit setzte ich das Schreiben nach einer kurzen Unterbrechung wieder fort.
Hanna erlernte den Beruf der Friseurin. Allerdings übte sie diesen Beruf in meiner Kindheit nicht mehr aus. Haare geschnitten hatte sie nur innerhalb der Familie, damit wir die Kosten für den Friseur sparen konnten. Sie arbeitete in Teilzeit als Reinigungskraft in der Schule der Brucknerstraße, die mir als sogenannten schwierigen Schüler immerhin ein Besuchsrecht beziehungsweise eine Aufenthaltsgenehmigung von ungefähr 1 ½ Jahren gnadenvoll gewährte. Gelegentlich besuchte ich sie auf der Arbeit. Ich stellte die Stühle hoch, damit sie die Klassenräume fegen und wischen konnte. Oder ich putzte die Tafeln. Aus welchen Gründen auch immer machte es mir Spaß. Das genaue Motiv dafür ist mir allerdings inzwischen entfallen. Vielleicht brauchte ich das Gefühl, etwas Nützliches zu machen.
Heinrich verfügte über keine Berufsausbildung. Dies lag daran, dass er als junger MannVerantwortung für seine sechs Geschwister übernehmen musste. Er übernahm früh die Rolle des Ernährers. Gerne hätte er den Beruf des Elektrikers ausgeübt. Auf diesem Gebiet verfügte er über ein gewisses Talent, das er in unserer Wohnung mehrfach unter Beweis stellte. Jedoch arbeitete er stattdessen in jungen Jahren auf dem Bau als Stahlflechter und Betonbauer. Auch andere Talente blieben ungenutzt. Er konnte hervorragend Klavier und Orgel spielen. Da wir weder über den Platz noch das Geld für solche Musikinstrumente verfügten, konnte er diese Seite seines Daseins nur selten auskosten beziehungsweise ausleben. Eine Tatsache, die ich nachträglich sehr bedaure. Viel Zeit verbrachten meine Schwester und ich ohnehin nicht mit unseren Vater. Denn häufig arbeitete er sieben Tage die Woche. Urlaub ließ er sich meist auszahlen. Und immer schleppte er sich krank zur Arbeit. Der Nutzen seines Pflichtbewusstseins? Gebracht hat es ihm den ersten Herzinfarkt mit 37 Jahren. Nicht unbedingt das Alter, um auf dieser Weise knapp den Tod zu entrinnen. In diesem Zusammenhang sei hier erwähnt, dass der Herzinfarkt nicht nur aufgrund der Überarbeitung zustande kam, sondern auch wegen eines angeborenen Herzfehlers. Alle seine Geschwister erbten zwangsläufig diesen Herzfehler durch die Gene meiner Großmutter Inge. Darum sind sie auch alle mit Ausnahme der jüngsten Schwester Christiane vor ihrem 65. Lebensjahr verstorben. Im Klartext bedeutete dies, dass sie nicht einmal das normale Rentenalter erreichten. Das gesellschaftspolitische System konnte sich freuen, dass die Rentenkasse durch die Familie Krüger nicht unerheblich entlastet wurde. Ich bin erleichtert, dass ich nicht zusätzlich dieses Handicap geerbt habe. Dadurch steigen meine Chancen, den Staat im Alter ordentlich zu schädigen.
Nur in der Phase meines achten oder neunten Lebensjahrs erlebte ich das Gefühl, etwas mehr Aufmerksamkeit von meinem Vater zu erhalten. Er brachte mir das Schachspielen bei. Meistens verlor ich die Partie, weil mir die Geduld und die Disziplin dafür fehlten und machte häufig überhastete Züge, die zwangsläufig zu Niederlagen führten. Trotzdem machte es mir Spaß. Diese Zeit blieb als einer der wenigen Ausnahmen, wo ich Heinrich als meinen Vater wahrnahm. Meist konnte er mit uns Kindern wenig anfangen. Alibimäßig ging er mit mir zum Entenfüttern in den Schleidenpark, der sich nur knapp fünf Minuten von unserer Haustür befand. Jedoch schüttete er sofort den kompletten Inhalt der Tüte mit dem Brot in den Teich, um damit schnell fertig zu sein. Er ging lieber in die Kneipe, um ein Bier zu trinken. Mit Christina machte er es genauso, erzählte sie mir später.
Heinrichs zusätzliche Belohnung für sein Pflichtbewusstsein? Der Verlust des Arbeitsplatzes. Nach seinem Kuraufenthalt in Wintermoor bekam er prompt die Kündigung von der Baufirma. Fast täglich ging er zum Arbeitsamt und hoffte schnell wieder in Brot und Arbeit zu kommen.
Der Arbeitsvermittler beim Jobcenter sagte zu meinen Vater: „Sie sind sehr pflichtbewusst und erkundigen sich regelmäßig nach Arbeit. So etwas muss belohnt werden. Daher habe ich für Sie ein Angebot als Pförtner herausgesucht. Ich hoffe, Sie bekommen die Stelle“.
Heinrich bedankte sich beim Arbeitsvermittler und bewarb sich telefonisch für den Posten. Nach einer kurzen Zeit der Arbeitslosigkeit arbeitete er als Pförtner für eine große Bank. Diesmal arbeitete er keine sieben Tage pro Woche. Wenigstens den Sonntag hielt er sich für die Familie frei. Und den Urlaub ließ er sich nicht mehr auszahlen. Der Herzinfarkt erwies sich sicherlich als eine lehrreiche Lektion. Insgesamt konnte die Familie etwas mehr Zeit mit ihrem Ernährer verbringen.
Jedoch auch dieser Job wurde kein leichter Spaziergang, da Heinrich in drei Schichten arbeitete. Es gab eine Früh-, eine Spät- und eine Nachtschicht. Heinrichs Schlafrhythmus litt unter diesen wechselhaften und unregelmäßigen Arbeitszeiten, und es ging zunehmend an seine Substanz. Im Alter von nur 52 Jahren verstarb er am 10. Februar 1988 an den Folgen einer Herzoperation.
Knapp drei Wochen zuvor kam er auf die Intensivstation des UKE. Wir zitterten und hofften bis zuletzt, dass er es doch überlebt.
Gedanklich formulierte ich mir täglich im Kopf die Frage: „Überlebt er es oder kommt jetzt das Ende“?
Die Ungewissheit quälte mich. Hannas Nerven lagen ebenfalls völlig blank. Ich versuchte ihr eine Stütze sein. Jedoch unsere Befürchtungen bewahrheiteten sich.
Denn Hanna erhielt von Universitätsklinikum Eppendorf die telefonische Nachricht, die sie radikal veränderte: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihr Mann heute früh verstorben ist“.
Dabei sah alles nach einen guten Verlauf der Operation aus. Daher verstanden wir die Welt nicht mehr. Wir erreichten einen Zustand der Fassungslosigkeit. Es gab nur eine Erklärung, die uns schlüssig erschien. Er wurde nach der Operation zu früh von der Intensivstation auf sein Zimmer verlegt. Zusätzlich bekam Hanna bei ihrem Besuch im Krankenhaus das Gefühl, dass die Krankenschwester, die Heinrich an diesem besagten Tag betreute, die Liegehöhe des Bettes zu ruckartig verstellte.
Heinrich signalisierte: „Das tat weh“. Immerhin hatte er eine frische Operationswunde.
Jedoch die Krankenschwester entgegnete ihm unverschämt: „Stellen Sie sich nicht so an! Ist alles nicht so schlimm“.
Hanna konnte in dieser Situation nicht angemessen reagieren, da sie wegen des ruppigen Verhaltens der Pflegerin verständlicherweise unter Schock stand. So eine Reaktion hatte sie von einen geschulten Pflegepersonal keineswegs erwartet. Nach diesem Vorfall ging es Heinrich schlagartig wieder schlechter. Eine Tatsache, die wir letztlich nicht eindeutig beweisen konnten. Und bei den Ärzten und Pflegern ist ohnehin bekannt, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Wenn wir also eine Klage angestrebt hätten, wäre für uns ein riesengroßer Geld- und Nervenaufwand entstanden, ohne tatsächlich eine reale Erfolgschance vor Gericht zu haben. Ein Kampf David gegen Goliath wäre entstanden. Allerdings mit umgekehrten Ausgang, wie in der Bibel beschrieben. Dies wollten Christina und ich Hanna nicht zumuten. Hanna bekam nach der Todesnachricht einen Nervenzusammenbruch und wurde ins Eilbeker Krankenhaus eingeliefert, sodass sie nicht an Heinrichs Beerdigung teilnehmen konnte. Die Ereignisse hatten sich in dieser Situation überschlagen und stellten eine Überforderung für sie dar. Den Schicksalsschlag verkraftete sie nicht.
Hanna sagte zu meiner Schwester in meiner Anwesenheit im Krankenhaus: „Ich möchte nicht, dass René an der Trauerfeier teilnimmt. Dies ist zu viel für ihn“.
Zwar wurde Hannas Wunsch akzeptiert, aber es stieß auf allgemeines Unverständnis. Dies spürte ich. Es gab kein böses Wort, aber Mimik und Gestik sprachen ihre eigene Sprache. Die Mehrheit in Freundes- und Bekanntenkreis erwarteten sicherlich, dass ich meiner Schwester in der schweren Stunde des Abschieds beistehe. Stattdessen glänzte ich auf der Beerdigung mit meiner Abwesenheit. Daher stufte man mich vermutlich als totalen Egoisten ein, ein Tatbestand, den ich wiederum akzeptieren musste.
Ehrlich gesagt kam mir Hannas Entscheidung sehr entgegen, da ich zu dieser Zeit große Probleme mit der Konfrontation des Todes hatte. Woran es genau lag, kann ich nicht wirklich eindeutig beantworten. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass ich bereits bei meiner Geburt, wenn auch eher unbewusst, mit meinen eigenen Tod konfrontiert wurde. Letztlich bleibt es nur reine Spekulation.