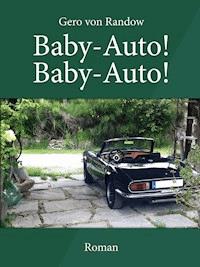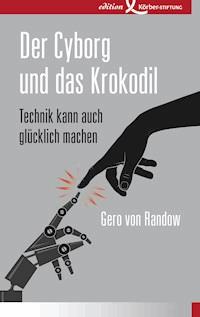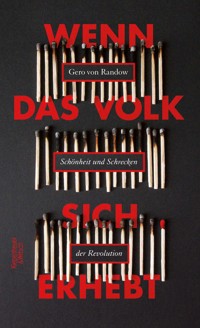
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Zeit der Revolutionen ist nicht vorbei Warum ist es so ein besonderer, geradezu erhabener Moment, wenn das Volk sich erhebt, auf dem Tahrir-Platz in Kairo oder auf dem Maidan in Kiew? Warum begeistern wir uns für Revolutionen, auch wenn wir wissen, dass sie ihre eigentlichen Ziele nicht erreichen, niedergeschlagen oder verraten werden – meist von den Revolutionären selbst? In seinem packend geschriebenen, sehr persönlichen Buch schildert von Randow sein Erleben von Revolutionen und geht der Frage nach, ob sie noch ein Zukunftsmodell sind. Seine Antworten sind hochaktuell und überraschend. Vor 100 Jahren siegte die russische Oktoberrevolution. Und vor 50 Jahren glaubte eine ganze Generation junger Leute, es sei wieder die Zeit der Revolutionen gekommen. Was blieb davon? Nur Resignation? Und was ist das überhaupt – eine Revolution? Dem Autor wurde im Jahr 2011 Anschauungsunterricht erteilt, als er Augenzeuge der tunesischen Revolution wurde. Seine These: Revolutionen kommen unversehens. Und doch lassen sich Muster erkennen. Der Blick des Autors richtet sich auf den amerikanischen Kontinent, auf West- und Osteuropa, Afrika und Asien. Er durchstreift die Jahrhunderte, von den aufständischen Sklaven des Altertums über die Revolutionäre von 1789 und die kommunistische Weltbewegung bis zu den Rebellen der Gegenwart, immer auf der Suche nach Tatsachen und Ideen, die das ungewöhnlichste, facettenreichste Phänomen der Geschichte erhellen können, die Revolution.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
GERO VON RANDOW
WENN DAS VOLK SICH ERHEBT
SCHÖNHEIT UND SCHRECKEN DER REVOLUTION
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über GERO VON RANDOW
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über GERO VON RANDOW
Der mehrfach preisgekrönte Journalist und Buchautor Gero von Randow, Jahrgang 1953, wurde 1992 Wissenschaftsredakteur der Hamburger Wochenzeitung DIEZEIT. Von 2001 bis 2003 wirkte er am Aufbau der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als Chef des Wissenschaftsressorts mit und kehrte dann zur ZEIT als politischer Redakteur zurück. Von 2005 bis 2008 war er Chefredakteur von ZEIT ONLINE, 2008 bis 2013 Korrespondent der ZEIT in Paris, seither arbeitet er als ZEIT-Redakteur im Ressort Politik.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Warum ist es so ein besonderer, geradezu erhabener Moment, wenn das Volk sich erhebt, auf dem Tahrir-Platz in Kairo oder auf dem Maidan in Kiew? Warum begeistern wir uns für Revolutionen, auch wenn wir wissen, dass sie ihre eigentlichen Ziele nicht erreichen, niedergeschlagen oder verraten werden – meist von den Revolutionären selbst? In seinem packend geschriebenen, auch sehr persönlichen Buch schildert von Randow sein Erleben von Revolutionen und geht der Frage nach, ob sie noch ein Zukunftsmodell sind. Seine Antworten sind hochaktuell und überraschend.
Vor 100 Jahren siegte die russische Oktoberrevolution. Und vor 50 Jahren glaubte eine ganze Generation junger Leute, es sei wieder die Zeit der Revolutionen gekommen. Was blieb davon? Nur Resignation? Und was ist das überhaupt – eine Revolution?
Dem Autor wurde im Jahr 2011 Anschauungsunterricht erteilt, als er Augenzeuge der tunesischen Revolution wurde. Seine These: Revolutionen kommen unversehens. Und doch lassen sich Muster erkennen.
Das Buch bewegt sich auf dem amerikanischen Kontinent, in West- und Osteuropa, in Afrika und Asien. Es durchstreift die Jahrhunderte, von den aufständischen Sklaven des Altertums über die Revolutionäre von 1789 und die kommunistische Weltbewegung bis zu den Rebellen der Gegenwart, immer auf der Suche nach Tatsachen und Ideen, die das ungewöhnlichste, facettenreichste Phänomen der Geschichte erhellen können, die Revolution.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
VORWORT
Kapitel 1 EIN PERSÖNLICHES KAPITEL: WARUM ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN HABE
Das Parfüm der Revolte
Irreale Realpolitik
Widersprüche und wie man sie verdrängt
Kein Thema von gestern
Und deshalb dieses Buch
Kapitel 2 ANNÄHERUNG AN EINEN BEGRIFF
Das Gegenteil der Langeweile
Die Letzten werden die Ersten sein
Algerische Melancholie
Nicaraguanische Melancholie
Führer und Geführte
Ein vorläufiger Revolutionsbegriff
Kapitel 3 PANTHEON DER REVOLUTIONÄRE I: WELTBÜRGER, JUGENDLICHE, AKTIVISTINNEN
Victor Serge, der tragische Weltbürger
Schießübungen und Machtfantasien
»Wir sind noch neu«
Mein afghanischer Freund
Wie Olfa eine Revolutionärin wurde
Pussy Riot rules!
Die Gazelle, die eine Löwin ist
Kapitel 4 PANTHEON DER REVOLUTIONÄRE II: BERUFSREVOLUTIONÄRE, BANDITEN, ANARCHISTEN
Louise Michel, genannt die »rote Witwe«
Bakunin, der rastlose Riese
Che Guevara, tragische Figur
Abdel Hafed Benotman, Verbrecher, Rebell und Schriftsteller
Stehlen, plündern, Banken überfallen
Revolutionskommunen
Von der Zarenmörderin Sofja Perowskaja bis zu Ulrike Meinhof
Erich Mühsam, der zartfühlende Anarchist
Kapitel 5 IDEEN, MOTIVE UND VORWÄNDE
Die Revolution der Würde
Die maoistische Kulturrevolution
Die leuchtende Zukunft
Die Welt verbessern – oder sie retten?
Kapitel 6 DIE REVOLUTION SPRICHT
Losungen, Parolen, Slogans
Kapitel 7 MASSE UND KLASSE
Revolutionäre Klassen
Der Mob
Das Land kreist die Stadt ein
Gesucht: das revolutionäre Subjekt
»Besorgte Bürger«
Kapitel 8 DETONATION
Aufstand in der Ukraine
Sturm auf die Bastille
Kapitel 9 DRAMATURGIE
Deutsche Revolution 1918/1919
»In Hamburg fiel der erste Schuss«
Ein Revolutionär wider Willen
Der Pariser Mai 1968
Wie soll man die revolutionäre Macht sichern?
Räterepubliken
Den alten Staatsapparat zerschlagen?
Die Revolution frisst ihre Kinder
Thermidor
Noch ein Sonderfall: die deutsche Revolution von 1989
Kapitel 10 KONTERREVOLUTION
Revolutionärer Völkermord?
Kapitel 11 WELTREVOLUTION
»We Shall Fight, We Will Win. Paris, London, Rome, Berlin«
Winnetou ist Christ
Widersprüche revolutionärer Außenpolitik
Kapitel 12 KAIN UND ABEL
»Schafft zwei, drei, viele Vietnam!«
»Mit dem Feuer, mit dem Gift, mit dem Dolch«
Der bluttriefende neue Mensch
Jean Paul Marat: Größenwahn und Nützlichkeit
Kapitel 13 WAR ES DAS WERT?
Gibt es ein Vorwärts?
»… würdig bis zum Ende!«
Kapitel 14 UND SIE BEWEGT SICH DOCH: ÜBER DIE AKTUALITÄT DER REVOLUTION
Viva Zapata!
Ein prozessualer Revolutionsbegriff
Der große Treck von Budapest
Die neue reaktionäre Internationale
»Der kommende Aufstand« – wirklich? Und wo?
Epilog: IM PUPPENKABINETT
Die revolutionäre Mumie
Skizze für ein anderes Buch
Für Sigrid
VORWORT
Vor 100 Jahren, im Jahr 1917, siegte die russische Oktoberrevolution.
Die Revolution! Ein großes Wort. Es hat seine Anziehungskraft nicht verloren. Es gehört zu den meistbenutzten politischen Begriffen. Im Sommer 2016 hat es gar ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat zu seinem Schlüsselwort gemacht, und zwar allen Ernstes: der US-Senator Bernie Sanders, mit 75 Jahren, umjubelt von jungen Leuten.
Anders als Wörter wie »Kaiser« oder »Proletariat« zeigt das Wort »Revolution« nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Auf ungewisse, womöglich turbulente Zeiten, die noch kommen werden.
Ist das jetzt Optimismus oder Pessimismus? Es ist Realismus. Die Revolution ist schon so oft für tot erklärt worden, dass man mit ihrem Weiterleben rechnen sollte.
Revolutionen sind erhabene Ereignisse. Menschenmassen ziehen durch die Straßen, füllen Plätze, stürmen Gebäude, stürzen Machthaber, machen Geschichte. Das ist noch keine Definition, sondern nur eine Beschreibung, die aber auf einen Wesenszug hinweist: Revolutionen sind Gefühlsereignisse (weshalb dieses Buch auch ein emotionales Buch ist). Die revolutionären Massen empfinden Hass und Liebe zugleich. Und je größer der Widerstand gegen die Revolution, desto tiefer empfinden die Revolutionäre Hass und Liebe. In Revolutionen bewegen sich nicht nur die Gedanken, sondern auch die Körper, deswegen sind, ja deswegen müssen sie emotional sein. Sie sind konkret und nicht abstrakt. »Strukturen gehen nicht auf die Straße«, lautete ein geflügeltes Wort der Rebellen im Pariser Mai 1968, ein anderes: »Revolutionen sind Feste oder sie sind nicht«.
Die anstürmende Revolution ist ein Gefühlserlebnis, ihr Scheitern ist es allerdings auch. Wie der »arabische Frühling«. Weitere Wechselbäder von Euphorie und Depression stehen bevor, da bin ich mir sicher. Erst Enthusiasmus, dann Katzenjammer. Zwei sehr unterschiedliche Emotionen, nicht nur wegen des positiven und des negativen Gehalts, sondern weil die Begeisterung stets ein kurzlebigeres und intensiveres Gefühl ist als die Enttäuschung. Begeisterung reißt mit, Enttäuschung zieht herab.
Berühmt geworden sind die Worte, mit denen Georg Wilhelm Friedrich Hegel die Wirkungen der Französischen Revolution von 1789 auf die Gemüter der Zeitgenossen beschrieb: »Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen.«[1] Danach landeten die Schwärmer wieder auf der Erde.
Diese emotionale Eigenschaft von Revolutionen hat eine weitreichende Folge: Sie bleiben lebendig. Romane, Gedichte, Lieder, Bilder, Filme geben die Gefühlserlebnisse über Generationen weiter, mehr noch, diese hochemotionalen Erlebnisse werden wiederholt, aktualisiert, noch einmal empfunden.
Revolutionen sind Gemeinschaftserlebnisse. Gemeinschaftliche Befreiungsakte und, leider, oft auch gemeinschaftlich begangene Grausamkeiten.
Ihre Schönheit: Das ist der dramatische Moment der Befreiung. Der Sozialphilosoph Herbert Marcuse, Vaterfigur rebellierender Studenten, schrieb im Jahr 1969 in seinem »Versuch über die Befreiung«, sie sei »nur als die Weise denkbar, in der freie Menschen (oder vielmehr Menschen, die praktisch dabei sind, sich selbst zu befreien) ihr Leben solidarisch gestalten und eine Welt aufbauen, in welcher der Kampf ums Dasein seine häßlichen und aggressiven Züge verliert«.[2]
Eine umfassende Transformation der Gefühle. An die Stelle individuell empfundener Verzweiflung tritt das Erleben gemeinschaftlicher Stärke; »alle kämpfenden Kollektive kennen diesen Moment der katastrophischen Erregung, des intensiven Glücks, mag es auch vergänglich sein, das der Entdeckung der eigenen Kraft nachfolgt, einer Kraft, derer man sich zuvor nicht fähig fühlte«, schreibt ein anderer Sozialphilosoph: Frédéric Lordon, einer der intellektuellen Wortführer der französischen Alternativbewegung »nuit debout«.[3]
So schön die Befreiung, so schrecklich die Gewalt. Revolutionäre Massen können im Nu zu Täterkollektiven werden, die gemeinschaftlich zu Handlungen fähig sind, die ein Einzelner niemals verüben würde. Die Anwesenheit der anderen Wütenden senkt den Rechtfertigungsaufwand für Gewalttaten.
Man höre genau hin bei den Revolutionsliedern, die bis heute gesungen werden: Viele von ihnen singen das Lob der Lynchjustiz. »Die Aristokraten an die Laterne!«, heißt es im Sansculottenchanson »Ça ira«, und Hanns Eisler vertonte den »Roten Wedding«, den der Dichter Erich Weinert mit folgendem Text versah:
»Hier wird nicht gemeckert, hier gibt es Dampf,
denn unsre Parole heißt Klassenkampf,
nach blutiger Melodie!«
Nach blutiger Melodie also. Sagen wir es so: Wäre die Welt so beschaffen, dass sie Revolutionen überflüssig machte, sie wäre glücklicher. Doch sie ist schreiend ungerecht.
Und das Unrecht ist sichtbarer als je zuvor, nicht nur das, seine Darstellung wird auf erschütternde Weise bildlicher. Erst kam die Druckerpresse, dann das Radio, das Fernsehen, und heute erzeugt das Internet das Bild der Welt: Die Medien werden heißer, um einen Begriff des kanadischen Medientheoretikers Marshall McLuhan (1911–1980) zu verwenden, sie werden emotionaler, schneller, erregender. Sie gehen unter die Haut.
Revolutionen kämpfen um die Körper und um die Sprache, sie sind kommunikative Ereignisse. Die Machthaber ebenso wie die Rebellen organisieren und verabreden sich, verbreiten praktische Informationen sowie Aufrufe und Ideen, stören die Kanäle der anderen Seite. Zu den traditionellen taktischen Zielen eines Aufstandes gehören Rundfunk- und Fernsehstationen. Dieser mediale Wesenszug der Revolution wird durch das mobile Internet noch radikalisiert, wie sich während des sogenannten arabischen Frühlings erwies. Zwar scheiterte dieser beinahe überall (bis auf Wiedervorlage), es bleibt aber dennoch richtig, dass die digitale Technologie wegen ihrer Internationalität, Flexibilität und ihres Massencharakters den sich erhebenden Völkern letztlich mehr als ihren Unterdrückern nützt.
Wir werden das noch etliche Male erleben. Zwei tektonische Platten, die eine heißt Möglichkeit und die andere Wirklichkeit, reiben sich im Untergrund unserer Welt aneinander, bauen eine tellurische Spannung auf. In welchen Formen wird sie sich entladen?
Die Zeit der Erhebungen, Rebellionen, Aufstände und Revolutionen ist jedenfalls nicht vorüber. Sosehr dieses Buch daher auf vergangene Revolutionen zurückblickt, soll es doch auch das Potenzial zukünftiger Erschütterungen erahnen lassen.
Kapitel 1EIN PERSÖNLICHES KAPITEL: WARUM ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN HABE
Vor 50 Jahren, am 2. Juni 1967, wurde der 26-jährige Student Benno Ohnesorg erschossen.
Aus nächster Nähe. Von hinten. Er hatte in Berlin an einer Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien teilgenommen. Der Täter hieß Karl-Heinz Kurras und war damals Kriminalobermeister.
Tags darauf besuchte der Schah meine Heimatstadt Hamburg, mein Vater hängte aus Protest ein schwarzes Leintuch über den Balkon. Wieder wurde demonstriert, wieder prügelten deutsche Polizeibeamte und persische Geheimdienstler auf Demonstranten ein, es floss Blut.
Ich war damals 14 Jahre alt und schockiert. Nur drei Jahre später sollte ich mich bereits als Kommunist verstehen. Sehr viel später dann würde sich herausstellen, dass Benno Ohnesorgs Mörder ein Stasi-Agent war. Die Stasi behauptete von sich, ein Abkömmling der kommunistischen Tscheka zu sein: So hieß die nach der Oktoberrevolution gegründete Geheimpolizei. Wie merkwürdig die Dinge doch manchmal zusammenhängen.
Damals, vor 50 Jahren, existierte zwar kein Internet, aber dennoch war die Informationsdichte hoch, erzeugt vom Fernsehen und von der Massenpresse. Die deutsche Bundesrepublik war eine informierte Gesellschaft. Im Spiegel las ich damals von alten Nazis in Spitzenstellungen von Justiz, Militär, Wirtschaft und Politik (dass sie auch in der Redaktion des Spiegel saßen, erfuhr ich erst später). Und ich sah im Fernsehen die Bilder vom Krieg in Vietnam. Mein Vater war amerikabegeistert, ich war es eigentlich auch, aber dieser Krieg nahm mir das Vertrauen in die USA. Ich dachte pazifistisch und lief beim Ostermarsch mit; dort allerdings lernte ich Leute kennen, denen die Losung »Frieden in Vietnam« zu unpolitisch war. Sie skandierten den Slogan »Bürger, runter vom Balkon / Alle Macht dem Vietcong«, den ich damals nicht gaga fand, und erklärten mir: Nur wenn der Vietcong, die von den Kommunisten geführte Nationale Befreiungsfront, die Amerikaner aus Südvietnam vertreibt, kann es Frieden geben. Ich hatte viel über Vietnam gelesen, wieder im Spiegel, und mir leuchtete das Argument ein. Als ich es im Schulunterricht vorbrachte, erhielt ich vom Lehrer die Antwort: »Dann müssen Sie aber auch für den Kommunismus sein.« Was hätte ich darauf sagen sollen? Etwa: »Ach so, dann lieber doch nicht«? Nein, ich entgegnete: »Gut, dann bin ich eben für den Kommunismus.«
Also für die Revolution.
Warum entscheidet sich jemand für die Revolution, und was ist das überhaupt?
Das ist das Thema dieses Buches, und ich beginne mit einem persönlichen Zugang, weil ich hoffe, auf diese Weise meinem Gegenstand näherzukommen. Persönlich ist vor allem dieses Kapitel. Sollte Sie dieser Aspekt nicht interessieren, dann überspringen Sie es einfach.
Zugegeben, meine Antwort im Schulunterricht hatte mir selbst ein bisschen Angst eingeflößt. Ich hatte da mehr gesagt, als ich eigentlich dachte. Zugleich kam es mir vor, als hätte ich an etwas gerüttelt, das nur so tut, als sei es selbstverständlich.
Zu jener Zeit gaben die Beatles in Hamburg zwei Konzerte, und auf der Pressekonferenz stellten die Journalisten unfassbar dumme Fragen. Die Antworten der Band waren frech und cool. So wollte ich auch sein. Egal, was die Erwachsenen sagten. Meine kriegsversehrten Deutsch- und Lateinlehrer zum Beispiel, die über den Krieg nicht sprachen, und auch nicht über die Nazis. Oder der Religionslehrer, der prahlte, wie er im Krieg die von den Russen besetzte Höhe Nummer Sowieso genommen hatte – nun gut, der Mann war mir eh egal, weil ich mit Religion schon vorher in einer Waldorfschule abgeschlossen hatte. Dort wurde eine sanfte Sprache gepflegt, die Schule war aber autoritär wie alle anderen auch, und man wurde abwechselnd über verlorene Ostgebiete, arische Seelen oder spiritistische Erfahrungen unterrichtet.
Das war die Welt, mit der meine Freunde und ich im Jahr 1967 brechen wollten. Die Welt der sogenannten Schlagermusik und der Landserhefte. In jenem Jahr entdeckte ich auf Frank Zappas LP »Freak Out!« einen Song über »Gehirnpolizei«. John Coltranes radikale Freejazz-Hymne »Ascension« erschien, sie sprengte die Konventionen. Und Jimi Hendrix sang die Zeilen:
»Will I live tomorrow?
Well I just can’t say.
Will I live tomorrow?
Well, I just can’t say.
But I know for sure
I don’t live today.«
Auch dieses Stück kam 1967 heraus, vor 50 Jahren. In jenem Jahr malte ich eines Nachts an die Schulmauer das Wort »Untertanenfabrik«. Für mich traf zu, was Robert Musil in seinem »Mann ohne Eigenschaften« geschrieben hatte: »wenn wir damals Behauptungen aufstellten, so hatten sie auch noch einen anderen Zweck als den, richtig zu sein; eben den, uns zu behaupten!«
Und ich erstand ein frisch erschienenes Taschenbuch: Es hieß »Lenin. Aus den Schriften 1895–1923«.[4] Denn nach meinem etwas kühnen Wortwechsel im Unterricht wollte ich nun aus erster Hand erfahren, was es denn wirklich heißt, Kommunist zu sein. In dem Buch fand ich zum Beispiel einen Auszug aus Lenins Aufsatz »Die Aufgaben der russischen Sozialdemokraten«, den er 1897 in der Verbannung geschrieben hatte[5], 20 Jahre vor der Oktoberrevolution. Er erklärt darin, warum sozialistische Revolutionäre unbedingt für die konsequenteste Demokratie kämpfen müssten. Das gefiel mir. Ich las den Wortlaut naiv und ohne den historischen und ideologischen Kontext, so wie andere Textgläubige die Bibel oder den Koran. Dass es sich nur um die Phase des Kampfes gegen den Zarismus handelte und Lenin im Übrigen ein instrumentelles Verhältnis zur Demokratie hatte, fiel mir nicht auf.
Die Revolution der Bolschewiki vor 100 Jahren war ein Ereignis, in das Millionen Menschen Hoffnung setzten. Es folgten Terror, Krieg, Hungersnöte, Stalinismus, Gulag, Zerfall. Millionen hofften, Millionen starben. Eine schlimmere Enttäuschung war kaum denkbar. Es gibt zwar Leute, die behaupten, ohne die Oktoberrevolution wäre letztlich der Nationalsozialismus nicht zerschlagen worden. Aber das ist hypothetische Geschichtsbetrachtung und ändert außerdem nichts an der entsetzlichen Wirklichkeit des Sowjetkommunismus.
Die sowjetische Enttäuschung war nicht die letzte ihrer Art. Viele aus meiner Generation, die an die Revolution in Kuba oder Nicaragua, China oder Venezuela glaubten, wurden ebenfalls enttäuscht.
Das Parfüm der Revolte
Der Gedanke an eine Revolution veränderte 1967 meine Vorstellungswelt. Und meinen Alltag. Ich sah die Umgebung auf einmal mit anderen Augen. Die Gegenwart kam mir nur noch als Übergangszeit vor, als vorläufig. Jeden Konflikt mit Autoritäten verstand ich als Kampf gegen Verhältnisse, die nicht nur im Detail, sondern als Ganzes ungerecht waren. Die im Widerspruch standen zu den Idealen, von denen man mir in der Schule erzählt hatte. Ich vermeinte, hinter die Kulissen zu sehen, die mich umgaben. Es war das Bewusstsein, alles besser zu wissen. Was ja nur altersgemäß war.
Ich erinnere mich an den Moment, als ich im Mai 1968 den unbeholfenen Satz von Rudi Dutschke las: »Heute hält uns nicht eine abstrakte Theorie der Geschichte zusammen, sondern der existenzielle Ekel vor einer Gesellschaft, die von Freiheit schwätzt und die unmittelbaren Interessen und Bedürfnisse der Individuen und der um ihre sozial-ökonomische Emanzipation kämpfenden Völker subtil und brutal unterdrückt«[6] – angestrichen hatte ich mir die Wendung »der existenzielle Ekel vor einer Gesellschaft, die von Freiheit schwätzt«. Diesen Ekel hatte ich auch.
Letztlich also waren 1967 und 1968 für mich und viele andere die Jahre der Verneinung. Von ihr rührte die Attraktivität des Begriffs Revolution her, von der Negativität. Die Vorstellung von etwas Besserem war nur die notwendige Ergänzung, ohne die sich die Verneinung in Depression verwandelt hätte.
Im Jahr 1968 blockierten wir die Auslieferung der Bild-Zeitung (»Osterunruhen«), weil ihre Hetze gegen die linken Studenten in Berlin maßgeblich ein Klima erzeugt hatte, in dem sich schließlich jemand fand, der Rudi Dutschke mit den Worten »Du dreckiges Kommunistenschwein!« niederschoss. Zum ersten Mal bekam ich Tränengas in die Augen; wenn ich heute das Wort »Revolution« höre, erinnere ich mich an seinen stechenden Geruch. In kleiner Dosierung wirkt es sogar belebend. Es ist das Parfüm der Revolte. Ich habe es seit 1968 oft gerochen.
Eines Tages lud mich die Polizei vor. Angeblich hatte ich während einer Demonstration ein Schaufenster eingeschlagen. Das stimmte nicht, wie ich den freundlich-strengen Beamten ein wenig bekifft erklärte. Ich habe allerdings wenig später – mit anderen – die großen Glasscheiben des Hamburger Amerika-Hauses zerdeppert. Ein paar Jahre zuvor noch hatte mich mein Vater dorthin mitgenommen, um mit mir Gospels, Spirituals und Blues zu hören, nun aber saß in dem Gebäude der Feind, wie ich dachte. Wir riefen »USA – SA – SS«, wir deutschen Kinder einer Demokratie, für die auch amerikanische Soldaten gestorben waren, im Kampf gegen den SS-Staat.
Es gab erste Diskussionen über die Anwendung revolutionärer Gewalt. Auf meinem Plattenspieler lief jetzt nicht mehr das Spiritual »All God’s Children got Shoes«, sondern »Street Fighting Man« von den Stones:
»Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy,
’Cause summer’s here and the time is right for fighting in the street, boy«.
Doch im August 1968 wird auf einmal wirklich auf den Straßen gekämpft. Nicht in Hamburg, Berlin oder Paris, sondern in Prag. Sowjetische Panzer fahren gegen tschechische Demonstranten auf. Sofort finden sich zwei Dutzend oder mehr Schüler und Studenten im Zentrum des Hamburger SDS ein, des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, um zu diskutieren: Was bedeutet der Einmarsch? Was tun wir jetzt?
Solidarität! Das ist die eine Position. Also demonstrieren. Die andere: Die UdSSR sichert den Sozialismus. Also nicht demonstrieren. Die dritte: Die Prager Reformkommunisten sind vom Westen unterstützte Sozialdemokraten, folglich bäh; der Sowjetimperialismus ist das große Hindernis der Weltrevolution, auch bäh. Das ist die maoistische Position.
Und nun? Meine Freunde und ich beschließen, an der Demonstration gegen den Einmarsch teilzunehmen, mit Che-Guevara-Plakaten. Schließlich wissen wir, dass Guevara Streit mit der KPdSU hatte, die seiner Meinung nach nicht weltrevolutionär genug war. Fidel Castro, den wir zu jenem Zeitpunkt ebenfalls verehren, sollte den Einmarsch später freilich als »bittere Notwendigkeit« bezeichnen.
Wir ziehen also los. Sprechchöre haben wir diesmal keine. Einer ruft »Weg mit den Panzern, weg mit Dubˇceks SPD!«, aber das will nicht richtig zünden. Was nicht nur am verunglückten Versmaß liegt.
Ein Teil der Linken hat damals also den tschechischen Demokraten die Solidarität verweigert. Diesem schmählichen Verhalten lag allerdings eine Wahrheit zugrunde: 1968 in Westeuropa war von anderer Qualität als 1968 im Osten. »Der Pariser Mai, initiiert von den Jungen, war geprägt vom revolutionslyrischen Denken, der Prager Frühling hingegen war inspiriert vom postrevolutionären Skeptizismus der Erwachsenen«, wie Milan Kundera später treffend schrieb.[7] Wir ahnten das, setzten nur die Vorzeichen anders als er, der seine Enttäuschung bereits hinter sich hatte. Wir hingegen waren selbst revolutionslyrisch und jung, und wir lehnten den Skeptizismus der Liberalen ab. Eigentlich lehnten wir so ziemlich alles ab, den liberalisierten wie den autoritären Kommunismus.
Aber wir fühlten uns mehr und mehr vor eine Entscheidung gestellt.
Irreale Realpolitik
Nachdem der Ansturm der 68er vorüber war, landete ich im linken Sektenwesen, weil ich glaubte, an die Stelle der Spielerei müsse nun Entschlossenheit treten, und an die Stelle spontaner Rebellion systematische Machtpolitik. Ernsthaftes Arbeiten an einer Revolution. Und wir wünschten uns, wieder in den Worten Musils, eine »unzerreißbare Weltanschauung«.
Wir, meine Freunde und ich, blickten uns um und sahen nur eine einzige Macht, die auf der Seite des vietnamesischen Volks und des revolutionären Kubas zu stehen schien: die Sowjetunion. Und mit ihr das sozialistische Lager, die DDR eingeschlossen.
Klar war dieses Ostdeutschland nicht so wirklich attraktiv. Dass die Floskel vom »real existierenden Sozialismus« einen resignativen Unterton hatte, registrierten wir sehr wohl. Aber man kann sich die Umstände nicht aussuchen, meinten wir. Und auch nicht die Arbeiterklasse und die kommunistische Partei; sie sind so, wie sie nun mal sind, und wer die Revolution will, muss sich mit ihnen vereinigen – so dachten wir und nahmen Kontakt zur 1968 gegründeten DKP auf. Die war nichts anderes als die legalisierte Form der verbotenen KPD. Damals wurden viele gedrechselte Worte in den Raum gestellt, »Neukonstituierung« und so weiter, aber es war dieselbe Partei.
Nun lernten wir also Hamburger Hafenarbeiter kennen, die im Widerstand gegen die Nazis gekämpft und bis 1968 der illegalen KPD angehört hatten. Vorbilder. Enttäuscht waren wir dagegen vom Niveau der Schulungsarbeit. Kaum Originaltexte der sogenannten Klassiker (Marx, Engels, Lenin), dagegen hölzerne Abhandlungen aus der DDR. Wir hatten noch nicht begriffen, dass die Parteischulung auf Gehirnwäsche hinauslief, und dachten, wir könnten den ganzen ziemlich spießigen Laden mal kritisch auffrischen und auf Zack bringen – »die Partei bolschewisieren«, so nannten wir das, eine Floskel aus den Zwanzigerjahren benutzend, im Unwissen über deren wahren Gehalt, nämlich Stalinisierung.
Später erfuhr ich, dass es unter den Altkommunisten ziemliche Vorbehalte dagegen gegeben hatte, uns Verrückte in die Partei aufzunehmen. Junge Typen mit seltsamem Vokabular, die auf Parteiversammlungen mitschrieben und alles Mögliche zu kritisieren wagten. Doch eine flexiblere Funktionärsgruppe um Wolfgang Gehrcke, heute Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, setzte sich durch. Sie argumentierte, erstens würden sich die Neuankömmlinge schon anpassen, und zweitens würde die Partei dadurch attraktiver für andere junge Leute werden. Diese Funktionäre sollte in beiden Punkten recht behalten, besonders im ersten.
Auftragsgemäß absolvierte ich meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr, weil die Losung galt, man müsse sich dort aufhalten, wo die Arbeiterjugend ist, also nicht unter den Kriegsdienstverweigerern, die ja überwiegend Gymnasiasten seien. Folglich übte ich mich als Panzergrenadier im Schießen mit der Panzerfaust sowie im Eingraben in die schleswig-holsteinische Landschaft für den Fall, dass die Russen kämen. Die Rote Armee. Also meine Genossen. Angst vor den Vorgesetzten hatte ich nicht, ich war ja auf revolutionärer Mission: »antimilitaristische Soldatengruppen« zu gründen. Und hatte uns nicht auch der Liedermacher Franz-Josef Degenhardt agitiert? Er sang:
»Aber wenn du mich fragst, Junge,
soll ich gehen in die Armee?
Kann ich dir nur raten, Junge,
wenn du stark genug bist, geh. (…)
Lern mit ihren Waffen kämpfen,
wir gebrauchen sie einmal.
Lerne ihre Schwächen kennen.
Schwäche ihre Kampfmoral.«
Und wieder kam ich mir großartig vor. Wie lächerlich. Trotz mancher Schikanen und zuweilen auch entwürdigender Behandlung von Untergebenen handelte es sich schon damals, in den frühen Siebzigerjahren, um die Armee eines Rechtsstaats. Auch wenn hier und dort noch Nazitraditionen gepflegt und Nazisprüche gekloppt wurden. Mit meinen Beschwerden – etwa darüber, dass ein Vorgesetzter gesagt hatte, wir stünden unordentlich herum »wie in einer Judenschule« – konnte ich sehr wohl etwas ausrichten, aber das verbuchte ich auf meinem persönlichen Revolutionskonto und nicht auf dem des Rechtsstaats.
In den Folgejahren begegnete ich mutigeren Leuten, die sich mit Recht Revolutionäre nannten, sie kamen aus El Salvador oder Angola, Vietnam oder Chile, und sie beeindruckten mich. Wie die Philosophin und Bürgerrechtlerin Angela Davis, Schülerin von Herbert Marcuse. In Ronald Reagans Kalifornien drohte ihr die Todesstrafe, wegen »Unterstützung des Terrorismus«; sie wurde 1972 freigesprochen. Später erlebte ich Angela Davis bei einem fundraising dinner in New York; dass diese meine Heldin Mitglied der kommunistischen Partei war – ausgerechnet jener amerikanischen KP, die sich dogmatischer als alle anderen gebärdete –, bestärkte mich nur. Und sympathisierte nicht auch der Sänger und Bürgerrechtler Harry Belafonte mit dieser seltsamen Truppe? Er hat es mir selbst einmal erzählt. Amerikas Kommunisten konnte man viel vorhalten, aber nicht, dass sie jemals im Kampf für die Rechte der Afroamerikaner nachgelassen hätten. Der war eine gute Sache. Ich wähnte mich bei den Guten.
Kein Thema von gestern
In vielen, sehr unterschiedlichen Weltgegenden knirscht der Boden unter den gesellschaftlichen und politischen Gebäuden, auch in den reichen Ländern. In ihnen macht sich Misstrauen der Bevölkerung gegen die kleine Schicht der bestens in der Welt Eingerichteten breit, das sich beispielsweise in Wahlergebnissen für Parteien vom rechten Rand des politischen Spektrums ausdrückt, außerdem in Volksabstimmungen. Können daraus Erdbeben entstehen? Und wenn ja, welcher Art könnten die sein? Mir vorzustellen, da reife etwas Umstürzendes heran, flößt mir nicht nur Hoffnung ein – zu ungewiss ist das Kommende.
Jedenfalls ist irgendetwas im Begriff zu werden. Die politischen Umbrüche in den Vereinigten Staaten und in Europa, die Internationalisierung einer terroristischen Kalifat-Utopie, die Erosion der politischen Formen – aber auch das Phänomen, dass junge Aktivisten weltweit, und weltweit vernetzt, auf Tage oder Nächte währenden Versammlungen miteinander darüber diskutieren, wie das Kommende aussehen könnte, alles das lässt an jene berühmte Passage in Hegels »Phänomenologie des Geistes« denken, in der er schreibt, »daß unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist«. Hegel konstatiert »das allmähliche Zerbröckeln« seiner Welt, Teilchen für Teilchen; »ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet; der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, daß etwas anderes im Anzuge ist«.[8]
Für den deutschen Philosophen ging es grosso modo in der Geschichte immer voran, doch auch für ihn musste sie durch Phasen des Chaos und des Unheils; wie für alle Deutschen war ihm damals der Dreißigjährige Krieg nicht weiter weg als uns Heutigen die napoleonische Zeit. Und beschreibt er nicht mit diesen Sätzen eine Stimmung, die sich auch beim Lesen der Nachrichten von heute einstellt? Gegen Ende des Buches komme ich auf dieses Thema zurück.
Und deshalb dieses Buch
Ich habe zwei Soundtracks im Ohr. Der erste stammt aus der Osternacht 1968 in Hamburg: Hundertschaften von Polizisten hetzen mit ihren bellenden Hunden hinter uns her. Der zweite, aus Tunis, besteht aus dem abendlichen Singsang der Muezzins, dazwischen einzelne Gewehrsalven.
Auf die tunesische Revolution kommt dieses Buch immer wieder zu sprechen – schließlich habe ich sie miterlebt und das Land unzählige Male besucht, im Auftrag der Wochenzeitung Die Zeit, der ich dafür dankbar bin. Ansonsten bewegt sich das Buch auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent, in West- und Osteuropa sowie in Asien. Es durchstreift die Geschichte der Revolten und Revolutionen vom Spartacus-Aufstand bis zum Kiewer Maidan, geht aber nicht chronologisch vor, ordnet seinen Gegenstand auch nicht nach Ländern, sondern nach Aspekten, Motiven, Ideen, weshalb es frohgemut und vielleicht etwas gewagt für manchen Geschmack durch Zeit und Raum springt. Einige der Revolutionen werden mehrfach vorkommen, eben weil es sich um facettenreiche Vorgänge handelt und weil dies kein Geschichtsbuch ist, das die Ereignisse entlang des Zeitstrahls aufreiht.
Es werden Praktiker und Theoretiker der Revolution vorgestellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Den Lesern wird auffallen, dass besonders die französische Literatur zum Thema rezipiert wurde. Es liegt daran, dass sie die reichhaltigste ist, denn Frankreich hat die reichhaltigste Revolutionsgeschichte durchlebt. Und seine Revolution von 1789 ist die »Modellrevolution der Neuzeit«, wie der Historiker und Romanist Rolf E. Reichardt treffend schreibt.[9]
Namentlich in der französischen Literatur tobt der Streit um die Bewertung dieser Revolution bis heute. Zu nennen sind – neben vielen anderen – die Werke von Albert Soboul und François Furet. Doch auch die anderen Revolutionen, eigentlich alle, bieten Stoff für Historikerstreit. Die Schlachten von damals werden immer noch geschlagen.
Fertig geworden bin ich mit der Revolution bis heute nicht. Das ist das Motiv dieses Essays. Die Beschäftigung mit Revolutionen hat mich immer wieder verändert, mal so und mal anders. Geblieben ist eine Art Respekt. Revolutionen sind herrlich, schrecklich, sind groß im Guten wie im Bösen.
Und für alle Revolutionen gilt: Sie erzeugen Unwiderrufliches. Selbst dann, wenn die Konterrevolution siegt. Denn die Erinnerung bleibt. Nicht nur an die Ideen der Revolution, an die Utopien, die großen Hoffnungen. Sondern auch an die Kämpfe selbst, die Einmischung der von diesen Hoffnungen bewegten Massen in die Politik.
Revolutionen halten das Gedächtnis an etwas Allgemeingültiges lebendig, an eine überhistorische Botschaft, die Bertolt Brecht in seinem »Arbeitereinheitsfrontlied« so ausdrückte:
»Und weil der Mensch ein Mensch ist,
hat er Stiefel im Gesicht nicht gern.
Er will unter sich keinen Sklaven sehen
und über sich keinen Herrn.«
Kapitel 2ANNÄHERUNG AN EINEN BEGRIFF
Legendär, wenngleich nicht belegt, ist der Wortwechsel zwischen Ludwig XVI. und dem Herzog de La Rochefoucauld-Liancourt am Abend des 14. Juli 1789, des Tags, an dem in Paris die Bastille gestürmt wurde. Der König soll konsterniert gesagt haben. »Aber das ist eine Revolte!« Daraufhin der Höfling: »Nein, Sire, das ist eine Revolution.«
Aber was ist eine Revolution? Versuchen wir zunächst eine Skizze. Sie wird unscharf bleiben. Am Ende des Buches sind die Konturen vielleicht deutlicher, aber so viel steht fest: »Revolution« ist einer jener Begriffe, deren Ränder nicht begrenzt sind, sondern verlaufen. Es ist wie mit dem Begriff des Menschen: Ich bin einer, ein Stein ist keiner, aber es gibt problematische Fälle (Neandertaler, Embryonen im Vierzellstadium, Leichen).
Revolution heißt Umwälzung. Und um den Begriff einzuschränken, schließen wir von vornherein bestimmte Vorgänge aus, wie zum Beispiel Revolutionen der Industrie, der Technik, der Mode, der Sexualität und so weiter, obgleich derartige Umwälzungen durchaus mit Revolutionen in unserem Sinne zu tun haben können: Die industrielle Revolution brachte die Arbeiterklasse hervor, die technischen Revolutionen trugen mit Druckerpresse oder Internet zur Verbreitung revolutionärer Bewegungen bei; die Art und Weise wiederum, sich zu kleiden, wandelt sich mit den Revolutionen – denken wir nur an die phrygischen Mützen der Französischen Revolution, die Kossuth-Bärte der revolutionär gesinnten Ungarn im 19. Jahrhundert, den Mao-Look der Siebzigerjahre oder an die Che-Guevara-T-Shirts; sogar die »sexuelle Revolution« ist auf mehr als eine Weise mit den revolutionären Aspirationen der 68er verwoben.
Der Feminismus ließe sich ebenfalls als Revolution bezeichnen. Er erschüttert das Patriarchat, verändert also die Machtverhältnisse, und zwar durchaus unter Massenbeteiligung. Der Feminismus ist außerdem mit einigen klassischen Revolutionen eng verwoben. Die Französische Revolution wurde zwar lange Zeit von Männern als ausschließliches Werk von Männern beschrieben, aber in Wahrheit spielten Frauen in mehreren Episoden der Revolution eine entscheidende Rolle. Es gab damals auch Publizistinnen, die den logischen Schluss zogen: Menschenrechte für alle bedeuten das Ende der Männervorrechte. Doch noch ehe die Revolution endete, war diese Stimme schon wieder erstickt. Frauen durften in der Spätphase der Jakobinerherrschaft keine Revolutionssymbole mehr tragen, sich auch nicht in Klubs versammeln, und die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges endete 1793 unter der Guillotine.
Der Kampf für Frauenrechte war auch Element der Russischen Revolution – und definitiv der tunesischen. Gleichwohl zählt der Feminismus nicht zu den Revolutionen, die ich mit diesem Buch meine. Ebenso wenig wie die Aktivitäten kalifornischer Hightech-Unternehmen, die mithilfe radikal neuer Technologien die Gesellschaften umkrempeln wollen. Beide sind sehr wohl politisch und zielen auf eine Neuverteilung von Macht, dennoch geht es in diesem Buch um einen andersartigen Vorgang: Veränderungen der Staatsmacht, die sich als mehr oder weniger auseinandergezogene Kette von Explosionen vollziehen, ohne spektakuläre Massenaktionen undenkbar wären und eine veränderte gesellschaftliche Landschaft hinterlassen. Was zugegebenermaßen eine sehr vorläufige Annäherung an den Revolutionsbegriff ist, eine Hilfskonstruktion, wenn man so will, die wir später wieder vergessen können, wenn wir unseren Gegenstand gründlicher beleuchtet haben.
In der Geschichte kommt es auch hin und wieder zu Revolutionen der Herrschenden – doch das sind Revolutionen nur im übertragenen Sinn: radikale Weichenstellungen, vorgenommen von den Mächtigen, die ein Land modernisieren. »Soll Revolution sein, so wollen wir sie lieber selber machen als erleiden«, äußerte sich Bismarck, und er meinte damit den Krieg gegen Österreich im Jahre 1866, dessen Ergebnis ein preußisch geführter deutscher Nationalstaat war; damals ging der Begriff einer »Revolution von oben«[10] um, später sollte auch der revolutionstheoretisch beschlagene Friedrich Engels den Ausdruck für die Ereignisse des Jahres 1866 übernehmen. Der amerikanische Revolutionshistoriker Crane Brinton nennt als weitere Beispiele für Revolutionen von oben die kemalistischen Reformen in der Türkei, die Meiji-Restauration in Japan oder die vom amerikanischen General Douglas MacArthur nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan durchgeführten Reformen – die gesellschaftliche Wirkung aller dieser Umwälzungen reichte Crane Brinton zufolge weiter als diejenige der großen Revolutionen von unten, die er untersucht hatte.[11]