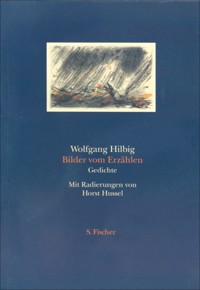12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Werke
- Sprache: Deutsch
Deutschland, Mitte der achtziger Jahre: Ein Schriftsteller aus Leipzig darf für ein Jahr die DDR verlassen. Obwohl ihm der Westen fremd bleibt und sich seine neue Lebensgefährtin wieder von ihm trennt, lässt er den Termin für seine Rückkehr verstreichen. Ohne echten Kontakt zu seiner Umwelt, weder zu seiner alten Heimat noch zu seiner neuen Umgebung, versinkt er in Alkoholexzessen und Schreibkrisen. Orientierungslos und ohne festen Boden unter den Füßen irrt er durch ein gespenstisches Land – es ist das seiner Seele, sein Leben. Ein Nachwort von Julia Franck und unveröffentlichtes Material zur Entstehungsgeschichte des Romans ergänzen den Band der Werkausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolfgang Hilbig
Das Provisorium
Roman Werke Band VI
FISCHER E-Books
Herausgegeben von Jörg Bong, Jürgen Hosemann und Oliver Vogel
Mit einem Nachwort von Julia Franck
Inhalt
Das Provisorium
Um meine Werke schreiben zu können, habe ich meine Biographie, meine Person geopfert. Ich habe nämlich schon früh den Eindruck gehabt, mein Leben sei für mich in Szene gesetzt, damit ich es von allen Seiten sehen solle. Das versöhnte mich mit dem Unglück, und es lehrte mich, mich selbst als Objekt aufzufassen.
August Strindberg: Schwarze Fahnen
Ich wandle in der Finsternis.
Doch mich leitet der Duft des Ginsters.
Nicolás Gómez Dávila
In Nürnberg, in der zwiespältigen Beleuchtung einer Boutique, war ihm plötzlich etwas geschehen: als er die flach gestreckten Stufen zum Souterrain hinunterstieg, um eine enger werdende Windung der Treppe, die eine Art Wendeltreppe war, unhörbar auf dem Teppich und mit unrhythmischem Schritt, da die Stufen ungleich lang und irritierend waren, hatte er sich auf einmal von hinten angegriffen gefühlt. Ein matter Schatten überholte ihn, er ahnte einen gegen sich erhobenen Arm, bewaffnet oder nicht, und gedankenschnell wirbelte er auf den Absätzen herum. Im nächsten Moment war er erstaunt, wie prachtvoll seine Instinkte noch funktionierten. Automatisch flog ihm die Linke aus der Hüfte, übercrosste den drohend erhobenen Arm und knallte trocken auf einen Kinnwinkel, den er noch gar nicht recht im Auge gehabt hatte. Das hätte scheinbar schon gereicht, doch mit der Rechten, unterstützt durch einen leichten Kniefall, traf er den anderen gleich darauf in der Körpermitte, er spürte den Hornknopf einer leger geschlossenen Jacke, welcher der genaue Zielpunkt war, und mit dem restlichen Schwung zog er die Rechte nach oben, dicht am Körper des anderen, der Knopf flog ab, und die Jacke sprang auf, und dieser Aufwärtshaken hebelte den Kerl aus. Und indem er mit einem kleinen Step wieder auf beide Füße pendelte, traf er mit einem zweiten linken Cross den ungedeckten Kopf noch einmal voll; das erledigte den Typ, er brach auseinander.
Mit einem Ächzen fiel der Kerl auf das Geländer, über dem er sich wie eine Schere schloß, dann wippte er zurück, setzte sich polternd auf die Treppe, wo er, ehe er auf dem Bauch liegenblieb, eine wenig elegante Rolle rückwärts vollführte und dabei eine Stehlampe umriß, die sofort erlosch. Dennoch war in dem Halbdunkel zu sehen, daß der Figur Stücke von zerbrochenen Gliedmaßen aus den Jackenärmeln rutschten, ihr Gesicht, das ins Genick gedreht war, zeigte ein vorwurfsvolles Grinsen. Durch die Staubwolke hindurch waren mehrere schrille Schreie von unten aus dem Verkaufsraum der Boutique zu hören; C. stieg, indem er sich den Gipsstaub abklopfte, über die zerstörte Schaufensterpuppe, von der er sich überfallen gefühlt hatte, hinweg und entfernte sich, das Durcheinander in seinem Rücken nicht achtend, und mit beschleunigten, aber gelassenen Schritten trat er wieder in die helle Nachmittagssonne auf der Breiten Gasse hinaus. Er schüttelte den Kopf und sah sich nervös nach allen Seiten um; dabei verschluckte er etwas wie ein merkwürdig schlechtes Gewissen: zweifellos war sein Gegenangriff viel zu massiert gewesen, wahrscheinlich hätte eine der beiden Doubletten schon ausgereicht.
Nichts war geschehen, der Nachmittag war normal, alles verhielt sich denkbar normal, auf der Breiten Gasse herrschte das alltägliche Gewühl der Konsumenten, in dem er ohne Aufsehen untertauchen konnte. Der Andrang war gerade jetzt, wenige Stunden vor dem Ende der Geschäftszeit, besonders stark; es gab niemanden, der in der glänzenden Ladenzeile langsam ging, alles eilte und eiferte, und alles trug in den Gesichtern die Überzeugung zur Schau, der gerechtesten Sache der Welt zu dienen: dem Shopping. Unten am Rand der Querstraße zur Breiten Gasse kamen die Taxis nicht zur Ruhe, kaum hielt eins von ihnen, wurden schon pralle Plastiksäcke auf die Rücksitze oder in den Kofferraum geworfen, ein Wagen nach dem anderen füllte sich mit Kundschaft, und einer nach dem andern glitten sie davon, weich und spielerisch, den nachrückenden Autos Platz machend, sie schnurrten auf das Weichbild der Stadt zu, oder hinaus in die Außenbezirke, wo die Taxis wieder neue, noch unbefriedete Käufer einluden und vor die Fußgängerzone fuhren. So ging es hin und her in stetem Handel und Wandel, wie dies irgendein Präsident, ein Bank- oder Bundespräsident ausgedrückt hatte, konservativ und geschmeidig im Handel und Wandel einer seiner Reden; und die Straßenbahnen, die vor dem Bahnhof anlangten, öffneten sich und spien Fluten von Käufern aus, die sich sofort in der Fußgängerzone verliefen. Und unter dem Pflaster jagten die U-Bahnen herbei, entließen unter den ordnenden Stimmen der Lautsprecheranlagen wiederum Scharen von Käufern, dirigierten sie auf die dicht bestandenen Rolltreppen, welche die Menschenströme direkt in die Helligkeit des Einkaufsviertels katapultierten. Und dort mischten sich die Zufriedenen mit den Unzufriedenen, und sie mischten sich umgekehrt; die Betrogenen vereinten sich mit den Unbetrogenen, und sie umarmten ihre Betrüger vor Glück, wenn sie in die Boutiquen eintraten, in die Shops und Drugstores und Galerien, und sie kauften und zahlten, und zahlten erneut und zeichneten ihre Schecks mit geflügelter Hand. Und wenn sie wieder auf der Breiten Gasse waren, strahlten sie im Glanz ihrer Liquidität, und jeder von ihnen war ausgezeichnet und bedeutsam genug, das Wohlwollen Gottes im Herzen zu tragen. So wandelten sie, überragt vom Getürm der nahen Kathedralen …
Unterdessen saß er schwitzend im Schatten eines der Schirme, von denen die Tische vor dem Eingang zu einer Konditorei überspannt wurden, und versuchte, einen lauwarmen Kaffee langsam zu trinken; das Glas Wasser, das er zum Kaffee bestellt hatte, war in einem einzigen Zug in ihn eingeflossen.
Hier wären nun also genug Leute! dachte er beleidigt und schaute dem Menschentreiben zu. Genug Figuren, es wäre eine Überzahl von Figuren selbst für einen dicken Roman. Und es müßte damit sogar die Kritik zufriedengestellt werden können, die Literaturkritik, die sich seit der seligen Postkutschenzeit immer wieder mit der Anzahl der Handlungsträger in Erzählwerken beschäftigt. Personen, Personen und nochmals Personen, es ist immer dasselbe Lied. Weshalb aber soll ich mich darauf noch einlassen … ich muß zusehen, daß ich mich selbst wieder zu einer Person machen kann. Und ich habe meinen Kampf mit der Kritik schon aufgegeben, ehe er noch begonnen hat. – Es war dies eine etwas großmäulige Rede, wie sie zu seinen Gewohnheiten gehörte, wenn er mit sich allein war und mit einem schattenhaften Gegenüber Gedanken, zumeist über Literatur, austauschte, oft genug in Augenblicken, in denen er sich von vorangegangenen Aufregungen erholen mußte.
In einer ihm unbestimmbaren Richtung, in die er durch Zufall blickte, irgendwo über den hohen Gebäuden, die linkerhand des Bahnhofs standen, war die Sonne in den Dunst eingetaucht, der über der Stadt lag; in diesem Dunst entzündete sie noch einmal, wie mit letzter Kraft, ihr Gleißen, und erhitzte Farben schienen sich von schräg oben in die Straße zu ergießen. Es wurde Abend, die Geschäftigkeit ringsum zeigte erste Anzeichen von Ermüdung. Im gerade noch dicht geschlossenen Wall der Autos am Trottoirrand taten sich Parklücken auf, die nicht wieder besetzt wurden, die Menschenströmung in die Fußgängerzone hinein begann zu verebben, und dafür kamen immer mehr Leute heraus. An den Tischen vor der Konditorei gab es plötzlich freie Plätze, und gleich wurde das Geschirr nur noch saumselig abgeräumt, da der Hauptbetrieb vorbei war. Ein junges Paar, das bei ihm am Tisch gesessen hatte, war urplötzlich aufgebrochen, als hätte es in ihren Köpfen ein Klingelsignal gegeben. Zuvor hatten die beiden noch mit verbissenen Gesichtern große Brocken von Erdbeertorte mit Sahne in sich hineingestopft; mehr als ein Drittel davon hatten sie auf den Tellern zurückgelassen. Nicht ohne sie noch mit den Kuchengabeln zu zerstoßen und zu zerreißen, so daß sie nicht mehr weiterverwendet werden konnten. Hatten sie die Blicke C.s etwa für die eines Verhungernden gehalten, als er gebannt zusah, wie sie sich vollstopften? Falsch gedacht, es war der Durst, der in seinen Augen glänzte. Der Grund für den überstürzten Aufbruch war ein anderer, es war die Enttäuschung darüber, daß es achtzehnuhrdreißig war und damit an der Zeit, das Einkaufsviertel zu verlassen. Vor den Eingängen der großen Kaufhäuser standen die Männer mit den Schlüsseln und öffneten den letzten Kunden, die sich in dem Warenlabyrinth verspätet hatten, noch einmal die Glastüren, so daß diese mit hochroten Gesichtern auf die Straße entkamen: Es war vorbei! Leer der Abend, endlos nun die folgende Nacht. Zäh und lastend das kommende Dunkel, das nahe am Nichts lag, und kaum beantwortbar die Frage, ob morgen noch einmal ein so schöner Einkaufstag werden konnte. Wolkenbahnen zogen sich vielleicht in der Finsternis über der Stadt zusammen – o dieser unberechenbare September! Mit einem giftigen rotgelben Absud von Farbe hatte sich die Sonne in den Dunst verkrochen, ihre Resthitze war nicht mehr imstande, die Winkelgerüche der Stadt zu verbrennen. Und diese wagten sich nun hervor: der unerklärliche Geruch von altgewordenen Garfetten hob sich aus den Gossen und setzte sich wie seifiger Schweiß über die Muster der geflochtenen Plastiktischdecken vor dem Kaffeehaus. In der Wärme war die himbeerrote Geleemasse der übriggebliebenen Erdbeertorte zerschmolzen, und in den Pfützen auf den Tellern zappelten einige Wespen, die in die Falle der Farben und Düfte gegangen waren. Bis zwanzig Uhr sollte das Café geöffnet bleiben, doch dieser Mensch, der allein sitzen geblieben war, der seit einer Stunde vor einer halben Tasse Kaffee saß, auf dessen hellbrauner Oberfläche ein gelbes Fettauge schwamm, das sich nach dem Verrühren der Milch nicht aufgelöst hatte, dieser Mensch, der nichts mehr bestellen wollte, erntete längst die scheelen Blicke des Personals, das aus einer Blondine und einer Brünetten bestand, beide von unbestimmbarem Alter. Woran dachte die- ser Mensch, der sich ganz offensichtlich ohne Wagen am Rand des Einkaufsviertels aufhielt? Er hatte allerdings nichts zu transportieren, denn seine Beute bestand lediglich aus dem dünnen quadratischen Inhalt einer einzigen Plastiktüte, in ihren Abmessungen etwa dreißig Zentimeter breit wie lang. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte er nur eine einzige Schallplatte gekauft, und hier am Tisch hatte er nur einen einzigen Kaffee bestellt, mit Mineralwasser, und nach dem Servieren sofort bezahlt. Ohne einen Pfennig Trinkgeld. Man konnte diesen Typus nicht einordnen, dem Dialekt nach kam er nicht aus Nürnberg. Eher vielleicht aus dem Osten, doch wie kam man aus dem Osten hierher nach Nürnberg, es paßte da etwas nicht ins Bild.
Seine Art war auch nicht der jener drei Biertrinker zu vergleichen, die an einem entfernteren Tisch, nahe der Trottoirkante, Platz genommen und ihre Autoschlüssel auf die Tischdecke geworfen hatten. Drei jüngere Männer, aber nicht zu jung, und drei verschiedene Wagenschlüssel, die mit den Firmensymbolen der Automarken und mit golden oder silbern blitzenden Schmuckanhängern versehen waren. Gelangweilt spielten sie mit dem klingelnden Metall, das nicht billig war, und ließen es ab und zu schwungvoll um die Finger wirbeln. Alle drei trugen sie bunt bedruckte Hemden, die bis knapp zum Gürtel offen gehalten waren, so daß sie solargebräunte Haut und das lockige helle oder dunkle Brusthaar zeigten: man konnte sehen, daß sie etwas taten für ihre Körper. Knapp saßen die kurzen Ärmel und spannten sich über der Muskulatur von Schultern und Oberarmen; zwei von ihnen trugen farbige Tätowierungen zur Schau, alle drei waren mit goldenen Armbanduhren und zusätzlich mit ebenfalls goldenen, feingliedrigen Gelenkketten geschmückt, und auch im Brusthaar schimmerte das Gold von Ketten. Sie gossen sich Bier nach, indem sie die Flaschen mit drei Fingern hielten, sie ließen den Gelenkschmuck in der Abendsonne blitzen und achteten konzentriert darauf, daß der Schaum den Rand der Stielgläser nicht überstieg … C. spürte seinen Durst, als er ihnen beim Trinken zuschaute; sie tranken so abgezirkelt und wohlbemessen, das Attribut dieser Art zu trinken hieß: wohlbezahlt; C. hatte das nie gekonnt; sie beachteten ihn nicht, sie wußten sich von den beiden Damen der Bedienung mit gebührlichem Ernst beobachtet … und dabei unterhielten sie sich aufmerksam und zugleich in einer etwas wegwerfenden Art. Stets sprach nur einer von ihnen, während die anderen zuhörten und dabei gelegentlich, wie im stummen Einverständnis, aus den Gläsern tranken. Einer, der Nicht-Tätowierte, dem C. ins Gesicht blicken konnte, wischte sich nach jedem Schluck sorgsam den Schaum aus dem Schnauzbart, worauf er die spitzen Enden dieses Barts zwirbelte, sehr präzise und scheinbar selbstvergessen; und die langen nach oben gebogenen Enden des Barts auf der etwas zu kurzen Oberlippe schaukelten, wenn er mit dem Sprechen an der Reihe war, und mit gebanntem Blick schaute C. diesem Schaukeln hinterher, es entfernte sich wie der Flug eines Geiers. Geschmeidig sich wiegend ließen die Damen der Bedienung ihre Hüften um die Tische gleiten, die noch nicht abgeräumt waren. Sie ordneten das Geschirr auf ein Tablett und fächelten die Krümel aus dem Geflecht der Tischdecken; von Zeit zu Zeit verschwanden sie im Innern des Cafés. Vor C. waren die Kuchenreste zurückgeblieben; er fühlte sich aller Aufmerksamkeit enthoben, und er dachte: Es ist vorbei …
Vorbei! wiederholte er, und es war schon wie ein Nachhall aus dem Schlaf. Vorbei und zu spät, mich wieder zurückzumelden. In wenigen Augenblicken werde ich nach irgendeiner Richtung in diese Stadt verschwinden. Es ist etwas abgebrochen, etwas hat sich verschoben. Vielleicht werde ich plötzlich die Augen aufmachen und sehen, was es gewesen ist …
Er war in Nürnberg, was er noch immer nicht recht begreifen wollte. Er war von anderswo gekommen, doch nun war er in Nürnberg, jener Stadt, in der sich eine bestimmte Sorte jüngerer männlicher Scheusale mit abgekupferten Kaiser-Wilhelm-Bärten zierte. Nürnberg war eine Stadt der Reminiszenzen, eine Stadt der Nachbildungen; er hatte den Eindruck, jedes Gran des menschlichen Wesens sei in dieser Stadt vervielfältigt worden, damit man es in den Boutiquen anbieten könne.
Er war also angekommen in einer Stadt, in der man mit absoluter Sicherheit spurlos verschwinden konnte. Verschwand er nach rechts hinten, nach dem alten Stadtzentrum zu, gelangte er bald, nach erneutem Durchqueren der Fußgängerzone, die nun fast ausgestorben war, vor den sogenannten Burgberg, wo alle Wege steil aufwärts führten. Hier wurde jeder Spaziergang zu einem beschwerlichen Aufstieg, nichts für das Volumen seiner Lunge, die einst eine Sportlerlunge gewesen war. Es gehörte dies zu einem anderen Leben. Vor der Abenddämmerung des Spätsommers lagerten sich auf den freien Plätzen vor dem Burggemäuer diejenigen, die man als Rucksacktouristen bezeichnete, gemeinsam mit beträchtlichen Gruppen jenes Teils der Nürnberger Jugend, der sich als unbürgerlich empfand. Es sah aus, es sollte so aussehen, als habe sich auf dem groben Pflaster der Plätze ein ganzes Heerlager von Abtrünnigen und Versprengten ausgebreitet; man sonnte sich in den letzten Strahlen der schon sinkenden Sonne. Alternatives Gebaren glaubte hier oben für die kurze Zeitspanne, in der es noch hell war, dem Konsumrausch zu trotzen, der eine Ebene tiefer, auf einer nicht so mühsam zu erklimmenden Stufe der Stadt, soeben erloschen war. Zwischen einem Pulk von Wein- und Biertrinkern versuchte jemand seine Gitarre und schien Aufmerksamkeit zu erringen. Und erreichte sogar, daß C. den Schritt verlangsamte … Was hatte es auf sich mit dieser Vorzeigemusik? Im Moment nicht mehr, als daß C. wieder an seine Schallplatte dachte, die er, daheim angekommen, sofort abspielen wollte.
Unter denen, die auf dem Pflaster hockten oder lagen, wandelten auch die anderen, welche die Szene nur zu besichtigen dachten, und auch zu denen gehörte C. nicht. Sie waren besser oder teurer angezogene Leute, jedenfalls solche, die nicht mehr die Verpflichtung spürten, sich standesgemäß in Jeansanzüge oder abgeschabtes Lederzeug zu hüllen, oder denen gerade nicht danach war, sich in diese ideologisch verknappten Konfektionsmaße zu zwängen, diejenigen also, die ihre Einkäufe zur Zufriedenheit erledigt und die Beute zuhaus abgestellt hatten. Und diese schritten nun aufrecht über den Burgberg, Toleranz verströmend aus jeder Pore und eine ebensolche unzweifelhaft für sich in Anspruch nehmend, in Form von Nichtbeachtung, und diese wurde ihnen freizügig entboten. So gingen sie erhobenen Hauptes durch den Bratwurstrauch, der in Nasenhöhe auf dem Bierdunst schwamm und im Kreis um den Burgberg zog. Alle Verkaufsstände rundum waren geöffnet, und man wartete an diesem Spätsommerabend nicht vergeblich auf Kundschaft. C. wollte heim und seine Schallplatte abhören, das wiederholte er sich eindringlich. Und er wollte nicht an einem der Bierkioske stehenbleiben. Er gehörte weder zu den einen hier, noch zu den anderen, weder zu denen, die hier herumlagen, noch zu denen, die dazwischen umhergingen und das Ganze besichtigten. Die Freiheit hier war nichts für ihn, denn er war viel freier. Er war unfrei aufgrund einer viel größeren Freiheit, denn er gehörte weder auf diese Seite der Welt, auf der man hier lag und flanierte, noch auf jene andere Seite, auf der man sich danach sehnte, hier zu liegen …
Er bewegte sich nun eilig, die kürzesten Wege zwischen den Sitzgruppen suchend; nur einmal hielt er an, als vor seinen Füßen eine leere Weinflasche laut klirrend das Kopfsteinpflas- ter abwärts rollte, bis sie von irgendwem gestoppt wurde. Die Schallplatte pendelte an seinen linken Oberschenkel, er hatte die Griffschlaufen der Plastiktüte übers Handgelenk gestreift und die Hand in der Hosentasche; mit der freien Hand rauchte er, was gut zu seinem zielstrebigen Gesicht paßte. Als er den Burgberg verlassen hatte, konnte er nicht mehr leugnen, daß sein vorherrschendes Empfinden ein starker Durst war. Zwei- oder dreimal blieb er vor einer der Gaststätten stehen, deren Türen weit geöffnet waren, offenbar, um die frische Abendluft hineinzulassen. Er zwang sich, weiterzugehen, und fand endlich ein Taxi, in das er einstieg.
Der Fahrer brauchte ihn nur ein kurzes Stück zu chauffieren, und schon war er da. Er einnerte sich – es war nun schon eine Weile her –, eine Zeitlang hatte er sich fast jeden Abend im Taxi zu seiner Wohnung bringen lassen, völlig orientierungslos, wie er war. Und wie oft war es geschehen, daß der grinsende Fahrer nur um zwei Ecken kurvte, durch eine winzige Nebenstraße, und nach einer Minute vor seiner Haustür anhielt. Er wäre vielleicht auch ohne jene Unmengen von Alkohol, die er trank, orientierungslos geblieben, er fand sich in den westdeutschen Städten nicht zurecht. Lange, monatelang hatte er sich in Nürnberg nicht im geringsten ausgekannt, ebensowenig wie die Monate zuvor in Hanau bei Frankfurt am Main, obwohl die Stadt klein war und geradlinig wirkte. Westdeutsche Straßen waren nie finster, und sie waren von einer inflationären Menge von Schriftzeichen, Sinnbildern, Piktogrammen und anderen Symbolen überschwemmt, unmöglich, aus diesem Überfluß an Zeichen ein paar Anhaltspunkte zu entnehmen und sie sich zu merken. Es herrschte eine Inflation von Anhaltspunkten, demzufolge war jeder Anhalt gleichzeitig richtig und falsch, das Schriftsystem hatte sich in ein Medium des Analphabetismus zurückverwandelt.
Er kannte sich auch jetzt noch nicht richtig in Nürnberg aus … jetzt, wo es an der Zeit war, sich auszukennen. Denn es war damit zu rechnen, daß er hier allein auskommen mußte. Aber er hatte schon mehrmals damit rechnen müssen, und es war nicht so geblieben. Und er kannte sich auch nicht in der Zeit aus, er war orientierungslos in bezug auf die Zeit, die er schon hier war. Doch das war auch weniger interessant, er war hier, das stand fest, und er war hier in einer gegenwärtigen Zeit, in einer täglich aufs Neue gegenwärtigen Zeit, mit der er klarkommen mußte. Wenn ihn jemand fragte, hatte er oft genug erwidert, er sei seit einem guten Jahr hier … und gleich darauf war ihm aufgefallen, daß es schon zwei Jahre waren. Oder gar mehr … es war, als ob er sich weigerte, aufzuwachen und sich Gewißheit darüber zu verschaffen, seit wieviel Jahren er schon hier in Nürnberg existierte. Wieviel von seiner Lebenszeit hier schon verstrichen war. Er hatte immer noch nicht mehr als dieses eine Jahr im Kopf … und er hielt es für möglich, daß er nach dem Ende des dritten Jahrs immer noch nicht mehr im Kopf haben würde, vielleicht nach fünf Jahren nicht.
Er hatte schon so angefangen, er war schon mit dieser Bewußtlosigkeit hier angekommen, monatelang hatte er es vor jedermann verschwiegen, daß er nach Nürnberg gezogen war. Und wie aus Gründen der Vorspiegelung hatte er seine kleine Wohnung in Hanau zusätzlich behalten, der größte Teil seiner Post ging noch monatelang nach Hanau und wurde ihm aufgrund eines Nachsendeantrags nachgeschickt. Er war hier angekommen wie in einer Hypnose. Hypnotisiert hatten ihn seine eigenen Gedanken, und diese kreisten um die Gestalt einer Frau. Sie kreisten um ihre Gestalt und um ihr Bild, und es war ihm absolut nicht gelungen, sie zu einer wirklichen Frau für sich werden zu lassen. Das war ihm bei noch keiner Frau gelungen.
Als es sich nicht mehr verheimlichen ließ, daß er einen Ortswechsel vorgenommen hatte, murmelte er etwas von einer preiswerten Wohnung ins Telefon, was nicht einmal gelogen war. – Aber deine Wohnung in Hanau war ebenfalls preiswert, sagte die Frauenstimme am anderen Ende der Leitung. Sogar noch viel preiswerter. – C. hatte den dumpfen Klang in der Stimme sehr wohl bemerkt, es baute sich eine Spannung auf, die in jedem Augenblick schrill werden konnte. Die Wohnung in Nürnberg sei ihm besorgt worden, erklärte er, da habe er einfach zugreifen müssen. Außerdem habe Hanau viel mehr Ähnlichkeit mit Leipzig, als ihm lieb sei … – Dir hat es also in Leipzig noch nie gefallen, sagte die Stimme enttäuscht, und vielleicht hat es dir auch bei mir noch nie gefallen. – Das ist Unsinn, sagte er. Du bist nicht Leipzig, du lebst nur da. – Und weil es dir in Leipzig nicht gefällt, wirst du nicht zurückkommen. – Das war schon immer deine Befürchtung. – Übrigens ist dir auch diese Wohnung in Hanau besorgt worden, wie ist so etwas möglich? Du kannst ja nicht zurückkommen wollen, wenn dir reihenweise Wohnungen besorgt werden. – C. hörte mit Schrecken, wie ein Schluchzen in die Stimme in Leipzig stieg. Um dies mit einem dummen Witz aufzulösen, sagte er: Ich habe eben irgendwo ein paar Gönner. Mir für ein Jahr etwas zu besorgen, das fällt ihnen nicht schwer. Aber nach dem Jahr würde die Sache ernst werden, und du weißt, wie ich dazu stehe … – Du wolltest sagen, du hast eine Gönnerin! Du willst mir mitteilen, daß du dich von ihr nach einem Jahr, wenn es ernst werden könnte, wieder verabschieden willst …
Was hatte er da für einen Blödsinn geredet! Es war natürlich nicht wahr, daß ihm die Wohnung in Nürnberg besorgt worden war; die Suche nach ihr war ihm höllisch erschienen. Er hatte diesen dummen Satz nur gesagt, um von dem wahren Grund seines Umzugs nach Nürnberg abzulenken. Das war ihm nicht gelungen, und die Stimme in Leipzig war in einem Weinkrampf zusammengebrochen.
Er hielt es nach einem solchen Gespräch keine Minute länger in der Wohnung aus und begab sich schleunigst in eine Kneipe. Dort redete er auf sich ein wie auf einen Kranken, er sagte sich, es sei schließlich nicht gelogen, daß er in diese Wohnung nur völlig provisorisch eingezogen sei. Der Alkohol bewirkte, daß er nach und nach die Gedanken an die Frau in Leipzig völlig ausblendete: und die Frau in Nürnberg gewann wieder die Oberhand. Die jedoch wollte es partout nicht ertragen, wenn er mit einer Alkoholfahne bei ihr auftauchte.
Dabei war es doch so, daß der Alkohol seine Liebe zu ihr steigerte, bis über die Grenze des für ihn selbst noch Glaubwürdigen hinaus, und bis zu einer ihm fremdartigen Beredsamkeit. Wenn die Wirkung des Alkohols nachließ, wurden auch seine Gefühle wieder nüchtern, und er fand es beängstigend, was er ihr in den Stunden zuvor alles gesagt hatte. Er war in Sorge darüber, ob es ihm möglich sein würde, nach der befristeten Zeit seines Hierseins diese Gefühle ad acta zu legen: etwa so, wie man sich einen tragfähigen literarischen Stoff in den Hinterkopf zurücklegt. Er fragte sich, ob es ihm gelingen konnte, seine Gefühle hinter sich zu lassen, wenn er hier wieder abzog.
Mit der Wohnung würde ihm das wahrscheinlich leicht- fallen. Er hatte nie die geringsten Anstalten gemacht, sich diese bewohnbar einzurichten. Die ersten Monate waren die Zimmer, bis auf eine Matratze auf dem Fußboden, völlig leer gewesen. Es hatte ewig gedauert, bis er Tische, Stühle und Bücherregale angeschafft hatte; da war die Hälfte seiner Zeit in Nürnberg fast schon vorbei. Die Regale waren zwar aufgestellt worden, aber nicht eingeräumt; in den Bücherregalen fanden sich Töpfe und Bratpfannen, und in einem anderen Fach der Haufen seiner Hemden und der Unterwäsche. Ein Plastikkörbchen für das Eßbesteck blieb ewig auf dem Küchentisch, obwohl es dafür in der Geschirrspüle ein leeres Schubfach gab, und die Messer und Gabeln befanden sich nicht in den Fächern des Plastikkörbchens, sondern gruppierten sich um das Körbchen herum und machten die Tischplatte unbenutzbar. Es war, als ob er unablässig Zeichen setzen mußte für den provisorischen Charakter seines Daseins. Als ob er Überzeugungsarbeit dafür leisten mußte, daß es so war. Überzeugungsarbeit für wen? Für sich selbst?
Es war aber nur ein Fall von depressiver Handlungsunlust, verstärkt durch den Alkohol und noch mehr durch die Phasen der Ernüchterung, die er überhaupt nicht mehr aushielt. Es stachen ihm dabei immer wieder einige unausgeräumte Umzugskartons ins Auge, die er in der Wohnung von Ecke zu Ecke schob. Sie waren voller Bücher, sie raubten ihm die Ruhe, vielmehr, sie ließen einen Anflug von Ruhe erst gar nicht an ihn heran. Er reagierte allergisch, wenn er auf den Symbolgehalt dieser unausgepackten Kisten angesprochen wurde. Oder wenn er sich selbst daran erinnerte, denn er konnte an der Symbolik dieses Zustands nicht vorbeisehen. Besonders zwei dieser Kisten waren es … sie waren das Unaufgearbeitete. Sie waren zwar vorhanden, sie standen vor ihm, sie standen ihm dauernd im Weg, aber sie waren die Gegenwart eines Verlusts …
Es war längst dahin gekommen, daß sich die meisten seiner Überlegungen nur noch mit einer Frage beenden ließen, die äußerst simpel war und auf alles mögliche anwendbar: Wohin soll ich gehen? – Eigentlich war er der Meinung, er sei von dieser Frage schon immer beherrscht gewesen, aber jetzt beherrschte sie ihn bis zur Ausschließlichkeit. Nun warf sie sich alle paar Schritte auf, die er irgend ging und zu gehen suchte. Sie bedrängte ihn um so mehr, je weniger er sie sich beantworten wollte. Er unterdrückte sie, doch sie verfolgte ihn schon, wenn er nur zu ein paar harmlosen Besorgungen auf die Straße ging, schlimmer noch, sie fiel ihn mitten in der Wohnung an. Seit er eine Wohnung mit drei Zimmern, plus Küche und Duschzelle, bewohnte, und somit über Räumlichkeiten von nie gekannter Größe und Übermacht verfügte, geschah es auf einmal, daß er mitten in der Wanderschaft über den Parkettboden zur Salzsäule erstarrte, so als habe er ungewollt einen Blick zurück nach Gomorra geworfen, und sich verwirrt fragte: In welches Zimmer soll ich gehen? – An deinen Schreibtisch sollst du gehen! erwiderte er. Das tat er dann auch, doch wenn er nur wenige Sätze aufs Papier geschrieben hatte, spürte er jenen Durst in seinem Innern aufsteigen, der ihn vom Stuhl wieder hochriß. Die ärgste Verunsicherung überkam ihn regelmäßig, wenn er unten auf der Straße seinen Schritt unwillkürlich, so als ginge es gar nicht anders, in Richtung eines kleinen Platzes gelenkt sah, welcher der Schillerplatz hieß. Fünfmal am Tag ging er dorthin und umkreiste den Platz; wie unter Hypnose, wie ein aufgezogener Automat war er immer wieder zum Schillerplatz unterwegs. Aber er wurde dort heute nicht erwartet! Es war in diesem Sommer etwas abgebrochen, es war eine Distanz aufgekommen zwischen ihm und der Frau, die dort wohnte. Ihre Unterhaltungen waren einsil- big geworden und handelten nur mehr von praktischen Dingen; immer öfter, wenn er sie etwas fragte, erwiderte sie: Darum mußt du dich nicht kümmern, ich werde damit zurechtkommen. Oder sie sagte: Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, es geht mir besser, als du denkst. – Sie hatte schon öfter verlangt, er solle sie für eine Weile in Ruhe lassen, doch diesmal hatte ihre Abwehr eine andere Qualität. Und dann erfuhr er plötzlich, sie sei nicht da. Sie sei weggefahren … Das mochte stimmen, denn ihr kleines Auto stand nicht vor der Tür. Nach unablässigem Nachfragen bei allen ihren Bekannten erfuhr er schließlich: Sie halte sich in München auf, unter anderem deshalb, weil sie eine größere Entfernung zwischen sich und ihn bringen müsse. Wenn er sich entschließen könne, sie für eine Weile in Ruhe zu lassen, werde sie eines Tages sicher zurückkommen …
Er kehrte also wieder um. Und da in der anderen Richtung fast nur Kneipen an seinem Weg lagen, zog er sich in die Wohnung zurück, um dort kreuz und quer durch die Zimmer zu laufen. – Auf dem Nebenhof, unter dem Fenster des Raums, den er sich zum Arbeitszimmer erkoren hatte, bellten die Jagdhunde des benachbarten Metzgermeisters, sie bellten dort bis tief in die Nacht.
Er konnte sich denken, wo sie sich in München aufhielt, aber er wagte dort nicht anzurufen. Es gab dort ein mit ihr befreundetes Ehepaar, das getrennt in zwei verschiedenen Wohnungen lebte, und die Wohnung des Mannes wurde, weil der längere Dienstreisen unternahm, oftmals für einige Tage, manchmal für Wochen, frei.
Auch C. war schon dort gewesen, für zwei, drei Wochen im letzten Winter; er hatte es später dichterisch ausgedrückt: vom Schicksal sei er nach München verschlagen worden. München hatte ihn immer schon angezogen, freilich nicht gerade im Winter, doch im Frühling oder im Sommer waren seine Wege stets im Bogen an München vorbeigegangen. Was er über die Stadt gelesen hatte, nährte den Rest eines romantischen Gefühls in ihm: es hatte für ihn einen Klang wie Italien (und übrigens verhielt es sich mit der Stadt Wien ganz ähnlich); und mit einem solchen übersteigerten Optimismus im Herzen war er dort auf dem Hauptbahnhof angelangt.
Das erste, worauf sein Blick sich heftete, war ein gewaltiger Schriftzug unter der Bahnhofsüberdachung, der München als die Stadt weltberühmter Biere anpries … er hatte damals schon angefangen, seinen unkontrollierten Alkoholkonsum als ein Problem zu betrachten. Also nichts von der Alten Pinakothek, die Brauereien führten die Welt dieser Stadt an, das wurde einem schon auf dem Bahnhof deutlich gemacht. Und die folgende Zeit hatte sich ihm zu einem Kampf mit dem Anspruch dieser Stadt gestaltet, was nicht ohne einigen Witz war, da er in die Welt von München sowieso kaum vorstieß: im Grunde genommen war seine Reise schon auf dem Bahnhof zu Ende gewesen.
Er fühlte sich überhaupt keiner Welt mehr zugehörig. Das war ihm gerade während dieser Wintertage in München bewußt geworden, oder nicht einmal wirklich bewußt, aber er hatte angefangen, sich wie ein sibirischer Hinterwäldler zu bewegen, den das Schicksal in einer modernen westlichen Metropole abgesetzt hat. Zwei Jahre Westerfahrung nützten ihm plötzlich nichts mehr, er war in einen seltsamen Strudel geraten, der ihn unwiderstehlich nach rückwärts und nach unten zog. Es fiel ihm mit einem Mal auf, daß er eigentlich aus einem anderen Land kam … das hatte er in dem zurückliegenden Jahr beinahe vergessen gehabt, und dieses Vergessen kam ihm nun vor wie eine Krankheit. Er konnte es nicht genau begründen, zu vermuten war jedoch, daß er in dem ganzen zurückliegenden Jahr bloß ein Niemand gewesen war. Vor zwei Jahren, ein Jahr vor dem letzten also, war das noch anders gewesen: er hatte damals ein Reisevisum gehabt und war ununterbrochen damit beschäftigt gewesen, dem Ablauf der Zeit entgegenzustarren, die ihm mit dem Papier eingeräumt war. Er hatte schließlich den Ablauf des Visums ignoriert und war in Westdeutschland geblieben: von jenem Augenblick an hatte sein Vergessen begonnen.
An manchen Tagen hatte er vergessen, weshalb man ihm dieses Visum gegeben hatte. In seiner Eigenschaft als Schriftsteller hatte er es beantragt und bekommen; es war ein komplizierter Vorgang gewesen, aber am Ende war es darauf hinausgelaufen. Nun war in dem zurückliegenden Jahr seine Eigenschaft als Schriftsteller, wie er es unnötig schwerfällig ausdrückte, so in den Hintergrund getreten, daß man sie fast als verloren bezeichnen mußte. – In dem Land, in dem er sich aufhielt, eignete er sich nicht zum Schriftsteller, dachte er.
Er überlegte plötzlich, wo die genannte Eigenschaft hergekommen war, und er fand es nicht mehr heraus. Er sah eine Art schattenhaften Wald, wenn er an dieses Herkommen dachte, einen Wald, in dem es dunkel wurde … jene Gegend, jenes psychische Gelände lag abseits hinter einer Grenze, über die er nicht zurückkonnte. Wie konnte er hier, wo er sich jetzt aufhielt, zu seiner Eigenschaft als Schriftsteller zurückfinden, wenn er von deren Ursprung, der ihm wie ein Existenzbeweis vorkam – und mochte der noch so vage und diffus sein –, für immer abgeschnitten war.
Er war eigentlich nach München gekommen, um seine Gedanken zu ordnen, sie gegebenenfalls niederzuschreiben: jede Möglichkeit dazu schien sich verschlossen zu haben … er hatte sich in dieser Stadt noch weiter von seinen Anfängen entfernt.
Nun fand er sich also jede Nacht auf dem Münchener Hauptbahnhof ein, wo es einen bestimmten Kiosk gab, der, wenn sich die große und kalte Halle gegen zwölf Uhr vom Reisebetrieb langsam leerte, noch immer von denen umlagert war, die, wie er, keine Ruhe in ihren vier Wänden fanden … vorausgesetzt, sie verfügten überhaupt über vier Wände. Von diesem Kiosk aus konnte er die Abfahrtstafeln vor den Bahnsteigen lesen, und während er trank, starrte er auf die Namen der avisierten Ziele, die ihm so gut bekannt waren: Leipzig Hauptbahnhof oder Berlin Hauptbahnhof. Oder vielleicht waren dort nur die Ankunftszeiten dieser Züge zu lesen … eines Nachts war er Zeuge einer Episode gewesen, die ihm zu denken gab. Er hatte den Vorfall notiert, es war das einzige schriftliche Ergebnis aus seiner Münchener Zeit. – Aus einem der letzten, gegen Mitternacht eintreffenden Züge kletterte ein junger Mann auf den Bahnsteig, der, kaum spürte er festen Boden unter den Füßen, beide Arme in die Höhe warf und in ein fürchterliches Geheul ausbrach, mit dem er sofort alle Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Er marschierte auf den Ausgang zu, ließ die Arme mit den schmalen Gepäckstücken wirbeln und brüllte im Rhythmus seiner Schritte – wobei er einen Marschtritt imitierte: kräftig stampfte er auf den Betonboden und riß dabei das gewinkelte Knie des anderen Beines bis zur Brust hoch – immer wieder: Nieder mit der DDR … nieder mit der DDR! – C. wußte sofort, mit welcher Spezialität er es zu tun hatte: das war ein Ausgereister, der diesen Lärm machte, also einer, dem es gelungen war, per Ausreiseantrag oder durch ähnlich strapaziöse Unternehmungen über die Grenze und bis nach München zu kommen. Und nun gab er seinem Freiheitsgefühl nach und verlieh ihm unter dem friedfertigen Münchener Bahnhofsdach widerhallend Ausdruck. Als er grölend auf der Höhe der Getränkekioske ankam, sah man die ersten Polizisten ausschwärmen. Schnell hatten sie ihn eingekreist und überwältigt. Noch während er mit auf den Rücken gedrehten Armen abgeführt wurde, gellte seine Stimme weiter: Nieder mit der DDR … nieder mit der DDR!
Bei dieser Szene war es ihm auf dem Bahnhof unbehaglich geworden. C. kaufte am Kiosk eine Flasche Wodka, schwang sich in ein Taxi und ließ sich zu seiner Bleibe fahren.
Der Auftritt war ihm lange nachgegangen; und seit damals nun häuften sich vergleichbare Szenen womöglich auf vielen Bahnhöfen in der Bundesrepublik. Seit einiger Zeit war die Presse voll von Berichten darüber, daß die jungen Bürger des »SED-Staats« drüben Ausreiseanträge zuhauf stellten, es war die Rede von Botschaftsflüchtlingen in Budapest und Prag, und man mußte immer mehr von ihnen ziehen lassen. Das Wort »Ausreisewelle« war auch früher schon aufgetaucht, doch war es nie mit so vielen Tatsachen untermauert gewesen. Und man ging so vorsichtig mit der DDR um, daß jeder von selbst auf die Idee kommen mußte, daß sich da drüben eine unverkennbare Auflösung vollzog. Wenn man früher von Auflösungserscheinungen gesprochen hatte, dann hatte C. solche Annahmen stets für ein Wunschdenken gehalten. Aber nun gab es den neuen sowjetischen Generalsekretär, der Sätze aussprach, die man nicht mehr überhören konnte: Wer zu spät käme, den bestrafe das Leben … ganz bestimmt war das selbstkritisch gemeint, aber solch ein Wort mußte schwerwiegen in der DDR. Für manche dort mußte es gar wie ein Todesurteil klingen.
C. erinnerte sich in diesem Zusammenhang an eine andere kleine Geschichte, die ihm signifikant vorgekommen war: Als er einmal gezwungen war, in der Haftanstalt von A. – der Kreisstadt jener Gegend, aus der er kam – zu übernachten, hatte er sofort gewußt, daß es ihm unmöglich sei, in dem Loch, in das man ihn gesperrt hatte, auch nur eine Minute zu schlafen. Wahrscheinlich war es eine Zelle zur Ausnüchterung, ringsum waren die Anzeichen der mit solchen Prozessen einhergehenden Katastrophen sichtbar … In der DDR, dachte C., hielt die Verfallenheit dem Alkohol gegenüber noch unauslöschliche Bilder bereit, weshalb es da auch für die Schriftsteller und Künstler nicht ganz abwegig war, wenn sie sich saufend die Zeit vertrieben. Die Zelle, deren Tür hinter ihm zugeknallt war, bestand aus ein paar Kubikmetern üblen Geruchs, enthielt eine Pritsche, einen kaputten Stuhl und eine zerplatzte Kloschüssel, die in einem Tümpel von Schlamm und Brühe stand und deren Wasserspülung sich nicht abstellen ließ. An der Wand hinter der Pritsche zog sich eine breite Spur von Erbrochenem nach unten, das schon eingetrocknet war; im trüben Schein einer 25-Watt-Birne sah man, daß die Wände über und über mit undefinierbarem Dreck, womöglich menschlichen Ausscheidungen, Blutspritzern und zahllosen eingekratzten Inschriften, Nachrichten und Adressen bedeckt waren. Er hatte somit die ganze Nacht zu lesen. Gleich einer der ersten Sprüche, die er las, lautete ohne Umschweife: Es lebe der Kapitalismus.
Den zweiten Teil dieses Satzes hatte er heute auf dem Bahnhof gehört. Und damit kannte er praktisch den Gedankenhaushalt der jungen DDR-Bürger. – Er meinte sich zu erinnern, daß er den Satz damals mit einer Aufwallung von Schadenfreude gelesen hatte. Jetzt allerdings quollen ihm ein paar merkwürdig theatralische Tränen aus den Augen, das rührende Schauspiel auf dem Münchener Bahnhof hatte etwas wie Heimweh in ihm geweckt. Und Heimweh brauchte man, um seine Ankunft im Westen endlich zu begreifen. In diesem Augenblick gehörte C. ebenfalls zu den in ihr Bier weinenden Autoren der Bundesrepublik …
Das war ein Zitat aus dem Feuilleton einer großen Zeitung, welche die bundesdeutschen Schriftsteller von Zeit zu Zeit mit Verweisen strafte, der man aber zum Glück kein Wort zu glauben pflegte. Auch C. schüttelte nur den Kopf, goß das vollgeheulte Bier in den Ausguß und schenkte sich ein neues ein.
An den folgenden Abenden begab er sich mit der gepackten Tasche zum Bahnhof; er glaubte bloß noch an die Möglichkeit, sein Heil in der Flucht zu suchen und zurück nach Nürnberg zu fahren. Er kam immer nur bis zu dem Kiosk vor den Bahnsteigen. Wenn alle Züge verpaßt waren, wurde es Zeit, zu seinem Schlafplatz aufzubrechen, mit einer neuen Flasche Wodka, die Tasche diente ihm nur dazu, den Stoff ungesehen in die Münchener Wohnung zu schaffen … er wußte plötzlich, was es hieß, wenn ein Alkoholiker den Schnaps als seinen »Stoff« bezeichnete. Immer hoffte er, den Schlüssel, den er unter dem Fußabtreter hinterlegt hatte, nicht mehr vorzufinden. Dann wäre der Freund wieder dagewesen, dem die Wohnung gehörte; er hätte ausziehen müssen, er hätte wirklich nach Nürnberg fahren müssen. Stets lag der Schlüssel noch unter der Bastmatte vor der Türschwelle; wenn er ihn hervorklaubte, war es schon so weit, daß er sich mit der Stirn an den Türrahmen lehnen mußte, um nicht umzufallen.
Die ausgetrunkenen Flaschen, die in der Küche neben dem Abfalleimer standen, waren noch leicht zu zählen: wenn es stimmte, daß er für eine Flasche Wodka zwei Tage brauchte – oder besser ausgedrückt: daß er jeden zweiten Tag eine neue Flasche gebraucht hatte –, dann war er jetzt zwölf Tage hier. Er hatte vielleicht einige Flaschen nicht mitgezählt, die er schon in die Mülltonne geworfen hatte, dazu kam noch eine Menge Bier, und manchmal hatte er sich auch zu Weinflaschen gerettet. Wenn er richtig rechnete, dann war seit ein paar Stunden der 22. Dezember … aber möglicherweise war auch schon der 23. Dezember. Er hatte sich vorgenommen, am Heiligen Abend mit dem Saufen aufzuhören, und er durfte sich im Datum nicht irren … vielleicht aber würde es geschehen, daß der Bahnhofskiosk in der Nacht des Heiligen Abends geschlossen war. Der Heilige Abend sollte ihm eine Zäsur werden; er begann plötzlich an den Heiligen Abend zu glauben wie an das Christkind …
Er hatte in dem Jahr seines Visums, vor fast zwei Jahren also (er fragte sich: Ist das wirklich schon zwei Jahre her?), ein Stipendium erhalten, ein ziemlich hohes monatliches Stipendium von einer literarischen Gesellschaft, und er hatte dann um eine Verlängerung dieses Stipendiums nachgesucht und auch die erhalten. Es war auf seinem Konto Geld aufgelaufen, das er nicht hatte verbrauchen können. Dann hatte er in einem literarischen Wettbewerb eine hohe Preissumme gewonnen; die übrigen Teilnehmer hatten ihn darum beneidet … Zu Recht übrigens, sagte er sich; er war inzwischen der Meinung, daß die meisten der Autoren in der Endausscheidung des Wettbewerbs bessere Texte vorgelesen hatten als er. Er hätte also diese Jahre nahezu sorgenfrei leben und ein neues Buch schreiben können … es war nicht gegangen, es war etwas Unheimliches mit ihm passiert, für das es tausend Erklärungen gab, aber keinen richtigen Grund. Und inzwischen floß ihm das Geld förmlich unter den Fingern davon …
An das Geld durfte er gar nicht denken, es schossen bei dem Wort Geld augenblicklich Wellen von Panik in ihm auf, die nur mit Alkohol zu bekämpfen waren. Die Ursache dieser Panik war eine beinahe unbeschreibliche Scham … Was hatte er getan? – Er hatte nichts getan, und das Nichtstun rief dieses Schamgefühl in ihm hervor. Er hatte das Geld genommen, Stipendien und Literaturpreise, und dann war er erstarrt und hatte nicht mehr weitergeschrieben. Manchmal, wenn er betrunken genug war, hoffte er, daß er schon tot war … nur als Toter konnte man aussteigen aus dem finanziellen Handel und Wandel der Gesellschaft. Aber man wußte nicht, ob jenes entsetzliche Schamgefühl noch fortdauerte, nachdem man tot war, man wußte es nicht genau …
Ab München gibt es noch einen späten Zug nach Leipzig, sagte er sich. Der erst am Morgen dort eintrifft … oder irre ich mich und es gibt diesen Zug nur ab Nürnberg? Nürnberg durfte er gar nicht streifen, wenn er plötzlich mitten in der Nacht aus der Deutschen Bundesrepublik verschwand. Wenn er verschwand, als ob er plötzlich gestorben sei. Wieso war er nicht fähig, sich einmal von diesem Kiosk wegzurühren und nach den Abfahrtszeiten zu schauen? Vielleicht würden sie ihn an der Grenze ohne Komplikation durchlassen, immerhin hatte er einen Reisepaß der DDR, vielleicht würden sie gar nicht bemerken, wie lange das Visum schon abgelaufen war. Aber wahrscheinlich konnte er sogar mit seinem BRD-Paß einreisen, den er natürlich ebenfalls besaß … wenn er einmal drin war im DDR-Käfig, dann war er drin. Und für die Bundesrepublik unauffindbar und gestorben …
Er hatte sich sogar einen Sinn ausgedacht für seine Trinkerei, für die er wirklich Durchhaltevermögen brauchte: er wollte ohne Geld in die DDR zurückkommen. Das Geld sollte eben noch für die Fahrkarte reichen … ohne Rückfahrkarte. Vielleicht noch ein paar versteckte Hundert-Mark-Scheine für seine Mutter, aber keinen Pfennig darüber hinaus. Ohne Zweifel würde er es mit den Behörden zu tun bekommen, wenn er wieder da war. Er konnte nicht ausschließen, daß einige der Bürokraten, die ihm übel wollten, und davon gab es eine ganze Reihe, der Meinung waren, daß er »republikflüchtig« geworden sei. So hieß der gebräuchliche Terminus für Leute, die dem Land auf unerlaubte Weise den Rücken kehrten; wenn man so wollte, dann hatte er diesen Tatbestand seit über zwei Jahren erfüllt. Abgesehen davon, daß es ihm ein Greuel war, die Wirtschaft der DDR mit einer Devisensumme, und mochte die noch so bescheiden sein, zu unterstützen, war der Besitz von Westgeld eine denkbar schlechte Voraussetzung dafür, wenn er drüben noch einmal neu anfangen wollte. Wenn er sich dieses Geld nicht abgewöhnte, würde er über kurz oder lang wieder seine Kontakte in den Westen knüpfen. Er würde wieder einrasten in den Kreislauf der Scham … und, wenn es der Teufel wollte, würde man ihm irgendwann noch einmal ein Visum geben …
Der Schlüssel lag jede Nacht treu und brav unter dem Abtreter, die Wohnung blieb frei, und so schien es endlos weiterzugehen. Er saß unter einer kleinen Lampe und leerte mühsam eine Flasche Wodka, mit Ausblick auf die spiegelnde Fassade eines Bürohochhauses, das seinem Fenster gegenüber aufwuchs. Unbeirrt trank er weiter, obwohl sein Magen revoltierte, bis der Morgen dämmerte und draußen großflockiger nasser Schnee niedersank. Dann löschte er das Licht, schlich sich ins Nebenzimmer, wie nach einer schweren unbeendbaren Arbeit, und legte sich schlafen.
Bevor der Alkohol die Denkmaschine in meinem Schädel zum Stillstand bringt, dachte er, will ich mir den Morgen meiner Ankunft in Leipzig vorstellen. Vielleicht werde ich tatsächlich nicht wieder aufwachen, dann will ich wenigstens ein Bild aus Leipzig mit in den Tod nehmen. Einen Morgen voll Sonne, denn nur der Gedanke an das Licht kann die Phantasie von Rückkehr und Neubeginn aufrechthalten. – Was war es, was dieser Mensch gesehen hat, wenn er in der Frühe auf dem Bahnhof in Leipzig ankam …
Ein bestimmtes Leuchten dort in der Bahnhofshalle, er sah es noch im Halbschlaf. Ein Licht, nur von einem auszumachen, der den Bahnhof genau kennt und der die Muße hat, es unter dem riesenhaften Gewölbe aufzufinden. Nur der bemerkt es, der sich um die allgemeine Depression nicht schert, die zu dieser frühen Abfahrtszeit vorherrscht. Niemand sonst aus der verschlafenen Menschenmenge, die um diese Zeit schon auf den Beinen ist, beachtet das Licht, dieses Funkeln, das sich verdichtet zu einem Gleißen; es ist der strahlende Schmutz in dieser seit mehr als einem Vierteljahrhundert nicht mehr gereinigten Kathedrale. Oben unter dem Dach entzündet es sich zuerst: Dunst, Rauch, Wasserdampf und Staub, die Ausatmungen von Mensch und Maschine. Davon sehen die abwartenden Leute nichts, die Luft ablassen und frösteln, im Kontrast nach der Enge in den Straßenbahnen und Bussen, die sie hierher gebracht haben. Die Menschenmenge atmet aus, es ist, als hätten sie alle in den Straßenbahnen nur einatmen können, um sich möglichst viel Raum zu schaffen inmitten der Kompression ihrer nicht mehr identifizierbaren Leiber. Nun sind sie für eine halbe Stunde frei und atmen aus, stoßen den verbrauchten Sauerstoff ab, daß der Dunst kocht unter dem Bahnhofsgewölbe; gleich aber fahren die Züge, die sie auf ihre Arbeitsplätze verteilen. – Dieser Mensch, der fast allein auf dem Bahnhof zurückbleibt, hat sich von den werktätigen Massen getrennt, vor ein paar Jahren schon, es war ein Schritt in die Unsicherheit, davon ist ihm eine Angst geblieben, so als wäre er aus der menschlichen Gesellschaft ausgetreten, wie aus einer Partei.
Man hat ihm dafür die Leviten gelesen. Freunde, die er hatte, sind weiter in die Betriebe gegangen und haben weiter gearbeitet, und sie sind vielleicht trotzdem die besseren Schriftsteller geworden, denkt er manchmal. Und er hat sie als Freunde verloren. – Er befindet sich jetzt auf dem breiten Plateau vor dem Beginn der Bahnsteige, etwa in der Mitte zwischen Ost- und West-Ausgang, und der Bahnhof ist beinahe leer; die meisten der Frühzüge sind unter dem erregten Sprachaufwand der Lautsprecher ausgefahren und haben die Menschenmenge mitgenommen. Er blickt nun die weite Strecke der leeren Gleise entlang zur Bahnhofsausfahrt, nach der sich die Schienenstränge in alle Richtungen auffächern. Dieses halbrunde Tor, die Ausfahrt, klein wirkend auf die Entfernung, ist jetzt von starkem Licht erfüllt. Und von diesem Halbkreis ausgehend – einer Morgensonne im Aufgang ähnlich, die erst zur Hälfte sichtbar ist –, ziehen sich unter dem gewölbten Bahnhofsdach neun leuchtende Streifen entlang, die immer breiter werden, noch bis über den Standort des Betrachters hinweg. Es sind die noch lichtdurchlässigen Glassegmente der Dachwölbung, und es sieht aus, als ob von einer aus dem Dunkel steigenden Sonne lange aufstrebende Strahlen entsandt werden. Die Sonne leuchtet im Bahnhof wie das Licht in einer Kathedrale. Und es sind neun Strahlen, das ist eine magische Zahl. Und durch die Sonne hindurch sind die Züge ins Freie gefahren und haben sich im blendenden Licht verloren.
Wie war es ihm während der Zeit in München überhaupt ergangen? – Und wie in den anderen Städten, von denen er kaum mehr als die Namen wußte und die Bahnhöfe kannte … er wußte, daß er sich in diesen Städten aufgehalten hatte, daß sie ihm aber auf seltsame Art verschlossen geblieben waren. Sein Wahrnehmungsvermögen hatte nicht funktioniert, und wenn er über die Ursachen dieses Phänomens nachdachte, so fiel ihm alles mögliche ein: der Alkohol, der seinen Blick trübte, seine Unfähigkeit, Kontakte zu knüpfen, seine Kontaktlosigkeit, sein Mißtrauen sich selbst gegenüber, die daraus entstehende Orientierungslosigkeit.
Nach und nach entglitt ihm die Wirklichkeit … er stand draußen, die Wirklichkeit nahm ihn nicht an, er war außerstande, die Wirklichkeit auf sich zu beziehen … er wußte nicht, wie er es hätte erklären können. Die Wirklichkeit lag hinter einer Mauer, er trug andauernd eine Mauer vor sich her. Und da diese Mauer nicht aus Beton war, sondern nur eine Empfindung, ein Bewußtsein, oder nur eine Empfindung unterhalb seines Bewußtseins … da diese Mauer selbst unwirklich war … schien es um so weniger möglich, sie abzubauen. Er konnte die Mauer nicht abschaffen, er konnte, wenn er seinen Zustand verändern wollte, nur sich selbst abschaffen …
In dieser Verfassung hatte er begonnen, nach seinen Erinnerungen zu suchen, aus einer merkwürdigen Not heraus, als stehe ihm nichts anderes mehr zur Verfügung als irgendeine fadenscheinige Erinnerung … und er versammelte Notizen um sich, kleine Zettel mit den Bruchstücken seiner Erinnerungen; wenn er die undeutlichen, unter Alkohol gekritzelten Sätze einen Tag später las, warf er sie in der Regel weg: sie waren im Stil eines halbherzigen Zynismus geschrieben, den er unerträglich fand …
Aber er war doch auch in den Städten des Ostens ohne Wirklichkeit gewesen, in Leipzig, Dresden, Ost-Berlin … was schon daran zu erkennen war, wie schwach er sich erinnerte. Und nun würde es diese Städte wahrscheinlich nicht mehr geben für ihn? Oder nur noch als die phantastischen spirituellen Gebilde aus einer Vergangenheit, die er nicht mehr als die seine erkannte … als virtuelle Gebilde, kaum noch abrufbar durch sein vom Alkohol gepeinigtes Gehirn. Er sah sich nicht mehr in diesen Städten – ebensowenig, wie er sich in den neuen, in den westdeutschen Städten sah –, er war ein Gespenst in den ostdeutschen Städten, ein Zufall, eine vorläufige Figur; vielleicht hatte niemand bemerkt, daß er gar nicht mehr dort war. Er würde darüber schreiben müssen … wenn er konnte, wenn er eines Tages wieder schreiben konnte! Aber er hatte immer öfter den Verdacht, daß er nur in jenen Städten selbst schreiben konnte …
Es sei mit jenen Städten, so dachte er manchmal, wie am Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie waren ausgelöscht worden, niemand wußte, ob sie noch einmal weiter existieren konnten. Sie würden, falls überhaupt, nur als andere Städte weiterleben können … und es war beinahe, als wäre er mit seinen Gedanken an jenem Kriegsende stehengeblieben: damals war es entstanden, sein Bewußtsein, sein Weltgefühl … und jetzt waren diese Städte für ihn noch einmal ausgelöscht worden, und zwar, so schien es, wirksamer als durch Bombenteppiche. Wirksamer, weil diese Auslöschung ihn in einem Moment erwischt hatte, in dem er ohne jede Festigkeit war. Eine Staatsgrenze hatte dies vermocht (seit dem Ablauf seines Visums eine unüberschreitbare Staatsgrenze), eine Mauer, ein Sperrgürtel bürokratischer Verordnungen. Darüber mußte geschrieben werden, ganz egal wie …
Was hinderte ihn eigentlich, damit zu beginnen? – Nicht zuletzt der Umstand, daß seine Freundin Hedda sich ihm verweigerte. Sie hatte die Flucht ergriffen … genauer wollte er die Sache gar nicht ausdrücken. Es war nicht das erste Mal, und je dringender, je verzweifelter er versuchte, den Kontakt zu ihr wieder herzustellen, um so schneidender bestand sie auf ihrer Distanz. Sie war verschwunden … sie hielt sich offenbar in München auf, als er aber in München auftauchte, war sie schon wieder abgereist. Nein, es war nicht das erste Mal, daß sie ihm gesagt hatte (oder daß sie es ihm hatte ausrichten lassen), sie brauche Bedenkzeit, er müsse sie vorläufig in Ruhe lassen. Und sie sei überzeugt, er müsse sich ebenfalls besinnen …
Vorläufig, das war das Wort, so lebte er seit einer geraumen Zeit. Er behielt den Kopf nur oben, wenn er trank; sie aber sagte, sie könne nicht dabei zusehen, wie er sich mit Hilfe von Alkohol zu vernichten suche …
Es sei die feigste Methode, sich umzubringen, sagte Hedda. Sie hatte etwas gegen den Alkohol. Das lag an ihrem russischen Vater, der sie ihre ganze Kindheit über beim Trinken hatte zuschauen lassen. Die Folge dieses Anblicks war nicht allein ihre Abneigung gegen Alkohol und gegen trinkende Männer, sondern eine nie ganz zu unterdrückende Skepsis gegenüber dem sogenannten russischen Charakter, was darunter auch zu verstehen sein mochte, und der freilich auch ihr eigener Charakter war. Hedda, das war nicht ihr wirklicher Name, sondern ein Pseudonym; sie hatte es sich ausgesucht, weil ihr Verlag dazu geraten hatte. Ihr wirklicher Name sei zu kompliziert für Buchumschläge, welche die deutschen Leser zum Kauf reizen sollten.
Auch C., hatte sie gesagt, brauche unbedingt eine Bedenkzeit, er müsse sich überlegen, ob er wirklich mit ihr zusammenleben wolle. Offensichtlich wisse er das nicht. Was dazu geführt habe, daß auch sie es ihrerseits nicht mehr genau wisse. Und er möge nachdenken, ob er wirklich nur trinke, weil er zur Zeit nicht schreiben könne – denn das hatte er einmal behauptet –, oder ob er, umgekehrt, nicht schreiben könne, weil er nur noch mit dem Trinken beschäftigt sei.
Noch mehr wäre zu bedenken: vielleicht könne er auch nicht schreiben, wenn er mit einer Frau zusammenlebe, beziehungsweise, er bilde sich so etwas ein. Nicht nur mit einer Frau, vielleicht könne er menschliche Nähe überhaupt nicht ertragen, wenn er schreiben wolle …
Aber wir leben gar nicht richtig zusammen, wir wohnen getrennt, erwiderte er.
Zum Glück! hatte Hedda gesagt.
Damals in München hätte er tatsächlich über diese Dinge nachdenken können, es konnte sein, er war sogar aus diesem Grund hingefahren. Vielleicht wäre er zu ähnlichen Schlüssen gekommen … es wären ihm schwer erträgliche Gedanken gewesen. Freilich, er hatte schon solche Dinge gedacht, aber warum war das so? Warum ertrug er keine Nähe? Weil man in Gegenwart der anderen Argumente brauchte für das Schreiben? Warum aber brauchte ein schreibend dasitzender Mensch, der sich verhältnismäßig ruhig verhielt, Argumente, warum mußte er sein Schreiben rechtfertigen? Er hatte nie Argumente dafür gehabt, und erst recht keine befriedigenden. Argumente riefen geradezu nach dem Widerspruch; Widerspruch gab es im Übermaß, man brauchte nur zuzugreifen. Er selbst war bis obenhin angefüllt mit Widerspruch.
In München war er für sich allein gewesen und hatte trotzdem nicht geschrieben. Er hätte dort zumindest auf die Idee kommen können, daß er vor Hedda, die selbst schrieb, kein Argument brauchte. Er schrieb nicht, weil er sich selbst im Weg stand, das war der ganze Grund. Aus scheinbar nichtigem Anlaß war es zwischen ihnen zu einer Mißstimmung gekommen, aus der eine Auseinandersetzung geworden war, eine Zerreißprobe: er hatte Heddas Geburtstag vergessen, der Alkohol war daran schuld gewesen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung hatte Hedda verlangt, er solle sie für einige Zeit allein lassen; schlimm daran war, daß sie sich über das Ende dieser Frist nicht hatte äußern wollen.
Während jener finsteren Tage in München war er sich vorgekommen wie ein Sträfling, den man auf ungewisse Zeit in die Verbannung geschickt hatte: das Ende dieser Zeit hing von seinem Verhalten ab … aber er wußte nicht, wie er sich verhalten sollte. Je mehr er trank, um so mehr beherrschte ihn das Gefühl, verstoßen zu sein … für immer, er sei verdammt, für immer in seiner Verbannung auszuharren. Das lähmende Entsetzen, das dieser Gedanke nährte, war nur mit Alkohol einzudämmen …
Das Ende seiner Zeit in München war verworren; er hatte nichts dazu beigetragen, aber eine Art Hauptrolle gespielt, und damit entsprach dieses Ende seinem Charakter vollkommen. Einige scharfe, fast grelle Bilder waren ihm geblieben, doch die stachen aus Nebelzonen hervor, zusammenhanglos und kaum in geordnete Abfolgen zu bringen. – Er war vom Klingeln des Telefons geweckt worden und schlaftrunken auf die Füße gekommen. Hätte er nicht die blitzartige Hoffnung gehabt, Hedda riefe an, versuche, ihn schon seit einer ganzen Weile zu erreichen, wäre er gar nicht an den Apparat gegangen. Es war schon wieder dunkel, später Nachmittag, die Zimmer waren eiskalt. – Ich bin in München! sagte er sich; das war jeden Tag der erste Satz, den er sich sagte. Und das erste, was er spürte, war ein rasender Kopfschmerz, dem zu begegnen er stets noch einen Rest, drei bis vier Zentimeter, Schnaps in einer Flasche reserviert hatte. Verzweifelt suchte er in den drei Räumen nach dem Telefon, das nicht aufhören wollte zu klingeln; endlich hatte er den Hörer in der Hand und meldete sich.
Eine Frauenstimme drang an sein Ohr, die nicht enden wollende Sätze sprach und viel zu schnell redete. Es war nicht Hedda. Nach einer Weile bekam er mit, daß er gemeint war und daß die Frau seines Bekannten am Apparat war, in dessen Wohnung er sich aufhielt. – Er müsse leider ausziehen … aus der Wohnung, meine sie … leider heute noch, es lasse sich leider nicht umgehen! Aber natürlich nur vorläufig …
Was? sagte er.
Nur vorläufig! Vorübergehend, nur über die Feiertage, vielleicht bis Anfang Januar. Ihr Mann sei von seiner Geschäftsreise zurück, schon seit dem Vormittag. Und habe dauernd angerufen, aber es sei niemand ans Telefon gegangen. Nun sei er schon mit dem Auto auf dem Weg zu seiner Wohnung … es sei doch so ausgemacht gewesen, daß er am Heiligabend wieder zurückkomme. Es tue ihr leid, sie frage sich, ob das alles nicht zu schnell … ob das alles nicht sehr schlimm für ihn sei.
C. erinnerte sich nur dunkel an diese Vereinbarung für den Heiligen Abend. – Kein Problem, sagte er, ich werde einstweilen meine Sachen packen.
So eilig sei es wirklich nicht. Ob er nicht, bevor sie in die Klinik führen, noch herkommen wolle, um etwas zu essen? Ihr Mann habe doch mit ihm schon geredet … oder etwa nicht? Nein? Oh, das sei aber jetzt eine wirklich dumme Geschichte! Also, ihr Mann kenne doch einen Arzt aus dieser Klinik sehr gut, das wisse er doch? Und der habe sich bereit erklärt, ihn heute noch aufzunehmen, davon müsse er doch etwas wissen! Nichts? Aber er sei doch damit einverstanden? Selbstverständlich müsse er nur ganz und gar freiwillig dorthin, in die Klinik. Sie sei überzeugt, daß es richtig sei … Hedda würde es sicher auch richtig finden. Ihr Mann habe den Arzt über dieses Alkoholproblem in Kenntnis gesetzt, und der habe bestätigt, daß die Sache bedenklich sei.
Hast du mit Hedda darüber gesprochen?