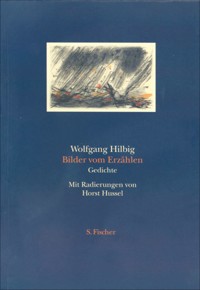29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Werke
- Sprache: Deutsch
In der siebenbändigen Wolfgang-Hilbig-Werkausgabe ist dieser umfangreiche Band mit Essays, Reden und Interviews der unverzichtbare Schlussstein. Zu den mehr als zwanzig Essays gehören Texte über Literatur – auch die Frankfurter Poetikvorlesungen Hilbigs sind hier enthalten –, aber auch über Heimat und die eigene Herkunft. Zu den gesammelten Reden gehören zahlreiche Dankreden für erhaltene Literaturpreise, die weit mehr sind als Danksagungen: Hatte seine »Kamenzer Rede« mit ihrer herben Kritik an der deutschen Wiedervereinigung 1997 noch für einen Skandal gesorgt, wurde die Büchner-Preis-Rede von 2002 zu einem melancholischen Rückblick auf die Rolle der Literatur. 36 Interviews und Gespräche mit Wolfgang Hilbig bilden den dritten Teil dieses Bandes. Des öfteren weist er in ihnen darauf hin, dass solche Interviews ihn vom eigentlichen Schreiben abhalten – zugleich bilden sie, wie nun in der Gesamtschau deutlich wird, einen Teil des Werkes. Sie enthalten wichtige Selbstaussagen zur Person und zum literarischen Schaffen, aber auch zahlreiche Stellungnahmen zur DDR, zur Wende von 1989 und dem wiedervereinigten Deutschland – sie sind die beeindruckende Selbstauskunft eines unverwechselbaren Dichters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 948
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfgang Hilbig
Werke, Band 7: Essays – Reden – Interviews
Essays
Über dieses Buch
In der siebenbändigen Wolfgang-Hilbig-Werkausgabe sind die Essays der unverzichtbare Schlussstein. Dazu gehören nicht nur Hilbigs Poetikvorlesungen und andere Texte zur Kunst, sondern auch die zahlreichen Dankreden, die Hilbig hielt, wenn er mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurde. Hatte seine Kamenzer Rede mit ihrer herben Kritik an der deutschen Wiedervereinigung 1997 noch für einen Skandal gesorgt, wurde die Büchner-Preis-Rede von 2002 zu einem melancholischen Rückblick auf die Rolle der Literatur. Hilbigs eigentliches Talent aber leuchtet in jenen traumschönen Essays, die Beobachtung und Reflexion mit der Kraft und dem Ton seiner Erzählungen verbinden. Darüber hinaus enthält dieser Band Wolfgang Hilbigs wichtigste Interviews – sie sind die beeindruckende Selbstauskunft eines unverwechselbaren Dichters.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Wolfgang Hilbig, geboren 1941 in Meuselwitz bei Leipzig, gestorben 2007 in Berlin, übersiedelte 1985 aus der DDR in die Bundesrepublik. Er erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, darunter den Georg-Büchner-Preis, den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Bremer Literaturpreis, den Berliner Literaturpreis, den Literaturpreis des Landes Brandenburg, den Lessing-Preis, den Fontane-Preis, den Stadtschreiberpreis von Frankfurt-Bergen-Enkheim, den Peter-Huchel-Preis und den Erwin-Strittmatter-Preis.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hißmann, Heilmann, Hamburg / Imke Schuppenhauer
Coverabbildung: Horst Hussel
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400995-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Essays
Über »Alt möcht ich werden« von Louis Fürnberg
Louis Fürnberg
Alt möcht ich werden
Die ewige Stadt
Der Mythos ist irdisch
Für Franz Fühmann zum sechzigsten Geburtstag
Vorblick auf Kafka
Über die Erzählung »Der Brief«
Späte Entgegnung
Der Name meines Großvaters
Der trügerische Grund
La bella Italia
Prolog
Epilog
Vortrag an der Universität in Lexington, Kentucky
Über Leonid Dobytschins »Die Stadt N«
Vorwort zu Jayne-Ann Igels »Fahrwasser. eine innere biographie in ansätzen«
Antwort auf eine Umfrage zur Debatte über die Schließung der Stasi-Akten
Stellungnahme zum Ausscheiden aus der Jury des Nicolas-Born-Preises
Nachwort zu James Joyce’ »Dubliner«
Der schwarze Fleck
Über »Der Archipel Gulag« von Alexander Solschenizyn
Anfang und Ende
»Anfang, der« Was uns zugefallen ist
»Ende, das« Das letzte Tabu
Lieber Lord Chandos …
Eine Antwort auf Hugo von Hofmannsthals »Lord-Chandos-Brief«
Nachwort zu Claudia Ruschs »Meine freie deutsche Jugend«
Die farbigen Gräber
Das Meuselwitzer Revier
Dylan in Rock
Das Loch
Abriß der Kritik
Frankfurter Poetikvorlesungen
Reden
Dankrede zum Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau (1983)
Selbstvorstellung anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (1991)
Dankrede zum Bremer Literaturpreis (1994)
Laudatio auf Adolf Endler
Zum Brandenburgischen Literaturpreis 1994
Dankrede zum Literaturpreis der Deutschen Schillerstiftung (1996)
Dankrede zum Lessing-Preis des Freistaates Sachsen (1997) Kamenzer Rede
Für Gil Schlesinger zum siebzigsten Geburtstag (2001)
Antrittsrede als Stadtschreiber von Bergen (2001)
Dankrede zum Peter-Huchel-Preis (2002)
Abschiedsrede als Stadtschreiber von Bergen (2002)
Über die Schwierigkeit, eine Abschlußrede zu verfassen
Dankrede zum Georg-Büchner-Preis (2002)
Rede für den Erhalt der Kontakt- und Beratungsstelle für obdachlose Jugendliche in Berlin (2002)
Interviews
Von der Beziehung der DDR-Gesellschaft zur Literatur
»Jeder Text müßte erscheinen können«
»Lyriker haben ideologisch unsicher zu sein«
Wie verbringt ein Dichter in Leipzig seinen Alltag?
Gewinnen, was man verloren hat
Sex im deutsch-deutschen Vergleich
»Sprache war für mich zwingende Suchbewegung«
»Wenn ich gelitten habe, dann ebenso wie die anderen«
»Es war eine merkwürdig gespaltene Situation«
»Die DDR-Literatur hatte völlig resigniert«
Zeit ohne Wirklichkeit
Die Abwesenheit als Ort der Poesie
»Die Lyriker müssen dem Bestreben, die Wende schnell hinter sich zu bringen, widerstehen«
»Da war kein Licht am Ende des Tunnels«
Die Krise der Kritik
»Die Suche nach Liebe ist wahrscheinlich der Urgrund des Schreibens«
»Die Hoffnungslosigkeit ist eher eine literarische Aussage«
»Literatur ist etwas Triebhaftes«
»Freiheit entsteht durch das Nein«
In der Narrenfreiheit
Der Dichter im Kesselhaus (Meine Lehrjahre)
»Jeder Text ist auch ein Rechtfertigungsversuch«
Gegen den Sound der Werbewelt
»Für einen Schriftsteller, der einen Text schreibt, ist die Welt immer auf irgendeine Weise provisorisch …«
Des Zufalls schiere Ungestalt
Antworten auf »Zwei Fragen heute an Bachmann-Preis-TrägerInnen«
Tippen und Kleben
»Ich kann den Terror der Welt beschreiben«
»Als wäre ich ein Schriftsteller«
Widerstand gegen diesen Lärm
»Leben habe ich nicht gelernt«
»Ich komme aus dem Wald«
»Aufstieg in die Oberliga«
Das Verschwinden der Stadt
Zur Person
Schreiben mit Wucht
Anhang
Quellenverzeichnis
Neun Irrfahrten zu Hilbig
Nachwort
Nachbemerkung zu dieser Ausgabe
Namensregister
Essays
Über »Alt möcht ich werden« von Louis Fürnberg
In diesem Gedicht will der Dichter eine bestimmte Stimmung ausdrücken, die ihn erfaßt hat, in einer »Zeit, wo alles neu beginnt«. Diese Zeit macht ihn glücklich, und er möchte noch alt werden in dieser Zeit.
Um das bildhaft auszudrücken, wählt er den Vergleich mit einem alten Baum, der schon viele Zeiten gesehen hat – ein sehr treffender Vergleich, denn es ist kein morscher Baum, dem Zusammenbrechen nahe, sondern einer, der sehr fest in seiner Erde steht, dessen Wurzeln so tief sitzen, daß sie kein Spaten sticht, der also tief in seiner Zeit verwurzelt ist, dessen Rinden sich immer wieder schälen. Er hat sich schon oft verändert, und die Zeit bringt mit sich, daß er sich noch oft verändern muß, stets gilt es, sich neu der Umwelt anzupassen, der Stamm aber, das Innere, muß stets gleich und unbeugsam bleiben. In der ersten Strophe hat Louis Fürnberg sein Ja-Wort zum Leben abgegeben, indem er sagt, daß er es möglichst lange besitzen will, in der zweiten Strophe sagt er uns, was ihm sein Leben in dieser Zeit so wertvoll macht. Das geschieht sehr folgerichtig, denn der Leser ist durch das Bekenntnis der ersten Strophe darauf neugierig geworden. Es heißt: »In dieser Zeit, wo alles neu beginnt.« Das ist die Zeit, die mit Beendigung des Krieges das schrecklichste Kapitel der deutschen Geschichte vergehen ließ. Der Dichter hat erkannt, daß erst jetzt das eigentlich wahre Leben anfängt, das Leben, das so lange erträumt war, »wo die Saaten alter Träume reifen«. In dieser Zeit, die ihm endlich Frieden und Glück verheißt, begreift er den Tod nicht, empfindet er den Tod als das Unglück, das ihm das nun so geliebte Leben nehmen will. Doch bei diesem großartigen Bekenntnis bleibt es nicht. Die schöpferische Seele des Dichters duldet nicht das tatenlose Genießen. Er, der die bösen Zeiten kennt, möchte Behüter sein für die, die sich gleich ihm des Lebens freuen. Er möchte »Schutz und Schatten spenden«, er ist der Besonnene, der Altgewordene, der sich über die freut, denen er das bessere Leben finden half. In dieser Strophe führt er den Vergleich mit dem Baum weiter. Und wie die zweite Strophe die erste gleichsam entschlüsselt, so bildet auch die letzte Strophe das erreichte Ziel der dritten und damit auch des ganzen Gedichts, das mit dem klaren jubelnden Urteil über die Zeit endet: »Wie ist sie schön! O wie wir glücklich sind!«
Der von Louis Fürnberg verwendete metrische und reimtechnische Aufbau kommt seiner beabsichtigten Aussage sehr entgegen und gibt dem Gedicht eine großartige Einheit.
Die zwei Strophen (1+3), die das Gleichnis des Baumes enthalten, sind beide im Dreierrhythmus gebildet und haben so einen ruhigen, fast erzählenden Tonfall. Sie sind dadurch als zusammengehörig erkenntlich. Die anderen beiden verwenden zu Beginn einen Jambus und haben dadurch einen gemäß ihrer Aussage schnelleren Rhythmus. In der Weiterführung bleibt der Dichter aber nicht schematisch, sondern durchbricht diesen Rhythmus.
Eine eigenartig schöne Variante gebraucht Louis Fürnberg bei der Art des Reimschemas. Die erste Zeile der Strophe bleibt jeweils ungereimt, die nächsten beiden reimen sich dann, und die vierte Zeile reimt sich mit der nächsten Strophe. Dadurch verkettet der Dichter das Gedicht in sich enger.
In der vierten Strophe durchbricht er aber diese Form noch einmal und läßt die erste mit der dritten Zeile gereimt, während die zweite plötzlich auf die erste der vorhergehenden Strophe paßt und sich somit noch einmal fester an diese hängt.
Ich bin der Meinung, daß dieses Gedicht von der technischen sowie von der bildhaften Seite her als sehr gelungen bezeichnet werden kann.
Louis Fürnberg
Alt möcht ich werden
Alt möcht ich werden wie ein alter Baum,
mit Jahresringen, längst nicht mehr zu zählen,
mit Rinden, die sich immer wieder schälen,
mit Wurzeln tief, daß sie kein Spaten sticht.
In dieser Zeit, wo alles neu beginnt
und wo die Saaten alter Träume reifen,
mag wer da will den Tod begreifen – –
ich nicht!
Alt möcht ich werden wie ein alter Baum,
zu dem die sommerfrohen Wandrer fänden,
mit meiner Krone Schutz und Schatten spenden
In dieser Zeit, wo alles neu beginnt.
Aus sagenhaften Zeiten möcht ich ragen,
durch die der Schmerz hinging, ein böser Traum,
In eine Zeit, von der die Menschen sagen:
Wie ist sie schön! O wie wir glücklich sind!
Die ewige Stadt
Im Sommer nach Rom zu reisen, ist wenig empfehlenswert; äußern Sie nur diese Idee und man wird Ihnen vieles nennen, was dagegen spricht, man wird Ihnen erschrocken abraten, fahren Sie ebensowenig im Frühling. – Die Lage der Stadt ist die ärgerlichste, das Klima ist bösartig. Irreführend schon durch die Bezeichnung, da es eigentlich Die Sieben Städte Rom heißen müßte, finden sich Roms ungeheure Ansammlungen von Gestein auf einer ebensolchen Anzahl von Erhebungen in einem Gelände, das von den Ausbrütungen einer hydrischen Flora vollkommen vergiftet ist.
Es ist vergessen, wie die Sümpfe in den Niederungen zwischen den sieben Stadtkernen entstanden sind, vergessen, das läßt uns nicht zweifeln, daß politische Verfehlungen die Schuld dafür tragen müssen. Verfehlungen solcherart sind unter den wechselnden Dynastien, die diese Region beherrschten, nichts Ungewöhnliches, die mangelhafte oder nur schematische Ausführung des berühmten römischen Wasserleitungssystems, eines Projektes von historischer Einmaligkeit, verdankt ihr Ende der fruchtlosen Plänemacherei einander ablösender Regierungen, deren eine den Wahnwitz der vorhergegangenen jeweils noch zu übertreffen suchte, so daß schließlich nichts mehr im Verhältnis zu seinen Möglichkeiten stand, das Verlorengehen aller Unterlagen bezeichnet die notwendige Folge solcher Politik. Ebenso unerforschbar bleibt es, wann das Sumpfland der Geschlossenheit der Stadt bedrohlich wurde. Nun sind da Ebenen, deren Ausdehnung nur nach Tagesmärschen zu messen wäre, aber es wagt sich auch zu Fuß kaum ein Mensch in diese Gebiete, die Fahrzeugen aller Art gänzlich unpassierbar sind. In der Morgenkühle (wenn dieses Wort auch nur im Sinne einer kaum spürbaren Abstufung zu verstehen ist, innerhalb nämlich eines Gleichmaßes an feuchter Hitze, die hier Tag und Nacht siedet) sind die Ebenen ganz unter einer endlosen Decke milchiger Nebel verborgen, aus der die bebauten Hügel wie abstoßende vieltürmige Zwingburgen ragen, die sich über unüberbrückbare Entfernungen eher zu drohen als zu grüßen scheinen. Wenige Stunden nach dem Sonnenaufgang, der diese Dunstsee hektisch erröten läßt, wenn die Temperaturen wieder auf die subtropische Höhe geklettert sind, auf der sie sich bis lange nach Mitternacht halten, verschwinden die Nebel, und jenes Sumpfland wird sichtbar, das eigentlich ein Gemisch aus einem pflanzlichen Filz und einer widerwärtig trüben Verdickung brackigem schimmligem Wassers ist, in dem nur noch wenige moorige Streifen festeren Grunds zu erblicken sind. Man weiß nicht, ob die wochenlangen Regengüsse, von denen Rom einigemal im Jahr heimgesucht wird, das Land in diesen übervoll gesogenen, faulenden Schwamm verwandelt haben, ob dann die unbefestigten Flüsse und Flußarme, die sich dort, die einmal zerfressene Bodenbeschaffenheit ausnutzend, ungemein rasch verzweigen und vervielfachen, irgendwann ein so verheerendes Ausmaß erreichten, daß die Gebäude unterhalb der Hügel versanken, oder ob gar das Tyrrhenische Meer seine salzgesättigten Ausläufer bis in diese Gebiete vorzuschieben begann. Durch ein Glas betrachtet und auf nur geringe Bildausschnitte fixiert, glaubt man zwar, daß die erschreckenden Bewegungen, die in diesem formlosen Geländebrei stattzufinden scheinen, nichts als optische Täuschungen sind, wirft man aber unvermittelt, etwa aus dem Fenster eines Hochhauses, einen weniger zielgerichteten Blick hinunter, vermeint man riesige Flächen in einer trägen und fetten Drift sich ineinander schieben zu sehen, oder gar das würgende Fließen langsam, aber immer zäher andrängend die Hügel umrunden zu sehen, man bildet sich ein, auf gegenläufigen Bahnen umkreise ein schlammiger Kosmos dieses behauste Siebengestirn, immer dichter, als solle es eingeschnürt, erdrosselt werden.
Wir meinen, daß die Behauptung, der Anblick dieser Bewegung sei täuschend und viel leichter erklärlich, sie entstünde in Wahrheit durch das Auf- und Niederfluten ungeheurer Insektenschwärme, noch nicht einmal den Vorwand für eine Beruhigung über dieses Phänomen darstellen kann. – Nur wenige der kurzen Winter noch hatten die Hoffnung zugelassen, daß die Sümpfe ein paar Tage lang zur Gänze eingefroren seien, und kaum jemand hat den Weg von einem Stadtteil zum anderen sich zugetraut; man weiß von einzelnen Unternehmungen, doch wer von diesen Wahnsinnigen wäre im heimatlichen Viertel wieder aufgetaucht, bestenfalls den Hinweg bewältigend und vom Auftauen der Sümpfe an der Rückkehr gehindert, beklagt man sie alle als verschollene Opfer der Niederungen. – Hinzukommt, und schließlich klingt es glaubhaft, daß nur noch ein paar wenige, und gerade die unerreichbarsten, einander entferntesten Stadtteile die eigentliche Stadt Rom ausmachen. Mit der Zeit sind die am dichtesten beisammen liegenden Hügel im Westen in den Besitz der katholischen Kirche gefallen und, wie man wissen will, von einem waffenstarrenden Militär abgeriegelt; als schwacher Trost nur erscheint, daß diese, dem Meer am nächsten gelegenen Teile die bedrohtesten sind, während die weiter dem Innern Italiens zugewandten als die widerständigsten gelten. Man rätselt, was der Vatikan gegen das Vordringen des Meeres unternimmt, um seine Bastionen zu halten, morgens, in der aufgehenden Sonne, kann man ein Blitzen in westlicher Richtung gewahren, mittels starker Fernrohre will man erkannt haben, daß es sich dabei um Lichtreflexe handelt, die aus mächtigen schwenkbaren Hohlspiegeln oder Radarschirmen zurückschlagen, die man zwischen den Ruinen installiert hat. Wenn man nicht spottete, daß diese Anlagen den Zweck einer Kontaktaufnahme mit der höheren Welt haben, meinte man, die Schirme hätten die Eventualität eines Angriffs der römischen Legionen zu bewachen, nur wäre ein solcher auf Grund der Auflösung und Schwäche Roms ein unsinniger Gedanke. Vor Jahren, vor vielen Jahren nun, hat ein aus dem Kirchenstaat zurückkehrender Pilger berichtet, es gäbe daselbst keinerlei Bestrebungen, von einem Verkehr mit den üblichen Städten Roms abzulassen, noch gar, ihn zu unterbinden. Es gäbe dort keine Spur von Stacheldraht, hieß es in dem Bericht, den die damals führende christdemokratische Zeitung druckte (ein freilich kurz nach dem Verfall dieser Partei verschwundenes Blatt), es gäbe dort keinen einzigen gesicherten Grenzzaun, keine Wachtürme, keinen Quadratmeter vermintes Niemandsland, nichts davon, wofür etwa das geteilte Jerusalem ein so bedauerliches Exempel liefere. Aber natürlich sind da die Sümpfe, die ehemals prächtigen Straßen auf eine Art zerstört, die man natürlich zu nennen sich sträubt, spanische Reiter sind lächerlich, die wenigen verfügbaren Backsteine wären für das Zumauern von Fenstern verschwendet. – Es bleibt die Frage, weshalb die einst so aufwendigen Radio- und Televisionssendungen eingestellt wurden, warum der Funkverkehr, immerhin noch möglich, als die Telegrafenleitungen versunken waren, unterbrochen wurde. Der letzte größere Flughafen liegt auf katholischem Gebiet, von Rom aus können nur Helikopter starten. Es führte zum Abbruch der Beziehungen Roms – ein rein formaler Abbruch, die Beziehungen waren eigentlich erloschen, und es ist zweifelhaft, ob der Funkspruch mit dieser Note den Vatikan überhaupt erreichte –, als die Helikopter zu verschwinden begannen. Piloten wollen Wracks der Maschinen, von Schlingpflanzen überwuchert, in den Salzsümpfen der westlichen Seite gesehen haben, als aber auch die Aufklärungsflieger nicht wiederkehrten, wuchs ein gärender, wiewohl machtloser Zorn in Rom heran. Als gleich nach dem Abbruch der Beziehungen ein Düsenflugzeug mit dem Kruzifix auf den Tragflächen gesichtet wurde, schoß man es kurzerhand ab. – Immerhin hat sich der Ärger Roms bald verflüchtigt, die eingeborene Friedfertigkeit und die Sorge um die eigne Existenz erzwingen hier jeden Gerechtigkeitssinn, der das eigentlich Wohltuendste ist an Rom, man begnügt sich zu meinen, man könne der katholischen Kirche nichts beweisen. –
Indessen gibt es aber einige Fremde – sie sind von auffälliger Hellhäutigkeit, stets entzündeten Augen, und [an] ihrem vergleichsweise riesenhaften Wuchs zu erkennen (zudem sind sie beinah ausnahmslos Glatzenträger) –, entweder Einwanderer oder notgedrungen hier Sitzengebliebene, die einen geheimnisvollen, schwer verständlichen Unmut schüren. Ausgerechnet im östlichsten und sichersten Stadtteil (dem natürlich am häufigsten besuchten) sind sie zahlreich und aktiv. Unter den breitrandigen Hüten, die ihre kahlen Köpfe schützen sollen, bilden sie in den Gärten der Weintavernen wahre Zusammenrottungen, geben sich kaum mit der von ihnen verachteten Bevölkerung ab und haben nur Kontakt zu den Mitgliedern der Contraverdura, einer längst verbotenen, radikalen Organisation, die, seit der Bürgermeister auf einem anderen Hügel festsitzt, und sich nur mehr durch Funksprüche bemerkbar macht, wieder ganz offen auftreten. Mit ihrem dilettantischen [Wappen] auf den Ärmeln, das ein grünes, von dicken roten Balken durchkreuztes Ulmenblatt darstellen soll, wären diese Gestalten, die die Rettung Roms auf ihre nichtvorhandenen Fahnen geschrieben haben, und, dauernd betrunken, von einem Marsch auf dasselbe singend, nichts weniger als ernstzunehmen, wenn man nach einer Verfolgungsjagd nicht entdeckt hätte, daß sie Waffenlager angelegt haben, wenn sich nicht herausgestellt hätte, daß sie nach der sagenhaften römischen Wasserleitung suchen, eben jener, deren nie gelungene Vollendung unter Cato in Angriff genommen worden sein soll. So hat man Lagepläne dieses Kanalsystems gefunden, die sie, allerdings in den widersprechendsten Varianten, rekonstruiert haben, Pläne, die zum Glück ihrer Phantasie entsprungen scheinen, die sie aber in längst offen geführten Debatten zu vervollständigen trachten. Unbedingt soll sie dieser Marsch gegen Rom durch diese Kanäle führen. Nur sind deren Eingänge noch nicht entdeckt. Da die Wasserleitung im größten Teil der Bevölkerung als ein Hirngespinst gilt, sind die Contraverduri im Begriff, ihr Maß an Lachhaftigkeit vollzumachen, was sie aber wirklich abstoßend in den Augen der Leute ausschauen läßt, ist die Tatsache, daß es ihnen, womöglich mit Hilfe der freiwilligen oder unfreiwilligen Asylanten, gelungen ist, die Verminderung ihrer Körpergröße zu stoppen, wenn nicht sie wieder zum Wachstum zu bringen. – Nelson Leopardi, unser bester Freund unter den Einheimischen, dem die schwarze Binde über dem einen Auge die düstere Entschlossenheit einer legendären, wenn auch zu winzig geratenen Admiralität verleiht, gibt der Überzeugung Ausdruck, daß die Contraverduri gerade wegen ihres unaufhörlichen Größenwachstums am möglichst schnellen Auffinden der Kanäle interessiert sind. Sie seien von den Barbaren, wie er die Fremden klassischerweise zu betiteln pflegt, in das Geheimnis der Präparation eingeweiht worden, die deren Wuchs so beschleunigt habe. Das gescheiteste Mittel, die Marschierer zu eliminieren, sei zugleich das allereinfachste, ein lächerliches Mittel, wie es denen, auf die man es anwende, nur zu angemessen sei, es bestünde darin, sie zu isolieren, woran sie durch ihr Benehmen tatkräftig teilhätten, und sie umfassend gewähren zu lassen. Der ausschließliche Umgang mit den Barbaren, welche Größe bis zur Blindheit erstrebenswert hielten – das Mithalten an barbarischen Gelagen, der Verzehr barbarischer, aus Moorböden gewonnener Speisen, die Teilnahme an einer bis zur Albernheit getriebenen Dehnungsgymnastik, die barbarischer Brauch sei – müsse den Wuchs der Contraverduri schließlich bis auf barbarische Ausmaße steigern, sodaß sie, gelänge es ihnen, in die Kanäle einzudringen, im blindwütigen Vorkriechen gegen ein vermeintliches Zentrum Roms, in dem sich verengenden System krepieren müßten.
Wir glauben uns keiner Unwahrheit schuldig zu machen, wenn wir, mangelnden Überblicks zum Trotz, uns festzustellen erlauben, daß die kommunistische Weltpresse bisher von der physischen Degeneration des römischen Menschentypus keinerlei Notiz genommen hat. Untersuchungen, die uns nicht zugänglich sind, die wir nur vom Hörensagen kennen, datieren den etwaigen Beginn dieser Erscheinungen bis zum Jahre 1945 zurück, bis in jenes Jahr also, das man als das erste eines neuen Zeitalters bezeichnet hat, die Gründe für eine so emphatische Hypothese haben wir uns erfolgreich zu vergessen bemüht. Wir haben uns [daran] gewöhnt, die damalige [Zeit], die graue Vorzeit der jetzigen zu nennen, es bleibt uns verborgen, ob jener Gongschlag, den wir aus dem Wort neu zu hören meinen, mit der Entdeckung des Rückwachstums der Angehörigen verbreiteter, südlich plazierter Bevölkerungsgruppen in Europa zusammenhängt. Es ist offensichtlich, daß der Stil eines Journalismus, der von da ab immer blumiger geworden ist, die Bedeutung solcher Wörter wie groß oder klein in einen dem Verständnis ganz unzugänglichen Bereich entrückt hat. Stünden uns die Archive offen, würden wir womöglich erkennen müssen, daß jene beiden Epitheta schon dazumal sich immer mehr in begriffliche Relationen wie neu oder alt zu verwandeln begannen, in Begriffe also, deren kosmologisch nicht zu begründende Stichhaltigkeit sie uns von allem Anfang an als unbrauchbar hätte kennzeichnen müssen. Übrigens läßt der Blick auf die in jener Zeit sich zu festigen beginnende materialisierte Weltsicht der oben erwähnten Sektion des Nachrichtenwesens den Schluß zu, daß ein unbedingter Fortschrittsglaube, der religiöser Natur war, und gerade deshalb um seinen physiologischen Nachweis in einem fort zu bangen hatte, in dem sichtbar werdenden Phänomen eine umfassendere als nur organische Rückentwicklung befürchtete, die zu dokumentieren sich selbst in Bezug auf Angehörige eines Systems verbot, das man noch zu bekämpfen vorgab (und auch im Falle Italiens in allen übrigen Hinsichten keinesfalls schonte), da diese Ereignisse dem ideologischen Sprachgebrauch sich zu entziehen schienen, da sie womöglich objektiven Entsprechungen zuzuordnen waren.
Was zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Entwicklung des Zeitungswesens sich als neu herauszukristallisieren begann – wobei wir, die einmal vorgegebene Reihenfolge beachtend, uns der Rückübersetzung des Wortes neu in das Wort groß nicht entschlagen können, weil der Umfang und die Menge der von diesem Apparat ausgestoßenen Produkte eher wuchs als sich verringerte – war die fortgesetzte Gebundenheit der gesamten Presse an ihre Archivierung. Als diese Erzeugnisse sofort aus den Druckereien – mitnichten blieben von dieser Anordnung die der Presse unterstellten Nebenmedien, wie etwa die Bücherherstellung, ausgenommen – in die Archive zu wandern begannen, gab ein italienischer Ethnologe in einem Fernsehinterview (dessen Wiederholung untersagt wurde) den allerdings schaurig klingenden Witz zum Besten, daß sich der Informationshaushalt der Menschheit konträr zum Geist in den Köpfen entwickele. So wie sich ersterer aufblähe, um mit ungeheuren Mengen nichtssagenden Papiers unterirdische Lagerhallen zu füllen, verdichte sich der letzte noch vorhandene Esprit in immer kleineren Zellen kleiner werdender Köpfe. Da es abzusehen sei, daß die Vergnügen des Denkvermögens bald in Stecknadelköpfe verbannt würden, sei das entgegengesetzte Erscheinungsbild, das die Erde als einen ausgehöhlten Schädel vorstelle, der mit Tausenden und Abertausenden Tonnen von faktisch leeren, sinnlos feuergefährlichen Druckerzeugnissen zum Bersten angefüllt sei, ebensogut vorhersagbar. – Als das Betreten der Archive, mit Sondergenehmigung, einigen Gelehrten noch erlaubt war, will jener Ethnologe, der ein entfernter Verwandter eines der nächsten Vorfahren unseres Leopardi war, auf einem der für Kuriosa gesondert eingerichteten Regale eine aus einem früheren Jahrhundert stammende Abhandlung gefunden haben, in der irgendein seltsamer Mensch ein Verfahren entwickelt haben wollte, mittels dem Papier auf geradem Wege sich wieder in lebendes Holz zurückverwandeln ließe. Dieses durch abergläubische Beschwörungsformeln und astrologische Bedeutungshuberei verunstaltete Werk soll der Anlaß gewesen sein, daß die Archive für immer geschlossen wurden. Da der Verfasser dieser Schrift sich zu der tollkühnen Behauptung verstiegen hatte, daß der Prozeß dieser Verwandlung, der ein natürlicher genannt werden müsse, sehr wohl auch ohne menschliches Zutun einsetzen könne, wenn immaterielle atmosphärische Kräfte einsprängen, die frei würden, wenn durch weitgehende Abholzung der Baumbestände ein ökologisches Umkippen der meisten Abläufe in ihre Rückentwicklung zur naturgesetzlichen Notwendigkeit werde, spielte auch hierbei die Furcht eine Rolle, es könne die Existenz einer mit dem Fortschrittsgedanken unvereinbaren, objektiven Tatsache, die schlechterdings ideologisch nicht zu bekämpfen sei, Eingang in das geistige Allgemeingut finden. So soll jene Schrift, in der sich so ungeheuerliche Sätze befunden hätten, wie jener von der Ankunft einer neuen Luft, die so leicht sei, daß sie [unter] dem wütenden Blicke des Saturnus sich zerteilen werde – denn nahe sein werde die Bahn jener Himmelskugel, stärker brennend als eine zweite Sonne, und es zerteilten sich vor ihrer Wut auch die Wasser des Tiberflusses –, schließlich ihrem eigenen Gegenbeweis gedient haben: neben allen anderen wurde das Papier des Scharlatans dazu verurteilt, statt in lebendes Holz sich in Staub zu verwandeln, oder zu einer ebenso nutzlosen Materie, wie all die Tonnen von Zeitungen es waren, die während der letzten Visite des erwähnten Ethnologen in den glutenschwangeren Kellern in, wie er behauptet hätte, ohrenbetäubender Weise vor sich hin knisterten und flatterten.
Wir haben mit Schreckensbildern von dieser ehemals so mächtigen und herrlichen Stadt Rom nicht gespart. Dennoch wäre dieser Bericht nicht wahrhaftig, er wäre sogar eine Beschönigung, würden wir nicht auch über den Lärm sprechen, von dem diese Stadt beherrscht ist. Er ist im Grunde das häßlichste der Übel, und das Ärgste daran ist, er ist das getarnte, hinter allem Anschein von Wirklichkeit am besten verborgene Übel, er ist wahrscheinlich sogar unhörbar. – Nur wenn Sie sehr früh am Morgen Ihr Hotelfenster öffnen, werden Sie einen Augenblick lang das Kreischen und Dröhnen zu gewahren glauben, das aus den Niederungen, womöglich direkt aus den Sümpfen hervorsteigt. Um jene Stunde, in der die Nebel über der Vegetation verfliegen, die Hitze aber noch nicht jede Regung der Atmosphäre auf den Boden herabdrückt, ist man plötzlich umgeben, eingehüllt von einer so undefinierbaren Vielfalt gleichzeitiger Geräusche, daß man glaubt wahnsinnig zu werden und seine Sinne dieser Wahrnehmung sofort verschließt. Sicher würde man wirklich wahnsinnig, überließe man sich diesem Lärm, glaubte man gar an ihn, so wäre man es bereits. Ursache und Wirkung fielen in eins zusammen, man hörte den wahnsinnigen Lärm, und man wäre wahnsinnig, weil man ihn gehört hat. Die Psychiatrie von Rom, die ein Gebäudekomplex von nicht enden wollender, irreführendster Ausdehnung ist – Gebäude, die irgendwann inmitten von Ruinen auslaufen, um plötzlich, nach zerstörten Straßenzügen, nach einem Gelände zertrümmerter Tempel, gefällter Säulenreihen, wieder neu zu beginnen – ist voll von den bemitleidenswerten Opfern dieses Lärms. Dicke Tücher um die schmerzenden Köpfe gewunden, straucheln diese Rasenden durch Gärten und Wandelgänge, verstopfen sich die Ohren und Münder mit Fingern, Fäusten, Watte oder Wachs, oder sie liegen in den Winkeln der Räume auf dem Gesicht, mit den Armen, mit Mänteln sich die Köpfe zu bedecken suchend. Ihr schreckliches Wimmern ist der einzige Laut, der sich vor dem gewaltigen Schweigen dieser hohen Wölbungen bricht, wenn man davon absieht, daß sich Neuangekommene ab und zu anbrüllen, da sie sich nicht zu verstehen glauben. Die meisten der Kranken sprechen nichts mehr zueinander, öffnen sie doch einmal den Mund, durchdringt kein Ton die Stille, als sei ihr Rufen in einem unheimlichen [Lärm, Getöse] untergegangen.
Die Ursache davon in den Bewegungen und Verschiebungen suchen zu sollen, die in den sumpfigen Ebenen vor sich gehen, ist eine anfechtbare These, sind doch diese Bewegungen so wenig bewiesen wie die Existenz des Lärms selber. Aber es ist an die Behauptung zu erinnern, daß sich in den unteren Dschungeln riesige Insektenvölker eingenistet hätten. Wenn die Wolken dieser Schwärme gleichzeitig sich in die Luft höben, entstünde dieses Schrillen und Kreischen, das wie Hunderte auf ein Kommando gezogener Dampfpfeifen klinge, um Rom augenblicklich in eine förmliche Kuppel von gellendem Geheul in den höchsten, unerträglichsten Tönen einzuschließen; sei die Jagd dieser Myriaden beendet, senkten sie sich in der Breite von Gewitterfronten nieder, und es werde ein schmetterndes Knattern, berstendes Dröhnen und Donnern ausgelöst, das mit dem fernen Niederstürzen von Lawinen nur ungenügend zu vergleichen sei. Überhaupt sei das Ganze unvergleichbar, einem Vergleichen stünden lediglich irdische [Wörter] zur Verfügung, während das Geschehen um Rom mit all seinen Gewaltsamkeiten einem kolossalerem Universum als diesem entspreche. So sei auch die feuchte giftige Hitze, in der selbst Wolkenbrüche keine Erleichterung brächten, eine die menschliche Leidensfähigkeit ebenso übersteigende, wie die Idee, daß man praktisch im unablässigen, sich überschneidenden Auf- und Niederebben einer Insektenwelt fuße, deren Hauptmerkmal allem Anschein nach Unersättlichkeit sei. Schon vermutet man, daß diese geflügelte Pest mit der Tageshitze eine seltsame Ehe eingegangen ist, manchmal sieht es aus, als seien ganze Kolonien zu einzigen Glutnestern verwandelt, ein gelber oder orangener Rauch färbt dann den grünen Teppich der Sumpfpflanzen, Ausläufer eines unerklärlichen, martialischen [Geruchs] steigen bis in die bewohnten Höhen, einige Beobachter beschwören, darin einen unverkennbaren Paarungsgeruch bemerkt zu haben. Die schimmernden Krusten, die kurze Zeit später die bräunlichen Moorstreifen verunzieren – die wir als salzige Rückstände eingedrungener und verdampfter Meereszungen uns gedacht haben – bezeichnet man als den Laich, der diesen glühenden Hochzeiten entsprang.
Nichtsdestoweniger gilt Rom noch immer als der Mittelpunkt der Welt. – Irreparable Unbelehrbarkeit unserer Gattung … unbeeindruckt wie unser Glaube, ist Rom endlich seine Fleisch- und Steinwerdung: einstmals in glänzendem Aufstieg, nun gleich unseren Anschauungen, in völligem Zerfall. Finden sich doch alle Kategorien, die wir zu bilden uns befleißigt haben, finden sich doch Ursprung und Ende wieder an diesem Ort, schließlich sind auch die Wölfe in diese Stadt zurückgekehrt. Furchtsam und ahnungsvoll haben sie sich in den Kellern und Katakomben unsichtbar gemacht. Nelson Leopardi nennt sie eine Hoffnung, ihre Instinkte verböten es ihnen, die eigene Brut zu fressen, andererseits seien sie so unbedarft, sich im Notfall mit vegetarischer Nahrung zu begnügen, wie er seine Worte aufs Merkwürdigste begründet. – Nichts von alledem begriffen aber hätten die Barbaren, was den Römern das Überleben gestatten wird, ihre zielsichere Entwicklung einer schon absehbaren Körperlosigkeit entgegen, empfinden sie als bloßen Rückschritt. Wenn sie nicht, wie seit den grauen Zeiten einer sich wirksam wähnenden Pseudorenaissance, von Riesenhüten beschattet, die Weinschläuche im Rachen, die zweimal größeren Staturen unter den eigens für sie angefertigten, riesenhaften Tavernentischen lagern, hocken sie zusammen mit der Bande der Contraverdura über falschen Plänen der ehedem hochberühmten Cloaca maxima, und speien Parolen in so schlechtem Italienisch aus, daß sie sich schon mit dem vaterländischen Verschwörerklüngel zu entzweien beginnen. Wenn sie nicht auf dem verlassenen Bahnhofsgelände sich selbst ihre ebenso exakten wie dummen Gymnastiken vorführen, Wachablösungen erproben oder Exerziermärsche einüben (woher nur wollen sie wissen, daß die Cloaca sie stehenden Fußes aufnehmen könnte), sind sie beschäftigt, ihre Rückkehr in die Barbarei vorzubereiten (sie glauben noch immer an eine solche Möglichkeit). Diese Vorbereitungen bestehen darin, sich Unmengen von steinernem Marschgepäck zu verschaffen: täglich sind sie beschäftigt, die in der Hitze sich spaltenden und bröckelnden Ruinen Roms abzutragen. Das Stehlen von Gestein, das sie wie eine jahrhundertealte Tradition pflegen, hat ihnen den Spott der Römer eingebracht. Ganze Wagenladungen voller Fälschungen sollen Rom verlassen haben, als dies noch möglich war, und nun türmen sich die Kisten auf dem Bahnhof und enthalten oft nur von Schulkindern notdürftig geformte Stücke, die wenige Jahre alt sind, Fratzen aus Ton, die häufig Ähnlichkeit mit Totenschädeln haben. Wie aber wollen sie Rom verlassen. Wenn es ihnen wirklich gelingt, sich in die Erde zu bohren, werden sie, wenn sie nicht darin ersticken, oder zu den Sümpfen durchdringen und dort umkommen, statt auf die Cloaca auf die Katakomben stoßen und von den Wölfen verschlungen werden. Wenn sie nicht doch den Vatikanstaat erreichen, um, ihres Deliriums müde, allesamt zu konvertieren (wofür es genügend historische Beispiele gibt), wenn nicht die Contraverdura über sie herfällt – da man in dieser Organisation, ganz besonders, seitdem nur noch Fälschungen existieren, sich mittlerweile auf den Wert des römischen Kulturguts zu besinnen beginnt –, werden sie Rom eines Tages enttrümmert haben, allen Schutt transportfähig verladen haben, werden sie Rom leergefegt haben. Aber es bleiben ihnen, sofern sie selber bleiben müssen, achtzig Prozent des römischen Territoriums, es bleiben ihnen die Labyrinthe, die Klöster, die Villen, die Arkaden, die Amphitheater der römischen Psychiatrie; sie werden darin für alle Zeiten Raum genug und Zuflucht finden, während die Gehörlosen mit den schon ganz durchscheinenden Leibern, die Kleinwüchsigen, die schreienden und gepeinigten Könige mit den Strohkronen auf den Köpfen, mit den zerbissenen Fäusten zwischen den Zähnen in die lichte Stadt zurückkehren.
Wenn diese Wendung der Dinge auch noch in der Ferne liegt (vermutlich, denn es gibt in Rom keine Zeitung, die es anders wissen will oder kann), wäre Rom, schon des malerisch goldenen, zwiefach besonnten Himmels dieser Landschaft, des berühmten Latium halber, immer eine Reise wert. – Nietzsche, der eines in Ihren Breiten so seltenen, boshaften Urteile über Rom fällte, hatte vollkommen Unrecht: Rom ist von der unberechenbarsten, unwiederbringlichsten Eigenart und Schönheit. Lassen Sie sich also nicht den Mut nehmen, reihen Sie sich ein in die Schlangen vor den Reisebüros, vor den Fahrkartenschaltern, drängen Sie sich in die Foyers der Flughäfen, drängen Sie sich vor, buchen Sie noch heute … die Tarife sind erschwinglich, Sie werden durch Schönheit entschädigt.
Der Mythos ist irdisch
Für Franz Fühmann zum sechzigsten Geburtstag
Die Deutung aus einem zufälligen Getöse ist der natürlichste Anfang der Orakelsprüche …
KARL PHILIPP MORITZ
Über dem Thema, das uns verbinden müßte, liegt ein Schatten.
Manches Mal ahne ich sein Glimmen darunter, gleich aber fühle ich mich an einer näheren Betrachtung gehindert, vor dem Kostbaren, das dieser Glanz sein muß, liegt eine altbekannte Schwelle, und wieder auf sie fällt zuerst der Blick. Beschriebe man diese Schwelle einfach als das Brett der Klasse, das man vor dem Kopf hat, man könnte irgendwelche Blößen in der Bildung, die man während fast vierzigjährigem Eingelagertsein in den wohlgepflegten Landschaftspark aufnahm, entschuldigend verwerten, sich zu fragwürdigem Gewinn umrechnen. Aber es scheinen inzwischen echte Sperren entstanden zu sein, zu schnell glaubt man sich mit sich selber darauf einigen zu können, daß es möglich sein müsse, unmittelbare Aussagen zu treffen, der Glaube daran ist übernommen von dort, wo jene Bildung steckt, und mindestens ebenso fragwürdig wie sein Gegenteil, das es, ich sage vorsichtshalber, gegeben hat, der Glaube an einen unbedingten Akademismus, ein Glaube, der allenfalls dort noch weiterwirkt, wo Akademie vermißt wird, dort, wo man das Zensorengrinsen spürte, das auf jene Schwelle deutete, die ja abgeschafft war, Akademie als Standesprivileg vergessen. Es scheint fast irreversibel, daß ein Schreiben, das lange geheimgehalten wird, aufständisch wird gegen die Akademie (während es sich ja innerhalb der Akademie kaum geheimhalten läßt), daß es durchlässig wird für die Gründe des Geheimen in einem ganz allgemeinen Sinn, für das Strafbare. Neben flüchtig gestreifte Bildung tritt das Ungebildete als eine ebenbürtige Größe, neben die Götterlehre ist plötzlich die Gespensterlehre getreten.
Der Mythos ist ein Thema, an dem ich gerade die erbärmlichsten jener Blößen in mir finde. Er wäre, öffnete er sich eines Tages, der Zugang zu jenem Schatz unter dem Schatten, er enthielte den Mythos von einem weißen Buch, das auf seine Zitate wartet, auf das Unaussprechliche, das man nicht erfinden kann. Und es gehörte zu diesem Thema E.T.A. Hoffmann –, wenn man nicht, hierzulande, beinahe gezwungen wäre, Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder Etwas über das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann zu sehr als ein Lehrbeispiel von außerordentlichem Seltenheitswert zu lesen, darüber, wie überhaupt mit einem Autor umzuspringen sei. Und das müssen wir erst lernen an einem Klassiker, dem wir nur noch mittelbar schaden können. – Hilft es mir also, mich mit Franz Fühmann – der mich unter anderem damit überrascht hat, daß er den Bitterfelder Weg zu einer Zeit ernst nahm, in der seine Praxis eine leider allgemeinübliche geworden schien (das »scheinbare Einpfählen der scheinbaren Sache«, wie Kafka es so kompliziert-genau ausdrückte), so ernst, daß er Eingeständnisse eines Scheiterns auf diesem Weg bis an die oberste Stufe des Zentralismus sandte, während es scheinbar üblich war, die Kontrolle mit Proklamationen zu versöhnen, wie ich den Eindruck damals nicht los wurde; ich hatte gerade das frühromantische »Frühwerk« verbrannt, glücklicherweise haßerfüllt, so der Lächerlichkeit solcher Aktion hoffentlich zum Teil entgehend, die Forderungen von Bitterfeld hatten mich krummerweise auf den Entschluß gebracht, die Schreiberei zu lassen, ich war dabei, mich auf mein Dasein bei den Wanderfirmen zwischen Bitterfeld, Wolfen, Leuna gedanklich vorzubereiten, unter anderem dergestalt, daß nicht zu fürchten sein müsse, es könne ein Schriftsteller in einer der Brigaden weilen – hilft es mir also, mich mit ihm und gleich noch mit dem Kammergerichtsrat, auf eine literarische Figur namens Kamptz zu einigen? Die wäre wohl nicht das Kostbare an diesem Thema.
Ich habe den Verdacht, daß das Thema naheliegender ist. – Womöglich gehören dazu die Wörter, die, verwendet oder verschwendet, im diesseitigen Bereich der … Bildungsschranke (der natürlichen, um das Wort abzuschwächen) oft für naiv gelten, im jenseitigen für schwer verständlich, wobei die beiden Attribute, auf gegenläufige Bahnen geschickt, sich über der Schranke, Schwelle klirrend kreuzen. – Wald und Schnee, sie waren die beiden Substantive des ersten Satzes eines seiner Briefe … daß ich erst einmal anhalten mußte, ehe ich den Brief weiter und zu Ende las … sie bezeichneten seinen Aufenthalt, er befinde sich wieder draußen in … die beiden Wörter erinnerten mich unzweideutig – und die ganze Verdorbenheit des Denkens auf den Plan rufend, daß Wörter lediglich Anhängsel der Materien seien, deren Ausrichtung sie anzuzeigen hätten, daß sie also das Manipulationsinstrumentarium par excellence seien – erinnerten mich viel eher an die umgekehrte Idee, daß die Dinge ohne ihre Wörter nichts sind. Laut meines Konsums von Sekundärliteratur hat irgendein beschimpfter, zum Ahnherrn aller Irrationalismen erklärter englischer Bischof dieses bemerkt. Vermutlich liegt in solcher Ansicht ein Skandal verborgen. Unter anderem der, daß die Macht über die Sprache nicht unbegrenzt ist. Den Ideologen wird dieser Gedanke zweifellos mehr Nerven kosten als den Dichter, für den letzteren relativiert sich die Frage nach der Sprachbeherrschung ohnehin leichter. Mich aber bringt das auf die Idee, wie Stimmiges zustande kommt und … zweierlei Literatur: den Proklamationen wird man mit Proklamiertem antworten, Erzählungen werden mit Erzähltem beantwortet. Es ist schnell zu erkennen, welche der beiden Literaturen sich vor sogenannten heiligen Kühen eher heilig oder unheilig verhält, rein aus ihrem Wesen heraus. – So ist es eine alte und befreiende Idee, daß die Stimmen der Kunst über die Zeiten hinweg sich das Wort erteilen, ich glaube, daß diese Idee auf Franz Fühmanns Werk entscheidend gewirkt hat (am schnellsten als Beispiel ist sein König Ödipus zur Hand). Ich nenne diese Idee befreiend in einem Sinn, der sich nicht konkreter verstehen kann, es somit, gewiß ohne andere Leistungen schmälern zu wollen, als eines der teuersten Werke kennzeichnend, bei deren Entstehung und Fortgang man hier Zeitgenosse sein darf. Mit den Jahren ist sein Erzählen von einem theoretischen Werk begleitet, begründet und verschärft worden, an dem ich vielleicht besser erklären kann, wo ich jenes Befreiende finde. Ich will mir nicht ausmalen, in welche Dürre unser Schreiben geraten wäre, wenn Franz Fühmann mit seinen Bemühungen in Richtung Mythos, wie er es einmal nannte, nicht auf die ersten Antriebe des Erzählens überhaupt verwiesen hätte, mit einer Überzeugungskraft, die diese Antriebe erneut eben befreit hat. Denn es gibt für mich keinen Zweifel, daß Mythen die Essenz ununterdrückbarer Artikulationsdränge sind, so wie sie solche wieder hervorrufen, entstanden auf der Suche nach einer Alternative, die, ihrerseits schon alternativlos, dem Geist einen Daseinsgrund über dem der Verkettung in die Banalstrukturen des Lebens hinaus zuzumessen sich mühen muß, also schlicht dem Bewußtsein einen Sinn zu erteilen, was immer auch heißt – wenn man sich darauf einigt, daß der sogenannte Kampf ums Dasein (schon hier klingt die Verfälschung des Mythos durch faschistische Ideologien an), und, in der Fortsetzung davon, der Kampf um den sogenannten Wohlstand, nicht ausreichen, die Potenz des Geistes zu erklären oder gar zu erschöpfen – das Bewußtsein zu erweitern. Ich möchte einen Satz Franz Fühmanns verlängern: wenn immer sich das Schreiben über die Bewegung des Selbsterhaltungstriebes hinaushebt, ist es erst Schreiben. Wenn es dann auch wieder – es ist nicht ein Paradox, sondern einfach eine Reihenfolge – aus Selbsterhaltungstrieb geschehen mag. – Diese Überlegungen führen fast zwangsläufig zur Romantik, zu deren Verteidigungen der Kunst, zu deren Hinwendung auf das Ungedachte, zur Annahme eines Unsagbaren, dessen Grenzen hinauszuschieben sind. Scheinbar ist es nur mit Ignoranz zu erklären, daß die Rückeroberung solcher Schreibantriebe durch Franz Fühmann noch immer kaum eine Literatur in der Nachfolge dieser Tradition zeitigt. Natürlich hat die Praxis einer sogenannten Erbe-Rezeption, die sich vor dem brisantesten Teil des Erbes geradezu gefürchtet hat, das ihre getan. Dabei wurde die Tatsache, daß das Wesen der Romantik der Unterdrückung des Geistes entsprang, nicht einmal von den Ideologen ihrer postumen Unterdrückung bestritten.
Was man der Romantik vorgeworfen hat, und vorwirft, ist unter anderem die Verwilderung der Formen. Zu deutlich klingt das nach unbezähmbarem Aussprechen, nach Besessenheit, nach blindem Vertrauen auf die Wörter, nach außer Kraft gesetzter Kontrolle. Und wenn man meint, daß mit einer verwilderten Form einem Inhalt nicht beizukommen ist, meint man womöglich auch, daß Inhalte in solcher Form schwerer zu kontrollieren seien. Kontrolle wäre vielleicht besser, in jedem Industriebetrieb stehen und fallen die Produkte in der Kontrolle. Bezüglich des Schreibens aber schleppt das Wort Kontrolle ein doppeltes Mißtrauen mit sich, unheimlicherweise, denn eigentlich will man ja kontrollieren, um sicherzugehen. Für mich ist ein Verdacht sofort da, wenn es um die Kontrolle eines Schreibens geht, das einer Alternativlosigkeit entspringt, die Franz Fühmann besonders scharf formuliert hat. Es ist ein Schreiben, das in jener oben schon erwähnten nächsten Dimension eines Selbsterhaltungstriebes stattfindet, das Franz Fühmann, in einem Beispiel dafür, daß öfters nur sogenannte Zuspitzungen das Ganze aussagen, so definierte: »Schreiben ist nicht etwas, das man muß, doch nur, wenn man es muß, ist es Schreiben.« – Die eine Art des Mißtrauens, diejenige, die von außen kommt, hält sich beim ersten Teil des Satzes auf, ihrer Meinung zufolge kann man schreiben, das Wörtchen kann deutet schon die Maßnahme an, sie hält es für kanalisierbar, sie fragt, in eine Strömungsrichtung deutend, ob man dorthin müssen solle oder nicht, während die andere Art des Mißtrauens, die von innen kommt, eben weil sie schreiben muß, immer fragt, ob sie es kann. Aber das Mißtrauen von außen denkt natürlich nicht daran, Verantwortung im Innern des Schreibers zu vermuten. Das Ganze, bei Franz Fühmann völlig zu Recht mit Widerspruch bezeichnet – und damit meilenweit weg von der Phrase, daß man »die Wirklichkeit mit all ihren Widersprüchen …«, und ein Beispiel dafür, einem Wort seine Bedeutung zu lassen, seinen projektiven Sinn, hier den des Widersprechens (der Titel seines Essaybandes Erfahrungen und Widersprüche ist ein Titel nicht für Ignoranten) – hat Geschichte, und zwar von beiden Seiten her, und immer, heimlich oder unheimlich, so verschränkt miteinander, daß man in der deutschen Schizophrenie fast zu Hause sein könnte. Auf diese Geschichte wird von Franz Fühmann am zielsichersten hingewiesen, E.T.A. Hoffmann ist eine Schlüsselfigur für heutige Literatur, das Schauerliche bei E.T.A. Hoffmann ist von frappanter Aktualität, sowie faszinierender als auch erschreckender Aktualität.
So auch werden wohl Geschichten, in denen sich Tote begegnen, wie jene der Seghers, in der Hoffmann mit Gogol und Kafka in einem Prager Café sitzt, fix als phantastisch bezeichnet.
Ich glaube, daß dies mythische Geschichten sind. Ich glaube, dem menschlichen Gedächtnis an sich eignet ein Moment des Mythos, die Kraft des Erinnerns, das Nicht-Vergessen, das Nicht-Vergessen-Wollen, das Nicht-Vergessen-Können. Wie die gesamte Odyssee nur möglich ist durch das Gedächtnis an Ithaka, wie durch die gesamte Götterwelt die magische Idee von der Schöpfung des Menschen sich zieht, immer wieder zunichte gemacht, bleibt sie doch unvergessen, bis sie einmal in einer Variante gelingt, wie sich niemand damit zufriedengibt, daß der Sinn der Orakel vergessen sei; kraft des Mythos wandeln Tote unter den Lebenden, drängen die Sünden der Väter in die Herzen der Söhne, läßt das tiefste Verlies dem Wärter keine Ruhe … wie es heißt, gibt es keinen Herrscher ohne Gespensterfurcht, wenn alles Gedächtnis ausgelöscht scheint, denken die Felsen des Tartaros selber weiter. Der Mythos ist der Katalysator des Menschengeistes, so daß dieser über Jahrhunderte hinweg Gespräche führen kann.
Ich vermute, von dort her ist es Franz Fühmann möglich, seine Wörter und Sätze von Begrenzungen rein zu halten. So glaube ich nicht, daß es nötig wäre, etwa die Übersetzungen seiner Geschichten mit Fußnoten für uneingeweihte Leser zu versehen. Aufs natürlichste ordnen sich seine Texte einer Weltsprache zu, deren Idee ein Zweig jenes Mythos vom Gedächtnis ist. Abgesehen davon, daß er sich so grundlegend mit dem Mythos beschäftigt hat, daß uns so Unentbehrliches wie der Essay Das mythische Element in der Literatur vermacht ist, war sein Werk wohl immer schon auf Mythen zurückführbar, der Mythos gewissermaßen konstitutioneller Untergrund all seiner Geschichten. Dem Mythos nämlich ist Nationales fern, wollte man ihn lokalisieren, müßte man sagen, er ist irdisch. – Der Mythos ist unentbehrlich und deshalb von einer Beständigkeit, für die das Attribut noch folgen soll. Der Mythos ist Metapher für eine der würdigsten Eigenschaften des Gedächtnisses selber, wie das Gedächtnis, das keines bliebe, wäre sein Wesen das Vergessen, erhält er sich selbst und sucht seinen Ausdruck über die Zeiten hinweg. Sein Thema ist immer wieder die Schöpfung, und dieses Thema ist gleichzeitig seine Wirkung, der Mythos verkörpert sein eigenes Thema, er ist das Phänomen, das nicht Medium ist, es sei denn, man verstiege sich zu der Behauptung, er sei das Medium einer höheren Macht. – Allein in der Idee, daß erst die Wörter die Dinge erschaffen – eine mythische Idee –, gewinnt der Gedanke daran, daß die Wörter nicht bloßes Medium der Gewalten sind, eine empirische Form. – Das Schreibenmüssen eines Schriftstellers erklärt sich womöglich daraus, daß seine Texte nicht mehr Medium für irgendwelche Weisheiten sind, sondern daß sie ihr Leben begonnen haben, weil ihr Gedächtnis sich zu erhalten im Begriff ist.
Es ist bei Franz Fühmann nachzulesen, daß es die Urform des Mythos nicht gäbe, er selbst habe den Schwefelhauch einer Höllenfahrt geschmeckt, als er einmal auf der Suche nach dem ersten Prometheus-Mythos war. Nun, weil er erkannt hat, daß der Mythos aus dem Offenen, Unbegrenzten kommt, ist seine Sicht auf den begrenzten, falschen Mythos die denkbar klarste. Immer dann, wenn Nationales mythisch verbrämt wird, wie es unter dem Nationalsozialismus der Fall war, wird das Gedächtnis ins Gegenteil verkehrt, ins Vergessen. Nicht zufällig rechnen aufs Vergessen alle Demagogen: wer wird noch an die Toten denken, wenn wir erst gesiegt haben, die Geschichte … manchmal sogar der Fortschritt … geht über die Toten hinweg. – Das ist ein Irrtum, aber er ist nicht auf die beschränkt, die ihn nötig haben. Zum Verzweifeln nähern sich solchem Flächendenken diejenigen Ideologen, für die der Mythos eine Form von dunklem Aberglauben ist, Spiritismus, der der Rationalität ihrer Prägung noch nicht teilhaftig war, der sie stört, weil er sich nicht in die fatale Logik ihres Automatendenkens einordnen läßt, weil er in der Erstarrung den umstürzlerischen Traum bewahrt, weil er die Zusammenbrüche nicht ohne die Idee des Lebens zurückläßt. Eines der Elemente des Mythos, die Franz Fühmann in Erinnerung bringt, ist seine »Gültigkeit weit über die Entstehungszeit hinaus, ja vielleicht bis ans Ende des Menschengeschlechts«. Nach diesem Wort vom Ende muß nun jenes schon angekündigte Attribut kommen. Franz Fühmanns Werk, wäre es gleich noch so vereinzelt, wäre noch lange niemand in Sicht, der ihm folgte, ist angetreten, den Satz zu beweisen, den er selber zitiert: »Der Mythos hat unzerstörbare Kraft.«
Der Ritter Gluck, jener seltsame degenbewehrte Musiker, der so viele Jahre nach seinem Tod auf der Friedrichstraße in Berlin auftauchte, um dem Ich jener Hoffmannschen Geschichte eines seiner Werke in ganz unerhörter Erneuerung vorzuspielen, eine Musik, die so faszinierend nur Gluck selber, nie aber ein Nachahmer des Verblichenen gespielt haben konnte, muß die Variation einer Musik gegeben haben, die schon immer im Menschengedächtnis schlummerte.
Ebenso etwa existiert, ich glaube es, eine Sprache, welche die Sinngeschichte des Menschen zu erneuern vermag, die nur darauf wartet, ein weißes Buch (das ich auch einen Mythos nannte) zu füllen, obwohl alles schon gesagt scheint. Sie sucht ihren Ausdruck, damit die vom Leben erschaffenen Wörter es schließlich auch werden erhalten können, denn diese Sprache dient nicht dem Vergessen des Lebens. Es ist ein Glück, daß ihr Ausdruck im Irdischsten zu Hause sein wird, der Mythos findet sich dort, wo wir ihm jederzeit begegnen können. Sein Ort ist jener, an dem das Erzählen stattfindet, es könnte ein beliebiger sein, er wird jeweils konkret benannt. – Der Ort hätte der meine sein können, wie es der seine ist, das so schwer verfügbare Wir (das so leicht zu proklamieren ist), das im Gedächtnis aufgehoben bleibt, bis es in einem Kunstwerk für viele die Berechtigung findet, braucht einen Ort, um sich zu erkennen. – Deshalb stockte ich, als ich die Worte seines Briefes las, in Wald und Schnee, es hätten noch viele andere sein können, mir ebenso Bekanntes Vorstellende. Und da mir das Bild so bekannt war, verstand ich, daß man vielleicht nicht so weit fort müsse, um das Thema zu finden, jenes, das vielleicht auch für mich auszuführen sein werde, das ich so in der Nähe aufglänzen sah, ganz gleich, ob ich über eine Schwelle stolperte, in den Schatten stürzte, ob ich die Grenze auch nie in aller Form würde übertreten können, das Thema, dachte ich, wird das unsere sein.
Vorblick auf Kafka
»… der Bursche, der auszog, das Fürchten zu lernen. Er ist in Potemkins Palast geraten …«
WALTER BENJAMIN: Franz Kafka.
Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages
Der Sexus ist im präfabrizierten Stoff, der zu einer Biographie werden soll, nicht vorgesehen. – Karl Roßmann, der von ihm überrascht wird – und er selbst hat ihn womöglich empfunden, aber nicht eingeplant, folgerichtig ist die Umarmung, die ihm zum Verhängnis wird, würgend –, wird aus seiner künftigen Biographie ausgestoßen, nach Amerika abgeschoben. Er wird nicht berühmt werden wie Kafka, für Unberühmte gibt es keine Biographien. Der Lauf seiner Biographie wird nicht mehr stattfinden. Am Schluß des Textes Der Heizer – dem ersten Kapitel des Amerika-Fragments, das Kafka, seine Bedeutungsschwere erfühlend, separat veröffentlichte, wenngleich es zu jenen Koffergeschichten gehört, die er möglicherweise nicht besonders schätzte – weicht der zuvor so fürsorgliche, der mächtige Onkel den Blicken Karls schon aus, als es darum geht, den unbekannten Kontinent zu betreten. Die bei Einfahrt in den Hafen von New York sonnenerleuchtete Freiheitsstatue ist in Karls Augen noch erstaunlich, aber schon ahnungsvoll: so hoch; man kann sich des Gefühls nicht erwehren, daß die Freiheit, die hier zu winken scheint, sich dem Neuankömmling untauglich erweisen wird und ihm nur Unheil bringen kann. Sein Schicksal wird das eines Verschollenen werden; aus einem frühzeitigeren Titel des Werkes glauben wir es zu wissen, das heißt, er wird seine Biographie ganz verlieren, sie wird in Unüberschaubarkeit enden. Und um ihn wird das unüberschaubare Leben von Menschen sein, die sich – wie der Heizer, dem Karl auf dem Schiff beizustehen bemüht ist – schon bei dem Versuch, geringste Details nur ihrer jüngsten Vergangenheit zu erläutern, heillos ins Unausdrückbare verstricken. – Etwas an diesem Heizer scheint Karl bezaubert zu haben, und vielleicht ist es das Großspurige und Wegwerfende seiner Worte und Gesten, mit denen er sein Leben bedenkt, das den Charakter einer Biographie hat, die man sich, anscheinend, selbst bestimmt, biographischer Stoff, der nur in den eigenen Gedanken Relevanz findet. Demgegenüber verwirrt den Heizer aufs heftigste, worin er einen Angriff auf das vermutet, was der Zweck eines fremdbestimmten Lebenslaufs wäre: ein tüchtiger und verläßlicher Diener seiner Berufung zu sein.
Diesen Verwirrungen scheint Franz Kafka, nicht vollständig, aber größtenteils, entgangen zu sein. Im äußeren Leben war er das folgsamste und demütigste Opfer seiner Prädetermination, der oft bis zur Verzweiflung in seinen Ämtern aufgehende Angestellte. Erst die Krankheit, das Wissen um ihr tödliches Ende zwingt ihn, sich ganz auf sein Werk zu konzentrieren. Doch da ist sein Schreiben schon ganz mit dem Leben verschmolzen, die Verwerfungen schließen das eine wie das andere ein, Gelingen meint er nur noch im Zurückschauen zu bemerken.
Den Verfassern literarischer Monographien scheint es nur zu selbstverständlich, daß sich das Leben ihrer Auserwählten in der im Rückblick vorgefundenen Form abspielen mußte, die faktischen Realitäten eines von seinem Abschluß her betrachteten Prozesses scheinen ihnen allemal recht zu geben; schon im kindlichen Stammeln finden sie die Rhythmen späterer genialer Werke vorgeprägt. Die Forschung durchfahndet so lange Schulaufsätze und Haushaltsbücher, bis sie den einen bedeutenden Satz entdeckt hat, aus dem sich der Beweis der Veranlagung aus der tristen Vergangenheit ihres Helden filtern läßt: Ein Autor, der erst im Alter zu schreiben begann, bleibt den Mystifikatoren der Literatur verdächtig; Fontane scheint dieses Schicksal nur wegen einer Klassizität nicht zu teilen, die sichtlich andere, deutschere Gründe hat als den Glanz seines Stils. Schwelgerisch ausgemalt dagegen wird in den Monographien die Revolte so vieler großer Schriftsteller gegen ein vorbestimmtes Dasein, dabei dient die Beschreibung dieser Ausbruchsversuche geradezu dem Beweis der Einmaligkeit und als Beleg dafür, wie ihr Leben so und nicht anders hatte verlaufen können … der seltsame Widerspruch solcher Tatsachen zu der Gläubigkeit, mit der Biographen auf die äußeren Lebensumstände starren, wird dabei nicht bemerkt.
Ein altes Versatzstück aus dem Kontext der Methoden, das Leben der Dichter konsumierbar zu machen, ist die Darstellung ihrer Beziehungen zum anderen Geschlecht. Allzudeutlich ragen die Erklärungen, die anhand des Einflusses tragischer Liebesbeziehungen auf Kunstwerke bereitliegen, aus dem 18. und 19. Jahrhundert herüber; von Hölderlin und E.T.A. Hoffmann setzt sich das Thema über Strindberg bis Majakowski und Pavese fort; die weiblichen Gegenbeispiele von George Sand … Else Lasker-Schüler bis zu Ingeborg Bachmann, die Außenseiterexistenzen der Homosexuellen erweisen noch einmal: Normalität gibt es kaum. Und die süffisanten Gerüchte in der Art, wie sie etwa über Goethes Frauenbekanntschaften in Umlauf sind, bringen ihre eigene Note ins Spiel. Der weit überwiegende Teil der Sprache, die diesen Aspekt der biographischen Wirklichkeit behandelt, ist zu sehr dem Normenkodex der Psychoanalyse verpflichtet, als daß im Leser nicht der Eindruck entstünde, er hätte es mit Krankheitsbildern zu tun oder mit Begriffen von Gesundheit in hypertrophierter Form, während die Gesellschaft – bei allen Lästerungen gegen dieselbe, die den Äußerungen biographizierter Helden nichts als konform gehen – das ganz Normale und jedermann Zuträgliche bleibt.
Glück, Erwartung und Erfüllung, erhält somit einen exotischen Touch, die Macht bleibt unangetastet; der Widerspruch zwischen Realität und Traum – ein alter Widerspruch der Poesie – erscheint angenommen und konsolidiert. Dabei wird, vom Beginn der Moderne an, also im Jahrhundert der Bewußtseinsindustrie, die verhängnisvolle Verkehrung der beiden einst dichterisch relevanten Begriffe in ihren Gegensatz widerstandslos akzeptiert; weltweit, unter allen ideologischen Vorzeichen wird der böse Traum, der die Wirklichkeit ist, mit Wahrheit verwechselt. Dabei ist der »Traum« zu einem bloß verbalen Unbegriff geworden, den die Priester der Macht ihren Mitläufern wie Gnadenerlässe verheißen. Der »Traum« – im Mißverständnis von Werbeagenturen und Reisebüros ebenso wie in den Genehmigungen für das, was von einer »glücklichen Zukunft« schon eingetroffen sein soll – wird zum fakultativ erweisbaren Schönheitserlebnis, das Heilslehrer in Form von Zensuren verteilen. – Es ist vergessen, daß die Psychoanalyse angetreten war, die Wahrheit in der Realität der Träume aufzufinden. Die derzeitige Psychologie hat sich aufgegeben, sie kann lediglich mit Vorschlägen aufwarten, geringste Details von vorgefundener Wirklichkeit zu modifizieren; es ist vergessen, daß Bewußtseinsindustrie herrscht, daß Bewußtseinsindustrie ohne Generationenwechsel nicht funktionierte; es ist vergessen, daß Leben und Bewußtsein eines Einzelnen zuerst vom Elternhaus, der kleinen Familie (der »Keimzelle des Staats«), und dann von der großen, heiligen »Familie« der Gesellschaft kanalisiert wird, der Tatbestand ist vergessener und verdrängter denn je … seit das Bewußtsein davon übermächtig geworden ist. – Einem Leben in solcher Bahn soll der Sexus später – wenn es seine Ordnung hat … zu spät – aufgepfropft werden als eine Art von, zusätzlichem, Verdienst eines erfüllten Lebens. Das Vokabular derartiger Nachrufe verrät schon in der Diktion die Absicht: der Sexus wird nicht als körpereigenes Element anerkannt, ein beträchtlicher Teil des Ich soll der Eigenverantwortung entzogen werden. Wie alles im Menschen apriorisch vorhandene, revolutionäre Potential wird ihm der Sexus geraubt, um ihm dann, wenn seine inkommensurablen und existentiellen Inhalte eingeebnet, zurechtgestutzt sind, in einer nutzbaren Form (nutzbar für wen?) wieder zugefügt zu werden.
Der Sexus in dieser Form blieb für Kafka letzten Endes unannehmbar. Am 5. Juli 1916 notiert er im Tagebuch: »Mühsal des Zusammenlebens. Erzwungen von Fremdheit, Mitleid, Wollust, Feigheit, Eitelkeit und nur im tiefen Grunde vielleicht ein dünnes Büchlein, würdig, Liebe genannt zu werden, unzugänglich dem Suchen, aufblitzend einmal im Augenblick eines Augenblicks.«
Franz Kafka ist der erste Dichter, der reagiert hat – und mit womöglich bis dato nicht wiederholter Schärfe – auf eine Welt, in der industriell gefertigtes Bewußtsein regiert, und es ist belanglos, ob er es sich selber erklärt hat oder nicht. Es ist, als ob in seine Ahnungen davon schon diejenige eingeschlossen war, daß die Erklärung einer Sache nur der Sache selbst dienen könne. Bei ihm sind Wirklichkeit und Wahrheit endgültig geschieden, die Trennung scheint irreparabel, und daß Wahrheit in der Wirklichkeit kaum noch aufzufinden ist, drängt sich als konsequente Folge auf. Er wußte vielleicht, daß es ihm nur möglich sein würde, zur Wahrheit vorzustoßen, wenn es ihm gelang, die Wirklichkeit geistig zu verwandeln. Es wäre falsch zu fragen, welchen Maßstab er dabei anlegte. Wahrheit war für ihn, so sehr ihre Bedrohung zu Kompromissen zu verführen schien, nichts Abzustufendes, daß der größte Teil seines Werkes fragmentarisch geblieben ist, bestätigt diese Annahme.
Kafka, der es (wenn wir ungefähr den Zeitraum nehmen, den seine Tagebücher umfassen) mit einer gerade in den Jahren 1910 bis 1924 für Schriftsteller nicht so häufigen Sicherheit erkannte, wohin Revolutionen führen: »… es bleibt nur der Schlamm einer neuen Bürokratie«, hat es auch für sich selber abgelehnt, die alte Wirklichkeit unter Verzicht auf die Wahrheit in eine neue Wirklichkeit zu verwandeln, er wußte, es würden sich lediglich die Attribute ändern … Er, der Einzelne, den irgendwelche Massen niemals angenommen hätten (zu fragen, wie oder warum er »Zugang zu den Massen« hätte finden sollen, hieße, das Pferd am Schwanz aufzuzäumen), war konsequent genug, sich der unveränderlich gesehenen Wirklichkeit selber unterzuordnen, Ausbruchsversuche wies er auch von sich, wenn sie seinem Schreiben hätten dienen können. Das religiöse Gedankengeflecht, mit dem er, der gläubige, auf komplizierte Weise aber auch ungläubige Jude – was vielleicht … wir verstehen nichts davon … eine jüdische Art ist, ein gläubiger Jude zu sein – sich umgab, diente womöglich dazu, den Wahrheitsverzicht zu rechtfertigen, dessen er sich verdächtigte, wenn er die Wirklichkeit annahm, die ihn an der Ausführung seiner Werke hinderte. Daß er die Wirklichkeit nicht liebte, findet sich in allen Äußerungen, die sein Tun und Lassen als Verstrickter in seine Ämter betreffen. Allerdings hing er an seinen diesbezüglichen Aufgaben (technische Verbesserungsvorschläge für die Industrie, die er bearbeitete, sind in der mitfühlendsten Sprache abgefaßt, die sich für solche Fälle denken läßt), und die Welt der Kanzleien muß er für so wirklichkeitsnah – was in diesem Falle heißt: so dem Leben entfremdet – gehalten haben, daß die Wahrheit, nach der er trachtete, ohne Kenntnis jener, ohne Reflexion auf jene Fesseln der gequälten Menschheit … aus Kanzleipapier, ihm vermutlich das Abstraktum geblieben wäre, das es für uns ist, die wir, ohne Kafka, bis hierher gekommen sind.
»2. Juli. Geschluchzt über dem Prozeßbericht einer dreiundzwanzigjährigen Marie Abraham, die ihr fast dreiviertel Jahre altes Kind Barbara wegen Not und Hunger erwürgte, mit einer Männerkrawatte, die ihr als Strumpfband diente und die sie abband. Ganz schematische Geschichte.«
Diese Eintragung stammt aus dem Tagebuch des Jahres 1913. Die letzte lapidare Bemerkung wirkt, wenn man die Aufzeichnungen weiterliest, wie ein Signal dafür, daß die Ohnmacht wächst, daß die Wirklichkeit dieser Jahre über ihm zusammenzuschlagen droht. Am gleichen Tag noch und unter dem Datum des nächsten Tags erörtert er seine Heirat: »3. Juli. Die Erweiterung und Erhöhung der Existenz durch eine Heirat. Predigtspruch. Aber ich ahne es fast.« – Bald beginnen schier endlose Reihen von Prosaentwürfen, die alle wieder abbrechen. Er zeichnet seine Träume auf, notiert Ideen, die allernächste Nähe zu Suizidgedanken haben. »Das Grauenhafte des bloß Schematischen«, wirft er im Mai 1914 zwischen die Prosaskizzen des Tagebuchs. Dennoch verlobt er sich, allen widerstreitenden Stimmen seines Innern zum Trotz, noch im gleichen Monat mit Felice Bauer. Sein Kommentar dazu am 6. Juni ist eindeutig: »Aus Berlin zurück. War gebunden wie ein Verbrecher …« – In diesem Jahr schreibt er den Prozeß, In der Strafkolonie, beginnt die Arbeit am Schloß, er reist soviel wie selten in seinem Leben; der Weltkrieg bricht aus, die bloß schematische Wirklichkeit scheint ihn ganz einzuschnüren; noch im gleichen Jahr entlobt er sich.