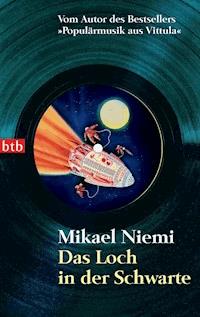9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein Dorf in Nordschweden 1852. Jussi entflieht seinem Elternhaus, wo Gewalt, Hunger und Alkohol regieren, und wird von dem protestantische Geistlichen Laestadius unter seine Fittiche genommen. Der vielseitig gebildete Erweckungsprediger lehrt den völlig vernachlässigten samischen Jungen nicht nur lesen und schreiben, er teilt mit ihm auch seine Begeisterung für die heimische Flora und Fauna. Als ein Mädchen tot im Wald gefunden wird - allem Anschein nach das Opfer eines Bären – geraten die Dorfbewohner in Aufruhr. Angestachelt von der Belohnung, die der Gendarm ausgelobt hat, locken sie das Tier in eine Falle und töten es. Nur Laestadius und Jussi glauben nicht, dass der Bär der Schuldige ist, denn die vermeintlichen Bärenspuren waren gefälscht. Als ein weiteres Mädchen verschwindet, ahnen die beiden nicht, in welcher Gefahr sie selbst schweben: Jemand sucht einen Sündenbock, und Laestadius hat sich mit seiner aufklärerischen Arbeit viele Feinde gemacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Ähnliche
Mikael Niemi
Wie man einen Bären kocht
Roman
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Koka björn« bei Piratförlaget, Stockholm
Die Übersetzung wurde von The Swedish Arts Council gefördert. Der Verlag bedankt sich dafür.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Mikael Niemi Published by arrangement with Hedlund, Agency Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by btb Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: © Look and Learn / Bridgeman Images Redaktion: Frauke Brodd / write and read Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-641-22971-9V001www.btb-verlag.de
Kengis 1852
I
Sitze im Walde
schreib einen Vers
mein Mädel, das holde
singt aus vollem Herz
Hinein in dein Herzen
will ich mich stehlen
der Lieb’ große Schmerzen
sollst du erleben
1.
ICH ERWACHE IN einer alles umfassenden Stille. Die Welt wartet darauf, erschaffen zu werden. Dunkelheit und Himmel hüllen mich ein. Ich liege auf dem Boden, die Augen wie Brunnen ins Weltall gerichtet, doch es gibt nichts dort, nicht einmal Luft. In dieser großen Stille beginnt mein Brustkorb zu zittern und zu beben. Die Stöße werden kräftiger, etwas, das da drinnen wächst, will sich herauszwängen. Meine Rippen werden wie die Streben eines Vogelkäfigs auseinandergedrückt. Es gibt nichts, was ich tun könnte. Ich muss dieser schrecklichen Macht nachgeben, wie ein Kind, das unter einem in Zorn geratenen Vater auf dem Boden kriecht. Nie weiß man, wann der nächste Schlag kommt. Und ich bin das Kind. Und ich bin der Vater.
Bevor die Welt ganz erschaffen ist, eile ich hinaus in die Morgendämmerung. Auf dem Rücken trage ich meinen Birkenrindenranzen, in der Faust meine von Hand geschmiedete Axt. Ich bleibe ein Stück entfernt von dem niedrigen Viehstall stehen, suche Schutz am Waldrand. Tue so, als wäre ich mit meiner Kleidung beschäftigt, falls jemand mich sehen und sich wundern sollte, was ich da treibe, binde wieder und wieder meine Schnürsenkel, suche die Mütze nach unsichtbaren Läusen ab. Tue so, als schüttelte ich sie auf die Erde. Die ganze Zeit schaue ich verstohlen zum Hofplatz hinüber. Der erste morgendliche Rauch steigt aus dem Schornstein des Rauchstubenhauses und verkündet, dass das Gesinde aufgestanden ist.
Und dann tritt sie heraus. In ihren Händen schaukeln leere Eimer. Das Kopftuch leuchtet weiß wie ein winterliches Schneehuhn in der Morgendämmerung, das Gesicht ist ein heller Kreis mit klaren Augen und dunklen Augenbrauen. Ich kann die zarte Haut ihrer Wangen und die schmalen rosa Lippen erahnen, die einen leisen Gesang und sanfte Worte einrahmen. Das Vieh horcht auf und muht mit prall gefüllten Eutern vor Erwartung, als sie die schwere Stalltür öffnet und hineinhuscht. Das Ganze geschieht so schnell, viel zu schnell. Ich versuche meine Sinne zu schärfen, um dieses Bild zu bewahren, damit ich es mir immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen kann. Aber das ist nicht genug, ich muss sie auch morgen wiedersehen. Ihre wippenden Hüften unter der Schürze, die sanften Rundungen ihrer Brüste, die Hand, die nach dem Riegel der Stalltür greift. Ich schleiche mich näher heran, fast laufe ich über den Hofplatz, als wäre ich ein Dieb, und erst an der Tür angekommen werde ich langsamer. Dann umschließe ich mit meiner Hand den Riegel. Meine rissige, sehnige Hand dort, wo ihre kleine weiche Hand gerade gelegen hat. Ihre Finger, die da drinnen die großen Zitzen umklammern, die weiße Strahlen in den Milcheimer peitschen lassen. Einen kurzen Moment lang ziehe ich an dem Riegel, als wollte ich eintreten, doch gleich danach drehe ich mich um und eile davon, voller Angst, es könnte mich jemand gesehen haben. Doch in meiner Hand bewahre ich sie noch den ganzen Tag. Die Wärme ihrer Haut.
2.
WENN ES ZEIT fürs Essen ist, warte ich immer ganz bis zum Schluss. Wenn die Frau des Propstes den schweren Kessel mit Grütze auf den Tisch stellt, verstecke ich mich in einer Ecke, denn er dampft und ist außen schwarz wie der Tod, als wäre er geradewegs aus den Feuern des Teufels geholt. Doch in seinem Inneren ist die Grütze hell, fast golden, etwas körnig und klebrig, wenn sie am Holzlöffel haftet. Brita Kajsa rührt mit dem breiten Holzkochlöffel um, sie drückt ihn bis zum Kesselboden hinein und zieht ihn dann wieder nach oben, zerreißt die dünne Haut, die sich an der Oberfläche gebildet hat, und lässt so die Düfte von Heu und Blütenstaub bis in jede Ecke des Rauchstubenhauses dringen. Die Kinder und das Gesinde sitzen erwartungsvoll da, ich sehe ihre blassen Gesichter, eine schweigende Mauer aus Hunger. Mit ernster Miene ergreift die Hausfrau die Schalen und füllt große Löffel für die Ältesten auf und kleinere Portionen für die Jüngeren, sie gibt den Dienstleuten und den Besuchern, die vorbeischauen, jeder bekommt seinen Teil. Anschließend senken sich die Köpfe, und die Finger werden auf der Tischoberfläche gefaltet. Der Propst wartet, bis alle verstummt sind, dann senkt auch er den Kopf und dankt voller Inbrunst für unser täglich Brot. Anschließend essen sie schweigend. Man hört nur das Mahlen der Zähne und wie die Holzlöffel abgeleckt werden. Die Ältesten möchten mehr haben, und das bekommen sie auch. Brot wird gebrochen, kalter, gekochter Hecht wird mit flinken Fingern gegessen, Fischgräten liegen auf dem Tisch in Reih und Glied wie glänzende Nadeln. Als alle fertig sind, wirft die Hausfrau einen Blick in die Ecke, in der ich sitze.
»Komm du auch her und iss etwas.«
»Nein, noch nicht.«
»Komm schon her und setz dich. Kinder, macht mal Platz für Jussi.«
»Ich kann warten.«
Ich sehe, wie sich auch der Meister umdreht. Sein Blick ist glasig, ich kann die darin liegende Qual sehen und wie er darum kämpft, sie zu verbergen. Mit einem kurzen Nicken bringt er mich dazu, zum Tisch zu schlurfen. Ich halte meine Holzschale hin, die ich selbst in Karesuando geschnitzt habe und die mich schon mein Leben lang begleitet, zuerst war sie weiß wie die Haut eines Säuglings, aber mit der Zeit ist sie von Sonne, Salz und dem tausendfachen Abspülen im Wasser dunkler geworden. Ich spüre ihr Gewicht, als die Hausmutter den Holzlöffel leert, und sehe, wie sie die letzten Reste an den Rändern zusammenkratzt, doch da bin ich bereits zurück in meiner Ecke, sitze mit unterschlagenen Beinen auf der Erde. Schnell schaufle ich die zähe, nach Getreide schmeckende Grütze in mich hinein, die inzwischen abgekühlt und jetzt genauso warm ist wie mein Mund. Ich spüre, wie der Brei durch meine Kehle nach unten rutscht und von den Magenmuskeln umschlungen wird. Dort wird er zu Kraft und Wärme, die mir helfen zu leben. Wie ein Hund schlinge ich das Essen in mich hinein, gierig und immer auf der Hut.
»Komm, hol dir noch mehr«, fordert die Hausfrau mich auf.
Aber sie weiß bereits, dass ich nicht kommen werde. Ich esse nur einmal. Und ich nehme das, was man mir zuteilt, niemals mehr.
Die Schale ist leer. Ich streiche mit dem Daumen wie mit einem Kissen über die Rundungen und lecke ihn dann ab, streiche und lecke, bis alles ganz sauber ist. Sanft rutscht sie in meine Tasche. Die Schale gibt mir zu essen, sie zieht das Essbare an, man muss es nur finden. Wie oft war ich vollkommen ausgehungert und kurz davor umzufallen. Aber sobald ich meinen Arm mit der Schale ausgestreckt habe, wurde sie mit einem Fischkopf gefüllt. Oder Rentierblut. Oder mit gefrorenen Beeren von einem Gebirgshang. Einfach so. Und ich kaute, und die Kräfte kehrten zurück. Man muss dafür sorgen, dass man den Tag überlebt. Nur das hoffe ich, und so bin ich immer weitergekommen. Deshalb habe ich mich auf den Boden gesetzt. Niemals würde ich mich hervortun und etwas fordern, wie ein Rabe etwas stibitzen oder fauchen wie ein Luchs. Aber auch nicht weichen. Wenn niemand mich sieht, bleibe ich im Schatten stehen. Doch die Hausfrau, sie sieht mich. Ich fordere nichts, und trotzdem gibt sie mir etwas. Ihre wortkarge Freundlichkeit, die gleiche Fürsorge für alle lebenden Wesen, Kühe wie Hunde. Alles, was lebt, soll auch leben. Ungefähr so.
Ich verschwinde, wann immer ich will. So ist das mit dem wandernden Volk. Jetzt bin ich hier, und im nächsten Moment bin ich dort. Ich stelle mich auf meine Beine, schnappe mir den Ranzen und gehe. Ganz einfach. Ist man arm, kann man so leben. Alles, was ich besitze, trage ich bei mir. Die Kleidung am Leib, das Messer im Gürtel. Das Feuereisen und die Schale, der Löffel aus Horn, das Säckchen mit Salz. Alles zusammen wiegt fast nichts. Ich gehe leichten Fußes schnell dahin, noch bevor mich jemand vermisst, bin ich schon im nächsten Flusstal. Ich hinterlasse keine Spur. Nicht mehr als ein Tier. Meine Füße drücken das Gras und Moos nieder, das sich gleich wieder erhebt. Wenn ich Feuer mache, benutze ich alte Feuerstellen, meine Asche fällt auf die Asche anderer und wird dadurch unsichtbar. Meine Notdurft verrichte ich im Wald, ich drehe eine Grassode um und lege sie anschließend wieder an ihren Platz. Der nächste Wanderer kann seinen Fuß darauf treten, ohne etwas zu merken, höchstens der Fuchs erschnuppert einen schwachen Menschengeruch. Im Winter ziehe ich meine Skispuren über den weichen Himmel der Schneedecke, ich fliege ein paar Ellen über dem Erdboden, und wenn der Frühling kommt, schmelzen alle meine Skistockabdrücke dahin. So kann der Mensch leben, ohne zu verwüsten und zu zerstören. Ohne eigentlich dort zu sein. Er kann einfach wie der Wald sein, wie die Laubmengen des Sommers und die Streu des Herbstes, wie der Mittwinterschnee und die unzähligen Knospen, die von der Sonne hervorgelockt werden. Wenn man schließlich verschwindet, ist es, als wäre man niemals hier gewesen.
3.
MEIN MEISTER QUÄLT sich. Ich sehe, wie sich seine Lippen verkrampfen, eingesogen werden und das Wort betasten, das nicht geboren werden will. Seine Feinde kommen immer näher, nicht ein Tag vergeht ohne neue Schläge und Verhöhnungen. Und er hat zu seiner Verteidigung nur die Feder. Ihren Schwertern und Knüppeln tritt er mit seiner Schreibfeder entgegen, doch die Worte wollen sich nicht einstellen. Jedes Mal möchte ich mich nur zu gern selbst schlagen, fest kneifen, um ihn zu erlösen. Alles tun, wenn so das Licht in ihn hineinschiene. Er könnte mein Vater sein. So denke ich auch über ihn, aber als ich das einmal andeutete, wurde er wütend. Ich sah, dass die Wangen meines Meisters rot wurden und er sich abwandte. Jetzt lasse ich mich wie ein Hund auf die Fußmatte niedersinken. Ich warte geduldig. Stunde um Stunde harre ich dort mit der Schnauze auf den Pfoten aus, jeden Moment bereit, ihm zu folgen.
Seine Stirn ist von den Narben seiner Gedanken gezeichnet. Sie ist schmutzig, vielleicht vom Tabaksaft, vielleicht vom Ruß des Lampendochtes. Sein Haar ist lang und hängt in fettigen Strähnen herab, ab und zu streicht er es zurück, wie Zweige in einem Wald. Einsam bahnt er sich seinen Weg durch Wälder und verwachsenes Gestrüpp, durch das vor ihm keine Menschenseele gewandert ist. Aber vollkommen allein ist er doch nicht. Ich folge ihm schweigend, trotte ihm hinterher, die Schnauze in seiner Spur, folge dem geteerten Leder seiner Schnabelschuhe, dem Rascheln des Strohs in den Schuhen, der feuchten Wolle der Hosenbeine. Er kämpft sich weiter vor ins Unbekannte, aber ich bin die ganze Zeit in seiner Nähe. Mein Bauch ist leer, aber ich beklage mich nicht. Wie ein Schatten folge ich ihm, klebe an seinen Hacken.
Bei einer unserer Wanderungen ließen wir uns an einer kalten Quelle nieder. Während wir unseren Durst stillten, beobachtete er mich nachdenklich von der Seite.
»Wie wird man ein guter Mensch?«, fragte er mich schließlich.
Ich vermochte nicht zu antworten.
»Wie wird man gut, Jussi?«, beharrte er. »Was macht einen zu einem guten Menschen?«
»Ich weiß es nicht«, stammelte ich.
Der Meister starrte mich weiterhin an, er strahlte ein helles Licht aus, eine Glut.
»Aber schau doch nur uns beide an, Jussi. Sieh mich und dich an. Was würdest du sagen, wer von uns ist gut?«
»Ihr, mein Meister.«
»Sage nicht Meister zu mir, wenn wir im Wald sind.«
»Ich meine … der Propst.«
»Und warum?«
»Weil der Propst der Pfarrer ist. Ihr gebt uns Gottes Wort, Ihr könnt den Sündern ihre Sünden im Namen des Herrn vergeben.«
»Das ist mein Amt. Aber kann schon ein Amt allein den Menschen gut machen? Dann gibt es also keine bösen Priester?«
»Nein, nein, das könnte ich mir niemals vorstellen.«
»Priester, die saufen, die huren. Die ihre Ehefrau halb tot schlagen. Ich sage dir, ich bin schon auf solche gestoßen.«
Ich erwiderte nichts. Starrte unverwandt auf den Feuerlöcherpilz, den wir als Schutz gegen die Mückenschwärme auf die Glut gelegt hatten.
»Schau dich selbst an, Jussi. Du schlemmst nicht. Du trinkst nicht.«
»Aber doch nur, weil ich arm bin.«
»Du prahlst nicht. Wenn etwas angeboten wird, bist du der Letzte, der vortritt, wenn jemand dich lobt, entziehst du dich dem.«
»Das tue ich nicht, Herr Propst, ich will doch nur …«
»Oft merke ich nicht einmal, dass du bei mir bist. Ich muss mich umdrehen und nach dir schauen, um sicher zu sein. Du bist so leise, dass du verschwindest, wie kann man da böse sein?«
»Aber der Herr Propst tut viele, viele gute Dinge.«
»Kommt das von Gott, Jussi? Denke darüber nach, denke darüber nach. Vielleicht flüstert mir nur der Ehrgeizteufel etwas ins Ohr? Und lockt mit den weltlichen Ehrungen und Lobpreisungen. Ich hoffe, dass die Menschen mich nach dem Tod als einen der Großen in Erinnerung behalten. Während du, Jussi, wie ein Schatten weggewischt sein wirst, den es niemals gegeben hat.«
»Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.«
»Ist das wirklich so?«
»Mmh.«
»Und das ist es, was dich gut macht. Du bist der Freundlichste, Liebenswerteste, den ich kenne.«
»Nein, Herr Propst …«
»Doch, das bist du, Jussi. Aber warte. Hör jetzt genau zu. Wirst du dadurch ein guter Mensch?«
»Ich denke nicht.«
»Nein, denn vielleicht folgst du nur deiner Natur. Du und ich, wir sind von Grund auf äußerst verschieden. Und genau deshalb vergleiche ich uns beide so oft. Wer von uns folgt dem richtigen Weg, wie sollte man eigentlich leben? Ich richte viel Gutes aus, das stimmt. Aber ich richte auch Schaden an, ich schaffe mir Feinde, ich verletze meine Gegner und trample auf ihnen herum. Während du die andere Wange hinhältst.«
Er sah, dass ich protestieren wollte, und hob die Hand.
»Warte, Jussi. Macht dich das gut? Ist es das, was unser Schöpfer gemeint hat?«
Lange Zeit betrachtete ich eine Bremse, die mit glänzenden, grün schimmernden Fliegenaugen auf seinem Hosenbein entlangwanderte. Vergeblich versuchte sie, durch den Stoff zu dringen.
»Ich habe dich das Lesen gelehrt, Jussi. Du verbesserst dich. Ich sehe, dass du denkst, aber was fängst du mit deinen Gedanken an? Wenn sich jemand dir entgegenstellt, weichst du zurück, du nimmst deinen Ranzen und machst dich auf die Wanderung. Du fliehst Richtung Norden in die Berge. Sollen wir so der Torheit der Welt begegnen? Denke darüber nach, Jussi. Tust du recht daran, niemals zu widerstehen?«
»Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch.«
Dem Propst gelang es nicht, ein Lächeln zu verbergen, als ich seinen Lieblingspsalm zitierte.
»Du bist ein Betrachter, Jussi. Das habe ich bemerkt, du studierst die Welt um dich herum, nicht wahr?«
»Ja, schon, aber …«
»Du willst verstehen, wie die Welt und die Menschen beschaffen sind. Aber wucherst du mit deinen Pfunden? Das ist meine Frage an dich, Jussi. Was tust du, um das Böse in der Welt zu bekämpfen?«
Ich hatte keine Antwort. Meine Kehle schnürte sich zu, ich fühlte mich ungerechterweise beschuldigt, hatte große Lust, einfach wegzulaufen und ihn zurückzulassen. Mit meinen schnellen Füßen wäre ich schon bald außerhalb seiner Reichweite. Er sah meine Qual. Beugte sich näher zu mir und legte mir die Hand auf den Arm. Auf diese Art wurde ich zurückgehalten. Er knüpfte ein Band um meine Flügel, als wäre ich ein aufgebracht flatternder Spatz.
Der Propst lehrte mich zu sehen. Dass die Welt um einen herum allein durch den eigenen Blick verändert werden kann. Meine ganze Kindheit und Jugend hindurch war ich durch Gebirgstäler und Birkenwälder gewandert, hatte Kiefernheiden durchquert und war über schwankende Moorflächen gestapft. Diese Landschaft gehörte mir, ich kannte sie in- und auswendig, dieses karge Land im Norden mit seinen felsigen Flussufern und den sich dahinschlängelnden Tierwanderpfaden.
Und dennoch hatte ich kaum etwas gesehen.
Ich erinnere mich, wie der Propst mich auf eine seiner Exkursionen mitnahm. Ich hatte den Ranzen voll mit Verpflegung und Zeichenmaterial und Rollen dicken grauen Papiers, und wir legten eine ansehnliche Strecke zurück. Gegen Abend schlugen wir unser Lager auf einem lehto auf, umgeben von einer weichen, mosaikartigen Sumpflandschaft. Wir waren beide müde, ich machte Feuer und bereitete unser Nachtlager vor. Er brach die Brotstücke und schnitt getrocknetes Fleisch in schmale Streifen, während wir auf den trockenen Tannenzweigen sitzend wieder zu Kräften kamen. Die Mücken surrten und stachen uns. Der Propst bot mir Pechöl an, aber ich zog stattdessen eine Handvoll tannennadelähnliche Blätter vom Stängel, zerdrückte sie und rieb mir damit die Handflächen ein. Es duftete intensiv nach Kräutern, und die Insekten wichen augenblicklich zurück.
»Sumpfporst«, sagte er.
»Was?«
»Die Pflanze, mit der du dich eingerieben hast. Ledum palustre.«
»Ledum …?«, murmelte ich.
Er kam auf die Füße, der Blick voller Tatendrang.
»Folge mir!«
Wir ließen unsere Ranzen am Lagerplatz liegen. Die Kiefernheide hörte auf, bald ging der trockene Sandboden in ein feuchtes, schwankendes Sumpfgebiet über. Ich spürte, wie er immer eifriger wurde, seine Schritte wurden schneller, der Nacken war gebeugt, während der Blick in alle Richtungen huschte.
»Diesen Kräutergarten wollte ich schon lange besuchen«, sagte er. »Und endlich stehe ich hier inmitten all dieses Reichtums.«
Ich schaute mich um. Ein Moor. Endlose und feuchte Weite.
»Was siehst du, Jussi?«
»Nichts.«
Er wandte sich lächelnd halb zu mir um.
»Nichts? Und was ist mit all dem hier?«
»Gras.«
»Nein, Jussi. Das ist kein Gras. Das ist Segge.«
»Ach so. Segge. Ja, dann sehe ich Segge.«
Er holte tief Luft und wandte sich wieder dem Sumpfgebiet zu. Ich begriff, dass wir tiefer eindringen sollten. Es war Anfang Juli, und das Wasser stand immer noch hoch. Die Kleidung, die wir trugen, bedeckte unsere Leiber, und die Halstücher wickelten wir uns um den Nacken, zum Schutz gegen die Wolken fleischfressender Insekten, die in jedem Tümpel ausgebrütet wurden.
»Bereits von hier aus sehe ich mehr als zehn verschiedene Arten, Jussi. Und dabei rede ich nur von der Segge. Und die Weide, diese rätselhafte Gattung, erkennst du, wie viele unterschiedliche Arten es gibt? Siehst du sie?«
»Nein.«
»Und schau da hinten! Das werden wir uns morgen näher anschauen, siehst du das Leuchten?«
»Meint der Propst die Blumen dort?«
»Orchideen, Jussi. Orchideen hier in unserem kargen Nordland. Sieh nur, direkt vor dir!«
Ich schaute nach unten. Ein kleiner Stängel ragte neben meinem Fuß hoch, ich wäre fast auf ihn getreten.
»Guck genau hin, Jussi, beuge dich hinunter. Ein Orchis, ein Knabenkraut. Die Blüte ist unregelmäßig, die Blütenblätter sind sechszählig mit einer Lippe.«
Der Stängel war voll mit diesen dunklen, rosafarbenen Blüten. Der Propst hielt vorsichtig den Stiel hoch, ich musste auf dem feuchten Boden auf die Knie gehen, um mir die Pflanze ordentlich anschauen zu können.
»Näher, Jussi, näher. Und dann riech daran.«
Ich führte meine Nasenlöcher dicht an die Pflanze und atmete ein. Eine schwache, kaum bemerkbare Süße glühte auf und verschwand gleich wieder.
»Hast du es gespürt? Hast du etwas gerochen?«
»Ja …«
»Ich denke, so duftet Gott.«
Wo ich zuvor nur Gras und Moos gesehen hatte, begegnete mir nun ein tausendfacher Reichtum. Wohin ich auch meinen Blick wandte, überall warteten neue Entdeckungen auf mich. Und alles konnte mit einem Namen bezeichnet und einsortiert werden auf einer eigenen Seite in Gottes gewaltigem Lexikon. Es war ein Wunder zu beobachten, wie sehr sich jede einzelne kleine Pflanze von einer anderen unterschied. Unter einer Glaslupe zu entdecken, dass der Stiel mit winzigen silbrigen Härchen bedeckt war, wie ein Blattrand gesägt oder gewellt oder gezackt war, und dass der Charakter einer Pflanze nicht zufällig so war, sondern sie jeweils mit ihrer ganz eigenen Art zur Schöpfung gehörte.
Der Propst erklärte, wie alle Pflanzen in Geschlechter und Familien eingeteilt waren. Dass die Einkeimblättrigen Blattnerven hatten, die parallel verliefen, wie bei Gräsern oder Lilien. Während die Zweikeimblättrigen über einen Mittelstrang verfügten, von dem aus die Seitennerven abzweigten, wie beim Birkenlaub. Warum einige Gewächse mit ihren bunten Blütengebilden so prunkvoll waren wie z. B. die Krone der Seerose oder die Fackel des Weidenröschens. Sie waren es, die von den Insekten befruchtet wurden. Während andere Blumen kaum zu sehen waren, wie die grauen oder grünlichen Formen der Erle oder des Grases, die Wolken von Samenstaub mithilfe des Windes verbreiten. Die Blüten mit vier Blütenblättern wurden Cruciferae genannt, die Doldenblütler hießen Umbelliferae, es gab Korbähnliche, und da waren auch noch die Hülsenfrüchtler mit ihrem schmetterlingsähnlichen Aufbau. Der Propst konnte voller Andacht bei Anblick eines üppig blühenden Moores stehen bleiben und seufzend darüber klagen, dass das Leben allzu kurz sei, allzu flüchtig, um all das hier zu erfassen. Dann ließ er sich auf die Knie fallen und zog seine Lupe heraus, um den kaum fingergroßen Stängel zu betrachten, den er da unten entdeckt hatte.
Der Meister hat mich das Geheimnis des Gedächtnisses gelehrt. Wissen findet am besten durch die Augen seinen Halt. Ist man auf eine Pflanze gestoßen, die man nie zuvor gesehen hat, sollte man zuerst um sie herumgehen und sie von allen Seiten betrachten. Anschließend sollte man sich hinunterbeugen und jeden noch so winzigen Teil von Blättern, Blattbefestigung, Form des Schaftes, Kelchblatt, Farbe des Samenstaubs, genau mustern, wirklich alles sollte geprüft werden. Auf diese Art und Weise wird im Inneren des Betrachters ein bestimmtes Bild bewahrt. Und wenn man der Pflanze das nächste Mal wiederbegegnet, sei es auch zehn Jahre später, dann wird die Freude des Wiedererkennens geweckt. Beschwerlicher war es mit den Namen, mit all diesem Latein, darüber habe ich oft gejammert. Wenn ich hörte, die weißschaumige Traubenkirsche heiße Filipendula ulmaria, wiederholte ich ihren Namen für mich zwanzig Mal, ja hundert Mal, und trotzdem konnte er nur wenige Stunden später wieder vollkommen verschwunden sein.
Nach vielen Wanderungen mit dem Herrn Propst veränderte sich meine Sehweise. Die Pflanzen und Bäume verwandelten sich in Freunde, in Individuen, die ich als lebendige Wesen kennenlernte. »Sieh mal an, hier stehst du also und genießt die Sonne. Und da sind ja auch dein Bruder und deine Schwester.« Ich spürte die Freude des Wiedersehens, als der Sommer kam, ich freute mich darauf, jedes einzelne Kraut wiederzuentdecken, und lernte, wann es in Blüte trat. Und dadurch, dass mir die Pflanzen so vertraut wurden, schärfte sich mein Blick für alles, was von dem Üblichen abwich. Mitten in einem feuchten Nadelwald konnte ich auf etwas Neues, Unbekanntes stoßen. Früher wäre ich einfach darauf getreten, ohne überhaupt hinzusehen. Aber jetzt blieb ich stehen und zeigte auf meinen Fund. Der Propst nickte zufrieden.
»Corallorhiza trifida«, sagte er. »Korallenwurz. Nicht sehr verbreitet hier im Norden. Gut gemacht, Jussi.«
Seine Aufmunterung ließ mich erröten, und ich beugte mich schnell hinab. Berührte und erkannte die typische Orchideenform mit ihren sechs Blütenblättern und der besonderen Form der Lippe wieder und begann vor mich hin zu sagen: Corallorhiza trifida, Corallorhiza trifida …
Bald sollte auch sie meine Freundin werden.
4.
EINES ABENDS STANDEN der Propst und ich in seinem Arbeitszimmer und pressten unsere jüngsten Fundstücke. Wir hatten sie in einem Flachmoor nicht weit von Kengis gefunden, vor allem einige unscheinbare Seggestiele hatten den Propst dazu gebracht, wie ein Jagdhund zu zittern. Vorsichtig hatte ich die Exemplare in seiner Botanisiertrommel nach Hause getragen, mit sorgfältig freigelegten Wurzeln, gebettet in weiches Tuch, und jetzt half ich ihm dabei, das feuchte Graupapier gegen trockenes auszutauschen, um die Pflanzen so gut wie möglich zu bewahren. Gemeinsam drehten wir die Pflanzenpresse, wir spannten sie, bis das Seil knarzte, und sicherten sie dann mit Holzkeilen.
Mitten in der Arbeit hörten wir, wie die Haustür aufgeschlagen wurde und eine fremde Stimme nach dem Pfarrer rief. Kurz darauf hörten wir ein Geräusch und sahen, wie die Tochter Selma vorsichtig durch den Türspalt lugte.
»Vater?«
Der Propst wischte sich die Hände an einem Lappen ab und sammelte die Tabakshäcksel zusammen, die ich ihm vom Zopf abgeschnitten hatte.
»Ich komme.«
Im selben Moment wurde die Tür zum Arbeitszimmer weit aufgeschlagen, und ein grobschlächtiger Jüngling stampfte herein. Er hatte etwas Unangenehmes an sich, sein Blick war abwesend, beunruhigend. Augenblicklich sprangen bei mir alle Warnsignale an, und ich begriff auch sofort, warum: Der Mann hatte Angst.
»Kirkkoherra«, stammelte er auf Finnisch, »der Herr Pfarrer muss kommen.«
Der Propst betrachtete den Gast mit ruhigem Blick. Nicht ein Zug in seinem Gesicht verriet Verärgerung über die Störung. Dennoch wusste ich, dass er hier in seiner Schreibstube sehr auf Arbeitsruhe bedacht war. Jetzt stand dieser Mann hier, der Schweiß tropfte ihm von der Nase, das Hemd war durchnässt, als wäre er weit gelaufen. Er machte ruckartige Bewegungen mit den Armen, als schlüge er auf etwas ein, um seine Eile zu unterstreichen.
»Was ist passiert?«
»Sie ist … wir wissen es nicht … sie war mit den Kühen im Wald.«
»Von wem redest du?«
»Von unserer Magd Hilda … Hilda Fredriksdotter Alatalo.«
Als ich den Namen vernahm, merkte ich auf. Ich kannte die Frau. Sie war Dienstmagd auf einem der Höfe in der Nähe, ich hatte sie oft mit dem übrigen Gesinde in der Kirche gesehen. Ein rundliches, blasses Mädchen mit Stupsnase, etwas langsam in ihren Bewegungen. In der Hand hielt sie stets ein Taschentuch, wie eine alte Frau. Wenn sie von der Predigt in geistige Erregung geriet, wischte sie sich damit über Augen und Nase.
»Ja?«
»Das Mädchen … Sie ist weg. Der Herr Propst muss sofort kommen.«
Der Propst warf mir einen Blick zu. Es war bereits ziemlich spät, und wir waren beide müde von den Wanderungen eines langen Tages. Aber es war Sommer, das Licht würde noch die ganze Nacht weiterleuchten. Der Jüngling bemerkte unser Zögern und trat auf der Stelle, es schien, als wollte er den Propst jeden Moment bei der Jacke packen und ihn mit Gewalt mit sich schleppen.
»Wir kommen«, sagte der Propst. »Jussi, gib du ihm etwas zu trinken.«
Ich eilte aus dem Rauchstubenhaus und brachte unserem durchgeschwitzten Besucher einen Becher mit Wasser. Er trank es wie ein Pferd.
Es war bereits spät, als wir auf dem besagten Hof ankamen. Der Mann, der uns geholt hatte, hieß Albin, er war der älteste Sohn des Bauern. Den ganzen Weg dorthin war er so um die dreißig Meter vorangelaufen, hatte dann auf uns gewartet, nur um wieder vorauszueilen. Als erfahrene Wanderer gingen der Propst und ich in einem schnellen, gleichmäßigen Tempo. Als wir den Hofplatz erreichten, strömten Leute vom Hof herbei, uns entgegen, sie mussten am Fenster Ausschau gehalten haben. Es waren der Bauer und seine Frau und hinter ihnen ein gutes Dutzend Kinder mit verschlafenem Schopf. Der Bauer und sein Sohn nahmen sich nicht die Zeit, uns etwas anzubieten, sie stürzten sofort los Richtung Wald. Wir stapften ihnen hinterher. Die Sonne näherte sich dem Horizont im Norden, während wir uns einen Weg durchs Gebüsch bahnten. Der Bauersmann hieß Heikki Alalehto, und er erzählte abgehackt und unzusammenhängend von dem Mädchen Hilda, das wie üblich morgens mit den Kühen in den Wald gegangen war. Aber gegen Abend war sie nicht zum Melken zurückgekommen. Die meisten Tiere waren von allein zur Scheune zurückgekehrt, aber von dem Mädchen fehlte jede Spur.
»Vielleicht sucht sie nach einer verloren gegangenen Kuh?«, schlug der Propst vor.
Heikki gab zu, dass dies eine Möglichkeit sein könnte. Allerdings war sie noch nie so lange fortgeblieben.
Ab und zu riefen sie den Namen des Mädchens. Ihre Stimmen hallten von entfernten Berghängen wider. Der Propst und ich gingen schweigend weiter, ich sah, wie sein Blick an einem Gramineae hängen blieb, das ihm unbekannt zu sein schien, und ich bemerkte, wie er hastig ein Büschel herauszupfte und in seinen Rindenranzen legte.
Ein gutes Stück drinnen im Wald gelangten wir zu einem einfachen Lagerplatz. Ein paar verbrannte Äste lagen noch auf der Feuerstätte.
»Hier macht sie immer Rast.«
Heikki wollte zur Feuerstelle treten, doch der Propst hielt ihn am Arm zurück. Eine ganze Weile stand der Propst schweigend da und studierte das Bild, das sich ihm bot. Sein Blick wanderte von dem erloschenen Lagerfeuer hin zu den abgescheuerten Kieferästen, auf denen sie gesessen hatte. Ein kleines Milchgefäß lag auf dem Boden, der Deckel hatte sich gelöst, und ein Schluck Sauermilch war ins Moos gelaufen, sodass dieses von innen zu leuchten schien. Der Propst neigte seinen Kopf leicht zu meinem.
»Was siehst du, Jussi?«, fragte er leise.
»Nun, dass … Hilda hat hier gesessen und eine Rast eingelegt. Sie hat Feuer gemacht. Und dann ist ihr der Sauermilchtopf umgekippt.«
»Weißt du genau, dass sie es so getan hat?«
»Nein … das weiß ich natürlich nicht.«
»Benutze deinen Blick. Und erzähle mir dann, was passiert ist, Jussi.«
Seine Stimme war gedämpft, aber gleichzeitig intensiv. Mit einer ungeduldigen Geste strich er sich eine Haarsträhne zurück, die ihm immer wieder vor die Augen fiel. Ich gab mir alle Mühe, jedes Detail zu registrieren und mir das Bild des Mädchens wieder ins Gedächtnis zu rufen.
»Hilda hat hier am Feuer gesessen. Es muss mitten am Tag gewesen sein, als die Sonne am höchsten stand. Dann wird man normalerweise hungrig. Doch plötzlich passiert etwas, das sie dazu bringt, wegzulaufen. Oder … vielleicht nicht wegzulaufen, oder doch, ja. Ich habe so ein Gefühl. Und dann vielleicht … vielleicht verirrt sie sich. Findet nicht wieder zurück. So mag es gewesen sein. Das glaube ich zumindest.«
»Gehe nur von dem aus, was du siehst«, ermahnte der Meister mich und zupfte sich an der Unterlippe. »Halte dich an die Tatsachen, was haben wir hier vor uns?«
Ich verstand, dass er unzufrieden mit mir war. Eine ganze Weile gab ich mir alle Mühe, mehr aus dem Bild vor uns herauszulesen.
»Das Kopftuch hängt noch an einem Busch. Also schaffte sie es nicht, es mitzunehmen, als sie sich von hier entfernte. Deshalb muss sie es eilig gehabt haben.«
»Gut, Jussi.«
Heikki stampfte auf der Stelle, ganz offensichtlich vor Ungeduld. Er wollte, dass wir aufhörten, miteinander zu reden, wir sollten mit der Suche anfangen, doch der Propst zeigte deutlich, dass wir damit noch warten mussten. Er schloss die Augen zur Hälfte und schien zu blinzeln.
»Das Kopftuch hängt am Busch, um zu trocknen«, sagte er. »Es muss also mitten am Tag gewesen sein und so heiß, dass sie geschwitzt hat. Trotz der Wärme hat sie ein Feuer gemacht, der Rauch sollte die Mücken vertreiben. Das Feuer hat noch gebrannt, als sie wegging, ist jetzt aber erloschen. Man sieht, dass das Holz in der Mitte ausgebrannt ist und dass die leichte Asche über das Preiselbeergestrüpp in östlicher Richtung geweht ist. Jetzt ist es windstill, aber heute Nachmittag hat es in östlicher Richtung geweht. Es müssen also mehrere Stunden vergangen sein, seit sie verschwunden ist. War sie allein?«
»Äh … ich denke schon. Also, ich meine, ich bin mir sicher.«
»Warum?«
»Hätte sie Besuch bekommen, dann hätte sie als anständiges Mädchen, das sie war, das Kopftuch umgebunden.«
»Das ist möglich. Auf jeden Fall saß sie hier und kaute auf einem Brotstück, als etwas passiert ist. Das Milchgefäß ist umgekippt, und das Brot hat sie im Moos verloren.«
»Verloren … Aber hier ist doch gar kein Brot zu sehen?«
Der Propst zeigte auf eine trockene Föhre gleich neben uns.
»Siehst du das hier an den Zweigen? Dünne weiße Flocken. Das ist getrocknete Sauermilch. Die kleinen Vögelchen müssen in der Sauermilch herumgehüpft und immer wieder auf den Baum zurückgeflogen sein. Etwas Essbares, vermutlich ein Stück Brot, muss also in der Milchpfütze gelandet sein.«
»Ja, natürlich!«, rief ich beeindruckt aus.
»Das Mädchen läuft also von hier fort. Du siehst die Abdrücke im Moos. Wenn man läuft, vergrößert sich die Schrittspanne genau wie hier.«
Erst jetzt bemerkte ich die kaum erkennbaren Vertiefungen, auf die mein Meister zeigte.
»Aber da sind ja auch noch … da sind auch noch größere Spuren, oder?«
»Gut, Jussi. Von jemandem, der größer war als sie. Und schwerer, du siehst, dass die Spuren tiefer eingedrückt sind.«
Heikki, der neben uns gestanden und uns zugehört hatte, stieß plötzlich einen Schrei aus. Bevor der Propst ihn noch zurückhalten konnte, lief er zu einem Kiefernstamm und zeigte darauf. Die Rinde wies frische Verletzungen auf. Heikki strich mit den Fingerspitzen über die tiefen Risse.
»Karbu!«, sagte er mit Entsetzen im Blick.
»Ein Bär!«, wiederholte ich erschrocken.
Der Propst untersuchte einige der Klauenspuren.
»Wir müssen eine Suchmannschaft zusammenrufen«, sagte er. »Jemand muss dem Landjäger Brahe Bescheid sagen. Ich fürchte, dem armen Mädchen kann übel mitgespielt worden sein.«
Heikki nickte, deutlich erschrocken, und warf ängstliche Blicke um sich in die Sommernacht. Schnell lief er den Pfad zum Hof zurück. Der Propst dagegen blieb an Ort und Stelle. Ich sah, wie er vorsichtig das Milchgefäß aufhob und es von allen Seiten betrachtete. Dann steckte er einen Finger in die ausgeschüttete Sauermilch und rührte darin herum, zog sie weiter auseinander und bekam etwas Langes, fast Unsichtbares zu fassen. Ich sah, dass es eine Haarsträhne war. Er strich sie sauber, wickelte sie in ein Stück Tuch und steckte das in die Tasche. Ebenso sorgfältig untersuchte er ihren Birkenrindenranzen, der immer noch aufgeschnürt an ein Grasbüschel gelehnt dastand. Ohne jeden Kommentar studierte er noch einmal die Kratzspuren an dem Baum. Aufmerksam machten wir uns auf, den Fußspuren zu folgen. Ich sah, wie der Propst sich hinunterbeugte und etwas aufhob, gleich darauf gingen wir weiter. Die Abdrücke waren gut fünfzig Schritte weiter deutlich zu erkennen, dann ging es leicht aufwärts, und der Boden wurde härter. Es wurde schwieriger, der Spur zu folgen, bald hatten wir sie ganz verloren.
Mit wachsender Unruhe gingen wir zurück zu Heikkis Hof. Ich rief Hildas Namen und schaute mich unruhig um. Das dichte Weidengestrüpp wirkte plötzlich bedrohlich auf mich. Ein gutes Versteck für etwas Großes, das jeden Moment herausstürzen und seine Zähne in meine Nackensehnen schlagen könnte. Die Lippen des Propstes bewegten sich, er schien mit sich selbst zu reden, vielleicht aber auch mit höheren Mächten. Ich selbst hob einen groben Ast vom Boden auf und schwang ihn durch die Luft. Immer wieder schlug ich mit ihm gegen die Holzstämme, die den Pfad säumten, und lauschte den dumpfen Schlägen, wie sie in den Nebelschleiern der Sommernacht wegrollten.
5.
ES WURDE SONNTAG, und die Kirchenbesucher versammelten sich vor der Kirche von Kengis. Ich stand zwischen den Gemeindemitgliedern und hielt verstohlen nach meiner Angebeteten Ausschau. Meistens kam sie in Begleitung einiger anderer Dienstmägde, ein Bukett von Sommerblumen, in dem sie die Allerschönste war. Normalerweise folgte ich den Mädchen in die Kirche, mit ein paar Schritten Abstand, aber so nah, dass ich ihren Duft erahnen konnte. Ab und zu kam es zu einem kurzen Gedränge in dem Kirchenportal, Leute drückten von hinten nach, und dann gelang es mir oft, ihr so nahe zu kommen, dass ich ihren Kleiderstoff berühren konnte. Dann war nur dieses dünne Gewebe zwischen mir und ihrer Haut, ihrer warmen Nacktheit. Jeden Sonntag hoffte ich, es sollte wieder geschehen.
Der Besitzer der Eisenhütte war noch nicht eingetroffen, die Herrschaften gehörten für gewöhnlich zu den Letzten. Sicher wollten sie so ihre Stellung gegenüber dem Propst markieren. Sohlberg hatte gegen die Einsetzung des umstrittenen Propheten aus dem Lappenland gestimmt und hinterher gegen den Beschluss Einspruch eingelegt; er hätte den bescheidenen Pfarradjunkt Sjöding bevorzugt. Der Propst dagegen hatte von Anfang an gezeigt, worum es bei dem Streit ging:
»Finnen und Schweden gehen vor den Branntweinstuben in die Knie, sie kriechen auf allen vieren, wenn der Branntwein es geschafft hat, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können, sie weinen zu Ehren Gottes mit dem Kopf voller Branntwein.«
In Karesuando war es ihm geglückt. Die Gemeinde war fast vollkommen trockengelegt, nur der Glöckner hatte sich am längsten noch an den Flachmann geklammert. Selbst die Trinkstuben hatten ihre Schnapstonnen geleert und Besserung gelobt. Aber hier in der Gemeinde von Pajala war die Lage eine andere.
»Ein Drittel hier sind Wirtsleute, ein Drittel Saufköpfe und ein Drittel arme Teufel, die ohne Zuwendungen nicht leben können«, hatte der Propst feststellen müssen.
Und jetzt standen Pajalas kritische Bürger murmelnd in kleinen Grüppchen zusammen. Da waren der Händler Forsström und der Polizeimeister Hackzell, umgeben von ihren Familien und Mitläufern: Die Herren hatten den Pfarrer beim Domkapital wegen der unerträglichen Stimmung während der Gottesdienste angezeigt. Die Leute schrien und tanzten paarweise im Altargang, und der Propst selbst benutzte eine besonders grobe und anstößige Sprache, die nicht in die Kirche passte. Sollte der Bischof von dem Chaos zu hören bekommen, das hier ihrer Meinung nach herrschte, würde es sicher unangenehm für den Herrn Propst werden.
Viele waren der Meinung, der Propst sei ganz einfach verrückt. Gerüchte von seinen Erfolgen in Karesuando hatten sich weit übers ganze Nordland verbreitet. Während einige deshalb Angst bekommen hatten, waren umso mehr Menschen neugierig geworden. Wer wollte nicht einem verrückten Pfarrer zuhören? Also nahmen die Gemeindemitglieder lange Wege auf sich, um das Schauspiel miterleben zu können.
Unten von der Dorfstraße kam jetzt der korpulente Landjäger Brahe in seiner Uniform herauf, mit Pferd und Wagen aus Pajala. Er stieg ab, wischte sich mit einem karierten Taschentuch den Schweiß aus dem Nacken und näherte sich leicht schwankend mit seinem bulligen Gang, der an einen Ochsen erinnerte. Lässig grüßte er nach links und rechts, sich immer seiner Bedeutung bewusst. Mehrere Tage lang hatte er die Suche nach der verschwundenen Dienstmagd Hilda Fredriksdotter geleitet, und die Neugierigen scharten sich um ihn, erpicht darauf, Neuigkeiten zu erfahren. Einen Kopf kürzer und deutlich schmaler gebaut, kletterte der Gendarm Michelsson vom Kutschbock herunter. Er hielt seine einfache Schirmmütze fest in der Hand und zog immer wieder seine äußerst schmalen Lippen spitz zusammen, dass es aussah wie eine Schnauze. Michelsson war rotblond, doch trotz seines jungen Alters war das Haar bereits schütter, es war nur noch ein dünner Kranz um die blasse Glatze übrig geblieben.
Ich näherte mich ihnen und hörte, wie der Landjäger Brahe die Kirchgänger vor dem reißenden Bären warnte, der da draußen sein Unwesen trieb. Während der Suche hatte man Spuren von der Bestie gefunden, die Reste von Elchkälbern waren weit verstreut auf dem Gelände gefunden worden, mit spitz herausragenden Rippen, und Ameisenhügel waren von kräftigen Klauen auseinandergerissen worden. Doch das arme Mädchen hatten sie immer noch nicht finden können. Die Bestie musste sie wohl mit Haut und Haar verschlungen haben. Brahe ermahnte die Leute, sich nicht allein in die Wälder zu begeben, und wenn doch, auf jeden Fall eine kräftige Axt zu ihrer Verteidigung mitzunehmen.
Vom Pfarrhof waren jetzt Frauenstimmen zu hören:
»Pappi, pappi …«
Hände reckten sich in die Luft, und die Menschen drängten nach vorn. Der Propst war auf dem Weg. Er war so klein gewachsen, dass er sich mit Armbewegungen, die fast wie Schwimmzüge aussahen, den Weg durch die Menge bahnen musste. Ein junges Mädchen warf sich ihm an den Hals und brach in krampfhaftes Schluchzen aus. Der Propst murmelte etwas in ihr Ohr, doch sie ließ nicht los, die Nächststehenden mussten helfen, ihn zu befreien. Die Herrschaften in der Gemeinde tauschten vielsagende Blicke. Der Propst und all seine Frauen, ach je, man konnte ja schon ahnen, was hinter den geschlossenen Türen der Beichten geschah.
Noch eine Kutsche kam an. Aus ihr stieg der Eisenerzhüttenbesitzer Karl Johan Sohlberg mit seinem jungen Sohn. Sohlberg trug einen dunklen Anzug mit Hemd und Weste. Er war ein rühriger Herr, der als Werksinspektor aus der Gegend von Karlskoga gekommen war und nach und nach alle Anteile an dem Werk übernommen hatte. Die Leute machten einen Knicks oder verneigten sich und zogen sich die Mütze vom Kopf, während er durch die versammelte Bürgergemeinde spazierte. Diese nickten nur kurz dem Propst zu, der ein Stück entfernt stand, man spürte die Kälte zwischen ihnen. Der Landjäger Brahe erwies dem Hüttenbesitzer die Ehre und teilte ihm etwas mit, aber ich konnte nicht hören, was. Doch dann sah ich, wie Sohlberg seine große Geldbörse hervorholte und einige Scheine aufblätterte.
»Es wird eine Belohnung für denjenigen ausgerufen, der den reißenden Bären tötet!«, erklärte er mit lauter Stimme.
Sein mittelschwedischer Dialekt war in dieser Gegend ungewöhnlich, viele sahen ihn verständnislos an.
»Kylla se hyvän rahan saapi joka karhun tappaa«, übersetzte Landjäger Brahe.
Er legte das Geld in seine Uniformmütze und schaute sich um, offenbar zufrieden damit, im Mittelpunkt zu stehen. Forsström und Hackzell beeilten sich, auch ihre Brieftaschen zu zücken. Brahe überließ Michelsson die Sammlung unter den Gemeindemitgliedern, und bald war auch das Klirren einiger Kupfermünzen zu hören, die weniger Begüterte in die Mütze fallen ließen.
»Möchte der Herr Pfarrer vielleicht auch etwas beitragen?«
Michelsson musterte den Propst mit seinem wässrigen blauen Blick.
»Ich habe kein Geld bei mir.«
»Gar nichts?«
Der spöttische Unterton war nicht zu überhören. Geizig war er, der neue Propst, das wusste ja jeder. Obwohl doch stattliche Geldmengen von den Erweckten flossen, und landeten die nicht größtenteils in der eigenen Tasche des Propstes? So erzählten es zumindest die Gerüchte in dem Ort.
Der Propst drehte sich um und trat durch das Kirchentor ein, die Erweckten drängelten sich hinter ihm hinein. Ich hörte, wie er die Aufdringlichsten ermahnte, sie sollten sich vor der Götzenverherrlichung in Acht nehmen, sich daran erinnern, dass er nur ein Werkzeug Gottes war. Doch die Erweckung war wie ein Feuer. Nicht einmal er konnte es bändigen. Und als es Zeit für die Predigt war, sparte er nicht an Pulver:
»In früheren Zeiten haben die Priester das Evangelium für die Reichen gepredigt. Für Huren, die keine Reue zeigten, für Diebe, die weiter stahlen, sie hatten ein so lebendiges Evangelium vernommen, dass die Milch der Huren einschoss und die Schnapshändler Krokodilstränen vergossen. Ich dagegen predige für die Armen, die Trauernden, die Zweifelnden, die Beladenen, die Weinenden, für alle, die jegliche Hoffnung verloren haben. Was nutzt es, dem Wirt zu sagen, dass er sittsam und gut ist? In die Hölle hilft man ihm damit. Stattdessen sollte der Pfarrer sagen: Euer Pate ist der Teufel, ihr Hurenböcke und Hurenweiber. Ihr lebt gegen den Heiligen Geist, und wenn ihr nicht umkehrt, kann euch niemand mehr aus der Hölle herausziehen.«
Die Stimme des Propstes war wohlklingend und tragend. Sein einfaches, volksnahes Finnisch drang unerbittlich in die Köpfe der Versammelten ein. Bald konnte man das erste Jammern und Klagen hören. Ein schwankender Arm wurde in die Luft gereckt. Jetzt erhob sich eine der alten Frauen, kurz darauf noch eine. Eine Woge breitete sich zwischen den Bänken aus, man konnte spüren, wie es immer enger wurde, Leute traten auf den Mittelgang, um sich freier bewegen zu können. Es war erschreckend, in ihre Gesichter zu schauen, die Blicke waren starr, die Kiefer angespannt, die Zähne mahlten aufeinander, unverständliche Worte vermischten sich mit Angst- und Klagerufen. Ich spürte den Blick des Propstes auf mir, beugte den Oberkörper nach vorn und wiegte mich wie meine Banknachbarn hin und her, ich verbarg mein Gesicht, während ich zur Frauenseite hinüberspähte. Dort saß sie. Meine Angebetete. Sie atmete so schwer, dass der Brustkorb sich hob und senkte, ihre Augen waren halb geschlossen, die Lippen murmelten etwas. Ich wurde von Verzweiflung erfüllt, spürte, wie heftig ich mich nach ihr sehnte. Mein Gesicht wurde von Tränen bedeckt, und ich tat es den anderen gleich, hielt es hoch ins Licht, zeigte dem Propst meine hässlichen, feuchten Wangen.
Der Hüttenbesitzer rutschte hin und her, seine Wangenmuskeln waren angespannt. Hackzell zog einen Papierbogen heraus und machte sich irgendwelche Notizen. Da saßen sie, umgeben von ihrem eigenen kreischenden Arbeitsvolk, den Mägden und Knechten von Kengi und Pajala, den Kätnern, die ihre geballten Fäuste in die Höhe reckten. Die Kraft in dieser Menge war beunruhigend. Aus ihr konnte doch wohl kaum etwas Gutes resultieren?
Doch der Propst setzte unbarmherzig seine Strafpredigt fort, er trieb die Gemeindemitglieder immer weiter vor sich her, bis sie am Rande des Höllenabgrunds balancierten, sodass sie mit eigenen Augen die Feuer und Schwefelseen erblicken und den stinkenden Atem aus der Unterwelt spüren konnten. Erst jetzt, als alles verloren zu sein schien, holte er tief Atem. Und dann ließ er das Licht einfallen. Zuerst nur einen schmalen Streifen, dann ein Schwert und zum Schluss ein ganzes Feuerwerk aus Licht, und schon bald schien der Erlöser höchstpersönlich über dem Altar zu schweben, mit seiner Dornenkrone, unter der das Blut hervorsickerte. Der Menschensohn streckte die Hand aus. Und die geballten Arbeiterfäuste öffneten sich wie Blumen, die Finger wurden zu weißen Blütenblättern, die sich der Rettung entgegenstreckten, zitternd vor Hoffnung. Und mit übermenschlicher Kraft ergriff der Erlöser die Gemeinde und zog sie aus dem brennenden Haus heraus, hob sie in die Höhe und hielt sie alle wie Vogelküken in seinen Händen. Und man schleckte den tropfenden Honig des Evangeliums auf, und verschreckte Kinder fanden Schutz bei den himmlischen Eltern.
Rundherum sah man, wie sich Eheleute und Geschwister, Nachbarn und sogar frühere Feinde in die Arme fielen und um die Vergebung ihrer Sünden flehten, während Fleisch und Blut auf dem Altarvorbau zum Vorschein kamen. Gemeinsam mit verschwitzten Mägden und Kätnern ließ ich mich auf die Knie nieder und bekam es in den Mund gelegt. Das, was Jesus genannt wurde.
Gegen Ende des Hauptgottesdienstes las der Propst die Bekanntmachung vor, die demjenigen eine Belohnung versprach, dem es gelänge, den reißenden Bären in dieser Gegend zu töten. Außerdem bat er alle, die etwas über das verschwundene Mädchen Hilda Fredriksdotter Alatalo wussten, sich beim Landjäger Brahe zu melden.
Nach dem Gottesdienst drängten viele der Kirchenbesucher zum Propst, um sich zu bedanken, ihn zu berühren, zu spüren, dass er aus Fleisch und Blut war. Er folgte dem Landvolk hinaus auf den Kirchenhügel, wo er sogleich von vielen umringt wurde. Da waren die Neuerweckten, da gab es welche, die von ihren Sünden gequält wurden, und wieder andere, die vor allem neugierig waren. Alle wollten sie ein kleines Stückchen vom Propst haben. Ich selbst blieb in der Kirche zurück, und als niemand mich sah, setzte ich mich auf die Frauenseite. Die Bank war bereits abgekühlt, aber hier hatte sie gerade noch gesessen. Schnell ließ ich mich auf die Knie nieder. Legte die Nase aufs Holz und atmete ihren Duft ein.
Im nächsten Moment war ein Husten zu hören. Ich sprang auf und schaute mich erschrocken um. Erst jetzt entdeckte ich, dass sich jemand auf eine der Bänke gelegt hatte, eine schwarz gekleidete Frau. Sie atmete merkwürdig, aus ihren Mundwinkeln sickerte eine klebrige Flüssigkeit.
»Haluaisin … haluaisin puhua … Ich muss mit dem Propst reden … lass den Propst mir den Segen erteilen …«
Ein widerwärtiger Gestank drang von den verrotteten Zähnen aus ihrem Mund, als ich mich bemühte, ihr aufzuhelfen. Sie gab sich alle Mühe, sich hinzusetzen, doch es gelang ihr nur, sich ein wenig umzudrehen, bevor sie von der Kirchenbank hinunterrutschte. Ich hörte den dumpfen Aufprall, als ihr Schädel auf den Boden schlug. Alles ging so schnell, dass ich nicht mehr eingreifen konnte. Nervös versuchte ich ihr auf die Beine zu helfen, ihre Nase war blutverschmiert, selbst aus dem Mund kamen rote Blasen. Vorsichtig schob ich die Arme unter ihren Nacken und die Knie und hob den wehrlosen Körper hoch. Ihre Kleider stanken nach Urin. Sie war schwerer, als ich gedacht hatte, nur mit großer Mühe gelang es mir, sie zum Ausgang zu tragen. Dort stellte ich mich in das grelle Licht auf der Kirchentreppe. Die Alte hustete, und ich spürte, wie mir etwas Feuchtes ins Gesicht spritzte. Als ich den entsetzten Blicken der Zuschauer begegnete, begriff ich, dass es Blut war. Ich konnte nichts anderes tun, als mit dem dunklen Bündel in den Armen auf der Stelle stehen zu bleiben. Dort stand ich mit dem sterbenden Körper, während die Gemeinde mich anstarrte.
»Schamanenbengel!«, hörte ich sie rufen. »Was tut er da?«
Hastig legte ich das Bündel auf die Kirchentreppe und eilte zurück ins Kirchendunkel.
6.
MEINE MUTTER SAGTE, ich sei böse. Das zu hören, ist für ein Kind eine schlimme Sache. Sie sagte, ich würde böse Dinge tun, Brot stehlen oder meine Schwester schlagen. Ich tat viele böse Dinge, das wusste ich bereits, während ich so handelte, doch ich tat sie dennoch. Aber es ist eine Sache, ungehorsam zu sein und eine Backpfeife zu bekommen, dass die Wange brennt. Etwas anderes und viel schlimmer ist es jedoch, wenn man als Kind zu hören bekommt, dass man bereits böse geschaffen wurde, dass das eigene Innere, die wahre Natur, vom Teufel stammt. Wenn man so etwas von klein auf immer und immer wieder zu hören bekommt, wenn es nur oft genug wiederholt wird, dann entsteht dadurch ein Schaden. Eine Wunde, die heilt und wieder aufgerissen wird, heilt und wieder aufgerissen wird, die nässt und sich nicht mehr schließt und schließlich mit hartem Schorf bedeckt wird. Dabei muss ich an einen alten, abgenutzten Lederhandschuh denken. Er ist so alt, dass sich die Rentierhaare schon vor langer Zeit gelöst haben, er ist für harte Arbeit benutzt worden, wurde nass, trocken und durch Schweiß und Körperflüssigkeiten ganz rissig, immer und immer wieder, bis er einer verbrauchten, eingetrockneten Lunge ähnelt. So sieht mein Inneres aus, mein Kummer.
Wenn ich anderen Menschen begegne, fällt mir auf, wie leicht sie doch das Leben nehmen. Sie begegnen einander mit Wärme, sie können sich über die einfachsten Dinge unterhalten und über kleine Ärgernisse lachen, statt wütend zu werden. Ein Mann kann einer Frau einfach sagen, er habe den Eindruck, dass sie beim Laufen fast tanze, ob es da vielleicht einen Liebsten gebe? Einfach nur so. Und die Frau scheint es ihm nicht einmal übel zu nehmen, vielleicht antwortet sie darauf, dass langsame Mädchen nie ihren Eimer mit Beeren voll bekommen. Und dann stehen sie da und tauschen kleine Neckereien aus, und während dieser Zeit geschieht etwas zwischen ihnen, das nicht sichtbar ist. Etwas, das beide froh macht, das wärmt und das bestehen bleibt, auch wenn jeder wieder in seine Richtung geht. Oder wie beim Landhandel, man möchte etwas kaufen, vielleicht eine Tüte Grobsalz oder Tabak. Und der Händler plaudert einfach munter daher. Dabei geht es ums Wetter und wie gut oder schlecht alles wächst, um Leute, die kommen und gehen, und man selbst kann nur mit Ja oder Nein antworten. Es liegt etwas in meiner Natur, das die Menschen abstößt. Vielleicht beruht das auf meinem schändlichen Inneren, auf dem Schaden, den mir meine Mutter zugefügt hat. Vielleicht musste aber so oder so ein derartiger Mensch aus mir werden.
Ich bin nicht liebenswert. Niemand, der mich sieht, fängt an zu lächeln oder spürt diese luftige Freude, die ich bei anderen beobachtet habe. Keine Frau erwidert meinen Blick mit einem Lächeln, nein, ihre Augen werden kalt, und sie wenden sich ab. Wenn ich meine Wünsche äußere, antwortet das Mädchen im Landhandel kurz und einsilbig. Das macht mein Leben einsam, aber ich verstehe schon, dass es so sein muss. Meine Versuche, ausnahmsweise einmal fröhlich oder witzig zu sein, gingen immer schief, ich stand nur als Sonderling da.
»Tabak«, sage ich. »Könnt ihr mir ein wenig königlichen Tabak geben?«
Doch das Mädchen hinter dem Tresen lächelt nicht. Kein neckischer Blick, kein schelmischer Kommentar über königlichen Tabak hier in Schwedens am wenigsten königlichen Distrikten, dass der königliche Tabak leider erst nächste Woche geliefert wird, wenn der Hoflieferant in seiner vierspännigen Kutsche vorbeikommt. Mir begegnet nur ein abgewandter Blick zu den Regalen hin.
»Dann nehme ich einen Zopf gewöhnlichen Tabaks«, murmele ich und ziehe umständlich meinen Geldsack heraus. Münzen kullern heraus, sie rollen wie Augen über den Fußboden, ich muss wie eine Sau auf allen vieren kriechen. Die harten Kupferstücke einsammeln. Sie auf den Verkaufstresen fallen lassen.
Wenn es mir zu still ist, gehe ich hinunter zum Fluss. Gern abends, wenn die Tagesgeschäfte erledigt sind, wenn Menschen und Tiere zur Ruhe gekommen sind. Ich bleibe an den Steinen stehen, die zum Vorschein gekommen sind, nachdem der Wasserstand nach der Frühlingsflut wieder gesunken ist. Direkt vor mir fließt der Strom. Oft kommt mir in den Sinn, dass er wie Glas ist, wie die Fensterscheiben im Pfarrhaus. Ein ewiger Glasboden, der dahingleitet und im Wasserfall in Splitter und Schaum zerschlagen wird. Die empfindliche Haut des Wassers wird verletzt und öffnet sich, sodass das Innere aus der Tiefe hervorquellen kann. Das Geräusch eines Wasserfalls ist beunruhigend, es kündigt Gefahr an. Schwarze Felsschädel sind zwischen den Wasserwirbeln zu erkennen, Bootkiele rauschen vorbei, nur um Haaresbreite den Klippen entgehend. Doch dann glättet sich alles wieder, der Fluss verbreitert seinen Schoß zu einem weitläufigen, ruhigen Wasserbett. Die aufgebrachten Stimmen verstummen, die schäumende Oberfläche verheilt und wird wieder glatt. Und dennoch befindet sich alles weiterhin unter ihr verborgen.
Der Fluss spült alles Hässliche weg. Ich balanciere auf den Ufersteinen und warte, dass die Unruhe von mir abfällt. Ich übergebe mich dem Fluss, lasse meine innersten Gedanken wegspülen und verschwinden. Vielleicht ist der Fluss das schönste Sinnbild des Lebens. Die Seele, die niemals geboren wurde und niemals aufhört, die einfach nur da ist. Der Fluss denkt an mich. Er hilft mir auszuhalten. Auch wenn ich das Gefühl habe, festgenagelt zu sein, antwortet er mir damit, dass alles in Bewegung ist, nichts beständig. Betrachte ich den Fluss lange genug, werde auch ich in Wasser verwandelt. Das ist ein mächtiges Erlebnis. Als Fluss bin ich es, der still steht, während die Ufer sich zu bewegen beginnen. Ich liege in voller Länge ausgestreckt da, während die Landschaft an mir vorbeisegelt, mit ihren Ufern voller Urwald und Sumpflandschaften. Ich lasse alles geschehen und umarme meinen Sommerhimmel.
Dieses Bild versuche ich mir abends vor Augen zu holen, wenn die Unruhe mich treibt. Sanfte Wolken ziehen vorbei, während ich die Augen schließe und ganz ruhig daliege. Der gute Schlaf des Flusses, der heilt, der all die surrenden Nachtmücken mit seinem leisen Rauschen übertönt.
Oft denke ich daran, wie sehr ich dem Pfarrer mein Leben verdanke. Er war es, der mich einst erschaffen hat. Er band mich an die Zeit. Auf diese Art wurde ich schließlich ein Mensch. Seitdem gibt es mich in dem Buch, ich bin aufgeschrieben worden. Jetzt kann mein Name niemals vergessen werden. Denn ist es nicht das Schlimmste, bereits zu Lebzeiten vergessen zu werden? Durch das Leben zu gehen, ohne jemals durch Buchstaben gesegnet zu werden. Die Buchstaben sind wie Nägel, geschmiedet in der Walloon-Schmiede. Nur einmal erhitzt und direkt aus der Eisengussschmelze gezogen. Langsam errötend kühlen sie ab, anschließend sind sie schwarz und stark. Ich denke an sie als Gewächse, genau wie die gebeugten Stämme windgepeitschter Bäume, die zerfetzten Moorkiefern oder die Krüppelbirken, die man an den Berghängen findet. Dort gibt es die Buchstaben. Manchmal bleibe ich stehen und suche ein k, ein verschnörkeltes a oder vielleicht auch ein r. Die schwarzen Zweigkonturen schreiben auf dem grauen Papier der Luft. Man kann es lesen. Wenn man sich die Zeit nimmt, kann man merkwürdige Sagen daraus deuten.
In dem Sommer, in dem ich in das Buch eingeschrieben werden sollte, hockte ich zusammengekauert am Moorweg, voller Wunden, geschlagen und mit leerem Magen. Ab und zu konnte ich etwas von einem der Vorüberziehenden erhaschen, einen Rest ranziges Fett aus der Pfanne, die sie sich teilten, etwas ausgespuckter Tabak, auf dem man noch lutschen konnte, um den Hunger zu vergessen. Ich sah seine Gestalt schon von Weitem, und sofort überfiel mich ein Gefühl der Angst. Etwas Hartes, Eiliges lag in seinem Ausschreiten. Er trug eine Lodenjacke, das Haar war lang und zottelig, man hätte ihn für einen Vagabunden halten können. Doch sein Blick war aufmerksam, schweifte die ganze Zeit hin und her, er ließ den Blick von einer Seite zur anderen wandern, manchmal bis hoch in die Baumkronen und dann wieder um die Zehenspitzen herum, worauf er sich plötzlich nach unten beugte und irgendeinen kleinen Grashalm abzupfte. Die Angst in mir wurde immer größer, und ich drückte mich tief ins Gras im Graben, wollte mich unsichtbar machen. Aber natürlich entdeckte er mich. Ich sagte nichts, war bereit, sofort davonzulaufen. Doch erst einmal streckte ich ihm zögerlich bettelnd meine kleine Handfläche entgegen.
»Onkos sulla nälkä?«, fragte der Fremde auf Finnisch. Und als ich nicht antwortete, wechselte er ins Samische:
»Lea go nealgon? Hast du Hunger?«
Ich verstand beide Sprachen, fürchtete aber, geschlagen zu werden. Meine schmutzige Jungshand zitterte, doch ich zwang mich dazu, sie ausgestreckt zu halten. Er suchte eine Weile in seinem Rindenranzen und zog dann eine nachgedunkelte Spanschachtel hervor. Dann steckte er den Daumen hinein und fuhr mit ihm darin herum. Als er ihn wieder herauszog, war der Daumen ganz gelb. Er hielt ihn mir entgegen, diesen großen, aufrechten Daumen eines erwachsenen Mannes mit einer klebrigen Mütze. Mit ernster Miene nickte er mir zu. Ich wollte das Gelbe hastig mit meiner Hand abwischen, doch er war darauf vorbereitet und parierte meine Handbewegung. Stattdessen führte er seinen Daumen an meine zusammengekniffenen Lippen und drückte ihn auf sie. Sie wurden ganz klebrig, und reflexartig leckte ich sie ab. Etwas erwachte in mir. Der Gaumen begann zu singen. Er wartete, bis ich den Mund wieder aufmachte. Dieses Mal lutschte ich den Klumpen ab. Ein seliges Entzücken erfüllte meine Mundhöhle. Ich schmatzte und spürte, wie der Klecks schmolz, den Gaumen mit seiner gelben Farbe ausfüllte. Und jetzt konnte ich nicht mehr an mich halten, ich wurde zu einem Flaschenkalb, das leckte und saugte, bis der Daumen vollkommen sauber war.
»War das gut?«, wollte er wissen.
Gut war nicht das richtige Wort. Etwas Vergleichbares hatte ich noch nie geschmeckt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gab, dass die Welt so etwas Köstliches bieten konnte.
»Das heißt Butter«, sagte er. »Voita.«
»Mehr«, flüsterte ich auf Finnisch.
Er betrachtete mich auf diese musternde, intensive Art und Weise.
»Wie heißt du?«
»Jussi.«
»Wie heißt dein Vater? Mikäs sinun isän nimi on?«
Ich starrte auf den Boden.
»Wie alt bist du? Du bist doch bestimmt schon neun Jahre alt. Oder zehn?«
»Weiß nicht.«
»Du weißt es nicht?«
Er beugte sich näher zu mir herab, und ich nahm an, er wollte mich schlagen. Instinktiv kniff ich die Augen zusammen und zog die Schultern hoch. Aber der bekannte harte Schmerz kam nicht. Stattdessen spürte ich seine Finger in meinem Haar, über meinem Ohr.
»Weißt du, wer die Seligen sind? Weißt du, wem das Himmelreich gehört?«
Wieder schüttelte ich den Kopf.
»Den Kindern.«
Ich hatte noch nie jemanden etwas in der Art sagen hören. Als ich vorsichtig hochsah, war sein Gesicht ganz nah. Wortlos betrachtete er mich. Seine Augen waren blassblau mit grünen, samischen Einsprengseln. Wie ein Gebirgsbach.
An diesem Abend schlief ich das erste Mal in einem richtigen Haus. Ich hatte schon in Heuschuppen übernachtet, in Waldhütten und Samenzelten, in jeder Form von Erdkuhlen oder ganz einfach unter den herabhängenden Zweigen einer Kiefer. Aber nie zuvor hatte ich in einem Rauchstubenhaus geschlafen. Zuerst wollte ich nicht und versuchte, mich in die Scheune zu schleichen und mir ein Lager im Heu zu machen, doch von dort holte er mich mit ziemlich wütender Miene wieder zurück. Ich weigerte mich, mich in ein Bett zu legen, trat und schlug um mich, bis er einwilligte, mir ein Lager auf dem Boden zu bauen. Das Rauchstubenhaus wurde von einem alten Paar bewohnt, sie kannten den Propst und saßen nach dem Abendessen noch lange mit ihm zusammen und unterhielten sich. Ihre ruhigen Stimmen waren erfüllt von Alltag und Zärtlichkeit. Ich selbst wälzte mich in der kratzigen Decke, die sie mir gegeben hatten, hin und her und spürte, wie das Essen mich wie eine Lampe von innen wärmte. Den ganzen Abend über hatte der Propst versucht, mich dazu zu bringen, von meinen Eltern und meiner Familie zu erzählen, aber ich hatte immer nur wiederholt, dass ich auf Wanderung war. Er sah mir an, dass ich aus dem Norden kam. Aus der Kleidung schloss er wohl, dass ich ein Same war, aber sicher konnte er nicht sein. Denn der Name Jussi war ja finnisch, und ich war beider Sprachen mächtig.