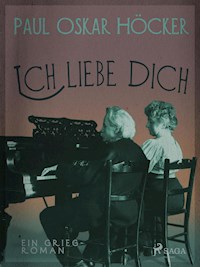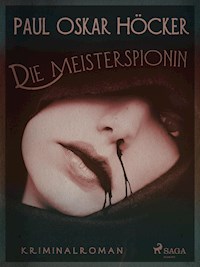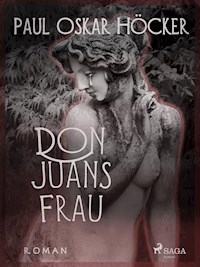Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Wunderbare Geschichten, die das Leben schreibt, bietet dieses Buch. In der ersten Geschichte wird der Pfarrer eines kleinen Schwarzwalddorfes von seiner Ehefrau zu einer Schweiztour ermutigt. Doch anstatt die vereinbarten Orte anzulaufen, geht es ins Theater. Der Schock sitzt tief, als er nach seiner Rückkehr seiner Frau hiervon berichtet. Und er wird noch größer, als plötzlich eine der Schauspielerinnen bei den Pfarrersleuten vor der Tür steht. Zum Autor: Paul Oskar Höcker, geboren 1865 in Meiningen, gestorben 1944 in Rastatt, war ein deutscher Redakteur und Schriftsteller. Höcker verfasste Lustspiele, Kriminalromane, Unterhaltungsromane, historische Romane und auch etliche Jugenderzählungen. Er galt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als überaus erfolgreicher Vielschreiber. Einige seiner Romane wurden verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Wie Schorschel Bopfinger auf Abwege geriet
Saga
Wie Schorschel Bopfinger auf Abwege geriet
Eine Sommergeschichte
Mit dem schmalen Rücken gegen die Wand der Zweiten Kajüte gelehnt stand der Pfarrer Bopfinger an Bord des „Wilhelm Tell“, der ihn von Flüelen nach Luzern bringen sollte, und bemühte sich, die Ortschaften am Südufer des Vierwaldstätter Sees auf seiner zerlesenen Baedekerkarte festzustellen.
Das Fragen hatte er sich in den anstrengenden Reisetagen seines Schweizer Generalabonnements abgewöhnt. Die Leute verstanden ihn meist gar nicht. Vielleicht sprach er zu leise. Er war eben schüchtern, war auch nie gereist. Die Kleinbürger und Bauern daheim in Gündelrodeck waren den traulichen Dialekt auf der Kanzel schon von seinem Vater her gewohnt. Er war frisch von der Freiburger Universität weg als Hilfsprediger in die Pfarre gekommen, vor zwanzig Jahren, als sein Vater zu kränkeln begann. Nach dessen Tod fiel die Wahl der Gündelrodecker einstimmig auf ihn. So hatte er denn gleich das Sophiele heimgeführt. Versprochen waren sie ja schon seit der Konfirmation. Anderthalb Jahrzehnte sassen sie nun als still zufriedenes Musterehepaar — leider kinderlos — in dem kleinen Schwarzwaldnest. Selten verirrten sich Sommerfremde dahin. Es lag hoch oben im rauhesten Teil des Wutachtales. Wäre nicht das Lehrerseminar dorthin verlegt worden, so hätte es gar keinen geistigen Austausch gegeben. Denn ’s Sophiele war zwar eine kreuzbrave Frau, fleissig, unheimlich fleissig sogar, und gut, ach so herzensgut, — aber grosse Reden konnten sie nicht miteinander führen. Worüber debattieren? Sie waren ja in allem so einig.
Nun hatte der Missionstag in Basel die Veranlassung zu dieser ersten Trennung gegeben. Es war eine Art Weihnachtsgeschenk der Frau Pfarrer. „Weischt, Schorschel,“ hatte sie am heiligen Abend gesagt, „fahre mir zusamme auf Basel, nord koscht des e ganz Häufle Batze, und mir habbe keins ebbes davon, weil ich doch als ’s Eisebahnrüttle net vertrage kann. Ha no, denk ich, also gehsch her und nimmsch das Geld, wo ich g’koscht hätt, und fahrsch dafür e bissle durch d’ Schweiz. Gell? Ich freu mich schon arg drauf, wann d’ mir hernach alles verzählsch.“
Ach, so gut hatte sie’s mit ihm gemeint. Er war ihr auch dankbar. Gewiss. Die ganze Zeit bis zum Sommer und auch jetzt auf der Reise selbst. Aber anstrengend war’s, sehr, sehr anstrengend. Dass er das Eisenbahnrütteln ebensowenig wie sie vertragen konnte, das hatte er nämlich gleich am zweiten Tag gemerkt.
Die Reiseroute war an der Hand der Eisenbahnkarte und des Kursbuches aus dem „Wutacher Hof“ bis ins letzte ausgearbeitet. An manchem langen Winterabend hatten sie auf dem Papier die Schweiz nach allen Richtungen hin durchstreift.
Von Basel ging’s nach Genf, von Genf zum Simplon, vom Simplon nach Neuchâtel (hier versäumte er leider den Zug) — von Neuchâtel zum Bodensee, ins Engadin, nach Zürich, nach Interlaken, zum Rigi, an den Luganer See, zur Aarschlucht, auf den Brünigpass, nach Airolo ...
An den meisten Punkten blieben ihm freilich nur ein paar Stunden übrig, manchmal noch weniger. Das war recht schade. Und die Strecken waren so gelegt, dass er zweimal das Nachtquartier sparte. Denn billig galt es schon zu reisen. Aber zum Schlafen war er auf diesen weiten, unruhigen Nachtfahrten doch nicht gekommen — und am Tage darauf auch nicht so recht zum Genuss. Nicht einmal die Fahrt durch den Gotthardtunnel hatte die erwartete seelische Erschütterung in ihm ausgelöst. Es war ihm bei der Rückfahrt nur ganz übel im Magen geworden, von dem Kohlendunst. Und selbst der Urner See — über dem nun allerdings bleigraue, föhnschwere Wolken hingen — wollte nicht zu seinem Herzen sprechen. Dabei kannte er seinen Tell fast auswendig. Überhaupt hatte er die Reise aufs sorgfältigste vorbereitet angetreten. Über alle Wasserscheiden auf Schweizer Gebiet, über Schweizer Geschichte und Altertümer, über Industrien, Moränen, Militär, Hotelpreise, Vegetation, Eisenbahnbauten, Trinkgelder, Panoramen hatte er sich aus Doktor Knittels altem Baedeker orientiert. (An diesen ernsten Studien hatte ’s Sophiele redlich teilgenommen.) Und nun fuhr er und fuhr und fuhr — dort drüben lag die gewaltige Alpenwelt, die Schiller, der Ärmste, der dies alles nie gesehen, so klassisch schön geschildert hatte, — und er, der vom Schicksal Begünstigte, der hier Tag und Nacht auf der Eisenbahn und auf dem Dampfschiff all den gewaltigen Naturschönheiten so nahe sein durfte, er musste sich ordentlich zwingen, die Augen aufzuhalten.
Plötzlich entfiel der Baedeker seiner Hand. Erschrocken sah er sich um.
Da hob ihm ein junger Herr, der einen goldenen Kneifer trug, den Baedeker auf.
„Aber nein, sind Sie so gut und bemühen Sie sich nicht!“ stiess der Pfarrer hervor, wie auf einer bösen Tat ertappt.
„E arge Füll’ hier, Herr Superintendent,“ sagte der junge Herr lächelnd.
Bopfinger hatte bei dieser Anrede mehrfache Empfindungen: eine wahre Herzensfreude darüber, dass der andre auch badischen Dialekt sprach, und eine tiefe Beschämung, dass er ihm eine unverdiente Würde beimass. Aber vor allem war er glücklich, dass er ein bisschen plaudern konnte. Er lehnte also die Standeserhöhung bescheiden ab.
„Aber dass Sie ein geischtlicher Herr sind, das hab’ ich gleich gemerkt.“
„So. Woran denn?“
„An Ihre gute Auge — und an Ihrem Regeschirm. Das gleiche Modell tragt nämlich mein Onkel in Huttersheim.“
„In Huttersheim! Ha, da amtiert doch mein lieber Amtsbruder Storch!“
„Dem sein ungerat’ner Herr Neveu bin ich.“
Bopfinger gab ihm die Hand. „Ungeraten sehn Sie mir aber nicht aus. Den Schalk haben Sie in Ihrem jungen Gesicht. — Gelt? Und der sucht sich jetzt ein Opfer?“ setzte er lächelnd hinzu.
„A bewahr. Jetzt net. Ausnahmsweis net.“ Er lachte. Dann näherte er sich dem Pfarrer und sagte in leiserem Tone: „Dort drübe — in der erschte Klass’ — da hab’ ich nämlich Mittag gegesse — und jetzt fehle mir grad neunzig Centimes zum Bezahle. Ich hab’ mich um und um gesehe: bloss Engländer. Da hab’ ich Sie entdeckt, Herr Pfarrer. Zu dem gehsch und pumpsch ihn an, hab’ ich mir da gesagt.“ Er zog nun kurz den Hut. „Studiosus juris Storch.“
Bopfinger war verlegen und geschmeichelt. Machte sich der junge Herr auch wirklich keinen Witz mit ihm? Sein Huttersheimer Onkel hatte es faustdick hinter den Ohren.
„Natürlich schick’ ich Ihne das Geld, gleich vom Hotel aus, noch heut’ abend,“ setzte der junge Herr hinzu, nun selbst etwas aus dem Gleichgewicht gebracht, weil der Pfarrer noch immer schwieg, sich auch nicht vorstellte.
Aber mit einem Male ging ein wahres Strahlen über das schmale, feine, immer blasse Gesicht des Geistlichen. Er drehte sich um, bückte sich, holte sein Portemonnaie aus der Hosentasche, klimperte darin ein Weilchen, dann sah er sich scheu um, steckte dem jungen Herrn mit der auffälligen Heimlichkeit eines ungeübten Silberdiebs ein Frankstück zu und sagte: „Nein, Herr Studiosus, sehe Sie, das ist meine Bedingung — das Fränkli müsse Sie von mir geschenkt annehme!“
„Aber Herr Pfarrer —“
„Sind Sie doch nicht gleich bös. Es ist doch nicht schlimm gemeint. Ein junges Blut. Ich denk’ so dran, wie ich studiert hab!“
„Ha — Sie mache mich arg verlege, Herr Pfarrer. Sie müsse mir Ihre Adress’ gebe — sonscht kann ich’s ja gar net behalte.“
„Oh, dann täten Sie mich kränken. Ich freu mich doch so, dass ich einem Studentle hab’ aushelfen dürfen.“
„Und Ihre Adress’? Wenigschtens e Poschtkärtle darf ich doch emal schreibe?“
„Nein, nein, nein, nein!“ Bopfinger geriet in eine herzliche Fröhlichkeit über seinen Einfall.
„Ich erfahr’ sie doch noch, Herr Pfarrer. Vom Onkel Storch.“
Der Student lachte und zog ab. Nach einem Viertelstündchen kehrte er zurück.
‚Beckenried!‘ hallte es über das Deck.
„Wolle Sie hier aussteige, Herr Pfarrer?“
„Ich? Nein. Warum?“
„Weil Sie Ihr Handtäschle so krampfhaft ans Herz drücke.“
Bopfinger nahm sie an jeder Station an sich. Nicht aus Misstrauen gegen die Mitreisenden — nur aus einem gewissen Anschlussbedürfnis. Das gestand er dem jungen Herrn treuherzig ein.
„Sie scheine mir kein Reisevirtuos zu sein, Herr Pfarrer.“
„Ach nein.“ Und nun kam’s über ihn: er musste sich seine Verzweiflung von der Seele reden. „Ich kann mir jetzt gar nichts mehr behalten. Unglücklich bin ich darüber — aber wenn Sie jetzt sagen: gehn Sie her, Herr Pfarrer, grad eben zwischen den beiden Bergnasen da können Sie den Montblanc sehn, — ich bleib’ sitzen.“ Er schneuzte sich in sein Taschentuch.
„Habe Sie den Montblanc überhaupt schon gesehe?“ fragte der Student.
Bopfinger schüttelte den Kopf. „In Genf hat’s grad geregnet. Es war ja oft wüst, das Wetter. Bloss in Grindelwald hat die Sonn’ geschienen. Da hab’ ich drei Stunden Aufenthalt g’habt und bin zu dem Gletscher spaziert. Herr Studiosus — ein Gletscher! Ha, ich sag’ Ihnen, ich hab’ da gestanden, und ich schäm’ mich nicht, grad heulen hätt’ ich mögen! So ebbes Gewaltiges ist’s um die Allmacht Gottes! — Ha no, aber hernach hat’s gleich wieder geregnet. Arg leid hat mir’s getan. So viel Geld kostet’s — und man ist grad das eine Mal da, kommt nie im Leben mehr her — und so ein einzigs bös’ Wölkle giesst vom Himmel ’runter und verhunzt einem die ganze Aussicht! Ist’s nicht schad’?“
„Gewiss ischt’s schad’!“ Der Studentwar ordentlich gerührt. Verstohlen musterte er den geistlichen Herrn von der Seite.
Man hätte ihn sicher für älter als zweiundvierzig Jahre gehalten. Die schmächtige, ziemlich hoch aufgeschossene Gestalt hatte fast etwas Unentwickeltes. Und in den Augen, den hellblauen, feuchtblinkenden, lag eine Knabensehnsucht. Er war bartlos. Durch die schmale, stark vorspringende Nase bekam sein hübsches, offenes, gütiges Gesicht etwas Auffallendes.
„Der Sommer ischt überhaupt schlecht gewese,“ sagte der Student. „Ich war erscht in Chamonix. Dreimal habe mir auf den Montblanc kraxle wolle — und dreimal habe mir umkehre müsse. Immer Schneesturm. Ganz fuchtig bin ich schliesslich von Chamonix fort. Jetzt hock ich schon seit acht Tag da drübe, wo sie das Freilichttheater aufgemacht habe. Morgens mach’ ich Ausflüg’ und nachmittags guck’ ich mir das Spiel an.“
„Ein Freilichttheater? Was ischt jetzt daas?“
„Ha — so wie bei den alte Grieche. Und jetzt in Orange bei den Franzose.“
„Und so wie zu Goethes Zeiten in Weimar?“
„Akkurat. Ich hab’ einen grossen Eindruck, muss ich sage. ’s Wetter war ja auch da arg störend. Die Herre und Dame auf der Szen’, die habe nix zu lache in ihrem dünne Zeug. Aber wie sie die Iphigenie g’spielt habe — und die Medea — und den Tasso — fein, sag’ ich Ihne, Herr Pfarrer. Das ischt net zu vergleiche mit dem Spiel in einem geschlossene Theater. Sie sollte sich’s net entgehe lasse. So e gute Gelegenheit biet’ sich so bald nimmer.“
„Hm. Eigentlich wollt’ ich bis Luzern durchfahren. Dort soll ich mir heut noch den sterbenden Löwen und den Gletschergarten ansehn — und zum Sonnenuntergang müsst’ ich auf den Gütsch, sagt der Herr Doktor.“
„Vom Sonnenuntergang werde Sie auf’m Gütsch heut net viel bemerke, Herr Pfarrer, ’s ischt ja ganz grauer Himmel. Vielleicht treffe Sie’s morge besser.“
„Morgen muss ich nach Bern und nach Freiburg; abends zwölf Uhr — in Basel — läuft mein Generalabonnement ab.“
„Sind Sie doch froh, wenn Sie sich Bern und Freiburg schenke könne.“
Aus tiefstem Herzen atmete der Pfarrer auf. „Ja, wahrhaftig. Das ischt mir aus der Seel’ gesproche! — Meine Frau hat auch immer g’sagt: ‚Schorschel, überanstreng’ dich nicht!‘“
„Natur habe Sie g’nug jetzt.“ Der Student lachte. „Oder eigentlich: g’nug Bahnhöf’!“
Bopfinger nickte. „Am liebsten wär’ mir’s, ich brauchte in meinem ganzen Leben keinen Bahnhof nimmer zu betreten! — Und keinen Aussichtspunkt, wo man ein Fränkli zahle muss und doch nichts sieht!“
„Komme Sie mit ins Freilichttheater, Herr Pfarrer. Die ‚Iphigenie‘ spiele sie heut wieder. Ich kenn’ ein paar von dene Herrschafte. Der den Thoas macht, der war vorigen Winter in München.“
„Oh, oh, und mit den Schauspielern haben Sie da verkehrt?“
Der Student lachte. „Und glücklich war ich, dass sie mich geduldet habe. In dem Kreis hab’ ich erscht wieder Freud’ an der Kunscht gekriegt. Nach dem Maturum hatt’ ich mir ja geschwore: nie wieder rührsch ein klassisches Buch an. Auf der Schul’ wird einem das ja so arg verleid’t.“
Es zog den Pfarrer mächtig. Ach, wenn er Bern und Freiburg schwänzte! ’s Sophiele war doch eine liebe, verständige Frau —! Dafür brachte er ihr doch etwas ganz Neues, ganz Ungeahntes mit: er konnte ihr von einem Freilichttheater erzählen! Das kannte vielleicht nicht einmal der Herr Direktor Klöckner, der alles, was Kunst hiess, sonst für sich in Anspruch nahm. Und Doktor Knittel, der weltgewandte, gewiss auch nicht.
„Herr Studiosus — ich komm mit Ihnen!“ rief Bopfinger und griff sofort wieder nach seiner Handtasche.
In dem Augenblick läutete die Dampfschiffglocke. Man war da.
Es war ein grosses, grosses Erlebnis.
Alle Müdigkeit war vergessen. Schorschel Bopfinger sass auf der lehnenlosen Holzbank des billigsten Platzes mitten unter Kantonsschülern aus Zürich, die ebenso atemlos der Dichtung hingegeben waren, mit ebenso leuchtenden Augen den in ihrer klassischen Einfachheit so wundervollen szenischen Bildern folgten.
Durch die Edelkastanien, in deren Hain das Naturtheater lag, rauschte der Föhnwind. Der peitschte das Blut auf. Man geriet in eine seltsame innere Hitze. Das Drama packte ihn, das Spiel riss ihn in diese fremde, heidnische Welt, und zum erstenmal in seinem Leben fühlte er die Macht der Schauspielkunst.
Was für eine wundervolle Iphigenie war das aber auch! Schon diese klassisch edle Gestalt mit dem ausdrucksvollen Gesicht und den sprechenden Augen! Als ob Feuerbachs berühmtes Gemälde (das er sich einmal aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten hatte) lebendig geworden wäre!
Während des letzten Aktes brach die Sonne durch. Nun sah man ein paar Minuten lang blauen Himmel durch das Grün des ‚heiligen Haines‘ schimmern, und rote Felsen, von denen die Kantonsschüler sagten: ‚das ischt die Rigi!‘, erschienen feurig bemalt von der Spätnachmittagssonne. Und im Gezweig der Edelkastanien wiegten sich zwitschernd die Vögel.
„Jetzt — wenn doch’s Sophiele dabei wär’!“ sagte Schorschel Bopfinger zu sich.
Er konnte nicht mit in lautes Klatschen und Bravorufen ausbrechen, als das Spiel zu Ende war, wie die achthundert Hörer, die die langen Sitzreihen gefüllt hatten und nun aufstanden — viele erstiegen sogar die Bänke — und immer, immer wieder die Darsteller hervorjubelten, namentlich die Iphigenie. Ihm war das Herz zu voll. Die Abschiedsworte der letzten Szene klangen noch in ihm nach. Wie Iphigenie, die stolze, königliche, zu Thoas sprach:
„Leb wohl! O wende dich zu uns und gib
Ein holdes Wort des Abschieds mir zurück!“
... Oh wie sie das gesagt hatte! Wenn das doch ’s Sophiele hätte hören können!
Wie entrückt sass er da.
„Warum klatsche Sie denn net, Herr Pfarrer?“ rief ihm der Studiosus von der andern Seite eifrig, fast tadelnd zu.
Da klatschte er denn mit. Immer beherzter. Er ward ganz heiss von der Anstrengung.
In breitem Zuge kehrte das Publikum zur Dampferlandungsstelle zurück. Es gingen Extradampfer nach Luzern. Der Pfarrer sagte: „Jetzt möcht’ man am liebsten noch ein bissle still hier oben bleiben, von den Kastanien aus übers Wasser gucken, wo die Lichter anfangen aufzublitzen, und alles überdenken, statt dass man sich auf den Dampfer unter die Leut’ hockt. Nicht?“
Der Studiosus hatte sich in einem kleinen Gasthof in Pension gegeben. In seinem Zimmer standen zwei Betten. Wenn der Pfarrer bleiben wollte, dann sprach er gern mit der Wirtsfrau.
Bopfinger überlegte. Wie aus weiter, weiter Ferne wollte ihn eine blassgewordene Pflicht mahnen: der Gletschergarten — der sterbende Löwe! Aber dazu war’s heute ja doch zu spät. Und konnte der Sonnenuntergang vom Gütsch aus schöner sein als hier? Wenn der Doktor Knittel das hier gesehen, erlebt hätte, — du mein, was wäre dann je diesem Eindruck gleichgekommen!
„Erst noch! Ich bleib’!“ rief der Pfarrer mit einem tapferen Entschluss.
Sein Handtäschchen hatte der Studiosus in Verwahrung genommen. Heimlich hatte er das geliehene Fränkli hineingetan. Als sie ins Gasthofzimmer kamen und der Pfarrer die Tasche öffnete, um den Theaterzettel zu verwahren, entdeckte er das Geldstück. Im ersten Augenblick war er gekränkt. Dann sagte er: „Wissen Sie was? Das Fränkli werd’ ich mir nicht einwechseln lassen. Das behalt’ ich mir als Andenken. Denn dem verdank’ ich’s, dass ich so ebbes Grosses hab’ erleben dürfen.“
Sie gingen nicht in die allgemeine Wirtsstube, wo die Fremden sassen, sondern in das kleine Speisezimmer der Pensionäre. Hier fanden sich nach einem Viertelstündchen ein paar von den Darstellern ein, die sich für die Spielzeit in dem kleinen Gasthof einquartiert hatten. Auch die Iphigenie war darunter.
Eine Frau Minna Schrewe-Grantz war es. Der Studiosus war über alles unterrichtet: dass sie im Reich an einem Hoftheater engagiert war, dass ihr Mann augenblicklich eine Tournee durch Nordamerika unternahm.
Die schöne junge Frau schien die Bewunderung und das Interesse gewohnt. Sie verzehrte ihr Abendbrot mit gutem Appetit, sprach munter mit Bekannten und Kollegen und einem jungen Ehepaar, das aus dem Schlosshotel herübergekommen war, dem Studiosus Storch nickte sie einmal freundlich zu, und als sie ihre Mahlzeit beendigt hatte, fragte sie ihn, ob viel Deutsche unter den Zuschauern gewesen wären.
„An einem hawwe Sie jedenfalls e grosse Erobrung gemacht,“ sagte er schmunzelnd. „Darf ich Ihne den Herr Pfarrer aus Gündelrodeck vorstelle? Es hat ihm arg gut gefalle. Bloss besser mitklatsche hätt’ er müsse.“
Schorschel Bopfinger hatte sich pflichteifrig erhoben, als wäre er in der Schule aufgerufen worden. „Ich — ich — ich war zu ergriffen!“ stammelte er, ward rot dabei, — und dann genierte er sich furchtbar, so der Mittelpunkt des ganzen Lokals geworden zu sein.
Die Iphigenie gab ihm über den Tisch herüber die Hand. Der neben ihr sitzende alte Herr, ein gefeierter Schweizer Literarhistoriker, liess sich mit dem Pfarrer auch gleich in eine Erörterung des Freilichttheaterproblems ein — und so sah er sich denn zu seiner eigenen Verwunderung im Nu mitten unter den Künstlern. Er musste sein Schöppchen Landwein an den Tisch herüberholen. Und er sprach, wie ihm ums Herz war. Es klang ja immer ein bisschen nach Predigt — aber so viel ehrliche Begeisterung schwang da mit. Und so verwöhnt die Iphigenie mit Lob und Verehrung zu sein schien: diese naive Huldigung aus dem Munde des Schwarzwaldpfarrers machte ihr das Herz warm.
„Ich spiele ja zu gern hier!“ rief sie lebhaft. „Da hat man doch schöne, grosse Aufgaben! Und das Gefühl einer seltsamen Macht ist’s: du kannst die Zuhörer völlig in Bann schlagen durch die Dichtung, wenn du bloss selber willst und ganz in der Stimmung aufgehst! Die Sonne scheint — aber du kannst dem Zuschauer vermitteln: es ist Nacht. Dir ist kalt, das ganze Publikum fröstelt unter einem kühlen Seewind, den der Westwind herträgt: aber du kannst durch Ton und Gebärde das Schwelgen in paradiesischen Wonnen vorzaubern! Nie war ich so glücklich in meiner ganzen Laufbahn wie hier!“
Die Unterhaltung wandte sich dann allgemeineren literarischen Themen zu, auch die andern Aufführungen wurden besprochen, die Orestie. Bopfinger hatte diese Dramen noch nie gesehen, er war ja nur als Student ein paarmal im Theater gewesen. Aber es war ihm ein Bedürfnis, darzutun, dass er sich in seiner Schwarzwaldabgeschiedenheit auch mit literarischen Themen beschäftigte. Er besass sogar ein paar kleine ‚Heiligtümer‘, um die er schon viel beneidet worden war. Sein Vater war ein Intimus von Uhland gewesen. Zahlreiche Briefe von ihm hatte er in Vaters Nachlass gefunden.
„Unveröffentlichte?“ fragte der Züricher alte Herr, riss die Augen auf und rückte näher.
Und aus dem Gedächtnis, leuchtenden Auges, sprach Schorschel Bopfinger ihnen einiges vor. Auch dass Scheffel von Säckingen aus zweimal seinen Vater aufgesucht hatte, dass er nicht nur Briefe, sondern auch eine Anzahl Gedichte von ihm besass, erzählte er. Ein paar Wendungen daraus waren in dem, in jenem späteren Werke aufgetaucht. Frau Minna Schrewe interessierte sich lebhaft dafür. Sie kannte viel von Scheffel auswendig. Der war von Kindheit an ihr besonderer Schwarm.
Scheffels Humor liess jetzt seine Lichter spielen. Einer der jungen Schauspieler, der sonst nur Nebenrollen spielte, ward zum Scheffelbarden: er besass eine schöne Singstimme und sang reizend zur Laute. Das Instrument ward geholt, der hübsche, junge Mensch lehnte sich, die Beine übereinander schlagend, in seinem Sessel zurück, und dann begann er.