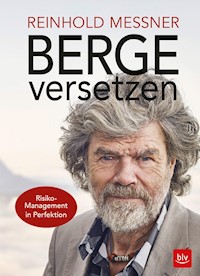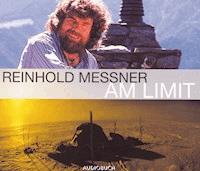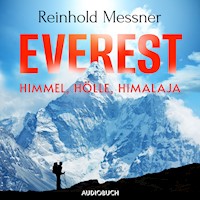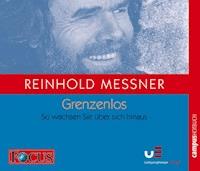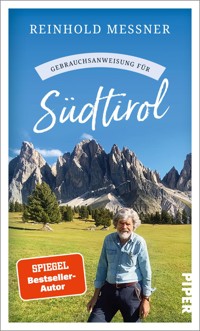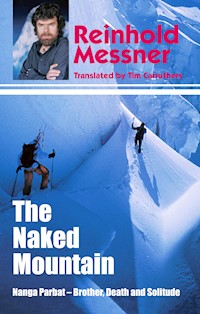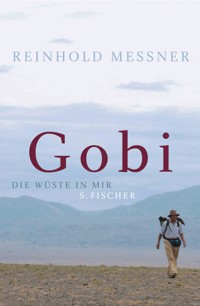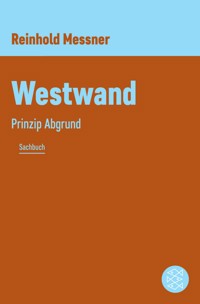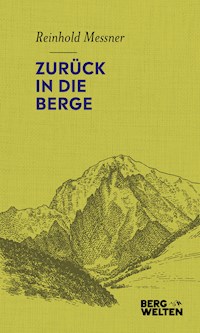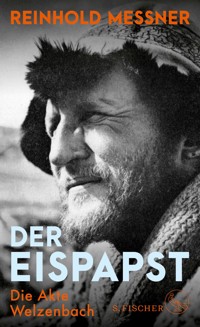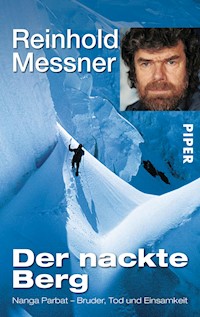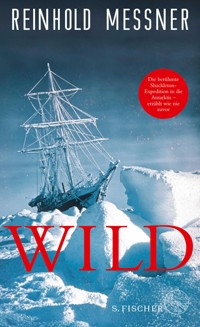
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die berühmte Shackleton-Expedition in die Antarktis – erzählt wie nie zuvor: Im Jahr 1914 bricht der englische Abenteurer Frank Wild zusammen mit dem bedeutenden Polforscher Ernest Shackleton und 26 Männern zum »letzten Trip auf Erden« auf – sie wollen die Antarktis durchqueren. Ihr Schiff, die Endurance, aber wird vom Packeis zerstört, drei Monate driften sie auf einer Eisscholle nordwärts und retten sich schließlich auf eine Insel, auf der sie nie jemand finden würde. Während Shackleton aufbricht, um Hilfe zu holen, bleiben 22 Männer unter der Führung von Frank Wild zurück, in dauernder Dunkelheit und eisiger Kälte. Allein durch seine Persönlichkeit erhält Wild in seinen Männern das Vertrauen auf Rettung aufrecht – einen ganzen antarktischen Winter lang, dem schlimmsten Gefängnis der Welt. Es ist die wahre Geschichte über die Wildnis und das, was uns darin überleben lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Reinhold Messner
Wild
oder Der letzte Trip auf Erden
Über dieses Buch
1914 bricht der englische Abenteurer Frank Wild zusammen mit dem bedeutenden Polforscher Ernest Shackleton und 26 Männern zum »letzten Trip auf Erden« auf- sie wollen die Antarktis durchqueren. Ihr Schiff aber wird vom Packeis zerstört, drei Monate driften sie auf einer Eisscholle nordwärts und retten sich schließlich auf eine Insel, auf der sie nie jemand finden würde. Während Shackleton aufbricht, um Hilfe zu holen, bleiben 22 Männer unter der Führung von Frank Wild zurück, in dauernder Dunkelheit und eisiger Kälte. Allein durch seine Persönlichkeit erhält Wild in seinen Männern das Vertrauen auf Rettung aufrecht- einen ganzen antarktischen Winter lang, dem schlimmsten Gefängnis der Welt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490513-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
»Plötzlich wird dem Mutigen [...]
Point Wild
Discovery
Nimrod
Aurora
Endurance
James Caird
Spitzbergen
Njassaland
Quest
Quest II
Grytviken
»Plötzlich wird dem Mutigen das Schlimmste zum Besten.«
Ernest Shackleton
Point Wild
Wohin, frage ich mich, ist unser Vertrauen entschwunden? Das Vertrauen in Führungspersönlichkeiten, in die Richtigkeit von Nachrichten, ja, warum nicht: auch das Gottvertrauen, das die Menschen einst aufrecht hielt, selbst dann, wenn alles verloren schien.
»We are lost, we all will die, if Wild doesn’t keep our spirit high«, lese ich eine Nachricht, geritzt in den überhängenden Fels einer Höhle. Hat der Expeditionsfotograf Frank Hurley sie hinterlassen, im Jahr 1916, als alle Hoffnung, in die Zivilisation zurückzukehren, gleich null war – so wie die Lesbarkeit der Zeilen darunter?
Ich stehe an jenem Point Wild auf Elephant Island, an dem hundert Jahre zuvor zwei umgedrehte Boote gelegen haben und 22 gestrandete Männer unter Führung von Frank Wild auf Rettung warteten. Vier Monate lang. Der Raum jetzt aufgesogen vom Nebel, der Boden glitschig; abgerundete Steintrümmer zu meinen Füßen. Meine Atemgeräusche verschluckt von der Brandung, das Dröhnen des Windes in den Ohren, glaube ich, das Gemurmel der Männer von damals zu hören. Ein Zittern geht durch meinen Körper. Beruhige dich, sage ich zu mir selbst und wie zum Trost: Sie sind alle gerettet worden.
Die Story, dass der große Abenteurer Ernest Shackleton ihr alleiniger Retter gewesen sei, hätte sich verfestigen können, weil seine Überfahrt nach Südgeorgien, um Hilfe zu holen, aufregender klang als das Ausharren der Zurückgelassenen auf Elephant Island. Ich aber weiß, dass Ausharren schlimmer ist, als etwas zu tun. Weil Ängste beim Handeln schrumpfen, beim Abwarten aber sich steigern. Nur weil die Mannschaft Frank Wild vertraute, konnte er sie am Leben halten.
Das Verlorensein am Ende der Welt ist mit den modernen Kommunikationsmitteln mehr und mehr aus unserem Bewusstsein verschwunden – so wie das Selbstbild von Führungspersönlichkeiten, das sich aus dem Vertrauen der Anvertrauten speist.
Wie ist es, noch im Zustand der Verzweiflung Haltung zu bewahren, das Vertrauen seiner Leute hochzuhalten, zu führen bis in Todesnähe? Niemand hat es klarer vorgelebt als Frank Wild. Bei fünf Expeditionen in die Antarktis ist er dabei gewesen, zehn Jahre hat er auf dem Eis verbracht: »Es war die glücklichste Zeit meines Lebens«, sagte er später. Im Winter 1916 hat er auf Elephant Island ein Wunder vollbracht. Weil er für alle seine Leute da war, fühlten sich alle besser.
Point Wild
Diese Trostlosigkeit! Schwarze, glitschige Felsen unter meinen Füßen, glattgeschliffen vom Salzwasser, das seit Jahrmillionen darüberspült; Nebel über der ölig dunklen See, dazu das ständige Klatschen der Wellen. Kaum Sicht. Das Schlauchboot, das Caroline und mich ausgesetzt hat, dümpelt bei einem zimmergroßen Eisblock, den die Flut ein paar Stunden zuvor angespült haben mag: vom Meerwasser zum Kunstwerk geformt. Es ist Ende Februar.
Unser Schiff, die Bremen, in einer amerikanischen Sondermission im Südpolarmeer unterwegs, darf wegen des starken Seegangs nicht verlassen werden. Nur Caroline Alexander, die mit »Die Endurance – Shackletons legendäre Expedition in die Antarktis« ein Buch über das »großartigste Abenteuer der Menschheitsgeschichte« geschrieben hat, und ich sind im Schlauchboot nach Point Wild gebracht worden. Wir wollen die Stelle aufsuchen, wo hundert Jahre zuvor die 22 Männer auf Rettung gehofft haben.
»Wie«, frage ich Caroline, »haben Shackletons Männer diese Hölle überlebt?«
»Sie haben durchgehalten, weil Wild ihr Vertrauen aufrecht hielt. Bis zuletzt.«
»Mit einem Trick?«
»Ja, er gab den Stellvertreter, den Boss gab es ja wirklich: Shackleton. Der aber weiß Gott wo war.«
»Aber die Zurückgebliebenen konnten sich nicht sicher sein, dass Shackleton noch am Leben ist.«
»›Leute‹, soll Wild immer wieder gesagt haben, ›unser Boss holt uns hier raus.‹«
»Ja. So retteten die beiden ihre Männer.«
Wie, fragen wir uns, hat es Wild geschafft, das Vertrauen seiner Leute in ihre Rettung aufrechtzuerhalten? Durch die schwierigste Jahreszeit hindurch, am desolatesten Ort der Welt: das eigentliche Expeditionsziel – die Antarktis-Durchquerung – längst aufgegeben, das Schiff verloren, Shackleton auf der Suche nach Hilfe 1500 Kilometer über den Ozean unterwegs und verschollen. Der »schlimmste Trip auf Erden«, wie Shackleton seine Endurance-Mission später genannt hat, war zum Albtraum geworden. Vier Monate Hunger, Hoffnungslosigkeit, Kälte und Finsternis für die auf der Insel Zurückgebliebenen – allein die Vorstellung dieser Situation ist schwer zu ertragen. Caroline und ich umarmen uns. Als wäre das Mitgefühl für diese Männer, die alle längst tot sind, nur geteilt zu ertragen.
Shackletons Überfahrt von Point Wild nach Südgeorgien in einem winzigen Rettungsboot, der James Caird, und sein anschließender Marsch über die Berge Südgeorgiens bis zum ersten bewohnten Ort speist bis heute das Pathos von der Notgemeinschaft, die überlebt. Die Stelle aber, an der ich jetzt auf Elephant Island stehe, dieser Ort als Tatsache, als Archiv der Hoffnung, die Wild mit Shackleton verband, erzählt eine andere Geschichte. Wir wissen heute alles über Shackletons Rettung bringende Überfahrt. Wild wusste damals nichts. Dieses Nichts füllte Wild mit Vertrauen.
Nur unter Tränen ist mir die Vorstellung möglich, wie es gewesen sein mag. Wie schwierig für Wild, nie zu verzagen, Entscheidungen zu treffen, selbst Vertrauen zu zeigen. Achtundzwanzig Männer waren durch die Hölle gegangen, ehe sie Elephant Island erreichten. Während der Monate auf dem Eis und der Tage in den Rettungsbooten, die folgten, galt das Wort Shackletons. Als 22 von ihnen ohne ihren Boss zurückbleiben, ist es Wild, der für Vertrauen und Sicherheit sorgt. Soweit er seiner Sache sicher sein kann. Dass sie alle sterben würden, ist das Wahrscheinlichste. Wild aber bleibt heiter, oft fröhlich. Er lässt sich nicht nervös machen, reagiert in Notfällen schnell. Den ganzen Winter über liegen die Männer in ihrer alten Kleidung unter ihren umgedrehten Rettungsbooten: ungewaschen, verrußt, triefend von Tran.
In der Zivilisation werden Menschen an Oberflächlichkeiten gemessen – auch weil es so viel Ablenkung und so wenig Zeit gibt. In der Wildnis – Abwesenheit von anderen Menschen und das Fehlen jeder Art von Zivilisation vorausgesetzt – ist Vertrauen eine Sache des Instinkts. Wild hielt es hoch. Bis zuletzt.
Es war zum Verzweifeln: Zuerst die lange Zeit des Wartens, dann die innere Leere, das Nichts. Der Rest des Winters eine anhaltende Verdunkelung, in der man sich dem Wahnsinn näherte. Nicht vorstellbar das Gefühl von Isolation: in einer Welt ohne Radio, ohne Telefon, jeder Einzelne auf den eigenen Körper zurückgeworfen, das gemeinsame Vertrauen auf Rettung längst aufgebraucht.
Ich wende mich von der glitschigen Felszunge am Kap Wild ab und schaue über das schwarze Wasser unter einem trüben Himmel. Das Wissen, dass die Männer damals nicht rebelliert haben, dass ihr Widerwille gegen Robbenfett, Kälte, die Enge ihrer Behausung nicht in einem Massaker endete, tröstet mich. Wieder stelle ich mir Frank Wild vor: Wie dieser Mann ohne Stolz und voller Würde herumsteht – immer er selbst. So hat er 21 Mann – hilflos und verzweifelt, wie Menschen nur sein können – 117 Tage lang am Leben gehalten. So haben seine Ausstrahlung, seine Selbstmächtigkeit, die Summe seiner Erfahrung und die Anerkennung, die ihm seine Männer schenkten, sie Tag für Tag am Leben gehalten.
Als Caroline und ich ins Schlauchboot steigen, um auf die Bremen zurückzukehren, versuche ich immer noch, den Zustand von Wilds Männern nachzuempfinden: Sie gaben ihm alles, was sie an Vertrauen aufbrachten, um ihm vertrauen zu können. Auf groteske Weise in ein selbstgewähltes Gefängnis geworfen, folgten sie dem kleinen, glatzköpfigen Mann, der ständig Pfeife rauchte, auch dann noch, als ihnen scheinbar keine Hoffnung mehr blieb.
Was ist es, was die Überlebensfähigkeit einer Gruppe von Menschen unter schwierigsten Umständen ausmacht? »Fotografieren konnte ich unseren Zustand nicht«, schreibt der Fotograf Frank Hurley später. »Wild aber summierte unsere mentalen Kräfte zur Überlebensstrategie.«
Jahre später bin ich wieder an Point Wild – diesmal bei gutem Wetter und zusammen mit meinen Töchtern Anna und Magdalena. Ich kann mir Frank Wilds Überlebenskunst noch immer nicht erklären. Also will ich seine Lebensgeschichte erzählen.
Discovery
»Wild«, stellt sich der kleingewachsene Mann – wenig Haare, marineblaue Augen – einem großgewachsenen Mann vor, der allein an der Reling der Discovery steht. Dieser sieht ihn fragend an.
»Frank Wild.«
»Ernest Shackleton«, sagt der andere mit irischem Akzent.
»Wie kommen Sie zu dieser Antarktisexpedition?«, fragt der Ire.
»Als Freiwilliger.«
»Und vorher?«
»Handelsmarine. Vor einem Jahr habe ich bei der Royal Navy angeheuert.«
»Und haben sich gleich für die British-National-Arctic-Expedition auf der Discovery beworben?«
»Ja, und bin angenommen worden, ausgewählt unter dreitausend Anwärtern.«
»Viertausend, sagt man«, weiß Shackleton.
»Ich wollte mich gar nicht bewerben, ein Kamerad von mir – großgewachsen, stark, sportlich – hat mich überredet, unsere beiden Namen an den Expeditionsleiter Robert Falcon Scott zu schicken.«
»Ist auch Ihr Kamerad dabei?«
»Nein, er ist nicht genommen worden.«
Frank Wild, 1873 in Skelton, Yorkshire, geboren, ist das zweite von dreizehn Kindern einer tiefreligiösen Lehrerfamilie. Seine blauen Augen und seine kleine Statur lassen ihn zurückhaltend erscheinen, obwohl er kräftig ist und geschickt. Im ersten Eindruck aber zeigt er wenig von einem Leader.
Frank Wild
Mit elf geht er von zu Hause fort, mit sechzehn hat er einen Job als Seemann und kreuzt auf allen möglichen Segelschiffen durch die Ozeane. Elf Jahre lang. Als er zur Royal Navy wechselt, hat er die Welt schätzungsweise neunmal umschifft. Obwohl ausgestattet mit Geduld, Loyalität und einer großen Portion Leidensfähigkeit, steht er lieber in der zweiten Reihe als ganz vorne. Auch in schwierigsten Situationen gilt er als überlegt und standhaft. Ist er es, weil ihm seine Mutter immer vertraut hat? Macht euch keine Sorgen um Frank, pflegte sie zu sagen. Er wird immer seinen Heimweg finden.
»Auch ich war bei der Handelsmarine, seit meinem sechzehnten Lebensjahr«, erzählt Shackleton, »es war mein Beruf, nicht aber mein Traum.«
Sein ausdrucksstarkes Gesicht und seine Statur beeindrucken Wild.
»Mir geht es ähnlich: Neunmal um die Welt ist genug«, sagt Wild.
Der hünenhafte Mann vor ihm nickt.
»Ich bin Offizier hier«, sagt er und reicht Wild die Hand. »Ernest.«
»Frank«, sagt Wild und betrachtet Shackleton, der über ihn hinwegzusehen scheint. Shackletons blaue Pupillen heben sich dabei deutlich im Weiß der Augen ab, seine Stirn ist glatt, das Haar in der Mitte gescheitelt, die kräftige Nase gibt dem Gesicht etwas herrisch Entschlossenes. Noch passen die beiden nicht zueinander. Bruchstücke von dem, was man ihnen über die Antarktis erzählt hat, stehen zwischen ihnen. Wie Eisberge im Polarmeer.
Am Heiligabend 1901 verlässt die Discovery Neuseeland, am 2. Januar 1902 passiert sie den Polarkreis, jetzt stößt sie durch einen Packeis-Gürtel zum Südpolarmeer vor. Immer größere Eisberge tauchen darin auf, glänzende Ungeheuer – zehn Kilometer lang, einen breit, Dutzende Meter hoch.
Shackleton, offen und immer gut gelaunt, sieht aus wie ein Held. Zum Siegen geboren! Dabei wirkt er nicht überheblich, es ist sein Charme, der ihm im Umgang mit Autoritäten hilft, seinen Teil zu bekommen und seinesgleichen für sich einzunehmen. Er strahlt die Selbstverständlichkeit eines Leaders aus, obwohl er mit allen auf Augenhöhe umgeht. Das macht ihn vertrauenswürdig. Die Gelassenheit, die von ihm ausgeht, lässt ihn überlegen und stark erscheinen, erkennt Wild. Unauffällig nimmt sich Shackleton so das Beste der anderen: ihr Vertrauen. Nur Scott, der die Privilegien des berufenen Leaders vor sich herträgt wie einen Schutzschild, lässt sich von Shackleton nicht beeindrucken. Shackleton aber, mit einer guten Portion Selbstmächtigkeit gepanzert, muss seine Überlegenheit nicht zeigen, und Verantwortung empfindet er nicht als Pflicht, sie gehört zu ihm wie sein Gewissen.
Ernest Shackleton
Anfang Januar 1902 kommen wieder Eisberge in Sicht: mehrere Kilometer lang und haushoch, die Formen von großer Vielfalt. Diese Monster, vom Schelfeis abgebrochen, von Wasser und Wind umgeformt, glänzen im schwarzen Ozean von Grün bis Silber.
Im McMurdo Sound können sich solche Eisberge über Jahre halten. Es gibt dort große offene Wasserstellen, wo das Meereis entsteht, wächst und sofort wieder verschwindet. Bei Kap Crozier zum Beispiel, wo die Kaiserpinguine nisten: ein windiger Platz, den Orkane regelmäßig leerfegen. Im Winter ist die Luft dort so kalt, dass die Meeresoberfläche an windstillen Tagen im Nu zufriert. Der Ozean ist dann mit einer dünnen Eiskruste überzogen. Der nächste Sturm aber treibt dieses Eis wieder fort, staucht es zu Eisbarrieren und schiebt dieses Packeis dann mehrere hundert Kilometer weiter nach Norden. Als wirkten in den Naturkräften Zauberei.
Das Schiff, die Discovery, läuft nicht gut. Es hat achtern zu viel Segelfläche und ist schwer zu mamövrieren, vor allem im Packeis. Das Meereis, das sich während des Winters über dem Rossmeer gebildet hat, ist von Schneestürmen nordwärts getrieben worden und staut sich jetzt in Barrieren vor Kap Adare. Diese Eisschichten verschwinden erst, wenn die Temperatur im Sommer ansteigt. Jetzt müssen sie durchbrochen werden!
»Diese Antarktisexpedition scheint die richtige Abwechslung für uns zwei zu sein«, sagt Wild zu Shackleton, als sie sich ein paar Tage später wieder begegnen.
»Ja«, sagt Shackleton, »in meinem Job bei der Handelsmarine war alles vorbestimmt: Du fährst ein paarmal um den Globus, wirst befördert, alles nur eine Frage der Zeit.«
»Auch mir hat diese Art von Routine nie gefallen.«
Ein halbes Jahr ist es nun her, dass Shackleton und Wild mit der Discovery England verlassen haben. Dass vier weitere Expeditionen – aus Schweden, Deutschland, Frankreich und Schottland – auf dem Weg in die Antarktis sind, interessiert die beiden nicht.
»Mich hat dieser Norweger begeistert«, sagt Wild nach einer langen Pause. »Fridtjof Nansen. 1888 hat er Grönland und 1895 mit der Fram die Arktis erforscht. Er ist weiter nördlich als alle anderen gewesen.«
»Ein Rekord«, weiß Shackleton.
»Vom Italiener Cogni inzwischen gebrochen«, korrigiert Wild, »ein Sieg des italienischen Königreichs.«
»Jetzt scheint die Erforschung der Antarktis Mode zu werden«, sagt Shackleton, während die Discovery durch loses Packeis segelt.
»Mich aber treibt nicht Patriotismus, mich lockt das Abenteuer.« Wild ist jeder Heroismus suspekt.
»König Edward ist doch an Bord gekommen, um uns ins Heldentum zu verabschieden.«
»Soll heißen, auch wir reisen zur Ehre des Königreichs?«
»Auch. Aber vor allem soll die Antarktis erforscht werden.«
»Was Nansen im Norden getan hat, gilt es jetzt im Süden zu tun.«
»Es geht mir dabei nicht um den schnellen Erfolg, Ruhm oder Reichtum«, sagt Shackleton. »Es geht mir um eine Abkürzung ins Abenteuer.«
»Mit der Handelsmarine ist auch bei mir Schluss«, sagt Wild.
»Ich fahre zur See, seit ich die Schule geschmissen hab und von zu Hause abgehauen bin.«
»Und die Eltern?«
»Mein Vater war Arzt und hatte nichts dagegen, die Mutter und meine Schwestern konnten mich nicht zurückhalten. Ich habe nur einen Bruder. Er heißt Frank, so wie du.«
»Ich habe mehr Brüder als Schwestern, mein Vater ist Lehrer. Von zu Hause weggerannt aber bin ich nicht, die Familie bedeutet mir viel.«
»Mir auch, ein bürgerliches Leben aber ist meine Sache nicht.«
»Wären wir sonst hier?«
Wild ahnt, dass Shackleton flunkert, wenn er den Ausreißer gibt. Dass er von zu Hause weggelaufen sei, ist eine Legende, die Shackleton selbst lanciert, seit er zur See fährt. Aber wahr ist, dass Vater Shackleton nur widerwillig seine Einwilligung gab, als der Sohn von der Schule ging.
»Als ich erstmals draußen war«, erinnert sich Shackleton, »hatte ich Heimweh. Plötzlich war ich von allem abgeschnitten, wusste aber, dass es anzukommen gilt: in meinem Leben.«
»Hast du auch darunter gelitten? Für dich allein auf hoher See, in der Einsamkeit und kein Weg zurück?«
»Ich kenne das: weit, weit von sich selbst weg zu sein – die Freiheit nur noch eine Illusion. Hier in der Antarktis aber fühle ich mich wie zu Hause.«
»Die Wichtigtuerei der Navy und von Scott aber nerven, sie stehen gegen die Natur des Menschen«, sagt Wild.
»Weil sie Mythen wie historische Tatsachen feiern?«
»Im Gegensatz zu mir. Ich bin nur neugierig.«
»Mich haben immer Bücher über Geschichte angezogen – ich meine eine bestimmte Art von Geschichte. Ich interessierte mich nie für Dynastien, Schlachten und Belagerungen, sondern für unternehmungslustige Männer, für Nationen, die Seeleute in unbekannte Meere sandten, für die Geschichte der Kolonialisierung und Erforschung anderer Kontinente. Von meiner frühesten Jugend an kannte ich mich aus mit all den Problemen von Forschungsreisen, ob in Zentralafrika, in Tibet, am Nord- oder Südpol. Ich las viel und erinnere mich bis heute an das Gelesene. Lange bevor ich in die Antarktis fuhr, wusste ich alles über Pack-, Treib- und Schelfeis. Und ich kannte jene, die vor mir auf dem Weg zu einem der beiden Pole gewesen sind. Das kann ich wirklich behaupten. Sie waren meine Helden, meine Propheten.«
»Sie alle haben gemacht, was sie sich vorgenommen hatten, ohne irgendjemanden zu fragen oder Rechenschaft abzulegen«, sagt Wild. »In der Wildnis herrscht Anarchie.«
»Auch ich bin hierher aufgebrochen, niemand musste mir den Weg in die Freiheit zeigen.«
»So haben wir unser Schicksal angefochten.«
»Schicksal?«, fragt sich Shackleton, »gibt es ein solches für unsereins?«
»Ja, wir sind unser eigenes Schicksal. Ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen und bin trotzdem gläubig geblieben«, sagt Wild.
»Auch ich vertraue Gott – nicht aber Scott.«
Beide, Shackleton und Wild, haben sich ihrem Schicksal gestellt, nichts geerbt und sich ihm nicht ergeben. Ihrer beider Leben sind auf ähnliche Erfahrungen gebaut, und beide glauben an ihre Zukunft. Denken sie sich diese doch selbst aus. Und sie wissen: Erst wenn es keinen Ausweg mehr gibt, in keine Richtung, außer der, die man selbst erkannt hat, beginnt das Abenteuer.
Shackleton und Wild, obwohl entgegengesetzte Charaktere, freunden sich an. Der eine großgewachsen, breitschultrig, muskulös; der andere unscheinbar, mit Glatze, scheu. Sie sind aber vom gleichen Geist beseelt: auf und davon! Das Volk mag sich nach Helden sehnen, die beiden sehnen sich nach Wildnis.
Robert Falcon Scott hingegen dient der Royal Navy und ist Kommandant ihrer Antarktisreise. Dank Sir Clements Markham, der sich das Unternehmen ausgedacht hat. Als Ideengeber, Königsmacher und Schiedsrichter sieht der sein Vorhaben in der Tradition der britischen Polarexpeditionen. Die Discovery ist eigens für dieses Unternehmen gebaut worden. Als Präsident der Royal Geographic Society hat Markham die Mittel organisiert und der Regierung einen Zuschuss abgetrotzt. Nur weil die Admiralität gezögert hat, ist die Forschungsreise ein ziviles Unternehmen, im Kern aber wird es von Männern der Navy getragen.
Auch Scott und Shackleton – beide sind Offiziere, beide ehrgeizig – sind entgegengesetzte Charaktere: Scott – unsicher, oft mürrisch, ein Zögerer – ist fähig, sich selbst bis zur Erschöpfung zu schinden; Shackleton – entscheidungsstark, engagiert und rücksichtsvoll zu allen Expeditionskameraden – ist der Typ Spieler. Bald schon sollen die beiden als Gegenspieler agieren. Shackleton aber, Offizier der Handelsmarine, jetzt Offizier der Royal Navy Reserve, hat sich von Anfang an unterzuordnen. Scott ist sein Chef.
»Ist die Discovery nicht eine private Expedition?«, sagt einer beim Abendessen.
»Ja, trotzdem gilt hier die Disziplin der Navy«, antwortet Scott streng.
»Dieses Gehabe gefällt mir nicht«, entfährt es Shackleton.
Von diesem Moment an beobachten sich die beiden Rivalen mit Argwohn. Scott bleibt der Expeditionsleiter, Shackleton aber, der keinen Unterschied macht im Umgang mit Mannschaft und Offizieren, wird bald zur Integrationsfigur.
»Ich mag keine aufgesetzte Hierarchie«, sagt Shackleton später zu Wild. »Das Leadership muss verdient sein.«
»Wie konnten sie Scott nur zum Kommandanten machen?«
»Frage ich mich auch. Er hat keinerlei Polarerfahrung.«
»Wir beide allerdings auch nicht.«
Wild und Shackleton sind offen miteinander, inzwischen Freunde, in gegenseitigem Respekt verbunden.
Drei Männer an Bord der Discovery haben Eis-Erfahrung: Louis Bernacchi, ein Physiker aus Australien, der die »Süd-Kreuz-Expedition« auf Kap Adare begleitet hat; Leutnant Armitage, Zweiter in Comand und wissenschaftlicher Leiter der Expedition, und Dr. Koettlitz. Die beiden haben sich in Franz-Josef-Land in der Arktis getroffen.
Weiter im Süden liegt aufgebrochenes Schelfeis. Dazwischen immer wieder Packeis – eine zerrissene weiße Masse – bis zum Horizont. Wild und Shackleton lauschen dem fernen Rumpeln der Eisschollen, am Himmel der Widerschein treibender Eisplatten. Gemeinsam erleben sie, wie die Discovery in eine archaische Welt eindringt. Stolz erfüllt sie und Neugier. Nach vier Tagen ist das offene Rossmeer erreicht, das sechzig Jahre zuvor von Admiral James Ross entdeckt worden ist.
Die Discovery ist ein langsamer Segler, die Besatzung ein zusammengewürfelter Haufen. Nicht Wilds Welt. Ihn stört die gespreizte Redeweise der Offiziere, die bald auch bei den Seeleuten zu hören ist. Ganz gleich, ob sie etwas zu besprechen haben oder sich über Alltägliches unterhalten, es klingt einfach aufgesetzt.
In der langsamen Zeit auf dem Schiff träumt Wild davon, aufzuwachen und dort zu sein, wo er hinwill. In der Stille, Wind und Sonnenlicht im Gesicht, die alte Welt vergessen. Wilds Träume decken sich dabei nicht mit den Zielen und Idealen des Expeditionsleiters. Scott fühlt sich der Königlichen Geographischen Gesellschaft sowie der Königlichen Marine verpflichtet. Wild weiß, die fünf Wissenschaftler an Bord, die auch nicht der Royal Navy angehören, sollen die Reise rechtfertigen. Sie kann zuletzt aber nur ein Fiasko werden. Weil Scott ein ganz anderes Ziel verfolgt: den Pol selbst.
In einem Rettungsboot landen Scott und Shackleton am 9. Januar bei Kap Adare, am Eingang zum Rossmeer, wo Borchgrevink 1895 einen Winter verbracht hat. Sie hinterlassen eine Botschaft für Versorgungsschiffe und fahren die Küste von Victoria Land entlang weiter nach Süden. Dann segelt die Discovery in östliche Richtung, das Ross-Schelfeis entlang. Neues Land wird gesichtet und nach König Edward VII. benannt. Die Halbinsel markiert das östliche Ende des Ross-Schelfeises.
Auf ihrem Weg zurück zur Ross-Insel fährt die Discovery in eine schmale Bucht ein, wo es möglich scheint, den eigens für die Erkundung der inneren Antarktis mitgebrachten Wasserstoffballon aufsteigen zu lassen. Scott schwebt als Erster in die Höhe, Shackleton als Zweiter. Er hat einen Fotoapparat dabei und bringt erste Luftaufnahmen vom Schelfeis mit. Scotts Plan, im McMurdo Sound vor der Ross-Insel im Eis zu überwintern, bleibt lange geheim. Auch, dass die Discovery über den Winter nicht nach Neuseeland zurück soll, erfahren die Männer erst nach der Landung.
Was für ein Ort! Wild steigt über einen steilen Hang zum Festland empor, um sich Übersicht zu verschaffen: das ideale Basislager in grandioser Landschaft. Darüber ragen die Vulkane Terror und Erebus in den Himmel: der eine rauchend, der andere erloschen. So scheint es wenigstens. Alles ist ruhig, und Wild weiß inzwischen: Hier werden sie den Winter verbringen. Die Discovery ankert derweil in einer kleinen Bucht am Ende einer Landzunge.
»Im nächsten Sommer«, sagt Scott, »wollen wir zum Südpol.«
Die Mannschaft ist begeistert, wenn die Idee auch nicht allen gefällt. Zuerst aber gilt es, die mitgebrachte Hütte aus Fertigteilen aufzubauen, alle Vorräte unterzubringen. Dann werden erste kurze Erkundungsreisen gemacht: Die Ausrüstung wird getestet, das umliegende Land soll verinnerlicht werden.
Noch vor Winterbeginn soll Shackleton eine Route nach Süden finden. Er startet am 19. Februar mit zwei Kameraden – dem Arzt Edward Wilson und dem Geologen Hartley Ferrar. Die erfahrenen Polarforscher – Armitage, Koettlitz und Bernacchi – hält Scott bewusst zurück. Ohne die geringste Erfahrung mit Reisen im Schnee, ohne Skier und Schlittenhunde – Scott hat sie nur widerwillig und auf Drängen von Nansen mitgenommen – startet Shackleton mit seiner Gruppe und führt sie ins Ungewisse. Bald schon verlieren sich die dunklen Punkte für die Zurückgebliebenen im unendlichen Weiß der Eisbarriere. Die Männer ziehen schwere Schlitten hinter sich her, schlafen im Zelt, stolpern durchs Whiteout. Es ist eine einzige Schinderei, aber sie führt die Männer immer tiefer in den Eiskontinent hinein. Shackleton marschiert mit seinen beiden Begleitern inzwischen auf White Island zu, eine Felsformation mitten im grauen Nichts, die Unendlichkeit dahinter ist nur zu fühlen.
Noch ist alles Improvisation, Versuch und Irrtum. Die Männer lernen, das Zelt auch im Sturm aufzustellen, die Schlitten zu packen, den Primus-Kocher zu bedienen. Häufig muss gerastet werden, und oft haben die Männer das Chaos vor Augen: zerrissene Zeltplanen, kaputte Schlitten. »Den anderen Gruppen wird es ähnlich ergehen«, tröstet Shackleton sich und seine Kameraden.
So lernt er das Kommando auch bei widrigen Umständen zu führen, obwohl er noch wenig Ahnung hat vom Überleben im Eis. Am liebsten wäre er gemeinsam mit Wild losgezogen, Scott aber lässt es nicht zu.
Kurz vor White Island sieht Shackleton von Süden her einen Schneesturm näher kommen. Er starrt in die Weite der unermesslichen Eisfläche. Wilson und Ferrar sind gerade dabei, das Zelt aufzubauen. Im Nu stecken sie im Wirbel aus Wind und Schnee. Sie sind bald nur noch mit dem nackten Überleben beschäftigt.
»Zur Hölle«, fluchen die Männer in ihren dicken Pelzkleidern. Sie können sich kaum bewegen, und zu sehen ist auch nichts. Der Sturm hebt die Zeltplane, die ohne festen Boden ist, wirbelt die Ausrüstung durcheinander. Wieder und wieder erfassen Böen das Lager, werfen schließlich das Zelt um.
»Was für ein Gelumpe«, schimpft Shackleton, »damit überleben wir keine Woche auf dem Weg zum Pol.« Trotzdem, die Männer suchen Schutz, hocken frierend stundenlang unter der flatternden Plane.
»Was hat sich Scott dabei gedacht?«, fragt sich Wilson.
»Nichts wahrscheinlich, für ihn denken andere«, sagt Ferrar.
»Da hast du wohl recht, er ist nur der Hampelmann von Sir Clements Markham, der – wie ich die Dinge sehe – selbst auch kein Zelt aufstellen kann.«
»So wie wir«, scherzt Wilson. Alle drei lachen.
»Fellhandschuhe und Fellstiefel sind sinnvoll«, meint Ferrar, »für längere Märsche aber müssen wir uns anders anziehen.«
»Mit diesen Windblusen, Balaklavas und Überhosen kommen wir nicht weit. Zurück auf der Discovery muss unsere Ausrüstung umgearbeitet werden.«
Shackleton ist fest entschlossen, Vorschläge zur Verbesserung der Kleider zu machen.
»Zum Glück haben wir die Kleider getestet, bevor es zum Pol geht«, sagt Wilson.
Warum aber ist in der Heimat nichts von alldem getestet worden? Kein einzelner Ausrüstungsgegenstand? Dazu kommt, dass sie nicht Ski laufen können, allen fehlt es an Erfahrung. Und niemand hat Routine im Umgang mit Hunden.
Erstaunlich, dass der erste Ausflug im Rahmen der Discovery-Expedition nicht in einer Katastrophe endet. Wild macht dann bei seinem ersten Trip ähnliche Erfahrungen wie Shackleton. Beide erkennen Fehler im System und korrigieren sie – zurück im Winterlager – sukzessive: Hundeteams, die verweigern, werden neu zusammengestellt; Schlitten verbessert; zwei Offiziere, die den Erebus an einem einzigen Tag besteigen und wieder zurückkommen wollen, belächelt. Schlittenteams, die weder den Kocher noch die Lampe bedienen können, werden aufgeklärt. Zelte aufstellen und die Kleidung richtig herum anziehen können zu Winterbeginn alle.
In diesem ersten Winter in der Antarktis sind Wild und Shackleton häufig draußen auf dem Eis. Nicht nur zur Jagd. Sie wollen tätig sein, Robben und Pinguine jagen, überzeugt, dass Frischfleisch Skorbut vorbeugt.
»Scott hält nichts davon«, sagt Wild.
»Weil er die Tiere nicht töten will.«
»Er ist auf diese Navy-Zwieback-Diät eingeschworen, sage ich dir.«
»Dabei weiß er von Nansen, dass sich Expeditionen in die Arktis nur mit Fleisch über den Winter gerettet haben.«
»Habe auch davon gelesen: Monatelang haben Nansen und Johansen 1896 in ihrem Unterschlupf in einer Art Höhle gelegen. Sie aßen nichts als Bärenfleisch.«
»Ohne an Skorbut zu erkranken«, ergänzt Shackleton.
»Und wie bringst du es Scott bei?«
»Ob der Captain will oder nicht, ich werde den Koch anhalten, der Mannschaft frisches Fleisch zu servieren. Nicht nur als Abwechslung zur Navy-Diät, sondern als eine Art Medizin.«
»Das Robbenfleisch aber wollen die Leute nicht.«
»Wegen des fischigen Beigeschmacks, ja. Die Eskimos aber leben seit tausend Jahren davon. Hauptsächlich wenigstens.«
»Ihre Rezepte aber kennt hier keiner.«
»Wir müssen lernen, Pinguin oder Krabbenfresser zuzubereiten, und zwar so, dass die Mahlzeiten schmecken.«
»Von denen jedenfalls gibt es hier genug.«
»Ja, es gilt, Vorräte anzulegen, bevor die Tiere weg sind. Fleisch ist im Nu gefriergetrocknet, jahrelang haltbar. Wir brauchen es auch als Hundefutter.«
»Du meinst, wir sollten tote Robben und Pinguine stapeln wie Eisklötze, die wir als Süßwasservorrat herbeischleppen?«
»Jedenfalls ist genug Getier da«, sagt Shackleton. »Wir brauchen zuallererst Nahrung und Wasser.«
»Wird ein hartes Stück Arbeit, genügend Tiere für den langen Winter zum Schiff zu bringen.«
»Wie anders sollen wir uns sonst die Zeit vertreiben?«
»Hunde trainieren, Ski laufen lernen, Ausrüstung testen.«
»Tut sonst ja niemand.«
»Weil Scott ein Dilettant ist.«
»Wie wir alle.«
»Nein, Armitage, Koettlitz und Bernacchi haben Polarerfahrung, auch wenn sie vorerst nicht zum Einsatz kommen.«
Tage später ist Wild mit einer Gruppe von zwölf Mann nach Kap Crozier unterwegs. Scott dirigiert diese Übungsmärsche vom Winterquartier aus. Die Kolonne ist zu langsam, auch weil die Männer mit Hunden immer noch nicht umgehen können und alle erst lernen müssen, Handgriffe mit dicken Handschuhen zu tun, im Whiteout Kurs zu halten und auf Skiern zu laufen. Royds, der die Verantwortung trägt, schickt neun Mann unter dem Kommando von Barnes zurück, während er mit zwei Mann auf Skiern und mit leichtem Schlitten weiterzieht.
Bevor die Umkehrer das Schiff erreichen, überrascht sie ein Blizzard: ihre erste Sturm-Erfahrung in der Antarktis. Die schlechte Sicht nimmt mit der Schneedrift zu, bald klagen die Männer über Erfrierungen. Endlich kommt der Befehl, die Zelte aufzubauen. Wild ahnt die Gefahr, in der sie stecken, sagt aber nichts, auch er folgt dem Kommando von Barnes. Wie alle anderen auch.
Der Orkan reißt ihnen zuerst die Planen aus den Händen, dann, im Durcheinander, kommt die Übersicht abhanden. Zwischen Stangen, Schnüren und Schlitten drängen sich alle unter die flatternde Hülle. Sie haben aber ihre Schlafsäcke nicht ins Zelt geholt und können nicht mehr hinaus.
Ein solcher Schneesturm in der Antarktis dauert meist achtundvierzig Stunden, öfters aber auch eine Woche oder zwei. Als der Blizzard am Nachmittag etwas nachlässt, gibt Barnes den Befehl, Richtung Hut Point weiterzuziehen, zurück zum Schiff. »Nur dort sind wir in Sicherheit«, sagt er. Fünf Kilometer von ihrer Winterhütte entfernt aber verlieren sie im Nebel die Orientierung. Wie Blinde stolpern sie durch Schneewehen, queren Mulden und steile Hänge. Einmal sinken sie bis zu den Knien ein, dann wieder ist der Boden eisig, und sie rutschen aus. Im dichten Schneetreiben kämpft jetzt jeder für sich.
»Sichtkontakt halten«, ruft Barnes.
Es wird aber immer schwieriger, den Vordermann nicht aus den Augen zu verlieren. Nur noch Angst, Kälte und Hunger treiben die Männer weiter.
»Zusammenbleiben!« Wieder kommt der Befehl von Barnes. Folgen ihm alle? Im Gänsemarsch? Im Zwielicht ist nichts zu erkennen.
»Wo ist Hare?«, schreit einer von weiter hinten. Wild dreht sich um. Aber da ist nur Schneetreiben. Ein paar Schatten schließen zu ihm auf.
»Hare?«, rufen die Männer durcheinander.
»Er fehlt!«
Die Kolonne ist zum Stehen gekommen. Kein Zweifel, Hare ist verschwunden. Er muss den Hang, den sie gequert haben, hinabgerutscht sein. Barnes befielt seiner Gruppe zu warten:
»An Ort und Stelle ist stehen zu bleiben!«
»Ich will absteigen, um nach Hare zu suchen«, sagt er. Bald schon ist Barnes in der dichten Schneedrift nicht mehr zu sehen, und auch er bleibt verschwunden. Als Dritter folgt Evans den beiden Vermissten in den Abgrund – auch er ohne Wiederkehr. Der Nächste in der Hierarchie ist der Offizier Quartly. Auch er entscheidet sich für die Suche nach den Kameraden, und auch er kommt nicht zurück.
Die fünf Männer, die oben noch warten, sind verzweifelt, unterkühlt. Verängstigt starren sie ins Nichts. Kommt denn keiner der vier Verschwundenen zurück? Befehl aber ist in der Navy Befehl: Die Wartenden bleiben stehen, wo ihnen befohlen worden ist, stehen zu bleiben. In ihrer Untätigkeit kommt ihnen die Wartezeit wie eine Ewigkeit vor.
Bis alle zu Wild schauen.
»Frank, hilfst du?«, fragt einer.
Einen Moment lang sieht Wild in die Runde. Alle stehen verzagt da. Wie gelähmt.
»Wie?«, will er fragen.
Auch er hat keine Lösung. Er lässt die Schultern hängen wie all die anderen. Dann – seine Arme halb gehoben, im Gesicht ein Ausdruck der Hilflosigkeit – zeigt er nach unten.
»Warum ich?«
»Frank, du kannst es«, sagt einer.
Wild schaut fragend in die Runde: »Was?«
»Das Richtige tun.«
Der Satz jagt die Leere aus seinen Augen. Wild ist plötzlich wie verwandelt. Er schaut in den Abgrund, geht kurz hin und her, noch einmal wandert sein Blick über die Gesichter der Männer neben ihm. Bis er sich aus dem stummen Häuflein Elend schält. Alle nicken. Wild strafft sich, steigt in den steilen Hang unter ihm ein, verschwindet im Dunkel von Schneedrift und Nacht. Man hört nur noch die Brandung am Schelf und den Atem der Wartenden.
Wild findet nichts als Abgründe. Also steigt er wieder auf und überredet die vier oben Wartenden, mit ihm zurück zum Schiff zu marschieren.
»Durch Nacht und Eis zurück oder wir sterben«, ist seine Überzeugung.
»Was ist mit den anderen?«
»Wir können ihnen jetzt nicht helfen«, sagt er mit vor Kälte bebender Stimme.
»Aber unser Befehl heißt warten!«
»Bis wir erfrieren?«
»Befehl ist Befehl«, sagt ein Dritter.
»Unsere Pflicht aber bleibt es auch, nicht zu sterben«, sagt Wild.
Alle wissen, dass sie erfrieren, wenn sie sich nicht bald bewegen. Sie müssen zum Winterquartier kommen, bevor es zu spät ist.
»Stopp«, versucht Vince, der seine Kiefer nicht mehr bewegen kann, zu sagen. Geht es zu Ende mit ihm? Wie irrsinnig geworden, starrt er Wild aus schneeverklebten Augen an. Er will sich hinhocken. Nicht um zu sterben! Wild aber zerrt ihn weiter, hilft ihm immer wieder auf die Beine. Bis er so stürzt, dass alle, die ihn zu stützen versuchen, aus dem Stand gerissen werden. Sie rutschen den Hang hinunter, endlos, der Eiskante entgegen, wo das Schelf ins Meer kalbt. Vince hält sich an Wild fest, und Wild versucht, Vince zu halten. Im Fallen aber werden sie auseinandergerissen, und als Wild im Schnee zum Stillstand kommt, verliert er Vince aus den Augen. Er hört noch, wie – weit weg – ein Körper ins Wasser klatscht. Die anderen drei Abgerutschten kann Wild aufhalten. Als sie Luft geholt, den Schnee abgeschüttelt und sich vergewissert haben, dass sie unverletzt geblieben sind, kriechen sie zur Stelle, wo Vince verschwunden ist. Das Schelf unter ihnen bricht senkrecht ab – hundert Meter senkrecht bis ins Meer.
»Vince?«, sagt einer.