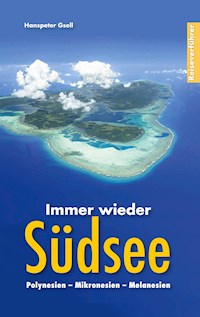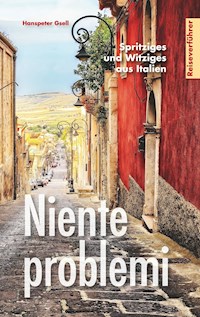Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Mein Grossonkel brach 1908 zu einer abenteuerlichen Reise nach Afrika auf. Ich habe seine Aufzeichnungen ergänzt und überarbeitet. Es entstand ein fantasievoller, autobiografisch geprägter Schelmenroman in der Tradition von Till Eulenspiegel. Onkel Fritz war zugleich Älpler, Bergler und Weltenbummler. Seine Geschichten erzählen mit viel Schalk und Witz von seiner anarchischen Unangepasstheit. Das Wort Rassendiskriminierung existierte in Kaufmanns Welt nicht, seine Sicht der Dinge war die eines weissen Kolonialisten anfangs des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Mein Großonkel brach 1908 zu einer abenteuerlichen Reise nach Afrika auf. Ich habe seine Aufzeichnungen ergänzt und überarbeitet. Es entstand ein fantasievoller, autobiografisch geprägter Schelmenroman in der Tradition von Till Eulenspiegel.
Onkel Fritz war zugleich Älpler, Bergler und Weltenbummler. Seine Geschichten erzählen mit viel Schalk und Witz von seiner anarchischen Unangepasstheit. Das Wort Rassendiskriminierung existierte in Kaufmanns Welt nicht, seine Sicht der Dinge war die eines weißen Kolonialisten anfangs des 20. Jahrhunderts.
Der Autor
Hanspeter Gsell ist als Autor von Büchern über Mikronesien, Polynesien, Melanesien und Italien bekannt geworden. Seine Kolumnen und Reportagen erscheinen in Tageszeitungen und in Fachzeitschriften.
Inhalt
Vorwort
I Schattloch | Garstigen |
II Marseille | Venedig | Mailand |
III Marseille | Port Said | Dschibuti |
IV Dschibuti | Dire Dawa |
V Addis Abeba | Butajiara |
VI Hosanna |
VII Hosanna |Souk |
VIII Wolamo | Kutscha |
IX Gofa | Mella | Kaffa |
X Bako | Omo |
XI Kanbata |
XII Addis Abeba |
XIII Meta Hara |
XIV Mehesso |
XV Dschibuti | Garstigen |
Quellenangaben |
Vorwort
Als sie mir das Buch überreichte, dachte ich zuerst nicht viel dabei. Es war 326 Seiten dick, 380 Gramm schwer und bordeauxrot. Der Schutzumschlag fehlte. Meine Mutter beobachtete mich, während ich darin blätterte und fragte: «Kennst du Onkel Fritz aus Afrika?»
Nein. Ich kannte niemanden dieses Namens. Schon gar nicht in Afrika.
«Ich schenke dir dieses Buch», meinte sie. «Allerdings nur unter der Bedingung, dass du mit keiner Menschenseele darüber sprichst. MIT NIEMANDEM! Schon gar nicht mit meiner Schwester. Denn Onkel Fritz war ein Vagant, ein Schelm, ein komischer Kauz. Der hat Sachen geschrieben in seinem Buch, das glaubst du gar nicht! Wenn meine Schwester davon erfährt, wird sie noch schwermütig.»
Einer meiner Vorfahren soll ein Buch geschrieben haben? Davon hatte ich keine Ahnung! Ich wusste zwar jetzt, dass es sich bei Onkel Fritz um einen Bruder meiner Großmutter und somit um einen Großonkel handelte. Er soll ein eher unstetes Leben geführt haben, sicher war er nie als Autor bekannt geworden.
Als er in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts einen Verleger für seine Afrika-Abenteuer fand, dürfte einer besonders perplex gewesen sein: er selbst, Friedrich «Fritz» Kaufmann.
Das Wort Rassendiskriminierung existierte in Kaufmanns Welt nicht, seine Sicht der Dinge war die eines weißen Kolonialisten anfangs des 20. Jahrhunderts.
Sollte ich das Leben von Onkel Fritz so beschreiben, wie es war? Oder sollte ich besser die Finger davon lassen? Ich habe mich FÜR das Buch und FÜR Onkel Fritz entschieden. Friedrich «Fritz» Kaufmann war Zeitund Augenzeuge: Seine Geschichten sollen weitererzählt werden.
Das Kaiserreich Abessinien war eine Monarchie im Nordosten von Afrika auf dem Gebiet der heutigen Staaten Äthiopien und Eritrea. Sie bestand von etwa 980 vor Christus bis 1974. Am 12. September 1974 wurde Haile Selassie gestürzt. Das Kaiserreich wurde abgeschafft und von der «Demokratischen Volksrepublik Äthiopien» abgelöst.
Das Land durchlief in seiner langen Geschichte unzählige Verwaltungsreformen. Fürstentümer und Königreiche sind untergegangen, Provinzen wurden neu organisiert.
Viele abessinische Wörter wurden von Kaufmann phonetisch geschrieben. So weit wie möglich habe ich für die von ihm benutzten Namen heute gebräuchliche Bezeichnungen verwendet. Ein nicht immer einfaches Unterfangen: Abessinien ist mit über achtzig Ethnien und etlichen Sprachen ein Vielvölkerstaat.
Kaufmann hat dieses Buch in der Mitte des 20. Jahrhunderts und somit lange vor den großen Rechtschreibreformen geschrieben. Das Original wurde zwar in deutscher Sprache verfasst. Trotzdem habe ich mir erlaubt, den Text zu transponieren, ihn dem heutigen Stil anzupassen.
Einige Helvetismen habe ich durch leichter verständliche Ausdrücke ersetzt. Es war mir jedoch ein Anliegen, den Text so authentisch wie möglich wiederzugeben.
I Schattloch | Garstigen 1892 – 1908
Wenn Sonntagskinder Pechvögel sind Hermann Gessler tanzt Der Tote vom Garstighubelsee Heidi im Schattloch Der Tag aller Tage Ein Leben als Vogelhirni Fritz unter Beschuss Fritz sucht die Front Fritz meldet sich ab
Wenn Sonntagskinder Pechvögel sind
Es war Sonntag, der 24. Januar 1892, als der kleine Kaufmann auf dem Hof Schattloch ob Garstigen das Licht der Welt erblickte. Obwohl er ein Sonntagskind war, schien es zunächst nicht so, als ob er auch ein Glückskind wäre.
Die Götter hatten nämlich alles unternommen, um die Geburt zu verhindern. Die Hebamme war im meterhohen Schnee stecken geblieben, der angehende Vater hockte im «Goldenen Sternen» und trank dort Kafi Fertig, eine teuflische Mischung aus dünnem Kaffee und starkem Schnaps.
In den Tagen zuvor hatte es ununterbrochen geschneit. Rund um Garstigen lag an diesem Abend beinahe ein Meter Neuschnee, von den Bergen waren die Lawinen im Stundentakt herunter gedonnert.
Die einzige anwesende Fachkraft bei Kaufmanns Geburt war ein Viehdoktor namens Tschümpperli, der im Stall nebenan eben einer Kuh beim Kalbern geholfen hatte. Und dies, obwohl man ihm vor Jahren die Praxis versiegelt hatte.
Er war nämlich dabei erwischt worden, wie er den Mitgliedern des lokalen Schwingvereins leistungsfördernde Medikamente verkauft hatte. Dummerweise hatten seine Pülverchen vornehmlich die Milchproduktion von Kühen und nicht – wie erwünscht – die Muskelproduktion des schmalbrüstigen Nachwuchses angeregt.
Als deren Brüste anschwollen, Muskeln und Hirnmasse jedoch dramatisch schmolzen, ging ihnen ein Licht auf. In Tschümpperlis Praxis hingegen ging es aus.
Bei der Geburt war einiges schiefgelaufen. Was angesichts der Alkoholfahne des guten Doktors nicht verwunderlich war.
Und so trat der kleine Kaufmann per Sturzgeburt ins Leben ein. Da man ihn zuerst gar nicht finden konnte, er war nämlich kopfüber unter eine Kommode gerollt, verging einige Zeit, bis er endlich an Mutters Brust landete und seinen ersten Schluck Milch trinken konnte.
Geburtshelfer Tschümpperli machte sich auf den Nachhauseweg. Als er im «Goldenen Sternen» Licht sah, überkam ihn ein gewaltiger Durst und er beschloss, diesen umgehend zu löschen.
Am Stammtisch traf er Vater Kaufmann, teilte ihm die freudige Nachricht mit und bestellte einen Schoppen Weißwein. Und da es in jenen Zeiten nicht viel zu feiern gab im Dorf, begossen die Anwesenden die Geburt, als ob die Welt am nächsten Tag untergehen würde.
Gegen morgen machte sich Vater Kaufmann auf den Weg zum evangelischen Pfarrhaus, fand jedoch nur den Mesmer, der ihm beschied, der Herr Pfarrer sei heute unpässlich. Kaufmann aber wollte unbedingt noch heute seinen Sohn taufen lassen. Man wusste nie! Ob er denn nicht «den Anderen» benachrichtigen könne, fragte er den Mesmer.
Und so kam es, dass der Sohn von Kaufmann nicht von einem evangelischen, sondern von einem römischkatholischen Geistlichen auf den Namen Friedrich, genannt Fritz, getauft wurde
Obwohl die Prognosen nicht zum Besten standen, die Geburt war schwierig gewesen, entwickelte sich der Bub prächtig. Ganz abgesehen davon, sollte er später nicht studieren, sondern melken und misten.
Kaum konnte Fritz auf eigenen Füßen stehen, musste er im Stall mitarbeiten. Zum Melken musste man nicht besonders groß sein. Ganz im Gegenteil. Und so brachte er es in den nächsten Jahren zu beträchtlicher Handfertigkeit, die Kühe waren zufrieden und der Muni stierte blöde.
Erst als Fritz älter wurde und sich so einige Gedanken zum Geschlechtsleben des Rindviehs machen konnte, verstand er den Blick des Munis und verspürte so etwas wie Erbarmen. Er begann mit ihm zu sprechen. Er erzählte ihm von der Schule, die er jetzt besuchte.
Zuerst versuchte er, dem Muni das Rechnen beizubringen. Als Vater dies hörte, versohlte er seinem Sohn den Hintern, ließ ihm die Ohren stehen und befahl ihm, Schnee zu schaufeln. Fritz wollte entgegnen, dass Sommer sei und deshalb kaum Schnee vor der Hütte liege, enthielt sich jedoch einer Antwort. Sein Vater konnte Widerspruch nicht leiden.
Da aus dem rechnenden Muni nichts wurde, verlegte er sich auf die Pflege der deutschen Sprache. Er las ihm Gedichte vor und erzählte ihm von Goethe und Schiller. Und ihm kam eine Idee.
Er könnte sich mitsamt seinem Muni in einer Varieté-Schau bewerben! Noch wusste er nicht, was er denn diesem Riesenvieh beibringen konnte. Zumindest mit der Rechnerei war wohl kein Preis zu holen und auch mit der deutschen Sprache standen die Chancen schlecht.
Ob man ihm wohl das Tanzen beibringen konnte? Er müsste vom lokalen Schuhmacher vier Steppschuhe schustern lassen und dann würden sie gemeinsam über die Bühne schweben. Als er sich den schwebenden Hornochsen vorstellte, bekam Fritz einen Weinkrampf. Er beschloss, die Idee zu begraben.
Er wollte eben den Stall verlassen als er Nachbars Schimmel sah. Da war doch mal was mit Pferden!
Ein Typ hatte unerzogenen Gäulen beigebracht wie man sich benehmen soll und dafür erst noch Geld erhalten. «Pferdeflüsterer» hatte man ihn genannt.
Fritz, der Muniflüsterer!
«Sehen sie zum ersten Mal im Circus: Fritz, der Muniflüsterer! Vor den Augen des verehrten Publikums wird er live und ohne doppelten Boden den Todesmuni aus dem Schattloch beflüstern. Wir bitten das sehr verehrte Publikum um absolute Ruhe!»
Hermann Gessler tanzt
Bis Fritz so weit war, gab es noch allerhand zu tun. Zuerst erhielt der Muni einen Künstlernamen, Fritz nannte ihn fortan Gessler, Hermann Gessler.
Als er den Muni das erste Mal losband, sagte dieser danke und demolierte den ganzen Stall. Anschließend lud er den Vater auf die Hörner und raste, als ob ihm der Metzger auf den Fersen wäre, zum Bahnhof. Dort rammte er eine Draisine, schiss auf den Bahnsteig und legte sich auf Gleis 2 nieder.
Da sich Herr Gessler weigerte, die Geleise zu verlassen, kehrte Vater ohne ihn nach Hause zurück. Dem Geschrei nach zu urteilen, fand das Treffen mit Fritz nicht gerade in feierlich-würdiger Atmosphäre statt. Nach nur kurzer Unterhaltung sah man Kaufmann Junior wie eine angesengte Wildsau zum Bahnhof rennen.
«Du wirst diesen Muni jetzt immediat vom Gleis 2 runter flüstern!», befahl ihm der Oberbahnhofsdirektor. «Hast du verstanden? Sofort!», beschloss er seine Ansage und entfernte sich. Er setzte sich zu den anderen Zuschauern. Es mochten wohl bereits einige Dutzend sein, die das Spektakel miterleben wollten.
Fritz aber ging zu seinem Muni, setzte sich neben ihn und sagte nur: «Sachen machst du.»
Und dann, etwas ernster: «Jetzt reicht es, du stehst nun auf und folgst mir auf Schritt und Tritt bis in deinen Stall, kapiert?»
Natürlich dachte Herrmann nicht im Traum daran, etwas anderes zu tun, außer im Schotterbett von Gleis 2 zu liegen und gelegentlich mal über den Zaun zu fressen. Das Publikum wurde langsam ungeduldig.
Eben beabsichtigte der Fotograf des lokalen Intelligenzblatts seine Siebensachen zusammenzupacken, als Bewegung in die Sache zu kommen schien. Fritz hatte sich auf den Nacken des Rinderbratens gelegt und streichelte ihm die Backen. Er beugte sich noch tiefer und schien ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Und ein Wunder geschah! Der Muni erhob sich, zaghaft zwar, aber stetig.
Man würde noch lange darüber diskutieren, ob er sich zuerst auf das Hinter- oder das Vorderviertel gestellt hatte. Da der Fotograf die Balance auf dem glitschigen Perron verloren hatte und mit seiner Kamera in Hermanns Hinterlassenschaft gelandet war, gibt es leider bis heute keine Bilder von der Auferstehung des Munis zu sehen.
«Ein schöner Scheiß!», rief der Fotograf und verließ den Ort des Grauens. Somit würden die Leser nie erfahren, welch‘ geheimes Wort Fritz seinem Muni zugeflüstert hatte. Brav trottete er hinter Fritz her und beide verschwanden im Sonnenuntergang.
Seit diesem Vorfall kamen immer wieder Leute auf den abgelegenen Bauernhof, wollten den Wundermuni sehen und Fritz das Zauberwort entlocken. Doch der konnte schweigen wie ein Appenzeller Käse, melkte weiter seine Kühe und freute sich des Lebens.
Es war ruhig geworden im Schattloch, seit Vater im Gefängnis saß. Dort hockte der alte Kaufmann, weil man ihn beim Bescheißen erwischt hatte. Allerdings hatte sich Vater auch saublöd angestellt. Er wollte den Milch-Kontrolleur nämlich glauben machen, seine sechs Kühe gäben täglich 600 Liter Milch.
Um die Haushaltskasse etwas aufzubessern, ging Fritz mit Rosa auf Tournee. Rosa war seine um zwei Jahre ältere Schwester. Sie trug über der Stirn einen hellbraunen, halbkreisförmigen Haarkamm. In goldenen Lettern stand darauf «Gott schütze Dich».
Die Tournee führte während der Fastnachtszeit durch die Wirtschaften von Garstigen. Als «Maria und Joseph» verkleidet, sangen sie vor mehr oder weniger angeheitertem Publikum Lieder und trugen biblische Verse vor. Wenn die Mutter nach ihrer Heimkehr die Kupfer- und Silbermünzen zählte, strahlten ihre braunen Augen.
An Sonntagnachmittagen arbeitete Fritz regelmäßig in der Kegelbahn des Restaurants «Rütli». Dort musste er die umgestürzten Kegel wieder aufstellen, die ausgetrunkenen Biergläser abräumen und die vollen Aschenbecher leeren. Das verdiente Geld holte sich Mutter am Abend im Wirtshaus ab.
Während Vaters Aufenthalt in Schweden hatte Fritz Zeit im Überfluss, seinen Muni weiter zu unterrichten. Er brachte ihn so weit, dass man auf ihm reiten konnte. Man musste dabei vorsichtig vorgehen, des Munis Kühe durften keinesfalls anwesend sein. Sonst wurde ihm ganz anders, und er war zu nichts mehr zu gebrauchen.
Mit der Zeit beherrschte das Vieh eine ganze Anzahl lustiger Kunststücke, gab Pfötchen und holte Stöckchen. Er war imposant anzusehen, wenn er im Handstand ein paar Schritte über die Wiese hoppelte. Nur mit dem Kopfstand bekundete Herrmann noch einige Mühen.
Der Tote vom Garstighubelsee
Im Januar 1907 erzählte der Lehrer, dass der Garstighubelsee zugefroren sei. Sie würden deshalb den im Sommer geplanten Klassenausflug kurzerhand vorverlegen und gemeinsam «über das Wasser wandern». Das würde sicher einen Heidenspaß machen!
Im Frühtau lustig über das Wasser wandern? Fritz wusste nicht, wie so etwas funktionieren sollte. Zu Hause war der Hofbrunnen zugefroren und die Glasscheiben in seinem Schlafzimmer waren jeden Morgen von Eis bedeckt. Das sollte lustig sein?
Der Pfarrer hatte zwar erzählt, dass schon in alten Zeiten einer über einen See gewandert sei. Aber der Pfarrer erzählte viel, wenn der Tag lang war. Sicher musste er nicht jeden Morgen zuerst das Taufbecken enteisen!
Natürlich ging Fritz mit auf den Ausflug. Mit dem Pferdefuhrwerk von Hansjakob Furrer hatte man gegen Mittag den See erreicht. Tatsächlich war er zugefroren. Auf der Eisfläche tummelten sich Dutzende von Menschen.
Ein Italiener hatte einen Marroni-Stand aufgebaut, der Metzger grillte Würste. Fliegende Händler boten alles an, was noch im Entferntesten mit einem zugefrorenen See zu tun hatte.
Am Ufer konnte man Schlittschuhe mieten oder sich Kufen an die Kinderwagen montieren lassen. Die Eispolizei, Uniformierte auf Schlittschuhen, sorgte für Ruhe und Ordnung.
Gegen Mittag versuchte ein Einspänner über die Eisfläche ans andere Ufer zu gelangen. Den Fahrer, es soll sich um einen nahen Verwandten von Fritz gehandelt haben, hat man danach nie mehr gesehen. Auch das Ross nicht.
Fritz erkundete den zugefrorenen See, schon bald fand er eine eisfreie Stelle. Aus einem Stöckchen und einer Schnur, die er immer bei sich hatte, konstruierte er eine Angel. Mit seinem Taschenmesser bohrte er ein Loch in das Eis.
Plötzlich fühlte er, dass die Leinenschnur hängen geblieben war. Er zog behutsam und spürte, dass er einen großen Fisch an der Angel hatte. Hier aber irrte sich Fritz: Etwas Dunkles hatte sich in der Leine verheddert, abscheulicher Geruch breitete sich aus. Mit Grauen erblickte er eine unbekannte Männerleiche; ihr Frack pendelte im Wasser wie eine müde Flosse.
Das Gesicht der Leiche schillerte in allen Farben. Fritz machte sich schnell von dannen, um seinen Lehrer und die Polizei zu benachrichtigen. Die Polizisten erschienen mit einem großen Schlitten und brachten den Toten ans Ufer.
Fritz erhielt den sonderbaren Auftrag, bei der Leiche zu wachen, damit sich keine gefräßigen Ratten an sie heranmachen konnten. Als der Sarg endlich gebracht wurde, machte sich Fritz aus dem Staub. Er ging zurück zur Klasse, um nicht auch noch beim Einsargen mithelfen zu müssen.
Heidi im Schattloch
Es wurde Frühling, Vater saß immer noch im Kerker; Mutter weinte sich die Augen aus dem Kopf und Fritz war dringend auf neue Ideen zur Aufbesserung des Haushaltsbudgets angewiesen.
Die ersten Touristen kraxelten die Wiesen herauf. Das Geld saß ihnen locker am Hintern, man musste es nur noch pflücken.
Vielleicht könnte man es mit einem Freilufttheater auf dem Schattloch versuchen. Die Geschichte von Heidi, dem Geissenpeter und dem Alpöhi? Genau! Aber woher eine Heidi nehmen und nicht stehlen?
Er versuchte es bei seinen Mitschülerinnen, hatte aber kein Glück. Er wollte die Idee schon aufgeben, als er SIE traf. Sie war in seinem Alter, hatte ihr blondes Haar zu langen Zöpfen geflochten und bewohnte zusammen mit ihren Eltern seit einigen Wochen ein Ferienhaus im Dorf.
Da sie sich furchtbar langweilte, war sie sofort bereit, eine Schauspielkarriere zu beginnen. Nur mit der Sprache gab es noch Probleme: Elisabeth, so hieß sie, sprach nur Berliner Dialekt. Das aber ging überhaupt nicht! Da sie jedoch ein äußerst gescheites Kind war, beherrschte sie das Drehbuch schon nach wenigen Tagen beinahe perfekt.
Der kleine Sprachfehler, sie lispelte etwas und konnte das ‘Ch’ wie in Chue oder Chaib nicht richtig aussprechen, wirkte durchaus charmant. Es kam auch äußerst gelegen, dass sie leicht schielte. Dieser Silberblick war es, der die Portemonnaies spendierfreudiger Touristen öffnen würde.
Zuerst aber musste man noch die tierischen Mitspieler der Älpler-Bühne einkleiden. Zusammen malten sie die weißen Geißen braun an und fertig waren die Gämsen. Den Geißbock verwandelten sie mit nur wenigen Handgriffen in einen Steinbock.
Auch die Kostüme für Heidi und den Geissenpeter waren schnell hergestellt. Fritz streifte sich einen alten Kartoffelsack über und setzte sich den Tiroler Hut auf, den ihm letztes Jahr ein amerikanischer Tourist geschenkt hatte.
Für Elisabeth, jetzt Heidi, fand sich in Mutters Wäschetruhe eine Sonntagstracht. Mit wenigen Scherenschnitten war sie auf Heidis Größe zugeschnitten. Auf den Einsatz eines Alpöhis verzichtete man aus Kostengründen.
Elisabeth gestaltete ein Plakat und hängte es direkt neben dem Tourismusbüro von Garstigen auf. «Heidi – das Original. Jetzt täglich außer Montag bis Freitag im Schattloch. Fünfzig Rappen Eintritt, Italiener und Militär die Hälfte, Kinder und Hunde gratis, Ruhe auf den billigen Plätzen.»
Natürlich musste noch eine Bühne her; Stühle und Bänke wurden aufgestellt. Mutter hatte eine alte Kommode zum Kassenhäuschen umgebaut und würde kalte Getränke und Älplermagronen verkaufen.
Man diskutierte lange darüber, ob man auch für den Gebrauch der Toiletten einen Franken verlangen könnte, als Fritz feststellte, dass man gar keine Toiletten hatte. Sie hatten nur so ein Häuschen beim Miststock, darin ein Loch, einen Knebel zum Draufsetzen und die Zeitung von gestern.
Der Tag aller Tage
Endlich war er da, der große Tag, der Tag der Uraufführung von HEIDI im Schattloch. Zur Vernissage am Sonntag, dem 30. Juni 1907, strömten die Zuschauer in Scharen herbei, Mutter nahm ihnen das Geld ab.
Man konnte – neben einem normalen Eintritt – auch ein Festivalticket zu fünf Franken lösen. In diesem Preis waren eine Wurst, ein Getränk, ein Programmheft sowie ein Toilettenbesuch und ein bemalter Tannenzapfen inbegriffen.
Die Zuschauerarena füllte sich bedrohlich. Einige Kinder, darunter auch Albertli, der Sohn des Schulmeisters, hatten sich auf dem Jauchewagen breitgemacht, andere kletterten den Fahnenmast hoch.
Um genau 15.00 Uhr ging das Theater los. Mutter Kaufmann haute auf einen alten Kupferkessel und schrie «Ruhe im Ring!» Da sie dies mit energischer Stimme kundtat, schwieg das verehrte Publikum sofort.
Die Stalltür öffnete sich und heraus traten eine Ziege, eine gefälschte Gämse, ein Ziegenbock, ein angeblicher Steinbock sowie ein Hahn mit fünf gackernden Hühnern. Artig stellten sie sich auf die Bühne und taten das, was sie gelernt hatten, nämlich gar nichts.
Als sie lange genug gar nichts getan hatten, öffnete sich wiederum die Stalltür und unter großem Applaus erschienen Heidi und Geissenpeter. Sie verneigten sich, sangen die erste Strophe der schweizerischen Nationalhymne und, zu Ehren des nicht anwesenden Fräulein Rottenmeier, das Lied «Heil dir im Siegerkranz».
Das Publikum war begeistert, erhob sich spontan von seinen Sitzen und erfand die Olà-Welle. Dabei vergaß Albertli, dass er auf dem Jauchewagen saß und fiel rückwärts auf den Misthaufen. Das verehrte Publikum rief begeistert: «Zugabe»!
Mutter rief zurück: «Ruhe auf den billigen Plätzen!» Daraufhin kramte sie eine alte Blechtrommel hervor und improvisierte den nächsten Programmpunkt herbei: der wilde Ritt auf dem Todesmuni.
Obwohl diese Einlage thematisch weder zu Heidi noch zu Geissenpeter passte, weder Fritz noch die Zuschauer genierten sich. Fritz hatte Herrmann sauber geputzt und bekränzt. Er hatte ihm sogar die Augenlider mit etwas Mehl aufgehellt und die Hörner grün angemalt. An deren Spitzen glitzerten zwei Brillanten aus der Schmuckschatulle von Elisabeths Mutter.
Zu den Klängen des Radetzkymarsches steppte der Muni vier Takte, um sich anschließend auf den Rücken zu werfen. Als er im Handstand über die Bühne hoppelte, bekam eine bayrische Touristin Anzeichen eines Höhenrausches, juchzte zweimal und fiel in Ohnmacht. Mutter rettete ihr mit einem Kübel Wasser das Leben, das muntere Treiben konnte weitergehen.
Eben setzte Herrmann zum Todessprung an, der Salto über die Kuh Flora sollte der Höhepunkt der Show sein. Doch plötzlich brach das Podest ein und der Koloss blieb mit allen Vieren im Bühnenboden stecken.
Darüber wurde er derart wütend, dass er beschloss diesem Zirkus ein Ende zu bereiten. Er befreite sich mühelos aus seiner misslichen Lage, nahm Anlauf und rammte die Zuschauer-Tribüne.
Dabei lud er gleichzeitig das Kassenhäuschen mit samt Mutter auf und warf beide auf den Miststock. Daraufhin verbeugte er sich kurz vor dem schockierten Publikum, trottete zurück in den Stall und legte sich dort zum Schlafen nieder.
Das Publikum war kurz erschrocken, dann jedoch vor allem empört.
«Geld zurück!», riefen die Zuschauer laut und deutlich. «Geld zurück, aber sofort!»
Gott sei Dank hatte Herrmann das Kassenhäuschen auf den Miststock geworfen, somit waren die Tageseinnahmen gerettet. Denn Mutter hatte sie dort ausgegraben, in ihrer Schürzentasche versteckt und war in das nahe Wäldchen geflohen. Sie hatte nicht die Absicht, das Eintrittsgeld zurückzuzahlen.
Fritz und Elisabeth hatten sich ebenfalls verdrückt und beobachteten vom Heuboden aus, wie sich die wütende Menge langsam auf den Heimweg machte. Sie beschlossen, ihre Theaterkarriere bis auf Weiteres zu beenden und wandten sich den schönen Dingen des Lebens zu.
Ein Leben als Vogelhirni
Etwas Abwechslung kam ins Leben, wenn jeweils im Frühling und im Herbst die Buden und Karusselle auf dem Dorfplatz von Garstigen erschienen. Die Schausteller reisten mit dem Zug an. Zuerst wurde der hinterste Gepäckwagen abgekoppelt und auf ein Abstellgeleise geschoben. Fritz half beim Ausladen und fuhr die Waren mit seinem Leiterwagen zum Marktplatz.
Manchmal war er bei einer Zeltbude beschäftigt, in welcher Stoffbälle nach Hampelmännern geworfen wurden. Er hatte die Aufgabe, die Bälle zum Tisch zurückzubringen und die umgekippten Figuren wieder aufzustellen.
Auch musste er mit seiner kindlich frohen Stimme das Publikum animieren. «Bitte meine Herrschaften, wer probiert’s, wer riskiert’s noch einmal – sieben Bälle für zwanzig Rappen!».
Meistens aber war er an solchen Tagen im «Wanderkino Speck» anzutreffen. Ein glänzend poliertes, mit Dampf betriebenes Lokomobil lockte die Menschen an; auf einem Podest vor dem verhängten Zelteingang spielten zwei Trompeter.
Als Platzanweiser bekam Fritz zwar kein Geld, durfte sich dafür jedoch die auf der Leinwand gezeigten Filme ansehen. Buffalo Bill gehörte zu seinen Favoriten; die Dokumentationen über fremde Länder bescherten ihm zum ersten Mal in seinem Leben ein unbändiges Fernweh.
Im Alter von fünfzehn Jahren verließ Fritz die Schule und fand eine Anstellung als Koch. Nicht weil dies sein Wunsch war, er wäre eigentlich lieber Lokomotivführer oder Löwenbändiger geworden. Aber sein Vater hatte entschieden, dass er für solche Berufe viel zu blöd sei, schließlich habe es bereits nach seiner Geburt geheißen, er habe einen Schatten im Hirni.
«Mit einem solchen Vogelhirni gibt es nur eins: Du wirst Koch! Und morgen fängst du im ‘Sternen’ an!»
Vater hatte ihm nicht gesagt, dass er dort noch Schulden hatte. Und so kam es, dass der Lohn nicht ausbezahlt, sondern direkt mit Vaters Schulden verrechnet wurde.
Der «Goldene Sternen» war vorwiegend bekannt für seine Röschti. Und so verbrachte Fritz seine Zeit vor allem und beinahe ausschließlich mit Kartoffelwaschen, Schälen und Raffeln. Wenn er so vor sich hin wusch, schälte und raffelte, träumte er von fernen Ländern.
Manchmal holte er sich einen alten Wurzelstock aus dem Schopf und begann diesen zu bearbeiten. Er schnitzte Adler, Murmeltiere, Gämsen und Steinböcke, so wie es bereits seine Vorfahren getan hatten. Er brachte es dabei zu einigem Können.
Aus besonders schönem Holz schnitzte er das Ebenbild der Wirtstochter. Da er dies mit äußerster Exaktheit und Detailtreue tat, wurde ihm eines schönen Tages zum Verhängnis. Als der Wirt in der Speisekammer gleich zwei Dutzend nackte Töchter vorfand, langte er Fritz tüchtig hinter die Ohren und warf ihn im hohen Bogen raus.
Fritz unter Beschuss
Fritz war 16, konnte Röschti bräteln, Holz schnitzen, Munis beflüstern und sonst nicht viel.
Letzteres jedoch kam ihm zugute als er im Januar 1908 zum Militärdienst einberufen wurde. In diesen schweren Zeiten wurden bereits 16-Jährige eingezogen. Man riet ihm, sich bei der Gebirgsartillerie einteilen zu lassen. Dort könne er sich zum Geschützmechaniker ausbilden lassen. Fritz war von der Idee begeistert und wurde sogleich Rekrut bei der fünften Gebirgsbatterie der achten Division.
Als es endlich so weit war, dass er mit kahl geschorenem Schädel in die Kaserne Chur einrücken musste, war er sichtlich stolz, im Zeughaus die persönlichen Effekten entgegennehmen zu dürfen. Nachdem er eingekleidet und ausgerüstet war, kam er sich vor wie ein römischer Legionär.
Die Rekrutenschule war eine Schinderei. Auf dem Kasernenhof wurden ihm in den ersten Wochen die elementarsten Grundkenntnisse der Armee beigebracht: militärisch korrekt grüßen, exerzieren, Schuhe putzen und einfetten, Gewehre reinigen; Drill vom Morgen bis am Abend.
Einige Wochen später, die Grundausbildung war abgeschlossen, wurde Fritz zusammen mit einem Offizier zur Zielbeobachtung abkommandiert. Sie hatten sich in der Nähe des Zielhangs, einer steilen Geröllhalde, in Deckung begeben.
Von hier aus konnten sie genau beobachten, ob die abgefeuerten Granaten ihr Ziel erreichten.
Nach einer kurzen Feuerpause war ein Zielwechsel vorgesehen. Das verabredete Signal dazu – ein Offizier hätte eine große Fahne schwenken müssen – kam allerdings nie. Ohne jegliche Vorwarnung setzte das Geschützfeuer wieder ein, Granaten explodierten mit infernalischem Lärm über ihrem Beobachtungsposten, Fritz wurde mit einem Gewitter aus Geschosssplittern und Steinen eingedeckt.
Kaum war der letzte Donner verhallt, jaulten Schrapnelle heran und krepierten über ihnen am Berghang. Sie übergossen die Beobachtungsstelle mit einem Hagel aus grobem Schrot. Der Offizier hatte Fritz geistesgegenwärtig zu Boden gerissen und ihn vor größerem Schaden bewahrt. Ob das wohl Fritz’ Feuertaufe gewesen war? Taufe ja. Aber die nächsten Schießereien folgten gleich.
Wenige Tage später latschte er nämlich, zusammen mit einem Kameraden, mitten in die Feuerlinie einer Schützenkompanie. Eben noch waren sie gemütlich durch eine Kuhweide marschiert, als ihnen plötzlich Gewehrkugeln gefährlich nahe um die Ohren pfiffen.
Gewitzt durch den Vorfall mit der Artillerie warf sich Fritz zusammen mit seinem Kumpel auf den Boden. Dass sie inmitten einer Ansammlung von Kuhfladen zu liegen kamen, störte sie dabei nicht. Der Geschosshagel hörte erst auf, als den Schützen die Munition ausgegangen war.
Als das Feuer endlich eingestellt wurde, machten sie sich rasch aus dem Staub. Um nicht entdeckt zu werden, robbten sie auf allen Vieren durchs Gras und verschwanden anschließend in einem nahen Wäldchen.
Rekrut Kaufmann machte sich mit seinen Eskapaden beim Schulkommandanten nicht beliebt. Und so beschloss dieser, Fritz nach Thun zu beordern. In der dortigen Kaserne sollte er Gehorsam lernen und «den letzten Schliff erhalten».
Fritz sucht die Front
«Soso, Koch sind Sie», rief Oberst Zünsel. «Ab in die Küche mit diesem Kartoffelschnitzer!»
Fritz wollte erwidern, dass er Geschützmechaniker sei, ließ es jedoch sein. In einer Küche konnte man sicher besser denken als unter Artilleriebeschuss.
Und so schälte und raffelte Fritz wieder einmal Kartoffeln. Dabei dachte er an fremde Länder, an Buffalo Bill und an Karl May. Während der Freizeit suchte er im nahen Fluss ein Stück Treibholz und schnitzte daraus einen kleinen Elefanten oder auch zwei. Die Tage flogen nur so dahin, die Elefanten wurden immer eleganter.
Eines Tages kam die Frau von Oberst Zünsel zu Besuch in die Kaserne. Als sie die kleinen herzigen Elefanten in der Küche sah, war sie unglaublich entzückt und bat ihren Mann, diesen Koch doch mal mit nach Hause zu nehmen.
Sie hatte nämlich den Stadtpräsidenten Schmucki samt Gattin sowie den Direktor des Gewerbevereins mit seiner angeblichen Sekretärin zu einem ungezwungenen Abendessen eingeladen.
Küchengehilfe Fritz wurde abkommandiert, die Tischdekorationen zu schnitzen. Und so setzte sich Fritz an den Küchentisch und schnitzte und schnitzte. Für den Herrn Oberst gab’s eine Haubitze, für die Dame des Hauses ein herziges Murmeltier.
Der Stadtpräsident bekam aus unerfindlichen Gründen einen großen Elefanten mit kleinem Rüssel, Frau Schmucki einen kleinen Elefanten mit großem Rüssel. Etwas indigniert schaute sie sich Fritz’ Meisterwerk an und wollte es in die Hand nehmen. Da die Schnitzereien jedoch nicht immer standfest waren, brach das gute Stück entzwei und Frau Schmucki hielt nur noch den Rüssel in der Hand.
«Oh my god!», schrie sie, und ließ das Ding vor Schreck fallen. Die Frau Stadtpräsidentengattin sprach zwar kein Englisch. Aber in ihren Kreisen sei es üblich, wie sie einmal betont hatte, englische Redewendungen zu gebrauchen.
Oberst Zünsel hatte das Treiben interessiert mitverfolgt. Die Elefanten passten jedoch nicht in sein Weltbild, schon gar nicht ins Militärische!
«Willst du uns für dumm verkaufen? Was soll das? Und was bitte hat es mit diesen Rüsseln auf sich? Du weißt es selbst nicht? Macht auch nichts! Ich kommandiere Dich hiermit umgehend an die Front!»
Fritz hatte zwar einen leichten Sprachfehler (manchmal) und eine Obsession (immer) für Elefanten, war jedoch nicht blöd (meistens). Er wusste haargenau, dass es seit dem Sonderbundskrieg 1847, und somit seit über sechzig Jahren, in der Schweiz keine militärischen Fronten mehr gegeben hatte.
Da jedoch der Oberst mit viel Fantasie ausgestattet war und zudem zahlreiche Tricks beherrschte, traute ihm Fritz zu, zur Durchsetzung seiner Ziele einen kleinen Krieg vom Zaun zu reißen. Vielleicht mal die Franzosen ärgern oder dem Fürsten von und zu Liechtenstein wieder einmal ein paar Kühe von der adligen Alp schießen.
Als er sich mehrere Varianten seiner persönlichen militärischen Laufbahn genauer betrachtet hatte, entschied er sich für die Infanterie. Er dachte, dass ihm der Gebrauch von Gewehren, Handgranaten und Minenwerfern mehr fürs Leben bringen würde als das Bräteln von Röschti.
Und so kam es, dass Füsilier Kaufmann eines bitterkalten Morgens auf dem Waffenplatz stand, sein Gewehr schulterte und an die Front marschierte.
Da er diese bis am Abend noch nicht gefunden hatte, und auch weit und breit kein Oberst Zünsel zu sehen war, suchte er sich ein bequemes Nachtquartier in einer alten Scheune. Er legte sich hin, und ließ sein bisheriges Leben Revue passieren.
Fritz war im Großen und Ganzen zufrieden mit sich selbst und der Welt. Er war inzwischen siebzehn Jahre alt, konnte nicht nur Kühe melken, Munis beflüstern und Ziegen anmalen, sondern auch Holz schnitzen und leidlich Röschti bräteln.
Fritz meldet sich ab
Es war ein frostiger Herbstmorgen. Fritz hatte Urlaub bekommen und machte sich auf den Weg ins Schattloch ob Garstigen. Der Nebel kletterte die Berge hinauf, es war dunkel wie in einer Kuh, und beinahe wäre Fritz auf halbem Weg mit einer seltsamen Gestalt zusammengestoßen.
Der Mann, um einen solchen handelte es sich, war von mittlerer Gestalt, trug einen Zylinder und war auch sonst etwas unpassend gekleidet. Er schien wohl direkt einer Revue entsprungen zu sein.
Der Frack flatterte unfroh, ein leichter Biswind ließ den Mann vor Kälte zittern. Sein rötlicher Bart war verfilzt und von Eiskristallen durchzogen. In der Hand trug er einen Reisekoffer aus feinstem Leder. Dieser schien schwer zu sein, denn der einsame Reisende schnaubte fast wie Herrmann der Muni.
«Wo geht’s denn ins Schattloch?», nuschelte der Fremde.
«Wer will denn ins Schattloch?», antwortete Fritz.
«Aehhh, mein Name ist Heinrich, aber alle nennen mich Barbarossa. Wegen der roten Barthaare. Ich bin der Bruder der Bäuerin und möchte sie besuchen.»
Seine Mutter hatte einen Bruder? Obwohl Fritz noch nie von einem abgängigen Onkel gehört hatte, war er nicht erstaunt darüber.
«Du kannst mir folgen. Ich bin der junge Kaufmann, du somit mein Onkel und jetzt vorwärts, Marsch!»
Glücklicherweise hatte sich der Nebel in der Zwischenzeit etwas gelichtet und schon bald hatten sie das Schattloch erreicht.
Als Mutter Kaufmann ihren Bruder erkannte, brach sie in Tränen aus. Aber es waren keine Freudentränen. Eher Tränen der Wut. Zur Begrüßung schmiss sie Barbarossa einen Blumentopf an den Kopf, griff anschließend in den Korb mit den Kartoffeln und setzte zu einem veritablen Artilleriefeuer an. Fritz konnte sie nur mit Mühe daran hindern, auch noch Messer und Gabeln einzusetzen.
«Ein Lump bist du, ein lumpiger. Ein Schelm, ein Strauchdieb, ein Nichtsnutz, ein Vagant, ein vagantischer! Als du das letzte Mal bei uns warst, fehlten in der Haushaltskasse fünfzig Franken, im Stall zwei Hühner und eine Ziege. Also verschwinde bloß wieder ins Pfefferland oder sonst wohin!»
Der unwillkommene Gast hatte sich während der Tirade auf einen Schemel gesetzt und dachte nicht daran, viel zum Gespräch beizutragen.
«Du könntest ruhig etwas netter zu mir sein. Ich lebe jetzt nämlich am Hof des Kaisers von Abessinien.»
«Das heißt ‘auf dem Hof’ und der liegt nicht in Hinterindien, sondern in Garstigen!»
«Nein», entgegnete Barbarossa. «Ich lebe in Abessinien und berate dort den Negus von Kutscha beim Bau einer Eisenbahn.»
«Du und Eisenbahn? Du spinnst wohl. Erstens hast du keine Ahnung von Eisenbahnen und zweitens könntest du nicht einmal einen räudigen Gaul beraten. Geschweige denn eine kaiserliche Hoheit. Wenn der Neger erfährt, dass du ein nichtsnutziger Vagant bist, wird er dir eines Tages den Hals umdrehen lassen! Nicht, dass du dich nachher bei mir beklagst!»
Heinrich «Barbarossa» wollte noch anfügen, dass der Negus kein Neger, sondern ein Sultan, ein Kaiser oder so etwas Ähnliches sei, beließ es jedoch angesichts der angespannten Lage bei einem Blick an die Decke.
Fritz ließ die zwei Streithähne allein, ging in den Stall und melkte die Kühe. Den Muni strafte er mit Verachtung, der hatte ihm ja den ganzen Schlamassel eingebrockt. Zur Strafe sollte er ihn eigentlich zum Metzger bringen. Als er darüber nachdachte, wie viel ihm das Vieh einbringen würde, hörte er, wie Barbarossa den Stall betrat.