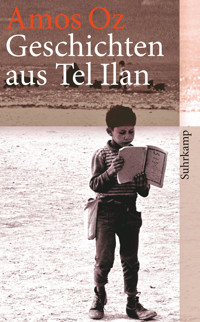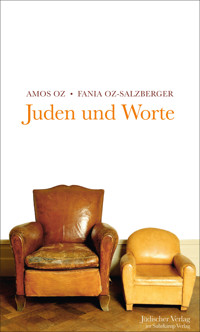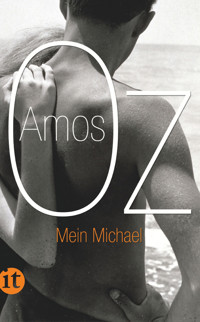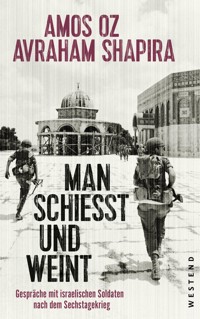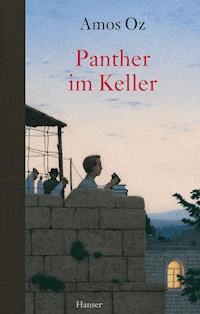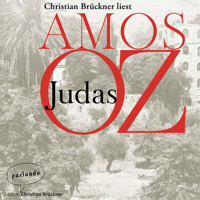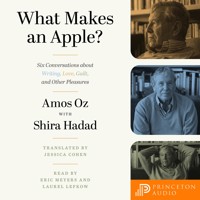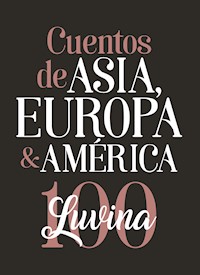11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Autor trat Amos Oz auf ihn bezeichnende Weise zum ersten Mal 1961 an die Öffentlichkeit, mit einem politischen Essay sowie einer Erzählung. Es folgten mehr als zwanzig Romane, Erzählsammlungen und Essaybände. In Wo die Schakale heulen, seiner ersten Buchpublikation aus dem Jahre 1965, acht Erzählungen, die erstmals in deutscher Übersetzung vorliegen, ist in exemplarischer Weise mitzuerleben, wie Oz zu dem Schriftsteller geworden ist, der er ist.
In den Erzählungen sind alle den Autor prägenden Themen bereits versammelt: Der eminent politische Oz erzählt vom Kibbutzalltag in feindlicher Umgebung. Dabei zeigt sich: Politische Gegebenheiten sind äußerst wichtig für das individuelle und kollektive Handeln. Im Heulen der Schakale jenseits der Zäune ist der israelisch-palästinensische Konflikt präsent. Das Außen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, erklärt jedoch nicht hinreichend das Verhalten der Einzelnen: Es hängt im gleichen Maße ab von den Traditionen, den Phantasien, dem Glauben. Auch in den frühesten Erzählungen erweist Amos Oz sich als Meister im Verfolg der luzidesten Regungen seiner Personen, die sich auf keinen vorgefassten Begriff bringen lassen. Hier haben die traumhaft-utopischen Aspekte seiner Bücher ihren Ursprung – auch wenn die Hoffnungen von Autor und Protagonisten auf politischer wie individueller Ebene nie in Erfüllung gehen.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Amos Oz
Wo die Schakale heulen
Erzählungen
Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler
Suhrkamp
Für Nili
Land der Schakale
1.
Endlich legte sich der Wüstenwind.
Vom Meer fuhr der Wind in das glühende Wassermelonenfeld und schlug kühle Schneisen. Die zunächst leichten, zögerlichen Brisen versetzten die Wipfel der Zypressen in ein sehnsüchtiges Schaudern, als flösse, von den Wurzeln in die erbebenden Stämme aufsteigend, Strom durch sie hindurch.
Gegen Abend frischte der Westwind auf, und der Wüstenwind, der Chamsin, zog sich nach Osten zurück, in die judäischen Berge, von dort aus in die Senke von Jericho und weiter bis zu den Wüsten der Skorpione östlich des Jordan. Es schien der letzte Wüstenwind zu sein. Der Herbst stand bevor.
In schrillen Freudenschreien stürmten die Kibbuz-Kinder über die Rasenflächen. Ihre Eltern zogen die Liegestühle von den Terrassen in die Gärten. »Keine Regel ohne Ausnahme«, lautete ein Spruch von Saschke. Diesmal war er die Ausnahme, er verbarg sich allein in seinem Zimmer, um ein weiteres Kapitel seines Buchs über die Probleme des Kibbuz in Zeiten des Wandels zu schreiben.
Saschke gehörte zu den Gründungsmitgliedern unseres Kibbuz und war einer der herausragenden Aktivisten. Ein vierschrötiger Mann, von rötlicher Hautfarbe, mit Brille und einprägsamen, weichen Gesichtszügen, der väterlich gelassen wirkte. Eine gewisse Umtriebigkeit ging von ihm aus. Der angenehm kühle Abendwind, der in sein Zimmer drang, zwang ihn dazu, einen schweren Aschenbecher auf die rebellierenden Blätter zu legen. Eine aufrichtige Begeisterung ließ ihn an seinen Sätzen feilen. Zeiten, die sich ändern, sagte sich Saschke, Zeiten, die sich ändern, erfordern Ideen, die sich ändern; nicht stehenbleiben, nicht sich wiederholen, man muss energisch und klug vorgehen.
Die Häuserwände, die Blechdächer der Vorbauten und die neben der Schreinerei lagernden Eisenrohre begannen die Hitze abzustrahlen, die sich in den Tagen des Chamsin in ihnen aufgestaut hatte.
Galila, Saschkes und Tanjas Tochter, stand unter der kalten Dusche, ihre Hände glitten über den Nacken, die Ellbogen nach hinten gedrückt. Der Duschraum war fast dunkel. Die blonden Haare fielen schwer und nass auf die Schultern, auch sie kamen ihr fast dunkel vor. Hinge hier ein großer Spiegel, ich hätte mich vielleicht vor ihn gestellt und meinen Körper betrachtet, langsam, zärtlich. Wie man den Meerwind betrachtet, der draußen weht.
Aber die Dusche war klein, eine quadratische Zelle, in der sich kein großer Spiegel befand und auch gar nicht hätte befinden können. Galila beeilte sich, leicht nervös. Ungeduldig trocknete sie sich ab und schlüpfte in saubere Kleidung. Was will Matitjahu Demkow von mir? Er bat mich, nach dem Abendessen zu ihm zu kommen. Als wir klein waren, schauten wir ihm und seinen Pferden gerne zu. Aber den Abend in irgendeinem verschwitzten Junggesellenzimmer zu vergeuden, das ist zu viel verlangt. Er hat zwar versprochen, mir Farben aus dem Ausland zu geben. Andererseits ist der Abend kurz, und andere freie Stunden haben wir nicht. Wir sind Arbeiterinnen.
Was für einen verwirrten und unbeholfenen Eindruck Matitjahu Demkow gemacht hat, als er sich mir in den Weg stellte und sagte, ich solle nach dem Abendessen zu ihm kommen. Und diese in der Luft herumfuchtelnde Hand, die versuchte, Worte aus dem Wüstenwind zu pflücken, wie der Mund eines nach Luft schnappenden Fischs, der nicht die Worte findet, die er sucht. »Heute Abend. Lohnt sich, wenn du kurz vorbeikommst«, sagte er, »du wirst sehen, es interessiert dich. Nur für einen Moment. Und auch ziemlich … wichtig. Du wirst es nicht bereuen. Richtige Leinwände und Farben von professionellen Malern, wirklich. Genau genommen habe ich das alles von meinem Cousin Leon, der in Südamerika lebt. Ich brauche keine Leinwände und keine Farben. Ich – und Malerei. Alles ist für dich, du musst nur kommen.«
Galila erinnerte sich an diese Worte und empfand dabei sowohl Widerwillen als auch Vergnügen. Sie dachte daran, wie abstoßend hässlich Matitjahu Demkow war, der sich dazu bereiterklärt hatte, sie mit Leinwänden und Farben zu versorgen. Nun, ich werde wohl zu ihm hingehen und sehen, was passiert, und herauskriegen, warum ich diejenige bin. Aber ich werde nicht länger als fünf Minuten in seinem Zimmer bleiben.
2.
In den Bergen ist der Sonnenuntergang schnell und heftig. Unser Kibbuz liegt in der Ebene, und die Ebene verzögert den Sonnenuntergang, mildert seine Heftigkeit. Langsam wie ein müder Zugvogel sinkt die Dämmerung herab. Erst werden die fensterlosen Schuppen und Vorratskammern dunkel. Das Dunkelwerden stört sie nicht, denn die Dunkelheit verlässt sie nie ganz. Dann kommen die Wohnhäuser an die Reihe. Eine Schaltuhr setzt den Generator in Bewegung. Sein Klopfen klingt wie ein schlagendes Herz, ein fernes Trommeln. Die elektrischen Adern werden lebendig und verborgener Strom fließt durch unsere dünnen Wände. In diesem Moment gehen auf einen Schlag in allen Fenstern der Pioniere die Lichter an. Die Metallteile auf der Spitze des Wasserturms fangen die letzten Strahlen des Tageslichts ein und halten sie lange fest. Schließlich verblasst auch der Blitzableiter ganz oben auf dem Turm.
Die Alten der Siedlung verharren in ihren Liegestühlen wie leblose Gegenstände, erlauben der Dämmerung, sie einzuhüllen, sie leisten keinen Widerstand.
Gegen sieben begeben sich alle langsam zum Speisesaal. Manche unterhalten sich darüber, was heute geschah, andere darüber, was morgen zu tun ist, wieder andere schweigen. Zeit für Matitjahu Demkow, seine Höhle zu verlassen und sich in menschliche Gesellschaft zu begeben. Er schließt die Wohnungstür ab, lässt die sterile Stille hinter sich und begibt sich in den betriebsamen Speisesaal.
3.
Matitjahu Demkow ist ein kleiner, dünner und dunkler Mann, der nur aus Knochen und Muskeln besteht, seine schmalen Augen liegen tief in den Höhlen, seine Wangenknochen sind ein bisschen schief und sein Gesicht hat immer einen leicht besserwisserischen Ausdruck: ›Habe ich’s euch nicht gesagt?‹ Er ist gleich nach dem Zweiten Weltkrieg zu uns gekommen. Eigentlich stammt er aus Bulgarien. Wo genau er gewesen ist und was er getan hat, erzählt dieser Demkow nicht. Wir verlangen keine Rechenschaft. Er hat sich eine Zeitlang in Südamerika aufgehalten. Und er trägt einen Schnurrbart.
Matitjahu Demkow verfügt über einen beinahe perfekten Körper: kompakt, jugendlich, fast unnatürlich stark und geschmeidig. Welchen Eindruck dieser Körper wohl auf Frauen macht? Bei Männern weckt er nervöses Unbehagen.
An der linken Hand hat Matitjahu Demkow nur noch Daumen und kleinen Finger. Dazwischen ist Leere. »In Kriegszeiten«, sagt Matitjahu Demkow, »haben Menschen mehr verloren als drei Finger.«
Tagsüber arbeitet er in der Schmiede, mit nacktem, schweißüberströmtem Oberkörper. Die Muskeln tanzen unter der gespannten Haut wie zusammengedrückte Sprungfedern. Er schweißt Zubehörteile, er lötet Rohre, hämmert verbogene Arbeitsgeräte wieder zurecht, haut ausrangiertes Werkzeug zu Schrott. Seine rechte Hand, die vollständige, ist stark genug, um den schweren Vorschlaghammer über den Kopf zu schwingen und mit gezügelter Wildheit auf die Gegenstände einzuschlagen.
Vor vielen Jahren hat Matitjahu die Pferde des Kibbuz derart geschickt beschlagen, dass alle ins Staunen gerieten. Schon in Bulgarien hatte er sich, so scheint es, mit Pferdezucht beschäftigt. Manchmal hat er groß und breit den Unterschied zwischen Zuchtpferden und Arbeitspferden erläutert und den Kindern, die ihm zuschauten, erzählt, er und sein Partner oder sein Cousin Leon hätten die wertvollsten Pferde zwischen Donau und Ägäis gezüchtet.
Ab dem Tag, ab dem der Kibbuz keine Pferde mehr benutzte, wurde Matitjahu Demkows Kunst überflüssig. Ein paar Mädchen sammelten die überflüssig gewordenen Hufeisen ein und schmückten damit ihre Zimmer. Nur die Kinder, die beim Beschlagen zugeschaut hatten, erinnerten sich noch manchmal daran: an die Geschicklichkeit. An den Schmerz. An den beißenden Geruch. An die Gelenkigkeit. Galila hatte auf ihrem hellen Zopf herumgekaut und den Mann von weitem mit grauen, weit geöffneten Augen angestarrt, den Augen ihrer Mutter, nicht ihres Vaters.
Sie wird nicht kommen.
Ich glaube ihrem Versprechen nicht.
Sie hat Angst vor mir. Und sie ist misstrauisch wie ihr Vater und schlau wie ihre Mutter. Sie wird nicht kommen. Und wenn doch, werde ich’s ihr nicht erzählen. Und wenn ich’s ihr erzähle, wird sie’s mir nicht glauben. Sie wird Saschke alles sagen. Mit Worten ist nichts zu erreichen. Aber hier sind Menschen, hier ist Licht: Guten Appetit!
Auf jedem Tisch glänzte Besteck, standen Metallkannen und Brotkörbe.
»Man muss die Messer mal wieder schleifen«, sagte Matitjahu Demkow zu seinen Tischnachbarn. Er schnitt die Zwiebeln und die Tomaten in dünne Scheiben, würzte sie mit Salz, Essig und Öl. »Im Winter, wenn ich weniger Arbeit habe, werde ich alle Messer des Speisesaals schärfen, und ich werde auch die Dachrinne reparieren. Der Winter ist schon nicht mehr weit. Dieser Chamsin, denke ich, war der letzte. Das war’s. Der Winter wird uns in seinen Fängen haben, bevor wir darauf vorbereitet sind.«
Am Rand des Speisesaals, neben dem Durchgang zu dem Raum mit den Wasserkesseln und zur Küche, drängte sich eine Gruppe knochiger Veteranen, manche kahlköpfig, manche weißhaarig, um das einzige Exemplar der Abendzeitung. Die Seiten wurden auseinandergetrennt und die Rubriken abwechselnd unter den Lesern, die sie für sich »reserviert« hatten, herumgereicht. Einige gaben Kommentare ab. Andere betrachteten die ›Experten‹ mit altersmüder, spöttischer Miene. Und es gab welche, die nur stumm zuhörten, die Gesichter von stiller Trauer gezeichnet. Sie waren, nach Saschkes Worten, die Treusten unter den Treuen, jene, die das ganze Leid der Arbeiterbewegung ertrugen.
In der Zeit, in der die Männer sich um die Zeitung drängten und sich mit Politik beschäftigten, versammelten sich die Frauen um den Tisch des Arbeitszuteilers. Tanja, das Gesicht faltig, die Augen müde und angestrengt, protestierte lautstark. Sie hatte einen Metall-Aschenbecher in der Hand und klopfte mit ihm im Takt ihrer Beschwerden auf den Tisch, erstens und zweitens und drittens. Sie beugte ihren Oberkörper über die Arbeitslisten, als ob sie ihn unter das Joch der Ungerechtigkeit beuge, das ihr auferlegt wurde oder ihr auferlegt werden würde. Ihre Haare waren grau. Matitjahu Demkow hörte ihre Stimme, verstand aber nicht, was sie sagte. Bestimmt versuchte der Arbeitszuteiler jetzt, sich angesichts von Tanjas Zorn mit Würde aus der Affäre zu ziehen. Und nun sammelte sie wie nebenbei die Früchte ihres Siegs ein, richtete sich auf und wandte sich Matitjahu Demkows Tisch zu.
»Und jetzt zu dir. Du weißt, dass ich sehr viel Geduld habe, aber alles hat seine Grenzen. Und wenn der Rahmen bis morgen früh um zehn nicht gelötet ist, werde ich Krach schlagen. Was zu viel ist, ist zu viel, Matitjahu Demkow. Und überhaupt …«
Der Mann verzog das Gesicht, so dass er noch hässlicher wurde, bis er aussah wie ein Schreckgespenst, oder als trüge er eine Clownsmaske.
»Wirklich«, sagte er leise, »du regst dich völlig unnötig auf. Dein Rahmen ist schon seit Tagen fertig gelötet, du hast ihn nur nicht abgeholt. Komm morgen, wann immer du willst. Mich muss man bei der Arbeit nicht drängen.«
»Drängen? Ich? Nie im Leben hätte ich es gewagt, dich zu drängen. Entschuldige. Ich hoffe, dass du nicht gekränkt bist.«
»Ich bin nicht gekränkt«, schloss Matitjahu. »Im Gegenteil. Ich bin völlig entspannt. Friede sei mit dir.«
Mit diesen Worten waren die Angelegenheiten des Speisesaals beendet. Eigentlich war es jetzt an der Zeit, ins Zimmer zu gehen, Licht anzuzünden, sich aufs Bett zu setzen und ruhig zu warten. Und was brauche ich noch? Genau. Eine Zigarette. Streichhölzer, Aschenbecher.
4.
Elektrischer Strom pocht in den miteinander verwobenen Adern und beleuchtet alles mit mattem Licht: unsere kleinen Häuser mit den roten Dächern, unsere Gärten, unsere rissigen Betonwege, die Zäune und den Schrott, die Stille. Weiche, gedämpfte Lichtpfützen. Altes Licht.
Holzpfosten stehen in regelmäßigen Abständen entlang des äußeren Zauns, auf ihnen sind Scheinwerfer montiert. Sie versuchen, die Felder und die Täler bis zum Fuß der Berge zu erhellen. Ein kleiner Kreis der Anbauflächen ist tatsächlich lichtüberflutet. Doch außerhalb des Lichtkegels herrschen Dunkelheit und Stille. Herbstnächte sind nicht schwarz. Nicht hier. Die Nächte sind fast violett. Ein violetter Schimmer scheint auf den Weinbergen und Obstgärten zu liegen. Die Obstgärten werden langsam gelb. Das weiche, violette Licht verhüllt voller Zärtlichkeit die Wipfel, überdeckt die harten Konturen, bringt den Unterschied zwischen Leblosem und Lebendem zum Verschwinden. Auf diese Weise verzerrt es das Aussehen der leblosen Gegenstände, es flößt ihnen Leben ein, kalt und unheimlich, zitternd wie durch ein Gift. Andererseits verlangsamt es die Bewegungen des Lebendigen, verbirgt dessen Anwesenheit. Deshalb können wir die Schakale nicht sehen, wenn sie aus ihrem Bau kommen. Zwangsläufig verpassen wir den Anblick ihrer weichen Nasen, die in der Luft schnuppern, ihrer Pfoten, die förmlich über die Erde schweben, sie kaum berühren.
Die Hunde des Kibbuz sind die Einzigen, die diese unwirkliche Bewegung wahrnehmen. Deshalb heulen sie nachts aus Neid, Zorn und Wut. Deshalb scharren sie die Erde auf und zerren an ihren Ketten, bis ihre Halswirbel knacken.
Ein alter Schakal hätte die Falle bestimmt umgangen. Aber es war ein junger Schakal, geschmeidig, weich, mit gesträubtem Fell, angelockt vom Geruch des Bluts und des Fleischs. Er tappte jedoch nicht aus völliger Torheit in die Falle. Er folgte nur seinem Geruchssinn. Er näherte sich seinem Ende vorsichtig, mit kleinen Schritten. Einige Male hielt er inne, eine dumpfe Warnung in seinen Adern spürend. Vor der Falle blieb er stehen, erstarrte mitten in der Bewegung, still, grau wie die Erde und geduldig wie sie. Gepackt von einem unbestimmten Schrecken, spitzte er die Ohren, hörte aber nichts. Die Gerüche lenkten ihn ab.
War es wirklich Zufall? Wir behaupten, der Zufall sei blind, aber er schaut uns mit tausend Augen an. Jung war dieser Welpe, und selbst wenn er die tausend Augen spürte, die ihn anschauten, konnte er ihre Bedeutung nicht verstehen.
Eine Wand aus alten, staubigen Zypressen umgibt den Obstgarten. Was ist der verborgene Faden zwischen Leblosem und Lebendem? Wir suchen verzweifelt nach dem Ende des Fadens, zornig, verkrampft, beißen uns auf die Lippen, bis sie bluten, verdrehen die Augen wie im Wahn. Die Schakale kennen den Faden. Sinnliche Ströme pulsieren in ihm, die von Körper zu Körper springen, von Lebewesen zu Lebewesen, von Zittern zu Zittern. Und dann Ruhe und Frieden.
Schließlich senkte das Tier den Kopf und streckte die Nase vor zum verlockenden Fleisch. Ein Geruch von Blut und Saft. Die Nasenspitze des jungen Schakals war feucht und beweglich, Speichel trat aus dem Maul, tropfte auf das Fell, die Sehnen waren gespannt. Seine Vorderpfote tastete nach der verbotenen Frucht, sanft wie ein Hauch.
Nun kam der Moment des kalten Eisens. Mit einem leichten, metallischen Klicken schnappte die Falle zu.
Das Tier war wie versteinert. Vielleicht wollte es die Falle überlisten, indem es sich leblos stellte. Kein Ton, keine Bewegung. Lange prüften Schakal und Falle die Stärke des Gegners. Langsam, unter Qualen, kam wieder Leben in das Tier.
Die Zypressen bewegten sich lautlos, neigten sich, richteten sich wieder auf. Der Schakal riss das Maul auf und entblößte kleine, schaumverschmierte Zähne.
Plötzlich packte ihn die Verzweiflung.
Er sprang auf und versuchte, sich loszureißen und dem Tod ein Schnippchen zu schlagen.
Schmerz schoss durch seinen Körper.
Der kleine Schakal sank auf die Erde, schnaufte schwer, schnaufte und schnaufte.
Dann öffnete er das Maul und begann zu schreien. Sein Schreien und Heulen erfüllte die Nacht bis in die Tiefen der Ebene.
5.
In dieser Dämmerstunde besteht unsere Welt aus ineinandergeschobenen Kreisen. Außen befindet sich der Kreis der allgemeinen Dunkelheit, weit entfernt von hier, in den Bergen und den großen Wüsten. Von ihm umgeben und in ihn eingebettet ist der Kreis unserer nächtlichen Felder, der nächtlichen Weinberge, Orangenhaine und Obstgärten. Ein trübes Meer aus Flüstern und Schweigen. Unsere Felder täuschen uns in der Nacht. Jetzt sind sie nicht mehr vertraut und gehorsam, durchzogen von Bewässerungsschläuchen und Feldwegen. Jetzt sind sie ins Feindeslager übergetreten. Und schicken uns Wogen fremder Gerüche. Vor unseren Augen erheben sich nachts, drohend und feindselig, die Felder und kehren wieder in den Zustand zurück, in dem sie sich vor unserer Ankunft befanden.
Der mittlere Kreis, der Kreis der Lichter, schützt unsere Häuser und uns selbst vor zunehmender Bedrohung von außen. Aber das ist eine durchlässige Wand, sie hält nicht die nächtlichen, seltsamen Gerüche des Feindes und seine Stimmen ab. Alle nächtlichen Stimmen und Geräusche berühren unsere Haut wie Zähne und Klauen.
Und ganz im Inneren, im innersten Kreis der Kreise, im Herzen unserer beleuchteten Welt, steht Saschkes Schreibtisch. Die Tischlampe wirft einen ruhigen hellen Kreis aus Licht, der die Schatten von den Papierstapeln vertreibt. Der Stift tanzt in seiner Hand, und die Worte sprudeln hervor. »Es gibt kein Standhalten, das tapferer zu nennen ist, als das Standhalten weniger gegenüber vielen«, pflegt Saschke zu sagen.
Der Blick seiner Tochter ruhte lange und neugierig auf Matitjahu Demkows Gesicht. Du bist hässlich, du bist keiner von uns. Und es ist gut, dass du kinderlos bist und dass sich diese dummen mongoloiden Augen eines Tages schließen und du stirbst. Und keiner wie du wird zurückbleiben. Ich wäre jetzt gern woanders, doch vorher möchte ich wissen, was du von mir willst und warum du gesagt hast, ich solle kommen. Es ist so stickig in deinem Zimmer, es riecht nach altem Junggesellen, wie nach zu oft erhitztem Öl.
»Man kann sich auch setzen«, sagte Matitjahu aus dem Schatten heraus. Die schäbige Stille, die den Raum füllte, machte seine Stimme, die von weit her zu kommen schien, tiefer.
»Ich hab’s ein bisschen eilig.«
»Es gibt auch Kaffee. Echten. Aus Brasilien. Den Kaffee hat mir ebenfalls mein Cousin Leon geschickt, er denkt, ein Kibbuz ist eine Art Kolchose. Eine Arbeitslager-Kolchose. In Russland heißen die Kollektive Kolchosen.«
»Für mich bitte schwarz, ohne Zucker«, sagte Galila, und diese Worte überraschten sie selbst.
Was hat dieser hässliche Mann vor? Was will er von mir?
»Du hast gesagt, du willst mir irgendwelche Leinwände zeigen. Und irgendwelche Farben, nicht wahr?«
»Immer mit der Ruhe.«
»Ich habe nicht damit gerechnet, dass du dir die Mühe machst, Kaffee anzubieten und Kekse, ich habe gedacht, ich werde nur kurz vorbeischauen.«
»Du bist hell.« Er atmete schwer. »Du bist hell, aber ich irre mich nicht. Es gibt einen Zweifel. Muss einen geben. Aber so ist es. Das heißt, du wirst deinen Kaffee trinken, schön langsam, und ich werde dir eine Zigarette geben, eine Virginia aus Amerika, und inzwischen schaust du dir diese Kiste an. Die Pinsel. Und das besondere Öl. Und die Leinwände. Alle Tuben. Alles ist für dich. Aber trink zuerst, ganz langsam, lass dir Zeit.«
»Aber ich verstehe nicht«, sagte Galila.
Ein Mann, der im Sommer im Unterhemd in seinem Zimmer umherläuft, ist kein befremdlicher Anblick. Aber der affenähnliche Körper Matitjahus wühlte sie auf. Und dann geriet sie in Panik. Sie stellte die Kaffeetasse auf das Kupfertablett, sprang auf, trat hinter den Stuhl und hielt sich an der Lehne fest, als wäre sie eine schützende Sperre.
Ihre offensichtlich ängstliche Bewegung bereitete dem Gastgeber Vergnügen. Er sprach geduldig, fast spöttisch:
»Genau wie deine Mutter. Bei Gelegenheit muss ich dir etwas erzählen, etwas, das du bestimmt nicht weißt, etwas über die Wildheit deiner Mutter.«
Jetzt, angesichts der Gefahr, kam in Galila Kälte und Bosheit hoch:
»Du bist verrückt, Matitjahu Demkow. Alle sagen, dass du verrückt bist.« Ihr Gesicht zeigte eine milde Strenge, geheimnisvoll und mitleidig. »Du gehst jetzt zur Seite und lässt mich vorbei. Ich möchte weg. Ja. Jetzt. Geh zur Seite.«
Der Mann rückte etwas seitwärts, ließ sie aber nicht aus den Augen. Plötzlich machte er einen Satz auf sein Bett, setzte sich, lehnte den Rücken halb an die Wand und lachte lange und fröhlich.
»Langsam, meine Tochter, warum hast du es so eilig?«, sagte er. »Langsam. Wir haben erst angefangen. Geduld. Du darfst dich nicht so schnell aufregen. Du darfst deine Kräfte nicht sinnlos vergeuden.«
Galila überschlug rasch die beiden Möglichkeiten, die sichere und die aufregende, und sagte:
»Sag mir bitte, was du überhaupt von mir willst.«
»Eigentlich«, sagte Matitjahu Demkow, »eigentlich kocht der Kessel schon. Machen wir doch eine Pause und trinken noch einen Kaffee. Du wirst nicht bestreiten, bestimmt wirst du nicht bestreiten, dass du noch nie einen solchen Kaffee getrunken hast.«
»Für mich ohne Milch und ohne Zucker. Das habe ich dir ja schon gesagt.«
6.
Der Kaffeeduft vertrieb alle anderen Gerüche: Es war ein starker, scharfer, angenehmer, fast durchdringender Geruch. Galila bemerkte Matitjahu Demkows gute Manieren, sah die Muskeln, die sich unter seinem Netzhemd abzeichneten, sah seine absonderliche Hässlichkeit. Und als er erneut zu sprechen anfing, umklammerte sie mit beiden Händen die Tasse, und etwas wie eine vorübergehende Ruhe kehrte in sie ein.
»Wenn du willst, kann ich dir inzwischen etwas erzählen. Über Pferde. Über das Gehöft, das wir in Bulgarien hatten. Ungefähr siebenundfünfzig Kilometer von der Hafenstadt Varna entfernt, ein Gestüt zur Pferdezucht, es gehörte meinem Cousin Leon und mir. Zwei Geschäftszweige pflegten wir besonders: Arbeitspferde und Zuchtpferde. Das heißt Kastrieren und Decken. Was willst du zuerst hören?«
Galila beruhigte sich. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, schlug ein Bein über das andere und war bereit für die Geschichte, so wie sie unmittelbar vor der Gute-Nacht-Geschichte im Kinderhaus immer bereit gewesen war für die Erzählung.
»Ich erinnere mich«, sagte sie, »als wir klein waren, haben wir immer zugeschaut, wie du die Pferde beschlagen hast. Das war schön und sonderbar… auch du.«
»Eine gelungene Paarung vorzubereiten«, sagte Matitjahu und schob ihr einen Untersetzer mit salzigen Keksen zu, »das ist eine Aufgabe für Profis. Verlangt auf der einen Seite Wissen, auf der anderen auch Intuition. Erst muss der Hengst lange abgesondert werden. Damit er verrückt wird. Das verbessert seinen Samen. Man hält ihn ein paar Monate von den Stuten fern und von den anderen Hengsten. Vor lauter Lust könnte er auch über einen anderen Hengst herfallen. Nicht jeder Hengst ist zur Zucht geeignet. Vielleicht einer von hundert. Ein Zuchthengst auf hundert Arbeitspferde. Man braucht viel Erfahrung und ein gutes Auge, um das richtige Pferd auszuwählen. Ein dummes und wildes Pferd ist am besten geeignet. Aber das ist nicht so leicht herauszufinden, welches Pferd das dümmste ist.«
»Warum muss es dumm sein«, fragte Galila und schluckte Speichel hinunter.
»Es ist so etwas wie Verrücktheit. Nicht immer macht ein großer, schöner Hengst kräftige Fohlen. Ausgerechnet ein mittelmäßiger Hengst kann voller Energie und Nervosität sein. Wenn wir einen solchen Kandidaten monatelang allein gehalten haben, kippen wir ihm eine halbe Flasche Wein in seinen Trog. Das war eine Idee meines Cousins Leon. Um den Hengst ein wenig besoffen zu machen. Dann lassen wir ihn durch ein Gitter die Stuten sehen und auch riechen. Und da fängt er an, verrückt zu werden. Wird wild wie ein Stier. Wirft sich auf den Rücken, die Beine trampeln in der Luft. Er reibt sich an allem, kann aber seinen Samen nicht verspritzen. Brüllt und beginnt, nach allen Seiten zu beißen. Das ist das Zeichen dafür, dass die Zeit reif ist. Wir öffnen das Tor und lassen ihn zur Stute rasen. Und ausgerechnet in diesem Moment hält der Hengst inne, zitternd und schnaubend. Wie eine Sprungfeder.«
Galila zuckte leicht, wie hypnotisiert hing ihr Blick an Matitjahus Lippen.
»Ja«, sagte sie.
»Und dann passiert es. Als wäre in diesem Moment die Schwerkraft außer Kraft gesetzt. Der Hengst rennt nicht, sondern scheint durch die Luft zu fliegen. Wie eine Granate. Wie eine Feder, die zerspringt. Die Stute beugt sich, senkt den Kopf, und er versetzt ihr einen Stoß nach dem anderen. Seine Augen sind blutunterlaufen. Die Luft geht ihm aus, er beginnt zu röcheln wie ein Sterbender. Er reißt das Maul auf, Schaum fällt auf ihren Kopf. Plötzlich fängt er an zu beißen und zu jaulen. Wie ein Hund. Wie ein Wolf. Krümmt sich und brüllt. In diesem Moment gibt es keinen Unterschied zwischen Genuss und Schmerz. Das Decken ist genau wie das Kastrieren.«
»Genug, Matitjahu, echt, es reicht.«
»Jetzt machen wir eine Pause. Oder soll ich dir noch erzählen, wie wir einen Hengst kastriert haben?«
»Ehrlich, es reicht«, sagte Galila flehend.
Langsam hob Matitjahu Demkow die Hand, an der die drei Finger fehlten. In seiner Stimme lag ein sonderbares, fast väterliches Erbarmen.
»Wie deine Mutter«, sagte er, »wie bei den Fingern und wie beim Kastrieren. Wir werden ein andermal darüber sprechen, jetzt ist es genug. Hab keine Angst, jetzt können wir uns beruhigen und eine Pause einlegen. Ich habe irgendwo noch Kognak. Nein? Nein. Vielleicht Wermut. Ich habe auch Wermut. Er soll gesund sein, von meinem Cousin Leon. Trink, ruh dich aus. Es reicht.«
7.
Das kalte Licht der fernen Sterne verbreitete einen rötlichen Schimmer auf den Feldern. Im Lauf der letzten Sommerwochen, der Wochen des Chamsin, hatte sich das Land verändert. Es war bereit für die Wintersaat. Feldwege schlängelten sich über die Ebene, da und dort erstreckten sich von Zypressen umhegte Obstgärten.
Zum ersten Mal seit vielen Monaten bekamen unsere Felder die noch zögerlichen Finger der Kälte zu spüren. Die Bewässerungsrohre, die Wasserhähne und die metallenen Ersatzteile waren stets die Ersten, die sich jedwedem Eroberer ergaben, der glühenden Sommerhitze wie der herbstlichen Kälte. Auch jetzt waren sie die Ersten, die vor der feuchten Kälte kapitulierten.
Damals, vor vierzig Jahren, hatten sich die Kibbuz-Gründer in diesem Land festgesetzt und es mit ihren blassen Fingern umgegraben. Unter ihnen waren blondhaarige wie Saschke und missmutige wie Tanja. In den langen, glühend heißen Stunden des Tages verfluchten sie die steinige, von der Sonne verbrannte Erde, verzweifelt, zornig, voller Sehnsucht nach Flüssen und Wäldern. Aber in der Dunkelheit, wenn die Nacht herabsank, besangen sie die Erde und vergaßen darüber Ort wie Zeit. Das Vergessen war der Sinn ihres nächtlichen Tuns. In der bedrohlichen Dunkelheit umgab sie das Vergessen wie ein mütterlicher Schoß, und sie sangen »Dort« und nicht »Hier«.
Dort, im Land der Väter,
werden sich alle Träume verwirklichen,
dort werden wir leben, dort werden wir schaffen,
ein reines Leben, ein Leben in Freiheit.
Menschen wie Saschke und Tanja versteckten sich hinter ihrem Zorn, ihrer Sehnsucht und Aufopferung. Matitjahu Demkow und die anderen später angekommenen Flüchtlinge hatten keine Ader für jene brennende Sehnsucht und jene Aufopferung, die einen die Zähne auf die Lippen beißen ließ, bis sie bluteten. Deshalb wollten sie mit Gewalt in den inneren Kreis eindringen. Sie streckten die Hände nach den Frauen aus. Sie verwendeten die gleichen Wörter. Aber ihre Traurigkeit war eine andere, sie gehörten nicht zu uns, denn sie waren später ins Land gekommen, sie waren außen vor, und so soll es bis zu ihrem letzten Tag auch bleiben.
Der gefangene junge Schakal wurde müde. Seine rechte Pfote steckte in den eisernen Fängen. Ergeben streckte er sich auf dem Boden aus.
Zuerst leckte er sein Fell, langsam, wie eine Katze. Dann machte er den Hals lang und begann, das glatte, glänzende Metall zu lecken. Als übergösse er es mit Wärme und Liebe. Liebe und Hass, beides führt zu Unterwerfung. Er schob seine freie Pfote unter die Falle, tastete langsam nach dem Köderfleisch, zog die Pfote vorsichtig wieder zurück und leckte den Geruch ab, der an ihr hängen geblieben war.
Schließlich erschienen auch die anderen.
Große Schakale mit struppigem, schmutzigem Fell und aufgeblähten Bäuchen. Manche mit eitrigen Stellen und manche, die nach verfaultem Aas stanken. Einer nach dem anderen kamen sie von allen Seiten aus ihren Verstecken, versammelten sich zur grausigen Zeremonie.
Sie bildeten einen Kreis und betrachteten mit falschem Erbarmen den zarten Gefangenen. Die Schadenfreude machte es schwer, Erbarmen zu zeigen. Wachsende Bosheit zitterte unter der Maske der Trauer. Auf ein geheimes Zeichen hin bewegten sich die Raubtiere vorwärts, im Kreis, wie tanzend, mit weichen, gleitenden Schritten. Als die Fröhlichkeit überhandnahm und zum Toben wurde, zerbrach der Rhythmus, platzte die Zeremonie, und die Schakale sprangen wie tollwütig herum. Da stiegen die verzweifelten Stimmen hinauf ins Herz der Nacht, Trauer, Geilheit, Neid und Toben, das Gelächter der Schakale und ihr flehendes Heulen klangen bedrohlich und steigerten sich zu einem Schrei der Angst, dann ebbte der Lärm wieder ab, wurde zur Klage, und Stille kehrte ein.
Nach Mitternacht hörten sie auf. Vielleicht aus Verzweiflung um ihren verlorenen Sohn. Heimlich gingen sie in alle Richtungen fort, zurück zu ihrem eigenen Leid. Die Nacht, die geduldige Sammlerin, nahm sie alle auf und verwischte die Spuren.
8.
Matitjahu Demkow genoss die Pause. Auch Galila versuchte nicht zu drängen, es war Nacht, das Mädchen rollte die Leinwände zusammen, die Matitjahu Demkow von seinem Cousin Leon bekommen hatte, und prüfte die Farbtuben. Es waren großartige Produkte, echter Künstlerbedarf. Sie hatte bis dahin nur auf gefettetem Sackleinen gemalt, oder auf billigen Stoffen, und die Farben hatte sie aus dem Kindergarten bekommen. Sie ist klein, dachte Matitjahu Demkow, sie ist ein kleines Mädchen, dünn und verwöhnt. Ich könnte sie zerbrechen. Ganz langsam. Er hatte Lust, es ihr unvermittelt zu sagen, heftig, wie mit einem Hammerschlag, beherrschte sich aber. Die Nacht knisterte. Gedankenverloren, freudig und hingebungsvoll strich Galila plötzlich mit den Fingern über den dünnen Pinsel, tippte mit ihm ganz kurz in die orange Farbe, streichelte mit den Pinselhaaren leicht die Leinwand, wie eine unbewusste Liebkosung, wie Fingerspitzen auf den Nackenhaaren. Die Unschuld, die Arglosigkeit übertrug sich von ihrem Körper auf seinen, sein Körper reagierte mit Wellen des Verlangens.
Danach lag Galila bewegungslos, wie schlafend, auf den mit Farben und Öl befleckten Fliesen, um sie herum verstreut die Leinwände und Farbtuben. Matitjahu lehnte sich zurück auf sein Junggesellenbett, schloss die Augen und beschwor seine Phantasien.
Wenn er sie beschwört, stellen sie sich meistens sofort ein, seine geheimen und auch seine wilden Phantasien. Sie kommen zu ihm und präsentieren sich. Diesmal wählte er die Flutphantasie aus, eine der schwersten in seinem Repertoire.
Am Anfang sieht man unzählige Schluchten, die an Bergflanken herabstürzen, und eine große Zahl fließender Gewässer, mäandernd und einander kreuzend. Mit einem Mal taucht an den Hängen ein Gewimmel kleiner Menschen auf. Wie winzige schwarze Ameisen schwärmen sie, pressen sich aus ihren in den Felsspalten verborgenen Höhlen heraus und ergießen sich abwärts wie ein Wasserfall. Horden von schwarzen, mageren Menschen strömen die Hänge herab, rollen wie reißende Steinlawinen ins Tal. Dort teilen sie sich in Tausende Kolonnen auf, rasen in wilder Flut Richtung Westen. Jetzt sind sie schon so nah, dass man ihre Form erkennen kann: eine ekelhafte, dunkle, abgezehrte Menge, voller Läuse und Flöhe, stinkend. Hunger und Hass entstellen ihre Gesichter. In ihren Augen glüht der Wahnsinn. Sie überschwemmen die fruchtbaren Täler, überrennen unaufhaltbar die Ruinen der verlassenen Dörfer. In ihrem Sog Richtung Meer reißen sie alles mit sich, was ihnen im Weg steht, entfernen Pfähle, überfluten Felder, zerbrechen Zäune, zerstören Gärten, räumen die Obstplantagen ab, plündern die Höfe, kriechen durch Schuppen und Speisekammern, krabbeln wie verrückte Affen die Wände hoch, immer weiter, westwärts, bis zum Meer.
Und plötzlich bist auch du umzingelt. Belagert. Stehst du wie versteinert da. Aus der Nähe erkennst du erst den Hass, der in ihren Augen lodert, die Münder sind weit aufgerissen, sie atmen schwer, ihre Zähne sind gelb und faul, und in ihren Händen blitzen gebogene Messer. Sie verfluchen dich in abgehacktem Ton, mit unterdrücktem Zorn oder mit dunklem Begehren. Schon greifen ihre Hände nach deinem Fleisch, schon sind da Messer und Schrei. Mit letzter Kraft löschst du diese Phantasie und atmest fast erleichtert auf.
»Auf geht’s«, sagte Matitjahu Demkow. Seine rechte Hand packte das Mädchen, die linke, an der die drei Finger fehlen, streichelte ihren Nacken. »Auf geht’s, lass uns von hier abhauen. In dieser Nacht noch. An diesem Morgen. Ich werde dich retten. Wir fliehen zusammen nach Südamerika. Zu meinem Cousin Leon. Ich sorge für dich, ich werde immer für dich sorgen.«
»Lass mich, rühr mich ja nicht an«, sagte sie.
Er zog sie schweigend in seine Arme.
»Mein Vater wird dich morgen umbringen. Lass mich, habe ich gesagt.«
»Dein Vater sorgt jetzt für dich und wird immer für dich sorgen«, antwortete Matitjahu Demkow ruhig. Er ließ sie los. Das Mädchen stand auf, strich sich den Rock glatt, fuhr sich durch die hellen Haare.
»Ich möchte das nicht. Ich wollte überhaupt nicht zu dir kommen. Du hast mich gezwungen und du tust mir Dinge an, die ich nicht will, und du sagst alles Mögliche, weil du verrückt bist, und alle wissen, dass du verrückt bist, da kannst du fragen, wen du willst.«
Matitjahu Demkow verzog die Lippen, als würde er lächeln.
»Ich werde nie mehr zu dir kommen. Und ich will deine Farben nicht. Du bist gefährlich. Du bist hässlich wie ein Affe. Und du bist verrückt.«
»Ich kann dir etwas über deine Mutter erzählen, wenn du es hören willst. Und wenn du jemanden hassen und verfluchen willst, solltest du sie hassen und verfluchen, nicht mich.«
Das Mädchen drehte sich schnell zum Fenster, riss es mit einer verzweifelten Bewegung auf und streckte den Kopf hinaus in die leere Nacht. Sie wird jetzt schreien, dachte Matitjahu Demkow erschrocken, sie wird jetzt schreien, und ich werde keine zweite Chance bekommen. Das Blut schoss in seine Augen. Er rannte zu ihr, hielt ihr den Mund zu, zog sie ins Zimmer, grub seine Lippen in ihre Haare, seine Lippen suchten ihr Ohr, fanden es, und er erzählte.
9.
Wellen kalter, herbstlicher Luft schmiegten sich an die Hauswände und suchten einen Weg ins Innere. Von dem Hof am Hügelabhang drangen Viehgebrüll und Flüche. Vielleicht fand bei einer Kuh eine schwere Geburt statt, und die große Taschenlampe warf Licht auf Blut und Schleim. Matitjahu Demkow kniete auf dem Fußboden seines Zimmers und sammelte die Malutensilien auf, die seine Besucherin verstreut hatte. Galila stand wieder am offenen Fenster, mit dem Rücken zum Raum und dem Gesicht zur Dunkelheit. Dann sprach sie, noch immer mit dem Rücken zu dem Mann:
»Das ist höchst zweifelhaft«, sagte sie, »das kann kaum sein, es ist auch nicht logisch, das kann man nicht beweisen und es ist verrückt. Vollkommen verrückt.«
Matitjahu Demkow starrte mit seinen mongolischen Augen auf ihren Rücken. Jetzt war seine Hässlichkeit vollkommen, eine komprimierte Hässlichkeit, durchdringend.
»Ich zwinge dich zu nichts. Bitte. Ich werde schweigen. Vielleicht werde ich heimlich in mich hineinlachen. Von mir aus kannst du Saschkes Tochter sein, sogar die von Ben-Gurion. Ich schweige. Ich schweige wie mein Cousin Leon, er liebte heimlich den christlichen Sohn, den er hatte und zu dem er nie ich liebe dich sagte, erst, nachdem dieser Sohn elf Polizisten und sich selbst umgebracht hatte, sagte er an seinem Grab zu ihm ich liebe dich. Bitte.«
Plötzlich, ohne Ankündigung, brach Galila in Lachen aus.
»Du Dummkopf, schau mich doch an, ich bin blond.«
Matitjahu schwieg.
»Ich bin nicht von dir, ich bin sicher, dass ich nicht so blond wäre, ich bin weder von dir noch von Leon, ich bin blond und wir dürfen es! Komm!«
Der Mann machte einen Satz hin zu ihr, schnaufte, stöhnte, suchte blind seinen Weg, stieß den Kaffeetisch um, zitterte, und das Mädchen zitterte mit ihm.
Dann wich sie vor ihm zurück an die Wand. Er schob den umgekippten Tisch zur Seite. Trat nach ihm. Die Augen blutunterlaufen, ein Röcheln drang aus seiner Kehle, und sie erinnerte sich plötzlich an das Gesicht ihrer Mutter und an ihre zitternden Lippen und ihr Weinen, und sie stieß den Mann wie träumend von sich. Als Geschlagene gingen sie auseinander, mit weit aufgerissenen Augen.
»Vater«, sagte Galila erstaunt, als würde sie am ersten Wintermorgen am Ende eines langen Sommers aufwachen, aus dem Fenster schauen und »Regen« sagen.
10.
Der Sonnenaufgang hat bei uns nichts Edles. Aus billiger Sentimentalität steigt die Sonne über die Berggipfel im Osten und berührt unsere Erde mit tastenden Strahlen. Ohne Glanz und ohne komplizierte Lichtspiele. Nur gewöhnliche Schönheit, wie auf einer Ansichtskarte, nicht wie eine wirkliche Landschaft.
Doch das ist bestimmt einer der letzten Sonnenaufgänge. Der Herbst kommt schnell. In wenigen Tagen werden wir am Morgen aufwachen, und es wird regnen. Vielleicht auch hageln. Der Sonnenaufgang wird hinter einer Leinwand aus grauen Wolken stattfinden. Frühaufsteher werden sich in ihre Mäntel wickeln, hinausgehen und vor dem schneidenden Wind erstarren.
Die Jahreswechsel sind banal. Herbst, Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Es hat sie schon immer gegeben. Wer den Lauf der Zeit und der Jahreszeiten aufhalten will, sollte auf die nächtlichen Geräusche hören, die sich nie ändern. Diese Geräusche erreichen uns von dort draußen.
(1963)
Beduinen und Kreuzottern
1.
Der Hunger trieb sie her.
Die von Hunger Bedrohten flohen nordwärts, sie und ihre staubigen Herden. Zwischen September und April war im Negev kein einziger Regentropfen gefallen, um den Fluch zu mildern, der Lössboden erstickte im Staub. Der Hunger verbreitete sich in den Zelten und richtete großes Unheil an unter den Herden der Beduinen.
Die Militärverwaltung kümmerte sich umgehend um die Situation. Trotz der Konflikte beschloss sie, den Beduinen den Weg nach Norden freizugeben: Man kann eine ganze Bevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, nicht dem Hunger überlassen.
Dunkel, schlank und muskulös machten sich die Stammesmitglieder auf, die staubigen Wege entlang, mit ihrem Vieh. Ihr Weg schlug Bahnen ein, die den Menschen mit festen Häusern verborgen blieben. Ein hartnäckiger Strom ergoss sich nordwärts, umging die Siedlungen, betrachtete mit aufgerissenen Augen das besiedelte Land. Ihr schwarzes Vieh breitete sich auf den gelb gewordenen Stoppelfeldern aus und riss mit rachsüchtigen, starken Zähnen die Stoppeln heraus. Das Verhalten der Beduinen ist geheim, dem offenen Auge verborgen. Sie bemühen sich, dir nicht zu begegnen. Wollen ihre Existenz verbergen.
Du fährst mit einem ratternden Traktor an ihnen vorbei, wirbelst Staubwolken auf, und sie halten ihr Vieh fest und machen dir mehr Platz, als nötig wäre. Von weitem betrachten sie dich unablässig. Sie erstarren zu Standbildern. Und die glühend heiße Luft verwischt ihr Äußeres und lässt sie alle gleich aussehen, den Hirten mit dem Stab, die Frau und ihr Kind, alt, die eingesunkenen Augen. Halb blind, und vielleicht stellen sie sich blind, um zu betteln. Einer wie du wird nie wirklich dahinterkommen.
Unser gepflegtes Vieh wird nie so sein wie ihr armseliges: ein Haufen räudiger Tiere, aneinandergedrängt, eines das andere schützend, ein dunkler, zitternder Haufen. Sehr leise ist dieses Vieh, nur die Kamele boykottieren die Demut, sie heben ihre Hälse und schauen dich mit müden Augen an, mit einem traurigen, spöttischen Blick. So etwas wie alte Weisheit liegt in den Augen der Kamele. Und was bedeutet das leichte Zittern, das ständig über die Haut dieser Kamele läuft?
Manchmal gelingt es dir, sie aus der Nähe zu überraschen. Wenn du übers Feld gehst, kann es passieren, dass du siehst, wie eine Herde träge herumsteht, von der Sonne gelähmt, als hätte sie in der trockenen Erde Wurzeln geschlagen. Und in ihrer Mitte schläft der Hirte, dunkel wie ein Basaltblock. Du näherst dich und wirfst einen Schatten auf ihn. Erstaunt stellst du fest, dass seine Augen offen sind. Er entblößt seine Zähne zu einem Lächeln. Zum Teil sind sie strahlend weiß, zum Teil verfault. Sein Geruch strömt dir entgegen. Du verziehst das Gesicht. Das trifft ihn wie ein Faustschlag. Flink springt er auf und steht da, mit gebeugtem Körper, gesenkten Schultern. Jetzt richtest du ein kaltes, blaues Auge auf ihn. Er zieht die Lippen noch weiter auseinander und stößt einen kehligen Laut aus. Seine Kleidung besteht aus Wolle und Leinen, einer kurzen europäischen Jacke, gestreift, darunter weiße Wüstenkleidung. Er legt den Kopf schief. In seinen Augen blitzt eine versöhnliche Glut auf. Wenn du ihn nicht beschimpfst, streckt er plötzlich die linke Hand aus und bittet in schnellem Hebräisch um eine Zigarette. Seine Stimme klingt seidig, wie die Stimme einer scheuen Frau. Wenn du nett zu ihm bist, steckst du dir eine Zigarette zwischen die Lippen und wirfst ihm eine in seine zerfurchte Hand. Zu deinem Erstaunen zieht er aus den Tiefen seiner Kleidung ein vergoldetes Feuerzeug und gibt dir Feuer. Das Lächeln verschwindet nicht von seinen Lippen. Es dauert zu lange, es ist ein nichtssagendes Lächeln. Ein Sonnenstrahl bricht sich auf dem breiten Goldring, der seinen Finger schmückt, und zittert in deinen blinzelnden Augen.
Schließlich kehrst du dem Beduinen den Rücken und gehst deiner Wege. Nach hundert oder zweihundert Schritten bemerkst du, solltest du den Kopf drehen, dass er stocksteif dasteht, den Blick auf deinen Rücken geheftet. Du könntest schwören, dass er noch immer lächelt. Und noch lange lächeln wird.
Und dazu ihr nächtlicher Gesang. Eine Art eintöniges, lang anhaltendes Jammern weht durch die Nachtluft, von Sonnenuntergang bis zu den frühen Morgenstunden. Die Stimmen ergießen sich über die Wege und die Gärten des Kibbuz, sie belasten unsere Nächte mit einer unbehaglichen Schwere. Du legst dich abends auf dein Lager, und ein fernes Trommeln skandiert deinen Schlaf wie hartnäckige Herzschläge. Die Nächte sind warm und dunstig. Wolken ziehen vor dem Mond vorbei wie Karawanen von jungen Kamelen, Kamelen ohne Glockenschwengel.
Die Zelte der Beduinen bestehen aus schwarzen Planen. Barfüßige Frauen gehen geräuschlos in der Nacht umher. Die Hunde sind mager und bösartig, sie verlassen das Zeltlager und jaulen die ganze Nacht den Mond an. Ihr Gebell macht die Hunde des Kibbuz ganz verrückt. Der älteste unserer Hunde wurde in einer Nacht wahnsinnig, brach in das Kükenbruthaus ein und tötete die Küken. Die Wächter schossen nicht aus Böswilligkeit auf ihn. Sie hatten keine Alternative. Jeder vernünftige Mensch würde den Wächtern Recht geben.
2.
Vielleicht irrst du dich und dann glaubst du, dass das Vordringen der Beduinen unseren unter der Hitze zusammensinkenden Nächten bis zu einem gewissen Grad Poesie verleiht. Vielleicht ist das ja so in den Augen einiger junger Mädchen ohne feste Beziehungen. Aber wir können eine Reihe prosaischer und sogar hässlicher Vorfälle nicht mit Schweigen übergehen, wie zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche, wie zum Beispiel die Zerstörung von Pflanzungen und zum Beispiel die epidemische Zunahme kleiner Diebstähle.
Aus der Wüste stammt die Krankheit, überträgt sich durch die Spucke der unbeaufsichtigten Tiere, die nie eine ausreichende tierärztliche Versorgung erlebt haben. Auch wenn wir einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben, hat die Seuche unser Vieh angesteckt, die Milchleistung drastisch verringert, und einige Kühe sind verendet.
Was die beschädigten Pflanzungen betrifft, müssen wir zugeben, dass wir nie einen Beduinen auf frischer Tat ertappt haben. Wir fanden nur menschliche und tierische Spuren in den Gemüsebeeten, in den Feldern mit Futterpflanzen und sogar in den umzäunten Obstgärten. Ebenso böswillige Zerstörungen unserer Bewässerungsrohre und der Grenzmarkierungen, der zurückgelassenen Arbeitsgeräte und der übrigen Gerätschaften.
Die Wahrheit ist, wir gehören nicht zu den Nachgiebigen. Wir glauben nicht an Geduld und eine vegetarische Lebensweise. Solche Dinge sind eher bei den jüngeren Kibbuzmitgliedern anzutreffen, und unter den Gründungsmitgliedern gibt es welche, die die Ideen Tolstois und seiner Anhänger vertreten. Um die Grenzen der Schicklichkeit zu wahren, werde ich nicht auf die Vergeltungsmaßnahmen einzelner junger Leute eingehen, die die Geduld verloren haben, sie beschlagnahmten Vieh, bewarfen einen verdächtigen jungen Beduinen mit Steinen und schlugen neben einem Wasserhahn im äußersten östlichen Feld einen Hirten zusammen. Zur Verteidigung der letzten Tat halte ich fest, dass dieser Hirte ein verschlagen schlaues Gesicht hatte: einäugig, gebrochene Nase, sabbernd, und aus seinen Kiefern – so haben die Täter einstimmig bezeugt – wuchsen lange, spitze und krumme Zähne wie bei einem Fuchs. Einer, der so aussieht, ist zu allem fähig. Und die Lehre werden sie nicht vergessen.
Die Sache mit den Diebstählen machte uns die größten Sorgen. Sie pflückten in den Gärten unreifes Obst, ließen Wasserhähne mitgehen, bauten auf den Feldern die Stapel mit den leeren Säcken ab, stahlen in den Hühnerställen, und ihre Finger vergriffen sich sogar in unseren kleinen Wohnungen an den bescheidenen Wertsachen.
Die Dunkelheit unterstützte ihre Diebereien. Unaufhaltsam wie der Wind verschwanden sie wieder im Lager. Und die Wächter, die wir aufstellten, nützten nichts, auch zusätzliche Wächter nicht. Manchmal ziehst du gegen Mitternacht los und drehst die Wasserhähne der Bewässerungsanlagen in einem fernen Feld zu, fährst mit einem Traktor oder einem gepanzerten Jeep, und die Scheinwerfer zeigen dir plötzlich irgendwelche verschwommene Schatten, einen Menschen oder ein Nachttier. Ein Wächter beschloss in einer Nacht, seine Waffe zu benutzen, und tötete einen verirrten Schakal.
Es versteht sich von selbst, dass das Kibbuzsekretariat nicht schwieg. Ein oder zwei Mal bemühte Etkin, unser Sekretär, die Polizei, aber deren Suchhunde irrten sich oder wussten nicht weiter: Nachdem die Polizisten sie ein paar Schritte außerhalb des Kibbuz geführt hatten, rissen sie ihre schwarzen Mäuler auf, ließen ein wildes Jaulen hören und starrten dumm vor sich hin.
Überraschende Razzien in den zerfransten Zelten brachten keine Ergebnisse. Als habe die Erde selbst beschlossen, die Räubereien zu verbergen und die Bestohlenen frech anzuschauen. Am Schluss wurde der Stammesälteste geschnappt und zum Kibbuzsekretariat gebracht, zwei Beduinen mit ausdruckslosen Mienen rechts und links von ihm, und die Polizisten, die sie ungeduldig vorwärtsschoben und immer wieder »los, weiter« sagten.
Wir, die Genossen des Sekretariats, behandelten den Alten und seine Leute höflich und respektvoll. Wir baten sie, auf der Bank Platz zu nehmen, waren freundlich, boten ihnen dampfenden Kaffee an, den Ge’ula zubereitet hatte, alles auf besonderen Wunsch von Etkin. Der Alte seinerseits antwortete würdevoll mit Segenssprüchen und guten Wünschen und lächelte unaufhörlich während des ganzen Gesprächs. Er formulierte seine Sätze in einem vorsichtigen, feierlichen Hebräisch.
Es stimmt, einige junge Männer des Stammes hätten die Hände nach unserem Besitz ausgestreckt. Es sei nicht zu leugnen. Sie hätten keinen Respekt, diese jungen Leute, und die Welt werde immer hässlicher. Deshalb wolle er um Verzeihung bitten und die gestohlenen Dinge zurückgeben. Gestohlener Besitz beiße ins Fleisch des Diebs, wie das Sprichwort sagt. So seien die Dinge nun mal, und es gebe kein Mittel gegen die Leichtfertigkeit der jungen Männer. Er bedauere die Belästigung und den Ärger, welche die jungen Leute verursacht hätten.
So sprach er, schob die Hand in die Tasche seines Gewands und holte einige Schrauben heraus, teils glänzend, teils verrostet, zwei Nägel, eine Messerklinge, eine Taschenlampe, einen zerbrochenen Hammer und drei verschimmelte Geldscheine, als Wiedergutmachung für den Schaden und den Ärger.
Etkin breitete verlegen die Arme aus. Aus Gründen, die nur ihm bekannt waren, zog er es vor, das Hebräisch des Gastes zu ignorieren und ihm in gebrochenem Arabisch zu antworten, eine Erinnerung an seine Schulzeit während der Zeiten der Unruhe und der Belagerung. Etkins Worte waren aufrichtig und klar, was die Brüderlichkeit der Völker betraf, die die Grundlage unserer Weltanschauung ist, und die gute Nachbarschaft, die das Verhältnis zwischen den Völkern des Ostens schon lange gekennzeichnet hat und umso wichtiger in der Gegenwart ist, wo so viel Blut vergossen wird und es so viel unnötigen Hass gibt.
Zu Etkins Ehren muss man sagen, dass er dem Gast die Diebstähle genau aufzählte, den Schaden und die Zerstörung hatte der Gast selbst bestätigt, aber – zweifellos aus Vergesslichkeit – vermieden zu entschuldigen. Wenn das Diebesgut zurückkäme und wenn die Diebstähle ein für alle Mal ein Ende fänden, seien wir aufrichtig bereit, eine neue Seite in der Beziehung zu den Nachbarn aufzuschlagen. Unsere Kinder würden einen Höflichkeitsbesuch in den Zelten der Beduinen bestimmt genießen und etwas daraus für sich lernen. Es sei wohl erlaubt zu sagen, dass als Folge davon auch ein Besuch der Beduinenkinder in den Häusern des Kibbuz beabsichtigt sei, um das gegenseitige Verständnis zu stärken.
Der Alte behielt sein Lächeln bei, das weder breiter noch weniger wurde, sondern gleich blieb, und erklärte höflich, die Herren des Kibbuz könnten keinen Beweis für weitere Diebstähle vorlegen, abgesehen von jenen, die er bereits eingestanden und für die er um Entschuldigung gebeten habe. Er unterstrich seine Worte mit einem Segensspruch, wünschte uns Gesundheit, ein langes Leben und reiche Frucht unseres Leibes und der Felder, ging und verschwand am Zaun, er und seine beiden in schwarze Kleidung gehüllten, barfüßigen Begleiter.
Da die Polizei nichts nützte und sogar die Nachforschungen einstellte, schlugen einige der jungen Männer vor, den Wilden in einer der nächsten Nächte eine Lehre zu erteilen, und zwar in einer Sprache, die sie gut verstünden.
Etkin wies ihren Vorschlag vehement und mit guten Gründen zurück, und die Jungen belegten daraufhin Etkin mit Ausdrücken, auf die ich aus Schicklichkeitsgründen nicht näher eingehe. Seltsam war, dass Etkin auf die Beleidigungen nicht reagierte und es sogar für richtig hielt, ihnen halbherzig Recht zu geben und zu versprechen, dass er den Vorschlag dem Sekretariat zur Entscheidung vorlegen wolle. Vielleicht fürchtete er Ungehorsam und ein Aufflammen der Gefühle.
Gegen Abend ging Etkin bei allen Mitgliedern des Sekretariats vorbei und lud sie zu einer dringenden Versammlung um halb neun ein. Als er in Ge’ulas Zimmer trat, erzählte er ihr von den Ideen der jungen Männer und dem ganz und gar undemokratischen Druck, den sie auf ihn ausübten. Er bat sie, zu der Sitzung des Sekretariats eine Kanne schwarzen Kaffee und viel guten Willen mitzubringen. Ge’ula antwortete mit einem säuerlichen Lächeln. Ihr Blick war verschwommen, weil Etkin sie aus einem unruhigen Schlaf geweckt hatte. Bis sie sich umgezogen hatte, war es bereits Abend, feucht, glühend heiß und stickig.
3.
Feucht, stickig und glühend heiß senkte sich der Abend über die Kibbuzhäuser, fing sich in den staubigen Zypressen und griff auf die Rasenflächen und die Ziersträucher über. Aus den Rasensprengern spritzte Wasser auf das durstige Gras, doch es wurde sofort verschluckt, vielleicht war es auch schon verdunstet und verschwunden, bevor es das Gras berührte. Im abgeschlossenen Sekretariatszimmer läutete vergeblich das Telefon. Alle Hauswände verströmten feuchten Dampf. Und aus dem Schornstein der Küche stieg Rauch nach oben, senkrecht wie ein Pfeil ins Herz des Himmels, denn es gab auch nicht den leisesten Wind. Von den fettigen Spülbecken war Lärm zu hören. Ein Teller zerbrach und jemand bekam einen blutigen Kratzer. Eine dicke Katze hatte eine Eidechse oder eine Schlange gefangen, zerrte ihr Opfer über den heißen Betonpfad und spielte träge mit ihm im Abendlicht. Ein alter Traktor ratterte in einem Schuppen, stotterte, stieß eine stinkende Benzinwolke aus, brüllte, hustete und setzte sich schließlich in Bewegung, um den Arbeitern der zweiten Schicht auf einem weiter entfernten Feld das Abendessen zu bringen. Ge’ula sah neben dem Paternosterbaum eine schmutzige Flasche liegen, mit Resten einer fettigen Flüssigkeit. Sie trat danach, trat noch einmal, aber die Flasche zersprang nicht, sondern rollte langsam in Richtung der Rosenbüsche. Sie nahm einen großen Stein. Versuchte, die Flasche zu treffen. Sie wollte sie unbedingt zerbrechen. Der Stein verfehlte das Ziel. Die junge Frau begann, eine undeutliche Melodie zu pfeifen.
Ge’ula ist eine untersetzte Frau, energisch, neunundzwanzig Jahre alt. Auch wenn sie noch keinen Mann gefunden hat, kennt doch jeder in unserem Kibbuz ihre Qualitäten, zum Beispiel die Hingabe, mit der sie sich gesellschaftlichen Problemen und kulturellen Tätigkeiten widmet. Ihr Gesicht ist blass und mager. Es passt zu ihr, starken Kaffee zu kochen, den man bei uns Kaffee nennt, der Tote aufweckt. Um die Mundwinkel ziehen sich zwei bittere Falten.
An Sommerabenden, wenn wir uns gemeinsam auf eine Decke legen, die auf einer der Rasenflächen ausgebreitet ist, und Witze und Lieder und Zigarettenrauch gen Himmel aufsteigen lassen, verkriecht sich Ge’ula in ihr Zimmer und gesellt sich erst zu uns, wenn sie eine Kanne dampfenden bitteren Kaffee gekocht hat. Und sie sorgt auch immer dafür, dass die Kekse nicht ausgehen.
Was zwischen mir und Ge’ula abläuft, gehört nicht hierher, ich begnüge mich mit einem Hinweis oder zwei. Vor langer Zeit gingen Ge’ula und ich gegen Abend in den Obstgärten spazieren und unterhielten uns. Das ist allerdings lange her und längst zu Ende. Wir unterhielten uns über unkonventionelle gesellschaftspolitische Ideen und diskutierten über die neueste Literatur. Ge’ula formulierte scharf, manchmal erbarmungslos; das machte mich sehr verlegen. Sie mochte meine Geschichten nicht, wegen der radikalen Polarität der Situationen, der Landschaften, der Figuren: Es fehlten die Zwischentöne zwischen Licht und Dunkelheit. Ich verteidigte mich oder stritt es ab, aber laut Ge’ula gab es immer Beweise, und sie war daran gewöhnt, einen Gedanken zu Ende zu denken. Manchmal wagte ich es, besänftigend die Hand auf ihre Schulter zu legen und zu warten, dass sie sich beruhigte. Sie kannte keine Ruhe. Wenn sie sich ein oder zwei Mal an mich lehnte, begründete sie es immer mit einer zerrissenen Sandale oder Kopfschmerzen. Dann haben wir das sein lassen. Bis heute schneidet sie meine Geschichten aus den Zeitschriften aus und legt sie, in Ordner sortiert, in eine spezielle Schublade.
Und ich kaufe ihr noch immer zu ihrem Geburtstag ein neues Buch von einem der jungen Lyriker. Wenn sie nicht da ist, schleiche ich mich in ihr Zimmer und lasse das Buch auf ihrem Tisch zurück, ohne Widmung. Manchmal sitzen wir zufällig im Speisesaal zusammen an einem Tisch. Ich weiche ihrem Blick aus, um nicht die spöttische Traurigkeit zu sehen. An heißen Tagen, wenn ihr Gesicht verschwitzt ist, röten sich die Aknepickel auf ihrem Kinn und sie sieht aus, als habe sie keine Hoffnung. Mit Beginn der herbstlichen Kühle kommt sie mir von weitem manchmal schön und herzergreifend vor. An solchen Tagen pflegt Ge’ula gegen Abend zu den Obstgärten zu gehen. Sie geht allein und kehrt allein zurück. Einige der jungen Leute fragen mich, was sie dort sucht, und auf ihrem Gesicht liegt ein böses Lächeln. Ich antworte, ich wisse es nicht, und tatsächlich weiß ich es nicht.
4.
Hasserfüllt ergriff Ge’ula einen zweiten Stein, um ihn nach der Flasche zu werfen. Diesmal traf sie das Ziel, doch sie hörte nicht das Zersplittern des Glases, das sie hören wollte, sondern nur ein leichtes Klirren: Der Stein hatte die Flasche nur gestreift und die Flasche unter einen Busch gerollt. Ein dritter Stein, größer und schwerer als seine beiden Vorgänger, wurde aus einer lächerlich kurzen Entfernung geworfen: Ge’ula trat auf das aufgelockerte Beet und stand über der Flasche. Diesmal war es ein trockener, ohrenbetäubender Knall, der keine Erleichterung oder Ruhe brachte.