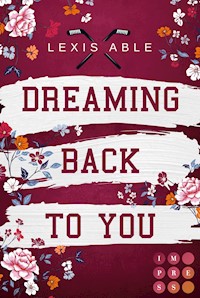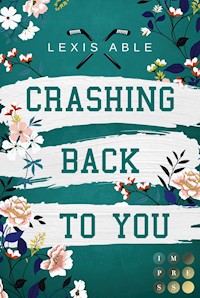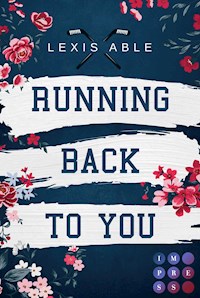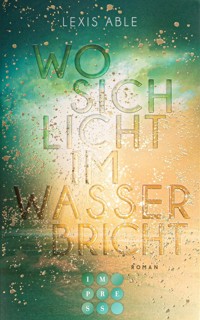
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dir will ich in Sternen ertrinken Endlich volljährig zieht es Enya in die Welt hinaus – sprichwörtlich den Sternen entgegen, auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste San Diegos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen – auch wenn sie es nie gelernt hat. Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen, und ehe Enya sich versieht, soll ausgerechnet er ihr das Schwimmen beibringen. Ein ewiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen, doch in Jonahs Tiefe lauert auch eine Dunkelheit … »Die Geschichte von Enya und Jonah ist wie eine salzige Meeresbrise, die dich mit seinen Wellen an die Küste Kaliforniens trägt – und dir auf dem Weg nach Hause die Sterne zeigt. Lexis Able hat mein Herz im Sturm erobert.« – SPIEGEL-Bestseller-Autorin Kate Corell //Dies ist der erste Band der emotional mitreißenden New Adult Romance »Westcoast Skies«. Alle Romane der fesselnden Reihe: -- Band 1: Wo sich Licht im Wasser bricht -- Band 2: Wo Wind und Wellen sich berühren Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ImpressDie Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Lexis Able
Wo sich Licht im Wasser bricht
Mit dir will ich in Sternen ertrinken
Endlich volljährig zieht es Enya in die Welt hinaus – sprichwörtlich den Sternen entgegen, auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste San Diegos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen – auch wenn sie es nie gelernt hat. Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen, und ehe Enya sich versieht, soll ausgerechnet er ihr das Schwimmen beibringen. Ein ewiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen, doch in Jonahs Tiefe lauert auch eine Dunkelheit …
»Die Geschichte von Enya und Jonah ist wie eine salzige Meeresbrise, die dich mit ihren Wellen an die Küste Kaliforniens trägt – und dir auf dem Weg nach Hause die Sterne zeigt. Lexis Able hat mein Herz im Sturm erobert.« – SPIEGEL-Bestseller-Autorin Kate Corell
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Vita
© HERZLICHT FOTOGRAFIE VON RENATE NEURAUTER
Lexis Able wurde 1986 in Österreich geboren und wohnt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und einigen Vierbeinern in Tirol. Aufgewachsen ist sie zwischen Bergen und Büchern, am liebsten in Kombination. Aus dem Schreiben schöpft Lexis die Kraft für ihren Beruf als Sonderkindergartenpädagogin, ihr erstes Buch hat sie selbst im Alter von sechs Jahren geschrieben. Auf langen Bergläufen entwickelt sie ihre Geschichten, die sie nun endlich mit anderen teilen darf.
VORBEMERKUNG FÜR DIE LESER*INNEN
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Lexis und das Carlsen-Team
Stark zu sein, macht dich groß.Starke Frauen an deiner Seite zu haben, unbesiegbar.Für Sylvia, Christine, Irene und Andrea.Für Yasemin.Und für Svenja.
Und natürlich für dich, mit meinem Buch in deiner Hand. Ich wünsche dir immer jemanden an deiner Seite, der deine Stärken wachsen lässt.
PLAYLIST
MORE THAN WORDS – JOSEPH VINCENT
YOU & ME – JAMES TW
STARLIGHT – LAYRZ
BE STILL – THE FRAY
STAY – HURTS
SAY SOMETHING – A GREAT BIG WORLD, CHRISTINA AGUILERA
WELCOME TO WONDERLAND – ANSON SEABRA
REWRITE THE STARS – JOSEPH VINCENT
IF YOU LOVE HER – FOREST BLAKK
TWO ORUGUITAS – SEBASTIÁN YATRA
WHEREVER YOU WILL GO – THE CALLING
PETER PAN WAS RIGHT – ANSON SEBRA
CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU – JOSEPH VINCENT
LEAVE ME ALONE (I’M LONELY) – PINK
THERE’S NOTHING HOLDIN’ ME BACK – SHAWN MENDES
SHAPE OF MY HEART – BACKSTREET BOYS
FOOTPRINTS – TOM GREGORY
ROMAN – PHILIPP POISEL
KISS ME – DERMOT KENNEDY
DOWN – JASON WALKER
HOW TO SAVE A LIFE – THE FRAY
PROLOG
ENYA
Niemand kann mich hören.
Leise schließe ich die Haustür hinter mir, drehe damit allem, was mir vertraut ist, den Rücken zu und atme tief ein und aus. Andächtig fahre ich mit meinen Fingerspitzen über die schmale Mappe mit den Straßenkarten. Zum ersten Mal in meinem Leben empfinde ich die sehnsuchtsvolle Unruhe in mir nicht als Bedrohung. Sie ist das, was mich mutig genug macht. Für einen Aufbruch und für meine Suche.
Das flackernde Licht auf der Veranda lässt mich die Buchstaben in der Dunkelheit kaum erkennen, und doch weiß ich, dass sie da sind und mir den Weg weisen werden. Frei sein in allen Himmelsrichtungen.
So viele Male habe ich mir diesen Moment vorgestellt, und jeder einzelne Schritt weg von der Lakefield Farm lässt die Enge um meinen Brustkorb schwinden. Abend für Abend bin ich mit dem Gedanken eingeschlafen, dass mich jede Nacht einen Tag näher an den achtzehnten Geburtstag bringt und damit der Möglichkeit, nicht mehr in der Vergangenheit gefangen sein.
Der Mond spiegelt sich auf der Windschutzscheibe des alten Wohnmobils, das mir Mr Shoebaker letzten Sommer mehr geschenkt als verkauft hat. Mit den wenigen Samstagen, an denen er meine Hilfe in dem kleinen Café wirklich gebraucht hat, wäre nicht einmal ein Bruchteil des Fahrzeugs abbezahlt gewesen.
»So muss der alte Riese zumindest nicht in der Scheune vor sich hin rosten«, hat er mit seinem sanftmütigen Lächeln gesagt und mir die Schlüssel in die Hand gedrückt. »Ich glaube kaum, dass Babs und ich ihn jemals wieder fahren werden. Kümmere dich gut um ihn, und er bringt dich einmal um die ganze Welt.«
»Vorerst reicht mir Amerika«, habe ich dankbar geantwortet. »Einmal in jede Himmelsrichtung.«
»Woher weißt du dann, wann du da bist?« Mr Shoebaker hat auf seine Uhr geschaut. »Und wann du umkehren musst?«
»Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass ich es spüre.«
Frei von Regeln und Strukturen, muss ich mein Bauchgefühl neu kennenlernen, mich neu kennenlernen und das finden, was mir die Zeit übrig gelassen hat.
Mit zittrigem Fuß am Gaspedal bin ich mit dem Winnebago aus der Scheune gefahren und habe das letzte Jahr darauf verwendet, die Inneneinrichtung mit allem zu sanieren, was ich auftreiben konnte. Das meiste Zeugs war zwar gebraucht, aber in gutem Zustand, nur den Vinylboden und die Matratze habe ich von meinen wenigen Ersparnissen neu gekauft.
Die hellgelbe Fahrertür quietscht leise, als ich sie öffne. Selbst die ausgetauschten Gummidichtungen konnten die eigentümlichen Geräusche des Oldtimers nicht vertreiben. Es stört mich nicht, er hat eine lange Geschichte. Bei dem blumigen Duft im Wageninneren seufze ich zufrieden auf. Die vielen Jahre in der Scheune haben ihre Spuren hinterlassen und der leicht modrige Geruch sich regelrecht festgekrallt. Erst die neuen Überzüge, die ich für alle Polsterungen aus alten Stoffstücken zusammengenäht habe, konnten den fremden Beigeschmack überdecken. Ich habe mir hier mein eigenes kleines Reich geschaffen, das nur mir gehört und das ich mit niemandem teilen muss.
Alle von der Farm haben sich schon gestern Abend von mir verabschiedet. Wir haben Geburtstagskuchen gegessen, und jeder Einzelne von ihnen hat mir einen Stern aus fluoreszierendem Plastik geschenkt, auf dem meine Wünsche und Träume Platz haben sollen. Ich werde sie einen nach dem anderen an die Decke meines Wohnmobils kleben, sobald sie sich erfüllt haben.
Als der ratternde Motor die Stille durchbricht und ich den ersten Gang einlege, fühle ich keine Einsamkeit. Die Dunkelheit bleibt hinter mir, die Welt breitet sich mit all ihren Möglichkeiten aus, und pure, ungetrübte Freude fließt durch mich hindurch.
Ich fahre über die lehmige Zufahrtsstraße vom Grundstück, konzentriert darauf, den Schlaglöchern auszuweichen, und biege auf die Straße hinauf in Richtung Highway.
Ohne ein einziges Mal in den Rückspiegel zu schauen, verlasse ich Wyoming. Von nun an gibt es nur eine Richtung: den Sternen entgegen. Ich bin bereit.
SWELL
Wellen, die weit draußen entstehen und auf die Küste zutreiben. Treffen sie auf den richtigen Untergrund, werden sie zur Brandung.
KAPITEL 1
JONAH
Unser Haus ist das einzige in der ganzen Straße, in dem zu dieser Zeit schon Licht brennt. Mom winkt mir durch das Fenster der Backstube zu, als ich mein Rad daran vorbei Richtung Straße schiebe. Sie zeigt auf ihren Kopf, und ich nehme anstatt eines Helms achselzuckend meine Cap mit dem Logo der West Coast University vom Lenker. Als ich die Cap aufsetze und mich mit einem entschuldigenden Grinsen auf das Bike schwinge, hebt Mom warnend einen Finger. Noch bevor sie aus der Backstube kommen und mich zu einem Helm überreden kann, trete ich in die Pedale.
Ich weiß, dass sie Angst um mich hat. Noch immer. Und trotzdem will ich meine Entscheidungen selbst treffen, wann immer mir eine Wahl bleibt. Viel zu oft verstecke ich mich hinter meinem Bruder Caden. Nicht, weil es der leichtere Weg ist. Es ist der sichere Weg, der mich vor musternden Blicken, höflichem wiederholten Nachfragen und Mitleid schützt. Und, noch viel schlimmer: vor beschissen langsam und überdeutlich gesprochenen Sätzen, die in der Wortwahl denen für Zweijährige ähneln.
Der Kies in unserer Ausfahrt knirscht unter meinen Rädern und scheucht ein Wildkaninchen auf, das sich aus dem angrenzenden Kiefernwald bis hierher verirrt haben muss. Als ich auf die Hauptstraße biege, ist es zwischen Dads an unserer Grundstücksgrenze aufragenden Sonnenblumen verschwunden.
Die abfallende Straße Richtung Küste ist nicht beleuchtet, und ich muss aufpassen, dass ich die kleinen Gesteinsbrocken nicht übersehe, die das Unwetter gestern Abend in den Weg geschwemmt hat. Bis ich die drei Meilen zur Bucht zurückgelegt habe, beginnt der Morgen schon leicht zu grauen, und ich finde den gut verborgenen Weg zum Strand auf Anhieb. Die Kiefern wachsen gleichmäßig bis an den Rand der Klippe und bieten keinen Orientierungspunkt. Ich erinnere mich nicht daran, wie oft ich den schmalen Durchgang schon verpasst habe und mit einem Kopfschütteln suchen musste. Ein geringer Preis dafür, dass diese versteckte Bucht mein kleines Geheimnis bleibt.
Ich lege das Bike flach auf den Boden und steige den lehmigen Pfad nach unten. Obwohl ich das Meer noch nicht sehe, dringt das wogende Rauschen der Wellen an meine Ohren, viel lauter als an den meisten Tagen. Das Abklingen des Unwetters lässt die Natur wahrhaftiger und voller erscheinen.
Ich trete hinter dem letzten Felsvorsprung hervor und zögere kurz, als ich die weiße Gischt sehe, die das Wasser schwallartig vor sich hertreibt. Hier sind zu wenige Felsen, um die sich auftürmenden Wellen zu brechen. Ich schwimme seit Jahren an dieser Stelle und kenne die Strömungen genau, aber nach einem Unwetter ist jedes Gewässer ein unbekanntes, und ich kann die Gefahr nicht einschätzen.
Mein Blick wandert zwischen dem Pfad hinauf zur Straße und dem Wasser hin und her. Ich sollte gehen, jetzt sofort, und Mom in der Konditorei helfen. Der Gedanke an das Radio, das neben dem Backen läuft, das ununterbrochene Piepsen irgendeines Ofens und das dumpfe Schlagen des Mixers treiben mich von der Klippe weg. Ich nehme meinen Rucksack ab, lasse ihn in den Sand fallen und setze mich daneben. Es braucht keine fünf Wellen, und ich weiß, dass mir die Aussicht aufs Wasser nicht genügen wird.
»Scheiß drauf«, murmle ich, schlucke jegliche Vorsicht hinunter und stehe auf. Die Schuhe streife ich gleichzeitig mit der Cap ab. Shirt und Hose. Und dann das Letzte, was mich von der Stille trennt.
In dem Moment, in dem meine Füße das eiskalte Wasser berühren, spüre ich nichts als Erlösung. Über die ersten Wellen kann ich noch springen, bis mir die Wogen gegen den Oberkörper preschen und ich mich in die Brandung fallen lasse. Mein Körper wird eins mit dem Drücken und Schieben der Flut. Das Meer zeigt einen Bruchteil seiner gewaltigen Kraft und lässt mich erbarmungslos fühlen, dass ich verloren bin, wenn ich nicht kämpfe. Ich schließe die Augen, hole tief Luft und schwimme. Die Beinschläge im Einklang mit den gleichmäßigen Zügen der Arme, jedes Luftholen präzise geplant.
Und es wird ruhig um mich. Ich bin umhüllt von der rettenden Dunkelheit des Wassers, in der es keine Rolle spielt, ob man hören kann.
Oder nicht.
KAPITEL 2
ENYA
Diese unglaubliche Weite.
Ich kenne das Meer aus meinen Erinnerungen und aus dem Fernseher, aber ich habe nicht mit dieser Weite gerechnet. Dabei ist es noch nicht einmal hell.
Ich falte die Straßenkarte, auf der San Diego rot eingekreist ist, in der Mitte zusammen und lege sie auf den Beifahrersitz. In den letzten Wochen hat sie mich verlässlich durch Amerika geführt und mich fühlen lassen, was es bedeutet, frei zu sein und für sich selbst zu entscheiden. Aus jedem Bundesstaat habe ich einen dieser Welcome to …-Sticker mitgenommen und auf das Heck des Campers geklebt. Sie sollen mir zeigen, dass ich vor nichts Angst haben muss, auch nicht vor dem Unbekannten.
Dieser Gedanke lässt meinen Blick auf die eine Ecke der Ansichtskarte fallen, die aus der Sonnenblende hervorschaut. Ich ziehe sie vorsichtig heraus. Die Kanten sind abgenutzt, und das Bild vom Strand mit dem Schriftzeichen von San Diego ist längst ausgebleicht. Und doch ist die Karte das Einzige, was mir von meiner Mom geblieben ist.
Meine Reise hat die Sehnsucht nach ihr mit dem Wunsch wachsen lassen, besondere Momente wie im Nationalpark in North Dakota oder meinen Besuch im Columbia Zoo in Ohio mit ihr zu teilen. Mit dieser Sehnsucht ist auch die Angst gewachsen, meine letzte Hoffnung auf ein Wiedersehen aufgeben zu müssen. Deshalb habe ich die Fahrt nach Kalifornien hinausgezögert. Sollte ich sie hier in San Diego nicht finden, weiß ich nicht, was ich noch machen soll.
Frei sein in alle Himmelsrichtungen. Und dieser Frieden hier am Meer. Das ist alles, was ich jemals für uns wollte, hat Mom für mich auf die Rückseite der Karte geschrieben. Ich freue mich schon so lange darauf, ihre Nachricht endlich auch zu spüren.
Mit einem Seufzen stecke ich sie zurück in die Sonnenblende und klappe diese nach oben, bevor ich weiterfahre.
Ein gelber Schimmer zeichnet sich am Horizont ab, und ich schalte einen Gang zurück, um an der Küstenstraße nach einer Parkmöglichkeit zu suchen. Bis zu den öffentlichen Stränden sind es laut Landkarte noch über zwei Meilen, und ich möchte meinen ersten Sonnenaufgang am Meer nicht im Wagen sitzend erleben. Ungeduldig biege ich bei der nächsten Möglichkeit Richtung Strand ab und bete inständig, dass es das riesige Wohnmobil den schmalen Weg auch wieder hinaufschaffen wird. Und dass es irgendwo da unten Platz zum Wenden gibt, denn Rückwärtsfahren ist definitiv nicht meine Stärke, was ich schon bei meinem allerersten Versuch am Weidezaun auf der Farm anschaulich bewiesen habe. Zumindest haben die Rinder jetzt einen zweiten Zugang zum Bach. Auch in den letzten Wochen ist mein Talent, den Camper zu manövrieren, nicht unbedingt gewachsen.
Das Fahrgestell ächzt auf dem unbefestigten Weg, und ich werde unsanft vor und zurück geworfen. Ein klirrendes Scheppern dringt durch den Wohnraum nach vorne, und ich kann nur hoffen, dass nicht alle Blumentöpfe kaputtgehen. Die Kiefern und Felswände zu beiden Seiten kommen unbeeindruckt näher, doch anstatt einfach anzuhalten, kämpfe ich gegen den Instinkt an, die Augen zu schließen, und gebe Gas. Ich sehe mich schon feststecken und aus der Dachluke klettern, da macht der Weg eine Biegung, und ich lenke den Winnebago schwungvoll um den Felsen herum.
Der erdige Untergrund wird breiter. Links von mir ragt immer noch die Klippe steil in die Höhe, aber auf meiner rechten Seite verläuft sich das Gestein in den Sandstrand und gibt den Blick auf den Pazifik frei. Erleichtert über genügend Stellfläche fahre ich ein Stück nach vorne, trete mit aller Kraft auf die Bremse und mache den Motor aus.
Auf der Fahrerseite habe ich gerade genug Platz zum Aussteigen. Ich widerstehe dem Drang, sofort zum Meer zu laufen. So wie es mir David, mein Pflegevater, gezeigt hat, hole ich zuerst den Unterlegkeil aus der Ladefläche an der Seite des Fahrzeugs und keile den gelben Metallpflock am hinteren Reifen ein. Der Wagen steht zwar gerade, dennoch möchte ich es nicht riskieren, dass er nach vorne rollt und wir für immer und ewig im Sand feststecken.
Mit kaltschweißigen Händen von der Abfahrt eben schlüpfe ich aus den Espadrilles und mache ein paar Schritte, bis meine nackten Füße in dem kühlen Sand einsinken. Vorsichtig bewege ich die Zehen und genieße das weiche Fließen der Sandkörner auf meiner Haut. Ich grabe einen Fuß tiefer und sehe zu, wie er umschlossen wird, sanft und fest zugleich. Lächelnd hebe ich den Kopf, schaue zum Wasser und gehe, wie von einer unsichtbaren Kraft angezogen, in Richtung Ozean.
Ich war das letzte Mal mit meiner Mom am Meer. Aus dem Leben einer Vierjährigen ist nicht viel übrig geblieben, aber ich erinnere mich noch genau an die vielen Strandtage in Los Angeles, an denen Mom mit mir das Schwimmen im Meer geübt hat. Ihre dunklen Haare, die sie immer zu einem Dutt gebunden hatte, und wie fest sie mich an sich gedrückt hat, wenn ich die kurzen Abstände alleine auf sie zuschwimmen konnte. Ich glaube, wir haben viel gelacht.
Aus meinen langsamen ersten Schritten werden schnellere, und je näher ich ihm komme, desto wilder renne ich auf das Meer zu. Dem dunklen Blau, dem ersten Licht der Sonne und meinen Erinnerungen entgegen.
Ein lauer Wind streift über meine Wangen, und ich inhaliere zufrieden die salzige Luft. An der feinen Naht zwischen hellem und dunklem Sand, Trockenheit und Wasser, halte ich abrupt an. Fasziniert schaue ich hinaus aufs Meer und spüre die fremde Grenzenlosigkeit. Ein lautes Lachen bricht aus mir heraus, als die ersten Sonnenstrahlen in meinem Rücken über die dunkle Wasseroberfläche gleiten und die Spitzen der Wellen in ein leuchtendes Gold tauchen. Ich spüre die Hand meiner Mom, die sich mit mir den Sonnenaufgang so oft angesehen hat, an meiner Schulter und bin mir plötzlich sicher, dass ich sie finden werde. Der Sonnenaufgang ist ein Neubeginn für diesen Tag und ein Neubeginn für mein Leben.
Umgeben von dem lauten Rauschen und Tosen mache ich den letzten Schritt nach vorne und warte die wenigen Sekunden, bis sich die nächste Woge auftürmt und mir entgegenwallt. Immer kleiner werdend verbeugen sich die Wellen vor mir im Sand und erreichen nur knapp meine Zehen. Die spitze Kälte belebt den kurzen Moment der Ruhe, und ich renne wieder los, den Sandstrand entlang. Das Wasser spritzt mir an den Beinen nach oben, und mein blondes Haar legt sich in wirren Strähnen um mein Gesicht. Ich renne so lange, bis mich mein schwerer Atem zum Anhalten zwingt. Dann drehe ich mich um und sehe im anmutigen Licht des Morgens, wie das Meer meine Spuren im Sand verschwinden lässt. Nicht grob und unaufhaltsam, sondern bedächtig. Fußabdruck für Fußabdruck.
Die Sonne ragt bereits über die Klippen und verwandelt das besondere Gold am Himmel in ein leuchtendes Orange. Wärme fängt meinen Körper ein, und ich bin überwältigt von dem Gefühl der Nähe und Geborgenheit, das so viel Weite einem vermitteln kann.
Die unbekannte Zuversicht spült jegliche Vorsicht und Angst hinweg und weckt eine fremde Euphorie in mir. Zaghaft trete ich nach vorne, bis die schäumenden Ausläufe meine Knöchel umspielen. Ich möchte mehr spüren. Mehr Wasser, mehr Kälte und mehr Leben, und ziehe mir den Hoodie über den Kopf. Ich trage keine Badesachen, aber ich schätze, für das Meer macht es keinen Unterschied, ob ich im Bikini oder in meiner Unterwäsche darin schwimme.
Schwimmen. Das letzte Mal muss vor vierzehn Jahren in Kalifornien gewesen sein. Andrea und David hatten auf der Farm in Wyoming zwar einen Pool für uns Pflegekinder im Garten, aber das Schwimmen habe ich in dem niedrigen Becken nie richtig gelernt.
Ich schüttle meine Zweifel ab und öffne entschlossen die Jeans. Nach ein paar Zügen wird mein Körper sich wieder daran erinnern, wie er sich oben zu halten hat. Oft genug habe ich Lotty dabei beobachtet, wie sie Bälle aus dem Pool gefischt hat – und ich glaube kaum, dass die Cattle-Hündin jemals Schwimmunterricht hatte. Befreiend und voller Eifer atme ich aus und stapfe durch das tiefer werdende Wasser, auf den pfirsichfarbenen Himmel zu.
Die Kälte durchtränkt sofort meine Unterwäsche, und ich stelle mich quer in die Brandung, damit ich nicht umgerissen werde. Salzwasser spritzt mir ins Gesicht, und ich komme nicht umhin, die Zunge auszustrecken und mir über die Lippen zu lecken, nur um mir selbst zu beweisen, dass es tatsächlich salzig ist. Ich lächle zufrieden bei dem erwarteten Geschmack, der sich in meinem Mund ausbreitet, und habe die sanfte Stimme meiner Mom im Ohr, die nicht will, dass ich vom Meerwasser probiere.
Kurz blicke ich mich um und gehe weiter, dem offenen Ozean entgegen. Die erste große Welle hebt mich hoch und drückt mich nach hinten, aber ich schaffe es, meinen festen Stand wiederzufinden. Den nächsten Rhythmus beobachte ich genau und stoße mich rechtzeitig vom Boden ab, um nicht erneut das Gleichgewicht zu verlieren. Nach wenigen Sprüngen vorwärts bin ich über den Punkt hinweg, an dem sich die großen Wellen auftürmen, und das Wasser wird etwas ruhiger.
Ich lasse die Hand über die Wasseroberfläche gleiten. Dabei werfen meine Finger einen dunklen Schatten auf das schimmernde Blau, das mir inzwischen bis zur Brust reicht. Mutig lehne ich mich etwas nach vorne, strecke die Arme aus und hebe die Füße leicht an, zuerst einen, dann den anderen. Und gehe sofort unter.
Bevor mein Kopf ganz in dem dunklen Wasser verschwindet, finden meine Füße Halt. Wieder breite ich die Arme aus, stoße mich dieses Mal sofort vom Boden ab und versuche zu gleiten, so wie es mir meine Mom gezeigt hat. Mein Oberkörper kann die kurze Schwebe ohne ihre Hilfe nicht halten, und ich gehe komplett unter. Prustend komme ich nach oben und erinnere mich an den Spaß, als sie mich im Wasser von sich geworfen hat und ich zu ihr zurückgehüpft bin, nur um das Ganze zu wiederholen. Genau dieses fremd gewordene, schwerelose Gefühl der Geborgenheit möchte ich hier im Wasser wiederfinden.
Darauf vertrauend, dass ich die richtige Körperspannung nur neu entdecken muss, nehme ich meine Ausgangsposition ein und strecke die Arme weit aus. Zu spät, um mich vor dem tiefen Rauschen an meiner Seite zu schützen, das alarmierende Nadelstiche unter meiner Haut explodieren lässt. Die volle Wucht eines rasenden Wellenberges kracht gegen meine Seite und reißt mich von den Beinen. Instinktiv trete ich mit den Füßen und suche nach Halt, kralle die Zehen in den sandigen Untergrund und stoße mich mit aller Kraft in Richtung Oberfläche ab. Das erlösende Morgenrot des Himmels blickt mir entgegen, und mit meinem ersten gierigen Atemzug werde ich mir des Schocks und der Angst bewusst, die sich in mir verbissen haben.
In dem Bruchteil, in dem ich die Anspannung mit meiner Atemluft aus mir hinausstoßen möchte, drischt eine neue Wasserwand auf mich nieder und zieht mich unnachgiebig mit sich. Ein zweites Mal trete ich panisch ins Leere und versuche, mich mit den Händen an irgendetwas festzuklammern, aber alles, was ich finde, ist ein Nichts aus flüssiger Dunkelheit.
Meine Mom ist nicht da. Und sie wird nicht kommen, um mich zu retten, weil sie sich selbst nicht retten konnte. Dieser vertraute Schmerz lässt fremd gewordene Bilder in mir aufsteigen. Die lange Zeit, die vergangen ist, macht sie nicht weniger klar oder bedrohlich. Noch immer ist da meine Mutter, mit roten und blauen Einstichstellen überall an ihrem Körper. Harsche Worte und tiefer Schlaf, der mir immer weniger Luft gelassen hat. Mir und uns.
In dem strömenden Sog wird oben zu unten, und ich verliere mich. Meine Augen erahnen den Anker aus Sonne und Licht, doch immer wenn ich überzeugt bin, mich damit retten zu können, wirbelt mich eine unsichtbare Kraft weiter in die Machtlosigkeit. Ich bin ausgeliefert, ein Nichts im Ozean, ein Nichts für meine Mom.
Trotz der urtümlichen Gewalt, in der ich versinke, sehe ich die letzten kleinen Luftbläschen aus meiner Lunge entweichen. Perfekt und rund, dem Leben so nah. Und dann hält die Welt einen Wimpernschlag lang an. Kein verschlingendes Rauschen an meinen Ohren, keine Stimme in mir, die nach Luft und Erlösung und Liebe brüllt. Nicht eine einzige Zelle mehr, die ums Überleben kämpft. Was bleibt, ist Stille.
Und in diese Stille falle ich, immer tiefer, geborgen in der Zuverlässigkeit der Ruhe, die sie mir schenken wird. Ein lautloses Sein, das Furcht und Unberechenbarkeit mit sich nimmt und beruhigenden Frieden bringt. So wie Mom auf ihrer letzten Karte für mich geschrieben hat.
Bis mir in dem stummen Fallen jemand die Hand reicht und meinen Körper an seine Seite zieht, mich festhält, wo ich losgelassen habe.
Ich spüre die Wärme des Lebens im Rücken, und das Orange und Gelb der aufgehenden Sonne funkelt hinter meinen Augen. Etwas streicht über meine Wange, erst leicht, dann fester, und ich beginne zu zucken. Zuerst mein Gesicht, dann meine Arme und Beine, schließlich mein Oberkörper. Ich hole Luft. Sauge gierig alles in mich ein, was meinen Körper wieder zurückbringt. Zurück an den Strand. Zurück ins Wasser. Zurück in die Arme, die sich um mich gelegt haben. Zurück zur keuchenden Atmung, die gegen das Wasser in meinen Lungen ankämpft. Und zurück zu einem Gesicht, dessen Umrisse sich im Sonnenlicht abzeichnen. Nasse Haare. Gänsehaut. Und dunkle Augen in einem tosenden Meer.
… von dem ich ziemlich sicher einen großen Teil verschluckt habe. In derselben Sekunde, in der ich Sand unter meinen Füßen fühle und mich die plötzliche Schwerkraft nach unten zieht, beginne ich, gegen das entsetzliche Brennen in meinen Lungen anzuhusten. Mit dem ersten Schwall Salzwasser, der meine Kehle hochsteigt, setzt ein Würgen ein. Gebeutelt von einer Mischung aus Husten und Erbrechen sinke ich nach vorne auf meine Hände. Sofort spritzen mir die auslaufenden Wellen ins Gesicht, und in erneuter Panik schnappe ich nach Luft.
Dieses Mal nehme ich wahr, wie groß seine Hände sind, als sie meine Taille umfassen und mir gleichzeitig nach oben und weg vom Wasser helfen. Humpelnd schaffe ich es ins Trockene und breche ,immer noch hustend und würgend, im Sand zusammen. Das Wasser rinnt mir aus Nase und Mund, und neben dem schmerzhaften Brennen meiner Lungen beginnen jetzt auch noch meine Augen unaufhaltsam zu tränen. Mir bleibt nicht einmal die Kraft, um zu meinem Retter aufzuschauen.
Ich halte mir den Bauch und versuche krampfhaft, die Reaktionen meines Körpers unter Kontrolle zu bringen, aber ich bleibe den Reflexen ausgeliefert.
Bis er seine Hand auf meinen Rücken legt und es um mich herum leise wird.
Kein Schnappen nach Luft, kein Würgen und kein Aufbäumen meines Körpers. Nur seine warme Hand auf meiner Haut, die mir zeigt, dass er da ist und ich nicht alleine bin. Langsam beginnt er, an meinem Rücken nach unten zu streichen, immer wieder. Gedanklich folge ich seiner Bewegung, passe ihr meinen Atemrhythmus an und komme zur Ruhe.
Meine Muskeln entspannen sich, und meine schmerzenden Lungen können die eingezogene Luft in sich behalten, ohne erneut von Salzwasser gereizt zu werden. Vielleicht bleibe ich länger als notwendig in der gebückten Haltung, um seine Berührung in mich aufzunehmen. Erst als das Gefühl der Nähe schwindet, hebe ich meinen Kopf. Sehe seine Knie, die neben mir im Sand versinken. Von Sonne gebräunte Haut, die im Morgenlicht einen bronzefarbenen Ton annimmt. Bemerke jeden einzelnen Wassertropfen, der über seine Bauchmuskeln rinnt und in den dunklen Badeshorts versickert.
Wieder ein Atemzug, dann erscheint ein markantes Kinn in meinem Blickfeld. Ich balle die Hände zu Fäusten und halte mich damit selbst zurück, um ihm nicht über das kleine Grübchen in seiner Mitte zu streichen. Ein weiterer Atemzug, und mein Blick gleitet zu seiner Nase. Breit, aber nicht zu breit. Eine feine Narbe zieht sich von einem Nasenflügel bis über seine Lippen. Ich halte inne. Noch ein Atemzug.
Im selben Moment versteift sich sein Oberkörper, als würde er sich ebenso sammeln für den einen Moment, in dem unsere Blicke aufeinandertreffen.
Ich hole tief Luft und hebe meinen Kopf dieses eine bedeutende Stückchen höher, das es braucht, um ihm in die Augen zu sehen. Erwarte Sorge oder Stolz über meine Rettung. Neugierde oder Wut. Ich rechne mit allem – aber nicht mit geschlossenen Augen.
Die dunklen Haare hängen ihm nass in die Stirn und über die ausdrucksstarken Augenbrauen. Einzelne Haarsträhnen zittern, zeigen dieselbe Anspannung, die sich auch um seinen Mund herum abzeichnet, den er jetzt zu einer schmalen Linie formt.
Wie von selbst bewegt sich meine Hand auf ihn zu, und als könnte er meine Berührung kommen fühlen, beginnt sich seine Brust zu heben und zu senken, schnell und unkontrolliert. Trotzdem lehne ich mich weiter nach vorne und stoße die eingehaltene Luft erst in dem Moment aus, in dem meine Fingerspitzen seine kalte Wange berühren. Nur flüchtig, und würde ich das Zucken seines Mundwinkels nicht sehen, würde meine Haut die kurze Berührung nicht wahrnehmen. Kein Lächeln, kein Augenaufschlag. Nichts.
Irritiert über diese Härte ziehe ich die Hand zurück und balle die Finger wieder zur Faust. Eine flache Windböe streift mich, und ich beginne zu frösteln. Die aufsteigende Scham über die Gefahr, in die ich mich beim Schwimmen gebracht habe, hetzt einen zusätzlichen Schauer über meinen Rücken. Hektisch blinzle ich, um mich selbst aus meiner Starre zu reißen.
Gerade als ich wieder genug Selbstbeherrschung finde, um meinen Blick von dem fremden Mann vor mir zu lösen, gleitet sämtliche Verbissenheit aus seinen Gesichtszügen. Bedächtig, wie von Selbstschutz geprägt, öffnet er die Augen.
Mir begegnet ein tiefes, sattes Braun. Ich versinke in der Farbe des viel zu dunklen Kakaos, den ich so liebe, und atme erst jetzt erleichtert auf. Er hält unserem Blick stand, scheint ebenso eine vertraute Erinnerung in meinen Augen zu finden. Die Stille hüllt uns ein und bindet uns für ein paar Herzschläge zusammen.
Ich öffne den Mund, um mich bei ihm für die Rettung zu bedanken, aber als er die Bewegung bemerkt, verschließt sich sein Gesicht, und die Härte kehrt zurück. Ohne mir die Möglichkeit zu geben, mich zu erklären, steht er auf und läuft davon.
Die Wellen neben mir preschen wieder donnernd gegen den Sand. Ich sinke zurück auf meine Füße und spüre die Enttäuschung bis in die Knochen ziehen. Ich bin verloren gegangen und alleine, und nicht einmal die Sonne, die jetzt vollständig aufgegangen ist, kann die plötzliche Leere in mir vertreiben.
KAPITEL 3
ENYA
Blaubeere oder Ananas? Oder doch Pistazie? Verdammt. Diese kleinen, aus Marzipan geformten Früchtchen auf jedem Cupcake machen die Entscheidung noch schwerer. Andrea hat oft etwas gebacken, und ich habe ihr geholfen, wir haben uns dabei aber lediglich auf Blechkuchen beschränkt, damit alle ein Stück abbekommen.
Entschuldigend lächle ich den älteren Mann hinter der Theke an. Das Shirt spannt über seinem rundlichen Bauch und lässt das Logo des Sunrise-Strandcafés riesengroß erscheinen.
»Willst du dir einen Geheimtipp geben lassen von jemandem, der täglich mindestens drei dieser Köstlichkeiten verdrückt? Und das seit Jahren?«
Ich lächle. »Klingt nach einer kompetenten Beratung, das Angebot kann ich nicht ausschlagen.«
»Zuallererst: Lass dich bei der Wahl eines Törtchens nie von dessen Aussehen täuschen.« Er stützt seine Arme auf dem gelben Tresen ab und beugt sich in meine Richtung, als würde er mir ein Geheimnis verraten. »Das gilt übrigens für so einiges im Leben, nicht nur für Gebäck. Das Aussehen mag noch so perfekt sein, wichtig ist immer nur, was drin steckt – und das ist im besten Fall sehr viel Liebe.«
»Und wie erkenne ich, ob sich ein Versuch lohnt?«
»Das spürt man, wenn man seiner Intuition freien Lauf lässt. Sieh dir die Törtchen noch einmal genau an, eines nach dem anderen, und fühle, welches dich magisch anzieht. Das Gebäck, das mehr verspricht, als nur lecker zu schmecken und ein paar Gramm auf deiner Hüfte zu hinterlassen, muss deines sein. Der Zucker kann sich übrigens auch hier vorne verewigen, wie bei mir.« Er reibt sich mit beiden Händen über den Bauch. »Welches Törtchen lässt dich den Strand und die Aussicht genießen, ohne an die Welt zu denken? Nur du und das Törtchen.«
»Nur ich und das Törtchen also«, wiederhole ich laut und konzentriere mich auf das bunte Angebot vor mir, als würde ich nicht nur ein Gebäckstück auswählen, sondern auch ein paar Minuten wunderschöne Lebenszeit.
Obwohl ich hinter mir bereits ein genervtes Seufzen höre, nickt mir der Verkäufer ermutigend zu. Ich fokussiere die Vitrine und lasse meinen Blick von links nach rechts und wieder zurück wandern. Und da sehe ich es, mein Törtchen. Das unscheinbarste von allen, in hellem Orange, wie der Sonnenaufgang heute Morgen.
»Sehr gute Wahl«, interpretiert der Mann mein Innehalten richtig und greift nach meinem Cupcake. »Das ist Mürbeteig mit einer Creme aus Amsden-Pfirsichen. Das weiße Fruchtfleisch ist besonders süß, und somit braucht es in der Zubereitung weniger Zucker.« Er zwinkert. »Mein Lieblingsstück.«
Ich lächle zufrieden und will bereits mein Geld aus den Shorts ziehen, da winkt er ab. »Sieh es als Experiment und sag mir später, ob das Auswahlprozedere hält, was ich dir vorausgesagt habe.«
»Danke, das werde ich«, verspreche ich, nehme den pinken Teller und meinen Cappuccino und gehe hinaus auf die Terrasse, die einen atemberaubenden Blick auf den Strand und das Meer freigibt. Die Tische in demselben Gelb wie der Tresen sind mit türkisen Fransenschirmen ausgestattet und verleihen alldem hier einen Urlaubsflair, den ich nur aus dem Fernseher kenne.
Ich setze mich auf den eben frei gewordenen Platz ganz vorne, staple das gebrauchte Geschirr und nehme einen Schluck von meinem ersten Cappuccino in Kalifornien. Im Wohnmobil habe ich eine alte Espressokanne vom Flohmarkt, deren Ergebnis nicht zu vergleichen ist mit dem sanft-milden Geschmack des Cappuccinos hier im Sunrise.
Ich könnte das Törtchen ganz leicht mit wenigen Bissen essen, hätte aber nach der Ode des Cafébesitzers eben ein ziemlich schlechtes Gewissen, wenn ich es achtlos hinunterschlingen würde. Also greife ich zu der Gabel, entferne das dünne Papier drum herum und steche das erste Stück herunter.
Schon als die helle Creme meine Lippen berührt, weiß ich, dass der Mann recht hatte. Die fruchtige Mischung erinnert mich sofort an Georgia, wo ich mir bei der Pfirsichernte im letzten Monat ein bisschen Geld dazuverdient habe. Beim zweiten Bissen nehme ich aber eher den Duft der violetten Blumen wahr, die an der Klippe neben dem Wohnmobil wachsen und das einsame Grau der Felsen mit wunderschöner Farbe besprenkeln.
Umfangen von all diesen Eindrücken schließe ich genüsslich die Augen. Ich höre die Gespräche um mich herum, die sich in der scheinbaren Unendlichkeit des Strandes verlieren, und das leiser werdende Kreischen einer Möwe. Das Klimpern von Geschirr verstummt, und was bleibt, bin ich, hier in diesem Moment. Bis sich der enttäuschende Nachgeschmack meines heutigen Besuchs im Administration Center im Stadtkern San Diegos in meine Gedanken drängt. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe, aber es war definitiv zumindest die Möglichkeit zu einem Gespräch und nicht nur ein Stapel an Formularen, die ich ausfüllen soll.
Für eine Auskunft muss ich das Verwandtschaftsverhältnis zwischen meiner Mom und mir amtlich nachweisen. Ich habe zwar meine Geburtsurkunde, trage aber nicht mehr denselben Nachnamen wie sie, was es schwierig macht. Andrea würde mir die Adoptionspapiere umgehend schicken. Die Chance auf eine Zukunft mit Mom kann ich nicht verstreichen lassen, auch wenn sie noch so gering ist. Nicht, weil ich Angst habe. Und doch fühle ich wieder diese schleichende Sorge, jeder Schritt in Richtung ihres Verbleibs könnte der letzte sein und damit die Hoffnung auf ein Wiedersehen endgültig mit sich nehmen. Ich mache ihr keine Vorwürfe. Sie hätte damals nur Hilfe gebraucht, die sie nicht bekommen hat.
Ich öffne meine Augen wieder, blinzle gegen das Licht der Nachmittagssonne an und esse weiter, mit einer Ruhe, die ich so nicht von mir kenne. Weit draußen auf dem Wasser beobachte ich ein vorbeiziehendes Segelboot, bevor ich ein paar Mädchen und Jungs beim Beachvolleyballspielen zusehe. Unweigerlich kommt in mir der Wunsch auf, ebenfalls Teil einer Gruppe zu sein. Freunde zu haben, die Zeit miteinander verbringen und Spaß haben. Meine Stiefgeschwister waren entweder jünger oder älter als ich, und in der Schule war ich durch Andreas Heimunterricht und die Abgeschiedenheit der Lakefield Farm zu selten, als dass ich anhaltende Kontakte hätte knüpfen können.
Sobald mein Cappuccino leer ist, nehme ich das ganze Geschirr vom Tisch und trage es hinein. Ich bin mit dem Bus in die Innenstadt und wieder hierher zurückgefahren. Wenn ich mich nicht total verschätzt habe, liegt nur ein kleiner Fußweg zwischen dem Sunrise und meiner Bucht.
»Der Kuchen ist wirklich etwas ganz Besonderes. Es stimmt, was Sie gesagt haben – für einen kurzen Augenblick gibt es nur dich und den Kuchen, und nichts anderes mehr spielt eine Rolle«, sage ich zu meinem Törtchen-Berater und schiebe ihm das Geschirr hin. »Ich mochte die nicht zu süße Creme mit dem leichten Hauch von Vanille, und kleine Fruchtstücke in den Teig einzuarbeiten, ist wirklich eine gute Idee.«
»Du bist wiedergekommen«, meint der Mann erstaunt und schaut auf den Tresen. »Und du hast den Tisch abgeräumt. Das tut nie jemand. Weder das eine noch das andere.«
»Sie haben mir bei der Auswahl geholfen und mir das Törtchen und den Cappuccino spendiert, da war es das Mindeste.«
»Trotzdem … Und nenn mich Ned.« Er verschränkt wieder die Arme vor seinem Bauch und legt den Kopf schief. »Du suchst nicht zufällig einen Job? Lennard, meine Aushilfe, hat sich das Bein gebrochen, und ich muss alle Schichten alleine mit meiner Frau stemmen. Wir könnten Unterstützung gebrauchen.«
Ich stocke, unsicher, was ich antworten soll. Nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, in einem Café zu arbeiten. Auch wenn in Mr Shoebakers Laden nicht annähernd so viel los war wie hier, hatte ich die Arbeitsabläufe schnell gelernt und Freude daran gefunden. Selbst das Zubereiten der Eisbecher, die ich bei den anderen Gästen auf der Terrasse gesehen habe, würde ich mir sofort zutrauen. Mein Blick fällt auf die Vitrine vor mir, und erneut scheint der ältere Mann – scheint Ned – meine Gedanken zu erraten.
»Oh, keine Angst, die Backwaren bekommen wir geliefert. Das Einzige, was du tun musst, ist, sie von der Bayside Bakery entgegenzunehmen.« Er grinst. »Und natürlich ein Törtchen nach dem anderen durchzuprobieren, damit du eine kompetente Empfehlung aussprechen kannst.«
Während Ned beginnt, die Fruchtshakes für die beiden Mädchen hinter mir zuzubereiten, trete ich zur Seite und wäge innerlich meine Optionen ab. Wenn ich nicht hier in San Diego bleibe und weiterreise, wird mein weniges Erspartes nicht ewig für das Benzin, die Lebensmittel, und was ich sonst noch alles brauche, reichen. Das Notfallgeld von David, für ungeplante Reparaturen oder Ähnliches, will ich auf keinen Fall verwenden. Und wenn ich etwas nicht habe, dann ist es Zeitdruck. Nichts zwingt mich dazu weiterzureisen, vor allem nicht, solange ich nicht das gefunden habe, wonach ich suche.
Außerdem könnte ich ihn vielleicht wiedersehen. Mich bei ihm für seine Rettung bedanken. Ich möchte ihn fragen, ob er nicht Angst hatte, dass ich ihn mit nach unten ziehe. Und ich würde mich dafür entschuldigen, ihn in Gefahr gebracht zu haben. Unwissentlich, aber das mildert meine Naivität nicht ab. Wenn ich alleine klarkommen will, muss ich rationaler denken und Verantwortung übernehmen. Ich weiß, dass der Aufbruch von der Farm und eine Reise in alle Himmelsrichtungen nicht ausreicht, um plötzlich erwachsen zu sein. Das hat mir die dunkle Angst im Wasser heute unmissverständlich klargemacht.
Er hat mich davor bewahrt zu sterben. Ich weiß es. Unbewusst suche ich seit heute Morgen unter allen Menschen, die mir begegnen, nach den Augen aus dem tiefsten Braun, das ich je gesehen habe.
»Drei Wochen«, unterbricht Ned den Erinnerungsstrom. »Ich brauche dich vorerst für drei Wochen, in der Früh- und in der Spätschicht, natürlich mit freien Tagen. Und das Allerbeste ist«, sagt er und zeigt mit einem Kopfnicken auf die Vitrine, »die übrigen Törtchen darfst du am Ende des Tages mit nach Hause nehmen.«
»Ich mache es«, antworte ich schneller, als die Gedanken sich in meinem Kopf formulieren, und scheine ihn damit zu überraschen.
Ned lächelt und klatscht in die Hände. Seine sichtliche Erleichterung lässt auch mich lächeln. Noch während seiner Erläuterungen über die Arbeitszeiten und meine Aufgaben spüre ich der wachsenden Freude in mir nach. Ich habe tatsächlich einen Job, bei dem ich Geld verdiene für meinen Lebensunterhalt, und das nicht nur für ein oder zwei Tage, um dann weiterzureisen wie bisher. Ich bekomme Gratis-Törtchen, und mit ganz viel Glück sehe ich den Mann aus dem Meer wieder, um mich bei ihm zu bedanken, vielleicht sogar mit einem meiner Törtchen.
KAPITEL 4
JONAH
Ich lehne den Kopf nach hinten gegen die Schaumstoffwand des Tonstudios meines Vaters, schließe die Augen und versuche, mich an eines der Worte zu erinnern. Nur eines. Komm schon.
Buchstaben tauchen auf und verschwinden wieder, ohne sich sinnvoll aneinanderzureihen und mir auch nur den kleinsten Lichtblick zu schenken. Meine Hände verkrampfen sich um das Lehrbuch auf meinem Schoß. Ich verstehe die Unterteilung der Gliazelltypen, erkenne ihre Funktion und die strukturelle und funktionelle Abgrenzung von Nervenzellen. Und trotzdem kann ich mir keinen einzigen verdammten lateinischen Begriff merken. Wenn ich bei den Nachprüfungen schon wieder scheitere, war es das schon vor meinem dritten Semester mit meinem Medizinstudium. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, ob mich das überhaupt stören würde oder ob ich mir damit nicht selbst einen Gefallen tue und mir viele weitere Blamagen erspare.
Mit einem Schnauben lasse ich die Zweifel verschwinden und lese mir das Wort vor, langsam und laut, mit der Gewissheit, dass mich hier unten im Keller niemand hören wird. Dass meinen Versuch, einzelne Laute klar zu verbinden, niemand belächeln kann.
»Oligodendrozyten«, stammle ich und muss mich nicht einmal besonders konzentrieren, um zu erkennen, dass ich die fremden Silben verwaschen ausspreche.
Ich wiederhole das Wort. Noch einmal und noch einmal, in der stillen Hoffnung, dass sich mein Gehör an den für es neuen Begriff gewöhnt, ihn in meiner Erinnerung verankert und zu den vielen Worten legt, die ich bereits vor dem Unfall erlernt habe. Aber bei jedem weiteren Mal stimmt das Gesprochene weder mit dem Gelesenen noch mit dem, was ich glaube zu hören, überein.
»Fuck«, flüstere ich und presse meine Lippen aufeinander, um nicht hysterisch aufzulachen. Es fühlt sich an wie ein schlechter Witz des Schicksals, dass ich mir mein Leben lang alles am leichtesten gemerkt habe, wenn ich es mir laut vorgesagt habe. Die kaputten Hörnerven haben mir auch die beste Lernmethode genommen. Nach sechs Jahren müsste ich all das längst kompensiert haben. Oder dank des Cochlea-Implantats am rechten Ohr alles genauso gut verstehen und aussprechen können wie vor dem Unfall. Stattdessen ist mein Leben eine einzige große Baustelle an Zielen, denen ich mich jeden Tag aufs Neue stellen muss. Und Enttäuschungen, weil ich sie nicht erreiche. Nicht so. Nicht mehr.
Bis auf heute Morgen, im Meer. Ich habe sie gesehen, wie sie um ihr Leben gekämpft hat, so stark und unnachgiebig. Alles, was ich habe und was ich bin, hat gereicht, um sie zu retten, und noch nie hat mich jemand so angesehen, wie sie es getan hat. Aufrichtig, dankbar. Als hätte ich keinen Makel.
Ich wollte sie so gerne hören und herausfinden, ob sie ebenso zart klingt, wie ihre Gesichtszüge es vermuten lassen, oder doch klar und unnachgiebig wie ihre Stärke im Wasser. Trotz der vielen Jahre, seit denen ich nicht mehr so höre wie früher, habe ich mich noch nie so sehr nach einer fremden Stimme gesehnt. Nicht, seit mir Geräusche und Klänge die meiste Zeit zu viel sind und somit alle meine Sinne und mein Denken ungefragt einnehmen. Ich wollte sie in mir fühlen und sehen, ob sie ein Kratzen ist oder eher einem Streicheln gleicht und ob sie mich berührt, schon nach wenigen Klängen, ebenso wie ihr Augenaufschlag.
Stattdessen bin ich geflüchtet. Sie hätte sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe mich vor dem einen Sekundenbruchteil der Erkenntnis gefürchtet, den jeder Mensch braucht, bis er seine Manieren wiederfindet und das offensichtliche Problem so galant wie möglich umgeht. Selbst wenn es nur ein Wimpernschlag ist, tut es weh. Jedes Mal aufs Neue.
Also bin ich gegangen, bevor sie sich mit einem bedauernden Lächeln oder hilflosen Handgesten zu einem Gespräch gezwungen fühlen konnte, das so nicht stattfinden kann.
Ich spüre den flachen Luftzug durch die leicht geöffnete Tür, noch bevor ich seine Schritte erahne. Jeder Tritt schickt eine kurze Vibration durch meinen Körper.
Caden setzt sich neben mich und wartet, bis ich ihn anschaue. Er ist geduldig und ausdauernd und derjenige von meinen drei Geschwistern, der mich nie entkommen lässt, selbst wenn ich ihn ignoriere, um mich so vor einem Gespräch zu drücken.
Ich gebe mir zwei weitere Atemzüge, bis ich den Kopf hebe. Mein großer Bruder sieht mich an, mustert mein Gesicht, um zu erkennen, wie es mir geht. Wie es mir wirklich geht.
Kaum merklich nickt er und zieht die Augenbrauen hoch. »Laurel hat versucht, ein paar Wildkaninchen zu fangen, um sie tiefer im Wald auszusetzen.« Er spricht langsam und deutlich. Nicht zu laut, den Kopf immer in meine Richtung gewandt. »Stattdessen ist ihr Rocket in die Falle gegangen. Er ist jetzt leicht verstört, und Dad sitzt seit einer halben Stunde ihm Wohnzimmer und hört nicht auf, ihn zu streicheln und auf ihn einzureden.« Caden grinst.
Laurel und Lia sind fast sechs und ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern. Ich stelle mir Dads Schock vor, als er erkennt, wen meine kleine Schwester in den Metallkäfig gelockt hat, und beginne ebenfalls zu grinsen. Seit Dad die verletzte Katze vor ein paar Monaten nachts im Garten gefunden und wieder gesund gepflegt hat, haben die beiden eine besondere Bindung zueinander.
»Scheiße, also ab jetzt doch eine Leine für Rocket«, sage ich und muss lachen.
Caden verzieht den Mund. Es ist ungewohnt, ihn frisch rasiert zu sehen. »Ich schwöre dir, wenn er noch einmal sagt, dass Rocket der beste Hund ist, den er jemals hatte, besorge ich ihm wirklich eine Leine.«
»Dad würde sich darüber freuen und mit ihm am Strand spazieren gehen. Bis Mom es ihm verbietet.«
Jetzt lachen wir beide, und ich strecke meine Beine aus. Augenblicklich fühle ich mich entspannter – Caden hat erreicht, was er wollte. Ich bin nicht mehr in meinen kläglichen Lernversuchen gefangen, und mir birst nicht mehr der Schädel vor Konzentration.
Caden rempelt mich mit der Schulter an. Zuerst die Berührung, dann das Sprechen. Über diese ersten Schritte bin ich in der Therapie nie hinausgekommen. »Bereit?«
Ich nicke nur und sehe zu, wie er das Lehrbuch von meinen Beinen nimmt und sich gegenüber von mir positioniert. Damit ist er genau so weit entfernt, dass ich seine Lippenbewegungen und Mimik beim Reden gut beobachten kann. Und kopieren.
»Wo warst du?«, möchte Caden wissen und senkt erst seinen Blick von meinem Gesicht auf das Buch, als der Satz fertig gesprochen ist. Kleine Feinheiten in automatisierten Sprechmustern, die für mich den großen Unterschied zwischen Nichtverstehen und Verstehen bedeuten. Zwischen Dabeisein und Außen-vor-gelassen-Werden.
»Gliazelltypen, Oligodendrozyten«, antworte ich ohne Zögern, ohne Scham. Caden versteht die Begriffe, selbst wenn ich sie nicht lautgetreu ausspreche, und er kennt meine Probleme. Deshalb habe ich mich für ein Medizinstudium entschieden. Es war die sicherste Variante. Nicht der leichteste Weg, aber der mit der größtmöglichen Unterstützung von Caden, der sechs Semester weiter ist als ich.
»Gut«, meint er und fliegt kurz über die aufgeschlagene Seite, um sich zu orientieren. »Wir haben drei Hauptgruppen: die Astrozyten, Oligodendrozyten und die Mikroglia.«
Ich nicke nur, konzentriere mich.
Caden befeuchtet seine Lippen und wartet, bis sich meine volle Aufmerksamkeit darauf richtet. »As-tro-zy-ten«, sagt er deutlich und langsam, in genau der richtigen Lautstärke. Er wiederholt das Wort für mich so lange, bis ich ihm mit meiner Hand das Zeichen gebe, das ihn still sein lässt.
Und dann bin ich an der Reihe. Sage Silbe für Silbe und blende mein mich oft täuschendes Gehör aus. Ich fokussiere mich rein auf die Imitation seiner Mundbewegung, seine Atmung und die erkennbare Lage der Zunge.
Caden und ich wechseln uns so lange ab, bis ich jeden Laut detailgetreu wiedergebe und die Silben richtig aneinanderreihe.
»Gut«, bestätigt er. »Nächstes Wort: O-li-go-den-dro-zy-ten.«
Selbe Lernform für ein anderes Wort. So lange, bis ich es verinnerlicht habe. Dann die Wiederholung der eben erlernten Begriffe, gefolgt von einer neuen Aufgabe. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Caden und ich in den letzten beiden Semestern hier unten verbracht haben, um mich halbwegs durch die Prüfungen zu retten. Er hat sich kein einziges Mal beschwert, genervt geseufzt oder mit den Augen gerollt, wenn wenige Wiederholungen nicht ausgereicht haben.
Er hat die Treffen mit seiner besten Freundin Rina verschoben und Shane abgesagt, wenn sie zum Surfen verabredet waren. Caden war einfach da. Immer, um mir zu helfen.
Dabei ist es nicht der Gedanke, Arzt zu werden, der mich antreibt. Nein, nicht einmal der tiefere Sinn, anderen Menschen zu helfen, wie Caden es sich vorgenommen hat. Ich will mir einfach nur beweisen, dass ich alles erreichen kann und nicht aufgebe – dass ich es wert bin.
Trotz alledem.
Ich weiß nicht, wie spät es ist, als Mom Lia und Laurel schickt, um uns für das Abendessen zu holen. Ihre blonden Haare haben heute beide zu einem Zopf gebunden, was es ihrem Umfeld noch schwerer macht, sie zu unterscheiden. Sie haben keine offensichtlichen Narben, auf die man sich konzentrieren könnte, und sie bewegen sich auch nicht unterschiedlich, sodass selbst Dad die Mädchen hin und wieder verwechselt. Ich hingegen erkenne Laurel an ihrem offenen Lächeln und dem überschwänglichen Interesse, mit dem sie alles und jeden um sich herum mustert. Sie ähnelt Caden in ihrem Charakter viel mehr als Lia, die aufmerksam beobachtet und nur langsam Vertrauen aufbaut.
Laurel springt auf Cadens Rücken und stößt dabei einen spitzen Schrei aus, der mich unvermittelt trifft und zusammenzucken lässt. Sie winkt mir zu und lässt sich von Caden nach oben tragen, ohne meine Reaktion auch nur bemerkt zu haben. Lia hingegen sammelt meine wenigen Stifte vom Boden auf, und als ich mich nach meinen Büchern bücke, streift sie meine Wange mit einer ihrer kleinen Hände, um sich meine Aufmerksamkeit zu sichern. Sie kennen es nicht anders. Mom war schwanger, als der Unfall passiert ist, und alle befürchteten, es würde mir schwerfallen, mich trotz meiner Probleme auf die neuen Familienmitglieder einzulassen. Dabei war es friedvoll, Laurel oder Lia im Arm zu halten und ihnen beim Schlafen zuzusehen, stundenlang. Ihnen war es egal, was ich getan oder nicht getan habe. Oder was ich hören konnte und was nicht. Ich habe sie vom ersten Moment an geliebt.
Lia zieht ihre Augenbrauen zusammen. »Stimmt es, dass ich es mit dem Opti nie wieder an Land schaffe, wenn ich den Seewind nicht erwische?«
Die Zwillinge machen gerade einen Segelkurs, und es sind täglich andere Dinge, die Lia verunsichern.
Ich knie mich hin und sehe sie an. »Wer sagt, dass man den Seewind verpassen kann? Dein Segellehrer?«
Sie schüttelt den Kopf. »Bobby Bakersfield aus meinem Kurs. Er sagt, wenn ich den Wind zum Land nicht erwische, treibe ich auf den Ozean und gehe verloren, und niemand wird mich finden.«
»Soll ich dir ein Geheimnis verraten, das Bobby Bakersfield vermutlich noch nicht weiß?«
Sie lächelt, und ich sehe die beiden Zahnlücken, die sie plötzlich so viel älter wirken lassen. »Der Wind ist überall um dich herum, wenn du segelst, und hört nicht einfach auf. Er weht vom Wasser aufs Land, ständig, weil sich das Land viel schneller erwärmt als das Meer. Aber«, ich stupse ihr mit dem Zeigefinger auf die Nase, »sobald die Sonne untergeht, ist es umgekehrt. Dann kühlt das Land viel zu schnell ab und es zieht die Luft hinaus aufs Wasser. Also ist alles, was du vorerst machen musst, nicht in der Nacht zu segeln. Dann ist alles gut.«
Lia sieht zwischen meinen Augen hin und her und fällt mir dann unvermittelt um den Hals. Ich lege meine Arme um sie und spüre ihr »Danke, Jonah« an meiner Brust, als sie sich an mich drückt.
»Und da ist noch etwas«, sage ich, als sie sich wieder von mir löst. »Wenn du jemals verloren gehst, werde ich da sein.« Ich schlucke. »Vergiss das niemals, in Ordnung? Ich schwimme und finde dich, egal wie weit.«
Lia nickt eifrig, und ich erkenne die Zufriedenheit, die sich über ihr Gesicht legt. Noch fällt es mir leicht, für sie da zu sein und den Mädchen zu helfen. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass ich das auch später noch kann und bei ihnen nicht denselben Fehler begehe wie bei Lara damals. Einen, der sich nicht wiedergutmachen lässt. Für uns beide nicht.
Lia grinst, verflicht ihre Hand mit meiner, und ich lasse mich von ihr nach oben ziehen. Die Sonne ist bereits untergegangen, und im Haus brennt nur das gedimmte Licht im Flur. Als wir in das große Wohnzimmer treten, kommt uns durch die zum Garten geöffneten Schiebelemente aus Glas der Geruch von brennendem Feuerholz und gegrilltem Fisch entgegen. Lia zieht mich hüpfend weiter.
Sobald wir die Terrasse betreten, steige ich automatisch auf die Holzplanken, die sich wie ein Gehweg bis hin zum Rasen über die Steinfliesen ziehen. Dad hat die Bretter damals gekauft und zu einer Verbindung zum Garten werden lassen, nachdem ich wochenlang keinen Fuß auf den Fliesenboden setzen konnte. Er hat mich nie gefragt, ob er das Konstrukt wieder abbauen kann, auch nach Jahren nicht. Dass ich immer noch ausschließlich auf den Holzplanken gehe, sagt ihm vermutlich genug.
Als wir dem von einer halbhohen Mauer umgebenen Essplatz näher kommen, blickt Mom vom Esstisch auf und geht hinüber zu der Stereoanlage, die Dad mit dem Erfolg seines ersten Werbejingles gekauft hat und seitdem hütet wie einen Schatz. Es war eines der wenigen seiner Dinge, die wir als Kinder nie berühren durften. Nicht einmal im Tonstudio hatte er so klare Regeln für uns. Musik ist sein Leben, wir sind mit Musik aufgewachsen. Immer und überall. Und jetzt müssen sie die Musik ausschalten, wenn ich da bin, weil ich sonst kein einziges gesprochenes Wort verstehe. Ich habe also nicht nur mir etwas genommen.
Lia löst sich von meiner Hand und läuft hinüber zu Caden, der Laurel an den Armen über den beleuchteten Pool schwingt, als wollte er sie samt ihrer Kleidung hineinwerfen. Laurel schreit nach mir, aber ich lächle ihr lediglich zu und zeige auf das Geschirr, das noch an seinen Platz gebracht werden muss. Ich denke, sie weiß, dass es eine Ausrede ist. Kein Pool, nie mehr.
Während ich den Tisch fertig decke, zündet Mom die restlichen Kerzen in ihren gefühlt hundert Laternen überall hier im Garten an. Das laute, rhythmische Zirpen einer Grille im Gebüsch hinter mir zieht meine Aufmerksamkeit auf sich, und ich bemerke erst, dass Dad mich gerufen haben muss, als Mom mir ein Zeichen gibt, mich zu ihm umzudrehen. »Bringst du mir die Teller, Jonah? Der Fisch ist so weit.«
Ich nicke und helfe Dad dabei, das Gemüse und den Fisch auf den Tellern anzurichten. Jeder von uns hat seinen festen Platz an dem runden Gartentisch, nur Lia und Laurel streiten sich regelmäßig darum, wer von ihnen beiden neben Mom oder Dad sitzen darf.
»Ratet mal, wer die Makrelen heute für uns gefangen hat«, sagt Dad und nimmt den ersten Bissen von seinem Fisch.
»Hmmm«, antworte ich übertrieben nachdenklich und schaue die Mädchen an. »Vermutlich war das jemand, der sehr geduldig ist und lange still sein kann. Makrelen beißen nicht sofort an.«
Caden nickt. »Ja, und jemand, der genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt da ist, den Fisch zu schnappen. Ohne sich davor auch nur das kleinste bisschen zu bewegen.«
Das stolze Grinsen von Laurel und Lia wird immer breiter.
»Stimmt, Caden«, sage ich und reibe mir über das Kinn. Die Mädchen sehen mich erwartungsvoll an. »Das muss Rocket gewesen sein, eindeutig.«
Wir alle genießen den perplexen Gesichtsausdruck der Zwillinge, bevor auch sie unseren Spaß verstehen und zu lachen beginnen.
Sie erzählen abwechselnd davon, wie sie nach ihrem Segelkurs mit Dad noch mal zum Angeln raus aufs Meer sind und wie furchtbar lange es gedauert hat, bis die erste Makrele angebissen hat. Dad schmückt ihren Bericht mit seinen leicht fantastisch angehauchten Ergänzungen aus, an die wir alle gewöhnt sind, und ich genieße die Ruhe, die sich beim Essen über mich legt. Es ist kein Uni-Vortrag, dem ich lückenlos folgen muss, und kein wildes Durcheinander an Stimmen, das zu einem einzigen Rauschen wird. Zusätzlich trägt das Essen dazu bei, dass sie sich nicht gegenseitig ins Wort fallen oder mehrere Gespräche gleichzeitig entstehen. Es ist einfach nur meine Familie. Sie bemühen sich seit Jahren, mich so gut wie möglich zu unterstützen, es mir einfach zu machen, ein Teil von ihnen zu sein.
Und doch bin ich der Einzige von ihnen, der diese wenigen, scheinbar unbedeutenden Sekunden später auf Fragen reagiert, verzögert antwortet oder einfach nur lacht, weil es auch die anderen tun.
Manchmal reicht Bemühen eben nicht aus.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: