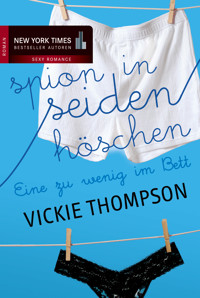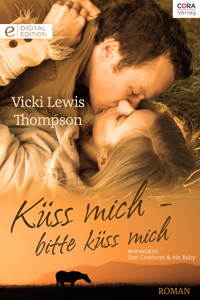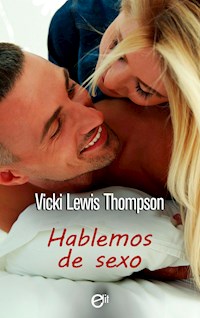1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Digital Edition
- Sprache: Deutsch
Seit Monaten wird Jessica von einem Stalker verfolgt. Ihre letzte Hoffnung ist Nat, der Mann, den sie liebt. Als der von seinem Auslandseinsatz heimkehrt, glaubt sie sich endlich in Sicherheit. Doch sie hat ihren Verfolger unterschätzt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
IMPRESSUM
Wünsch Dir was! erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© 2000 by Vicki Lewis Thompson Originaltitel: „That’s My Baby“ erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe BACCARABand 1140 - 2001 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg Übersetzung: Gabriele Braun
Umschlagsmotive: boggy22, SCHUBphoto / Thinkstock
Veröffentlicht im ePub Format in 10/2015 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733743017
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, HISTORICAL, JULIA, ROMANA, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Mit Schmetterlingen im Bauch erwartete Jessica Franklin auf dem John F. Kennedy Airport die Ankunft des Nachmittagsfluges aus London. Seit siebzehn Monaten hatte sie Nat Grady, den Mann, den sie so geliebt hatte und immer noch liebte, nicht mehr gesehen. Jetzt wollte sie unbedingt zu ihm, selbst wenn sie dafür diese schäbige Verkleidung tragen musste. Sie hatte sich fest vorgenommen, ihm von Elizabeth, ihrer gemeinsamen Tochter, zu erzählen, von deren Existenz er noch gar nichts ahnte.
Das Baby hatte Jessica aus Sicherheitsgründen in Colorado gelassen, denn sie wurde von einem Mann verfolgt. Sie betrachtete ihren Verfolger, der sich einfach nicht abschütteln ließ, fast wie eine ansteckende Krankheit, die sie daran hinderte, sich um ihr Kind zu kümmern.
Es war wie eine Ironie des Schicksals. Als Tochter aus einer sehr wohlhabenden Familie war sie mit der steten Gefahr aufgewachsen, gekidnappt zu werden, und ihr Vater hatte so verzweifelt versucht, sie davor zu schützen, dass sie fast daran erstickt wäre. Eines Tages hatte sie Bodyguards und Panzerglasscheiben nicht mehr ertragen können und war einfach fortgegangen, um sich irgendwo, wo man sie nicht kannte, niederzulassen. Es musste doch möglich sein, ein ganz normales Leben zu führen. Das hatte sie sich selbst und ihrem Vater beweisen wollen. Zunächst schien es ihr auch zu gelingen. Dann aber hatte sie zu ihrem eigenen Entsetzen erkannt, dass ihr Plan gescheitert war.
Ganz in ihrer Nähe stand jetzt eine Frau mit einem Baby auf dem Arm. Jessica hätte besser nicht beobachten sollen, wie die Mutter zärtlich mit ihrem Kind scherzte, weil sie jedes Mal schmerzte, wenn sie so etwas mit ansah. Sie schätzte das Baby auf acht Monate, also ungefähr so alt wie ihre Elizabeth. Ob Elizabeth auch schon so groß war? Es fiel Jessica schwer, sich das vorstellen.
Als sie ihre Tochter auf der Rocking-D-Ranch zurückgelassen hatte, war Elizabeth ein winziges Baby, gerade mal zwei Monate alt. Damals hatte sie den Gedanken nicht ertragen, sich für längere Zeit von ihrem Liebling trennen zu müssen. Sie hatte jedoch keine andere Wahl gehabt. Doch jetzt, wo Nat endlich zurückgekommen war, würde sie es wagen können, ihr über alles geliebtes Töchterchen wiederzusehen.
Jessica war davon überzeugt, dass Elizabeth auf der Rocking-D-Ranch absolut sicher war und dass ihre Freunde Sebastian, Travis und Boone gut für das Baby sorgten. Und jetzt konnte sie alle zusammen mit Nat überlegen, was sie machen sollten.
Eigentlich war Jessica nach allem, was passiert war, nicht gut auf Nat zu sprechen. Sie hatte sich damals Hals über Kopf in ihn verliebt. Er hatte jedoch darauf bestanden, ihre Beziehung geheim zu halten. Nur seine Sekretärin wusste Bescheid. Aber selbst seine besten Freunde, bei denen Jessica ihre Tochter zurückgelassen hatte, sollten nicht wissen, dass sie ein Liebespaar waren.
Hätte mir das nicht gleich zu denken geben sollen?, hatte Jessica sich später oft gefragt. Die Liebe hatte sie blind gemacht, und auch jetzt hasste sie Nat nicht. Immer wieder gingen ihr seine Abschiedsworte durch den Kopf: „Ich hätte es nicht zulassen dürfen, dass du deine Zeit mit mir verschwendest. Das bin ich nicht wert.“
Dann hatte Nat alles im Stich gelassen, sie, seine Freunde und seine Immobilienfirma. Er war als Freiwilliger in ein fernes, vom Krieg zerrüttetes Land gegangen, um dort in einem Lager Flüchtlingen zu helfen. Manchmal machte Jessica sich Vorwürfe, dass es ihre Schuld war. Wenn sie nicht darauf bestanden hätte, der Heimlichkeit ein Ende zu machen und zu heiraten, wäre er vielleicht nie fortgegangen, sondern bei ihr in Colorado geblieben. Sie hätte es weiter genießen können, von ihm auf diese wunderbare Weise geliebt zu werden.
Auf jeden Fall fühlte sich Jessica allein dafür verantwortlich, dass sie schwanger geworden war. Nat hatte ihr sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er keine Kinder wollte. Und sie hätte wissen müssen, dass Antibiotika die Wirkung der Pille beeinträchtigen konnten. Aber sie war zu behütet aufgewachsen, um sich in solchen Sachen auszukennen. Sie wollte ihm auch keine Vorwürfe machen. Doch für den Fall, dass ihr Verfolger sie erwischte und ihr etwas antat, musste Nat wenigstens von der Existenz ihres Kindes erfahren.
Zunächst musste Jessica sich ihm jedoch zu erkennen geben. Das war nicht so einfach, denn sie trug eine schwarze Perücke, schäbige, viel zu weite Sachen und eine klobige Hornbrille. Und wenn er sie erkannte, was sollte sie ihm sagen?„Nat, wir haben eine kleine Tochter namens Elizabeth.“ Nein, für einen Mann, der sich keine Kinder wünschte, war das viel zu direkt. Oder sollte sie erklären: „Ich trage diese scheußliche Verkleidung, weil ich verfolgt werde.“ Nein, für einen Mann, der gerade aus einem Krisengebiet kam, war das auch nicht das Richtige. Er brauchte erst einmal Ruhe, anstatt sich gleich wieder aufzuregen. Erst nach einer Weile wollte sie ihm alles so schonend wie möglich beibringen.
Als die ersten Passagiere aus der Maschine stiegen, flatterten Schmetterlinge in Jessicas Bauch. Nat konnte nicht mehr weit sein.
Gleich darauf entdeckte sie einen hochgewachsenen Mann mit Vollbart und langem Haar im Strom der Passagiere. Er trug eine zerknautschte Lederjacke, Jeans und derbe Boots. Die Art und Weise, wie er sich mit langen federnden Schritten bewegte, kam ihr bekannt vor.
Während Jessica ihn genauer musterte, begann ihr Herz laut zu klopfen. Ihr Blick blieb an seinem Mund hängen, den sie so oft geküsst hatte. Nat! In diesem Augenblick war aller Kummer vergessen. Dem Himmel sei Dank, er war heil nach Hause zurückgekehrt.
Sie fand ihn so attraktiv mit seinem sonnengebräunten Teint, dass sie sich sofort fragte, ob es nicht eine andere Frau in seinem Leben gab. Vielleicht eine exotische Schönheit, die sich in den großen gut aussehenden Amerikaner verliebt hatte, weil er den Flüchtlingen aus christlicher Nächstenliebe half. So etwas konnte leicht passieren. Der bloße Gedanke versetzte Jessica einen Stich.
Aber sie könnte es ihm nicht verübeln. Er war ein freier Mann, und siebzehn Monate waren eine lange Zeit für einen dreiunddreißigjährigen Junggesellen, um ohne Sex auszukommen. Selbst wenn er sich nicht neu verliebt hatte, schlief er vielleicht hin und wieder mit jemandem. Jessica würde ihn nicht danach fragen, aber die Vorstellung war ihr unerträglich.
Jetzt versuchte sie ihm in die Augen zu sehen. Ob Nat sie trotz ihrer Verkleidung erkennen würde? Endlich blickte er in ihre Richtung. Sie wollte gerade seinen Namen rufen, da erschrak sie, denn sein Blick war erschreckend nüchtern und kalt. Ein bitterer Zug lag um seinen Mund. Wie hatte Nat sich verändert! Früher hatten seine blauen Augen so viel Wärme und Humor ausgestrahlt. Hatten die Erfahrungen im Krisengebiet diese Härte auf seine Züge gelegt?
Er machte nicht den Eindruck, Jessica erkannt zu haben. Unbeirrt eilte er zum Ausgang, sodass sie nicht mehr den Mut fand, seinen Namen zu rufen. Aber sie musste doch mit ihm sprechen, bevor er auf der Rocking-D-Ranch anrief. Sie würden ihm sagen, dass sie die kleine Elizabeth dort zurückgelassen hatte. Obwohl Jessica niemandem den Namen des Vaters verraten hatte, würde es Nat sofort klar werden, dass es sein Kind war, wenn er sich nach Elizabeths Alter erkundigte. Aber auf diese Art sollte er nicht von seiner Tochter erfahren.
Jessica hatte Mühe, mit Nat Schritt zu halten. Schon hatte er den Ausgang des Flughafens erreicht und steuerte auf den Taxistand zu. Jessica folgte ihm in die kühle Oktobernacht. Die frische Luft tat ihr wohl, und sie konnte wieder klarer denken. Nein, hier wollte sie nicht mit ihm sprechen. Er würde sicher erst einmal in ein Hotel fahren. Sie würde ihm folgen und vielleicht konnte sie ihn in der Halle ansprechen und ihm bei einem Drink in der Hotelbar alles erklären.
Es gelang ihr, im gleichen Moment wie er in ein Taxi einzusteigen. „Bitte folgen Sie dem Wagen vor uns“, wies sie den Taxifahrer an und ließ sich auf die Rückbank fallen.
Der Fahrer wandte sich zu ihr um, um sie erstaunt zu mustern. „Soll das ein Witz sein?“
„Überhaupt nicht.“ Jessica wurde nervös, als sie sah, dass das andere Taxi schon anfuhr. „Beeilen Sie sich, sonst verlieren wir den Wagen noch.“
„Hoffentlich haben Sie auch Geld“, brummte der Taxifahrer, als er Nats Taxi folgte. „Am Ende sind Sie so eine Verrückte, die zu viele James-Bond-Filme gesehen hat. Aber ich warne Sie, in dem Fall liefere Sie an der nächsten Polizeistation ab.“
„Natürlich habe ich Geld.“ Und als der Abstand zwischen den Wagen weiter wurde, fügte Jessica schnell hinzu: „Sehen Sie, das Taxi hat einen V-förmigen Kratzer am Kofferraum, dadurch können Sie es nicht verwechseln.“
„Ich bin doch nicht blind, aber ich halte nichts von Räuber-und-Gendarm-Spielen, Lady.“
„Es ist nicht verboten, einem Taxi zu folgen“, entgegnete sie ungeduldig. Je näher sie dem Lichtermeer von New York kamen, desto aufgeregter wurde sie, als ob sie in ihrer Heimatstadt wieder dem Einfluss ihres mächtigen Vaters ausgeliefert wäre.
„Aber ich will da in nichts reingezogen werden, verstehen Sie?“, protestierte der Fahrer.
Jessica versuchte es mit Humor. „Im Film beschweren sich die Taxifahrer nie, wenn sie hinter einem Wagen herfahren sollen.“
„Hab ich’s nicht gleich gesagt, Sie verwechseln das hier mit einem Film!“
„He, passen Sie auf! Der Wagen hat gerade die Spur gewechselt.“
„Ja, ja, hab ich geschnallt. Schließlich habe ich meinen Taxischein nicht im Lotto gewonnen.“ Die Stimme des Taxifahrers klang gekränkt. „Wissen Sie eigentlich, wer da drin sitzt?“
„Ja.“
„Wahrscheinlich halten Sie ihn für Elvis.“
„Blödsinn, ich kenne den Mann gut, und ich muss dringend mit ihm sprechen.“
„Ach, ja? Und wer ist das?“
Am liebsten hätte Jessica geantwortet, dass ihn das gar nichts anging. Aber sie war ja auf den Fahrer angewiesen. „Der Mann war mal mein Freund“, erklärte sie. „Er hat mich im Flughafen nicht erkannt, weil ich mich sehr verändert habe. Dennoch muss ich dringend mit ihm sprechen.“
„Vielleicht will er aber nicht mit Ihnen sprechen.“
„Selbst wenn es so wäre, muss ich ihm unbedingt etwas sagen.“
Der Taxifahrer zog wissend die Brauen hoch. „Jetzt verstehe ich. Es geht um ein freudiges Ereignis, nicht wahr?“
„Nun, ja, man kann es so ausdrücken.“
„Wer den Spaß hatte, muss auch bezahlen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung“, meinte der Fahrer etwas freundlicher. „Haben Sie eine Ahnung, wo Ihr Freund hinfahren will?“
„Ich denke, in die City in irgendein Hotel.“
„Okay, ich werde ihm folgen.“
„Danke.“ Jessica lehnte sich erleichtert zurück. Als die Skyline von Manhattan näher rückte, hielt sie gewohnheitsmäßig nach dem Franklin Publishing Tower Ausschau und musste an ihre Eltern denken.
Seit sie von zu Hause fortgegangen war, hatte sie nur noch wenig Kontakt zu ihnen, rief sie nur noch alle paar Wochen kurz an. Ihre Eltern waren in dem Glauben, sie würde zu ihrem Vergnügen im Land herumreisen. Es musste schon Jahre her sein, dass Jessica ein richtig gutes Gespräch mit ihren Eltern geführt hatte.
Natürlich billigten sie den Entschluss ihrer Tochter, ein Leben außerhalb der High Society zu führen, keineswegs. Deshalb war ihre Beziehung auch sehr abgekühlt. Hätten sie erfahren, dass Jessica ein uneheliches Kind bekommen hatte und zudem noch verzweifelt versuchte, einen Verfolger abschütteln, hätte das nur ihre Befürchtungen, dass ihre Tochter allein ziemlich lebensuntüchtig war, bestätigt. Aber diesen Triumph wollte Jessica ihnen auf keinen Fall gönnen.
Die Stimme des Taxifahrers riss sie aus ihren Gedanken. „Wann ist es denn so weit?“
Sie lächelte. „Ich habe das Baby schon bekommen. Meine kleine Tochter ist im Moment bei Freunden untergebracht.“
„Und da wollen Sie den Vater erst jetzt zur Verantwortung ziehen? Wenn das mal gut geht.“
„Doch, doch, er hat eine Zeit lang im Ausland gelebt, wo ich ihn nicht erreichen konnte.“
Der Fahrer betrachtete sie im Rückspiegel. „Okay, ich glaube Ihnen. Ihre Stimme hört sich nicht so an, als ob Sie mir was vormachen. Mit der Zeit kriegt man da nämlich Erfahrung.“ Er richtete den Blick wieder auf die Straße. „Wie heißt Ihre Kleine denn?“
„Elizabeth.“ Als Jessica den Namen ausgesprochen hatte, fühlte sie plötzlich einen Kloß in ihrer Kehle, und sie musste sich zusammenreißen, um nicht zu weinen.
„Ein hübscher Name. Ich habe zwei kleine Jungen, Rory und Jonathan“, erzählte der Fahrer stolz. Plötzlich verfinsterte sich seine Miene. „Sieht gar nicht mehr so aus, als ob Ihr Freund in die City will. Das Taxi ist auf der Abbiegespur zum Hudson Parkway. Soll ich immer noch folgen?“
„Jawohl.“ Aber Jessica wusste selbst nicht, was sie davon halten sollte. War es ein Zufall, dass Nat ins Hudson Valley fuhr, wo ihre Eltern wohnten?
„Wie ich schon sagte, das wird keine billige Fahrt“, bemerkte der Fahrer. „Ob der raus nach Vermont fahren will, um sich das bunte Herbstlaub anzusehen?“
„Das glaube ich nicht.“
„Waren Sie um diese Jahreszeit schon mal dort?“
„Ja.“ Jessica erinnerte sich noch genau daran, wie ihre Eltern mit ihr dorthin gefahren waren, als sie neun Jahre alt war. Die schmalen Wege schienen viel zu eng für die große schwarze Limousine. Als sie dann auch noch auf einem Dorfplatz anhielten, um heißen Cidre zu trinken, war Jessica das Ganze das sehr peinlich gewesen, weil die Leute sie so anstarrten. Sie hatte versucht, ihre Blicke zu ignorieren, und die Kinder beobachtet, wie sie sich ausgelassen in die Haufen aus zusammengekehrtem Herbstlaub plumpsen ließen und dabei tausend bunte Blätter aufwirbelten. Ein herrlicher Spaß! Die Kinder wollten nicht aufhören zu lachen, und Jessica hatte sich schrecklich einsam gefühlt.
Und dann musste sie an einen klaren Herbsttag in Aspen denken. Nat hatte sich erst gewundert, warum sie die Blätter zusammengekehrt hatte, um danach wie ein Kind in den Laubhaufen herumzutollen. Aber schließlich hatte er begeistert mitgemacht.
Die Stimme des Taxifahrers unterbrach den Strom ihrer Gedanken. „Meine Frau will unbedingt, dass wir nächstes Wochenende mit den Kindern dort rausfahren. Aber ich hab keine Lust. Nur wegen der paar Blätter sind die Straßen ganz schön voll.“
„Ich meine, Sie sollten trotzdem mit Ihrer Familie rausfahren“, erwiderte Jessica. „Es gibt dort auch urgemütliche kleine Gasthäuser, wo man übernachten kann.“
„Na klar, wenn man das nötige Kleingeld hat. Meine Frau kauft sich für das Geld sicher lieber ein neues Sofa. Da haben wir alle länger was davon.“
Jessica fiel nichts mehr darauf zu sagen ein. Dabei hätte sie der Frau des Taxifahrers dieses romantische Herbstwochenende so gegönnt.
Mittlerweile hatten sie Manhattan hinter sich gelassen und fuhren die Jessica so vertraute Strecke am Hudson entlang. Das Anwesen der Franklins lag nur noch ein paar Meilen von hier entfernt.
„Das wird verdammt teuer“, meinte der Fahrer. „Sind Sie sicher, dass ich weiterfahren soll?“
„Ja, bitte.“ Etwa eine Meile vor Franklin Hall bat Jessica den Fahrer, langsamer zu fahren. So konnte sie Nats Taxi aus sicherem Abstand beobachten. Ihre Ahnung hatte sie nicht getäuscht, Nat ließ sich tatsächlich zum Haus ihrer Eltern bringen. Warum nur?
„Halten Sie bitte dort unter dem Baum“, wies Jessica den Taxifahrer an. „Ich möchte aussteigen.“
„Wieso das denn?“ Nur widerwillig fuhr er an den Straßenrand. „Ich kann Sie doch nicht im Dunkeln hier auf der einsamen Straße absetzen. Und in die Villa da vorn kommen Sie sowieso nicht rein. Die Grundstücke haben hier alle automatische Tore, und in den Gärten gibt es jede Menge Wachhunde.“ Er schwieg einen Moment und fragte dann ehrlich besorgt: „Was ist nur mit Ihnen?“
„Ich komme schon dort hinein“, versicherte Jessica ihm. „Früher habe ich dort nämlich gewohnt, sodass ich den Code für das Tor kenne.“
„Das glaube ich nicht!“
„Ich werde es Ihnen beweisen. Aber erst will ich mal bezahlen.“ Sie schaute auf das Taxameter und reichte ihm den angezeigten Betrag mit einem großzügigen Trinkgeld.
Das hatte einen gewissen Beruhigungseffekt auf den Fahrer. Dennoch blieb er sehr skeptisch. „Hören Sie mal, wir fahren jetzt nach Manhattan zurück. Sie brauchen die Rückfahrt nicht zu bezahlen, aber hier kann ich Sie nicht allein lassen. Wenn Ihnen etwas passiert, würde ich mir das nie verzeihen.“
Jessica erkannte die Schlusslichter von Nats Taxi, wie es jetzt die Auffahrt zu dem hinter hohen Bäumen verborgenen Haupthaus der Franklins hinauffuhr. „Fahren Sie mich bitte bis zum Tor“, bat sie. „Ich werde Ihnen demonstrieren, dass ich es öffnen kann.“
„Meinetwegen.“ Der Fahrer gab Gas. „Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie hier hingehören. Diese Leute sehen anders aus.“
„Warten Sie’s ab.“ Sie stieg schnell aus dem Taxi und blieb vor dem mit den Initialen ihres Vaters verzierten Eingangstor stehen.
Der Fahrer hatte sein Fenster geöffnet, um sie aufmerksam zu beobachten. Da war Jessica doch erleichtert, dass ihr die Zahlenkombination, die sie eintippen musste, so mühelos wieder einfiel und sich das Tor öffnete.
„Donnerwetter, das hätte ich nicht erwartet!“, rief er ihr zu. „Wer sind Sie eigentlich?“
„Ist doch nicht so wichtig.“
„Okay, okay, aber wenn ich meinen Freunden erzähle, dass …“
Jessica lief ein Schauer über den Rücken. Das hatte ihr noch gefehlt, wo ihr sowieso schon ein unheimlicher Verfolger auf den Fersen war. „Bitte erzählen Sie es niemand.“
„Aber wenn die Polizei mich ausfragt?“
„Die wird Sie ganz bestimmt nicht fragen. Ich möchte nur nicht, dass Sie es bei Ihren Kollegen herumerzählen. Bitte versprechen Sie mir das.“
„Na gut, versprochen.“ Der Taxifahrer winkte ihr zum Abschied kurz zu und fuhr los.
Jessica eilte durch das Tor. In dem Augenblick, als sich hinter ihr die breite Tür automatisch schloss, hatte sie wie früher das Gefühl, eine Gefangene von Franklin Hall zu sein.
2. KAPITEL
Obwohl Nat einen gewissen Luxus erwartet hatte, verschlug es ihm die Sprache, als das Taxi vor der prachtvollen alten Villa im Kolonialstil anhielt. Die elegante ockerfarbene Fassade mit den weißen Stuckverzierungen erstrahlte makellos im Flutlicht.
Hier war Jessica also zu Hause. Nat fand die Vorstellung so aufregend, dass seine Müdigkeit nach dem langen Transatlantikflug sogleich verflog. Ihre Eltern wussten sicher, wo Jessica sich aufhielt.
„Schönes Häuschen“, bemerkte der Taxifahrer.
„Das kann man wohl sagen.“ Dennoch spürte er sofort, dass er sich in der überdimensionierten Villa ebenso wenig wie Jessica wohlfühlen würde. Er konnte jetzt sehr gut nachvollziehen, wie einsam sie sich als einziges Kind in Franklin Hall gefühlt hatte.
Bevor er ausstieg, wandte er sich an den Taxifahrer. „Ich weiß zwar nicht, wie lange ich bleiben werde, aber vielleicht könnten Sie im Haus warten. Hier draußen wird es sicher bald sehr kalt.“
„Nein, nein, danke, ich bleibe lieber am Wagen und rauche eine. Lassen Sie sich nur Zeit. Auf mich brauchen Sie keine Rücksicht zu nehmen.“
Nat betätigte den schweren Türklopfer aus Messing, worauf ihn ein Butler einließ. Er sprach mit stark britischem Akzent. Und Nat erinnerte sich, dass Jessica ihm erzählt hatte, ihr Vater habe Barclay direkt aus dem „Savoy“ in London abgeworben.
Das Foyer stand der imposanten Außenfassade des Hauses in nichts nach. Funkelnde Kristalllüster spiegelten sich in dem auf Hochglanz polierten Holz antiker Möbel. Auf einem Wandtisch war eine riesige blauweiße Porzellanvase voller duftender Herbstblumen platziert.
„Mr und Mrs Franklin sind in der Bibliothek“, erklärte der Butler. „Wenn Sie mir bitte folgen möchten, Sir.“
Der dicke Orientteppich schluckte jedes Geräusch von Schritten. Als Nat an der Treppe mit dem schön geschwungenen Geländer vorbeikam, sah er im Geiste Jessica vor sich, wie sie es gewagt hatte, dort herunterzurutschen, obwohl es ihr streng verboten war.
Danach quälte ihn wieder die Erinnerung an das letzte Mal, als sie beide zusammen gewesen waren. Jessicas Haar war noch vom Liebesspiel zerzaust, aber in ihren großen braunen Augen glitzerten auf einmal Tränen. „Deine Liebe ist nicht stark genug!“, hatte sie ihm vorgeworfen. Er war gegangen, ohne etwas darauf zu antworten.
Für Jessica bedeutete Liebe auch, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Aber dazu fehlte Nat der Mut. Er traute sich einfach nicht zu, ein guter Vater zu sein. Daran hatte sich bis heute nichts geändert. Dennoch kam er nicht von Jessica los, sosehr er es auch versucht hatte. Er konnte keine andere Frau lieben.
Mit dieser Einsicht war Nat nun zurückgekehrt. Das Elend der Flüchtlinge, die ihre Liebsten verloren hatten, hatte ihn außerdem gelehrt, wie dumm es war, seine große Liebe aufzugeben. Er wollte Jessica um Verzeihung bitten und hoffte inständig, dass sie ihm noch eine zweite Chance gab. Mit der Zeit würde er sich schon an den Gedanken gewöhnen, eigene Kinder zu bekommen. Schließlich hatte er ein Adoptionsprogramm für Kriegswaisen ins Leben gerufen.
Zunächst aber musste er Jessica finden. In ihrem Apartment in Aspen hatte er sie nicht erreichen können und sich große Sorgen um sie gemacht, bis er erfahren hatte, dass sie nicht mehr dort wohnte.
Nat war so in seine Gedanken vertieft, dass er den Butler fast angerempelt hätte, als dieser in der Tür zur Bibliothek stehen blieb, um ihn vorzustellen. „Mr Nat Grady.“
Russell P. Franklin, ein eleganter älterer Herr mit vollem silbergrauen Haar, stand auf, um Nat zu begrüßen, während Adele Franklin in ihrem Schaukelstuhl sitzen blieb und ihm freundlich die Hand reichte. Ihre Ähnlichkeit mit Jessica war verblüffend, was vor allem auch durch das rote Haar unterstrichen wurde. Vermutlich hatte der Friseur bei der Farbe etwas nachgeholfen.
„Setzen Sie sich zu uns an den Kamin“, lud Russell Franklin Nat ein. „Was darf ich Ihnen anbieten?“
„Ich würde gern einen Scotch trinken“, erwiderte Nat, obwohl er keine große Lust auf Alkohol verspürte. Als erfahrener Grundstücksmakler wusste er, dass man besser mit den Leuten ins Gespräch kam, wenn man einen Drink akzeptierte. Und dieses Gespräch war ihm wichtiger als alle Geschäftsverhandlungen, die er je geführt hatte.
„Ausgezeichnet.“ Russell Franklin winkte seinem Butler. „Bitten Sie den Koch, ein paar gute Sandwiches zu machen. Dieser Mann hier hat den ganzen Tag im Flugzeug gesessen und somit nichts Anständiges zu essen bekommen.“
Wenn er wüsste, wie köstlich die Menüs im Flugzeug verglichen mit der Küche im Camp sind, dachte Nat im Stillen. Er strich sich über den Bart. „Bitte entschuldigen Sie mein wildes Aussehen. Ich bin direkt vom Flughafen hierher gekommen.“
„Ich verstehe schon“, antwortete Russell Franklin. „Ein Mann, der sich so einer Aufgabe widmet, hat anderes im Kopf als sein Aussehen.“
„Man setzt dort eben andere Prioritäten als zu Hause“, bemerkte Nat, während er in einem Sessel vor dem offenen Kaminfeuer Platz nahm.
Die Holzscheite knisterten fast feierlich, sie verbreiteten einen würzigen Duft und behagliche Wärme. Rechts und links vom Kamin gaben großzügige Fenster den Blick auf den Fluss frei, dessen Ufer in dieser Gegend nur spärlich beleuchtet waren. Deckenhohe Regale, in denen ledergebundene Bücher standen, bedeckten die übrigen Wände des Raums. Auch eine Rollleiter fehlte nicht.
Adele beugte sich lächelnd zu Nat vor. „Sie sind wirklich sehr engagiert, Mr Grady. Unsereiner spendet vielleicht ein bisschen Geld für diese Flüchtlinge, um sein Gewissen zu beruhigen. Aber Sie widmen sich gleich voll und ganz den armen Menschen. Das imponiert mir sehr.“
Der Klang ihrer Stimme kam Nat ungemein vertraut vor. Er hatte fast das Gefühl, Jessica sprechen zu hören. „Ich bitte Sie, ich komme mir eigentlich nicht wie ein Wohltäter vor“, sagte er bescheiden. „Es hat sich eben so ergeben.“
In diesem Moment brachte der Butler Nats Scotch und einige Sandwiches auf einem Silbertablett sowie zwei Gläser, wahrscheinlich mit Mineralwasser, für Adele und Russell Franklin.
„Trinken wir auf Ihr Engagement, Mr Grady.“ Russell Franklin erhob sein Glas und prostete Nat zu. „Und jetzt erzählen Sie mal genauer, wie Sie sich das Ganze vorstellen.“