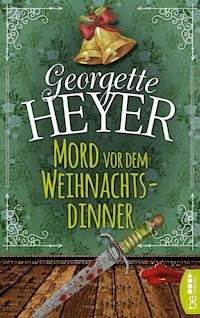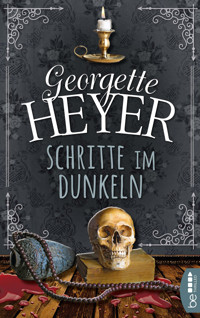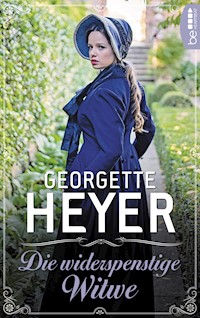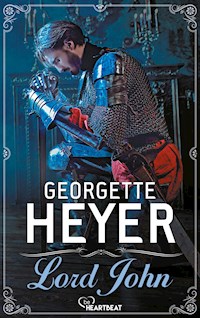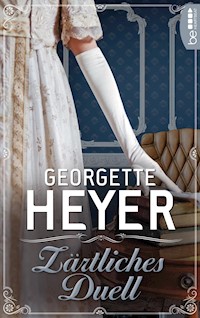
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charmante Verwirrungen, knisternde Kamine und rauschende Bälle
Unschuldige Damen und ruchlose Lords: Sie fahren mit der Postkutsche und werden bei Hof vorgestellt. Sie duellieren sich und geben sich dem Glücksspiel hin. Sie verlieben sich und sie heiraten nach vielen Irr- und Umwegen. Georgette Heyer kennt sich aus in der Gesellschaft des Regency wie keine andere Autorin. Die vorliegenden elf Erzählungen liefern eine kleine Kostprobe ihres Könnens.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
"Eine wundervolle Auswahl". - LIBRARY JOURNAL
"Alles, was das Herz begehrt: spannende Intrigen, abenteuerliche Mantel-und-Degen-Geschichten und romantische Komödien." - BEST SELLERS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. PISTOLEN FÜR ZWEI
2. EINE HEIMLICHE AFFÄRE
3. EINE MISS AUS BATH
4. DER ROSA DOMINO
5. EIN EHEMANN FÜR FANNY
6. KORREKTES VERHALTEN
7. DIE NACHT IN DER HERBERGE
8. DAS DUELL
9. GLÜCKSSPIEL
10. SCHNEEVERWEHUNG
11. VOLLMOND
Über dieses Buch
Unschuldige Damen und ruchlose Lords: Sie fahren mit der Postkutsche und werden bei Hof vorgestellt. Sie duellieren sich und geben sich dem Glücksspiel hin. Sie verlieben sich und sie heiraten nach vielen Irr- und Umwegen. Georgette Heyer kennt sich aus in der Gesellschaft des Regency wie keine andere Autorin. Die vorliegenden elf Erzählungen liefern eine kleine Kostprobe ihres Könnens.
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Zärtliches Duell
Aus dem Englischen von Ilse Winger und Heinrich von Bohn
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1960
Die Originalausgabe PISTOLS FOR TWO erschien 1960 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1975.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de
Illustration: © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4891-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. PISTOLEN FÜR ZWEI
Eigentlich entflammte der Streit, der schon viele Wochen geschwelt hatte, wegen einer solchen Kleinigkeit, dass jeder, so fand Tom, darüber gelacht hätte. Dass Jack vor der Tür einen Schritt zurücktrat, an ihn stieß, so dass er ein Glas Champagner verschüttete, und ihm auf den Fuß stieg, war allerdings nicht der eigentliche Anlass des Duells. Jack knirschte auch nicht erblassend vor Wut mit den Zähnen, weil er ihn einen Tollpatsch geschimpft hatte. Wenn man einen Menschen von klein auf gekannt, mit ihm gespielt und gemeinsam die Schule besucht hat, wenn man zusammen auf die Jagd und auf Fischfang gegangen ist, dann kann man ihn unbesorgt beschimpfen, und die Sache endet entweder mit einem kurzen Faustkampf oder mit Gelächter; jedenfalls nicht mit einem Zusammentreffen zu früher Morgenstunde, begleitet von Sekundanten. Und selbst wenn sie keine so guten Freunde gewesen wären, war derlei nicht mehr Mode – bloß für die Bühne geeigneter Unsinn. Toms Großvater allerdings hatte – wenn man der Familienlegende Glauben schenken durfte – fünfmal und bei der geringsten Provokation Duelle ausgefochten. Einmal hatte er sich mit Jacks Großonkel George duelliert – und sie mussten, hatten Jack und er oft lachend überlegt, überaus komisch ausgesehen haben mit ihren glattrasierten Köpfen (weil beide natürlich Perücken trugen) und den absurden Rüschen, die sie anstelle von Manschetten trugen und die sie hineinstopfen mussten, und mit ihren bloßen, unter dem rauen Boden leidenden Füßen. Trug man heutzutage ein Duell aus, so wählte man Pistolen und machte keine Maskerade daraus. Aber nur noch sehr wenige Leute dachten überhaupt noch an Duelle, und ganz bestimmt nicht wegen eines Zusammenstoßes an einer Tür.
Doch darum ging es ja eben gar nicht. Diese unvorstellbare Situation war aus etwas viel Ernsterem entstanden. Nicht, dass man Marianne Treen ernst nennen konnte; sie war der fröhlichste und unbeschwerteste aller erdenklichen Streitgründe.
Seltsam, wie ein paar Jahre ein weibliches Wesen verändern können. Bevor die kleine Marianne Treen nach Süden in ein Internat ging, war an ihr nicht das Geringste bemerkenswert. Tom konnte sich sogar genau erinnern, dass er und Jack und Harry Denver sie für eine dumme Gans mit Sommersprossen auf der Nase gehalten hatten, die sich überall dort vordrängte, wo man kein Mädchen brauchen konnte. Ihre Abreise aus Yorkshire rief daher keinerlei Bedauern bei ihnen hervor, und da sie die Ferien bei ihrer Großmutter in London verbrachte, konnte man sie bald vergessen.
Aber Marianne war nach Yorkshire zurückgekehrt. Sie hatte eine fabelhafte Saison in London hinter sich, und als sich die meisten Mitglieder der Haute-volée nach Brighton begaben, brachte sie Mrs. Treen zurück nach Treen Hall, und die Nachbarschaft hatte anlässlich einer Zusammenkunft in High Harrowgate Gelegenheit, die Bekanntschaft mit Marianne zu erneuern. Das war für alle jungen Herren im Umkreis von Meilen ein ungeheurer Schock, denn wer hätte gedacht, dass diese berückende Schönheit niemand anders war als die kleine sommersprossige Marianne, die zu betteln pflegte: »Ach, lasst mich doch mitkommen! Ach, bitte, nehmt mich doch mit!«
Man hatte sie nur selten mitgenommen, und das war jetzt ihre Rache. Doch sie war zu gutherzig und zu munter, um auf Rache großen Wert zu legen, und wenn sie diesen oder jenen vorzog, konnte man sofort sehen, dass sie trotzdem bemüht war, gerecht zu sein.
Jack und Tom gehörten zu ihren Lieblingen, da sie zweifellos die eifrigsten ihrer Verehrer waren. Jedermann lachte darüber, und man hänselte sie ein wenig, weil sie alles gemeinsam taten, selbst wenn es darum ging, sich zum ersten Mal zu verlieben. Das beruhigte die hitzigen Gemüter jedoch keineswegs. Seltsam und bedauerlich, dass die eigenen Verwandten nicht erkennen konnten, wie ernst man es meinte, ja dass sie im Irrtum befangen schienen, jemand, der Oxford noch nicht hinter sich hatte, dürfe nicht an eine Heirat denken.
Jeder der beiden fühlte sich als geeigneter Freier. Vielleicht lag Jack ein wenig im Vorteil, denn sein Vater war Baronet. Andererseits war Toms Vater ein Squire, und das zählte etwas, und Tom sein einziger Sohn, während Jack zwei jüngere Brüder hatte, für die gesorgt werden musste.
Vorerst war ihre Werbung ungetrübt von jeder Missgunst. Man stimmte überein, dass Marianne unvergleichlich war, und der Wettkampf um ihre Gunst ging fair und freundschaftlich vor sich. Vielleicht wusste keiner genau, wann die Veränderung in ihrer Beziehung eintrat. Vielleicht war Jack eifersüchtig, weil Tom größer war und breitere Schultern hatte (für ein Mädchen bestimmt anziehend), vielleicht beneidete Tom seinen Freund um dessen Eleganz und hübsches Profil. Was immer der Anlass gewesen sein mochte, eine Kluft tat sich zwischen ihnen auf. Sie betrugen sich feindselig und beobachteten einander misstrauisch, ständig auf eine Beleidigung gefasst. Dutzend Mal wären sie um ein Haar handgreiflich geworden, aber bis zu jener unheilvollen Nacht wäre es ihnen nie in den Sinn gekommen, ihren Streit bei Morgengrauen auf der Stanhope-Lichtung auszutragen – traditionsgemäß ein geeigneter Treffpunkt. Dass Marianne sich vor Sommerende für einen von ihnen entscheiden würde, daran zweifelte keiner von ihnen. Die einzige Frage war, wer es sein würde, und damit war es von ungeheurer Wichtigkeit, dass keiner sich einen unfairen Vorteil vor dem anderen verschaffen durfte. Nach ein paar Auseinandersetzungen hatten sie sich hierüber geeignet – oder Tom hatte es zumindest geglaubt, bis er am Abend des Galadiners bei Treen mit eigenen Augen Jacks Perfidie mit ansehen musste. Beide hatten beabsichtigt, Marianne einen Blumenstrauß mit einer entsprechenden Karte zu senden, den sie dann beim Ball tragen würde; der Strauß, den sie wählte, würde die Neigung ihres Herzens verraten. Tom hatte den Obergärtner des Squires überredet, ihm ein exquisites Bukett aus rosa Rosen und Wicken zu arrangieren, und er war an diesem Morgen höchstpersönlich nach Treen Hall geritten, um sein Geschenk beim Butler abzugeben, als ihm ein höchst fatales Missgeschick zustieß. Seine Stute wurde von einer Pferdefliege gestochen, und Tom, der schneidige Reiter, in rosige Träume verloren und mit lockerem Zügel reitend, trennte sich plötzlich und unsanft von Bess. Das war das Ende des zarten Buketts in seiner Rechten! Blumenblätter auf der Straße, gebrochene Stängel im zarten Behälter war alles, was davon übrig blieb.
Er hatte Bess eben erst wieder eingefangen, als – so wollte es sein Missgeschick – Jack auf der Straße von Melbury Court in seinem eleganten neuen Tilbury daherkam. Ein Strauß gelber Rosen lag auf dem Sitz neben ihm, so dass es sich erübrigte, nach seinem Ziel zu fragen.
Noch vor drei Monaten hätte Jack über Toms Missgeschick schallend gelacht. Heute war Jack die personifizierte Höflichkeit, und nicht einmal der Anblick des zerzausten Buketts brachte ihn zum Lächeln. Jack hatte die Unverschämtheit, sich großzügig zu geben. Er sagte, da Tom Pech gehabt habe, würde er sein eigenes Bukett auch nicht überreichen. Das war es, was Tom eben laut ihrer Vereinbarung verlangen wollte. Er hasste Jack wegen seiner Korrektheit und weil er ihm zuvorgekommen war. Jack lächelte geringschätzig, vermutlich um anzudeuten, dass bloß ein schwachsinniger Bursche wie Tom auf den Gedanken kommen könnte, einer Göttin mit herrlichem tizianrotem Haar rosa Rosen zu schenken.
Tom hatte den ganzen Nachmittag darüber gebrütet, aber noch nicht im Entferntesten gedacht, Jack zu fordern. Auch als er am selben Abend in Treen Hall Marianne in einem bezaubernden weißen Satinkleid mit einer Wolke Tüll darüber, in der behandschuhten Hand einen Strauß gelber Rosen, erblickte, war ihm dies nicht eingefallen. Wenn in seinem Gehirn ein vernünftiger Gedanke Platz hatte, dann bloß der vage Entschluss, Jack bei nächster Gelegenheit einen ordentlichen Fausthieb zu versetzen, falls ihm nicht Jack zuerst einen solchen versetzte (denn Jack war ein guter Boxer).
Es wurde eine großartige Party mit verschiedenen Londoner Salonlöwen, die sich jetzt alle in Treen Hall aufhielten. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Tom, an modischen Dingen sehr interessiert, ein raffiniert drapiertes Halstuch an einem Herrn bewundert, der sich mit Mrs. Treen unterhielt, oder den eleganten Schnitt eines Rockes, den ein mit Marianne tanzender Herr trug. Auf den Herrn selbst wäre er trotz dessen angenehmem Gesichts und fabelhafter Haltung nicht eifersüchtig gewesen, denn der Mann war ziemlich alt – mindestens dreißig, schätzte Tom – und vermutlich bereits Familienvater.
All seine Eifersucht, all sein glühender Zorn galten Jack, seinem besten Freund; auch Mr. Treens ausgezeichneter Champagner vermochte daran nichts zu ändern. Nach einer Stunde konnte es niemandem mehr entgehen, dass die beiden hübschen Jungen vom Herrschaftshaus und von Melbury Court danach lechzten, einander an die Gurgel zu springen.
Und dann trat Jack höflich zurück, um einen älteren Herrn durchzulassen, stieg dabei Tom auf die Zehen, und dieser schüttete seinen Champagner aus.
Irgendwie standen sie einander plötzlich in dem kleinen Salon vor dem Ballsaal gegenüber, und Tom beschimpfte Jack, und Jack, statt ihn in die Rippen zu stoßen oder sich für seine Ungeschicklichkeit zu entschuldigen, stand sehr gerade und sehr steif vor ihm, blass, mit zusammengepressten Lippen, die hübschen grauen Augen kalt und hart wie Granit. Dann hatte Tom die Worte ausgesprochen, die sich nicht mehr zurücknehmen ließen: »Ich werde dir meine Sekundanten schicken!«, sagte er in großartigem Ton, der nur von seiner wutbebenden Stimme ein wenig beeinträchtigt wurde.
Der liebe gute Harry Denver, der den Zusammenstoß beobachtet hatte und den beiden in den Salon gefolgt war, versuchte Frieden zu stiften, bat sie, Vernunft anzunehmen und sich zu erinnern, wer sie waren.
»Harry, willst du mein Sekundant sein?«, fragte Tom. Der arme Harry stotterte und stammelte: »Tom, du weißt, dass das zu weit geht! Jack hat es nicht bös gemeint! Jack, um Himmels willen –!«
»Ich bin durchaus bereit, Mr. Crawley zu treffen, wann und wo immer er es wünscht!«, erwiderte Jack mit kühler, harter Stimme.
»Wollen Sie die Freundlichkeit haben, Ihre Sekundanten zu nennen, Mr. Frith!«, sagte Tom, um an Korrektheit nicht nachzustehen.
»Jack, du hast doch nicht auch den Verstand verloren«, rief Harry flehend. »Sei doch nicht ein so verdammter Dummkopf, Junge!«
Dann merkte er, dass sie nicht mehr allein waren. Der Herr aus London, der mit Marianne Walzer getanzt hatte, war in den Salon getreten und hatte die Tür hinter sich geschlossen. Die drei jungen Männer starrten ihn an – die Feindseligkeit der Einheimischen gegenüber den Fremden leuchtete aus ihren Augen.
»Sie müssen mir vergeben«, sagte er höflich. »Eine Ehrensache, nehme ich an? Viel besser, man schließt die Tür, meinen Sie nicht auch? Kann ich einem von Ihnen zu Diensten stehen?«
Sie starrten ihn an. Harry, auf verzweifelter Suche nach einem Verbündeten, berichtete über den Anlass des Streites und flehte den Herrn aus London an, den beiden geschworenen Feinden zu versichern, dass sie sich wie Idioten benähmen.
Jack, der im Geiste seine Bekannten in der Umgebung Revue passieren ließ und sie alle als ungeeignete Kandidaten für das Amt eines Sekundanten verwarf, sagte hochmütig: »Ich bin überzeugt, kein Mann von Ehre würde einem anderen raten, eine Herausforderung abzulehnen. Natürlich, wenn Mr. Crawley es vorzieht, seine unbedachten Worte zurückzunehmen –«
Das war eine beabsichtigte Beleidigung, wie Tom sehr gut wusste, denn Jack war der wesentlich bessere Schütze. Er presste ein einziges Wort hervor: »Nein!« »Aber sie dürfen sich nicht duellieren!«, protestierte Harry, und seine ehrlichen Züge zeigten deutlich Verzweiflung. »Sir, sagen Sie es ihnen.«
Der Herr aus London sagte entschuldigend: »Ich bin der gleichen Meinung wie Mr. Frith. Ein Mann von Ehre, Sir, kann eine Herausforderung nicht ablehnen.« Jack sah ihn mit einer gewissen Anerkennung an, sagte jedoch steif: »Leider kenne ich Sie nicht, Sir.« »Mein Name ist Kilham«, sagte der Herr aus London.
»Darf ich nochmals meine Dienste anbieten? Ich werde Mr. Frith mit Vergnügen sekundieren.«
Drei Paar Augen starrten ihn an. Mochte man auch in einiger Entfernung von London leben, war man doch nicht so weltfremd, nichts von Sir Gavin Kilham zu wissen, dem Freund von Prinzen, Mitglied der feudalsten Klubs, Sportsmann, Parlamentsmitglied, tonangebend in der Herrenmode. Kein Wunder, dass die Falten seines Halstuches der kritischsten Betrachtung standhielten! Kein Wunder, dass sein Rock ihm passte wie ein Handschuh!
Jack, verwirrt von dem Gedanken, eine so hochstehende Persönlichkeit als Sekundanten zu haben, schluckte und brachte nur mit Mühe eine annehmbare Verbeugung zustande. Tom knirschte wütend mit den Zähnen, dass Jack wieder der Glückspilz war. Und Harry überlegte erleichtert, dass Beau Kilham sicherlich wusste, was zu tun war. Er wagte zu sagen: »Ich – ich werde Sie besuchen, wann immer Sie es wünschen.«
»Das könnte auf Schwierigkeiten stoßen«, erwiderte Sir Gavin, für den die tragische Situation etwas ganz Alltägliches zu sein schien. »Ich bin in diesem Haus nur zu Gast, wissen Sie. Besprechen wir lieber das Nötige jetzt gleich!«
Harry, der sich vage erinnerte, dass es sich für einen Sekundanten gehört, zwischen den Parteien eine Versöhnung zu versuchen, blickte ihn zweifelnd an, aber die Duellanten in spe stimmten dem Vorschlag begeistert zu.
Sir Gavin zog seine Schnupftabakdose hervor, öffnete sie und entnahm ihr eine kleine Prise. »Da wir, Sir, die Wahl haben, werden wir Pistolen und eine Entfernung von acht Meter wählen; ich bitte Sie, uns für morgen eine Zeit und einen Platz nach Ihrem Belieben zu nennen.«
Harrys Gesicht zeigte tiefe Besorgnis, denn die große Entfernung war vorteilhaft für den besseren Schützen. Bevor er den Mund auftun konnte, sagte Jack (unerträglich arrogant, fand Tom): »Ich ziehe es vor, mich mit Mr. Crawley auf eine Entfernung von vier Metern zu duellieren, Sir.«
»Ich schieße nicht auf eine Entfernung von vier Metern«, erwiderte Tom wütend. »Acht Meter, und damit Schluss!«
»Tom, um Gottes willen! Hört zu, ihr beiden Verrückten, das ist Wahnsinn! Der Streit könnte in Sekunden beigelegt werden!«, rief Harry.
Sie wandten sich gegen ihn, und all ihre aufgestauten Gefühle entluden sich in den feindseligen Worten, mit denen sie ihm Schweigen geboten.
So blieb dem armen Harry nichts anderes übrig, als Zeit und Ort festzulegen, die von Sir Gavin mit äußerster Liebenswürdigkeit akzeptiert wurden.
Und dann kam den drei jungen Herren ein furchtbarer Gedanke.
»Die – die Waffen?«, stammelte Harry und wechselte einen angstvollen Blick mit Tom.
Einen Augenblick lang schwiegen alle. Sir Gavins verschleierter Blick senkte sich auf seine reizende Schnupftabakdose, und falls seine Lippen zuckten, so wurde es von niemandem bemerkt. Jack und Tom wälzten bittere Gedanken über Väter, die ihre Duellpistolen hinter Schloss und Riegel hielten (falls sie überhaupt welche besaßen). Man sollte meinen, dass jeder kluge Vater seinem Sohn anstatt eines Schießgewehrs ein Paar Manton-Pistolen geben und ihn belehren würde, wie man sich in einer Situation wie dieser richtig verhält. Weder Sir John noch der Squire hatten in dieser Beziehung die geringsten Anstrengungen gemacht; und eine genaue Kenntnis dieser beiden Herren zwang die Söhne, sich mit der unangenehmen Tatsache abzufinden, dass ein Hilferuf an die Eltern in diesem Augenblick nur zu einer sofortigen Beilegung des Streites führen würde.
Obwohl Harry die Angelegenheit liebend gern bereinigt hätte, durfte er den Herrn aus London nicht darüber aufklären, dass sein Freund keine Duellpistolen besaß. Daher erklärte er, Toms Pistolen seien leider soeben wegen einer kleinen Reparatur an den Erzeuger zurückgeschickt worden. Jack konnte sich natürlich nicht übertrumpfen lassen, und da ihm für das Nichtvorhandensein von Pistolen keine Erklärung einfiel, die nicht einem Plagiat gleichgekommen wäre, sagte er mit boshaft verzerrten Lippen: »Merkwürdig, dass ich Mr. Crawleys Pistolen niemals sehen durfte!«
»Du hast auch keine, also red keinen Stiefel!«, erwiderte Tom sofort.
»In diesem Fall«, sagte Sir Gavin und steckte seine Tabakdose ein, »werde ich für die Waffen verantwortlich sein. Und da die Stunde des Treffens nicht mehr fern ist, möchte ich vorschlagen, dass die beiden Herren sich jetzt zurückziehen und nach Hause fahren, um ein wenig zu schlafen. Mr. Frith, ich werde Sie um halb sechs mit meiner Kutsche abholen. Mr. Denver, ich möchte gern einen Augenblick mit Ihnen sprechen, bevor wir uns trennen.«
Es ist einfach, von Schlaf zu reden, wenn man bei einem Duell nur Sekundant ist, überlegte Tom verbittert. Er hatte sich aus Treen Hall fortgeschlichen und war bei Vollmond nach Hause gefahren. Die kühle Luft, die über das Moor wehte, hatte seinen Kopf und auch seine Wut beträchtlich abgekühlt. Als er das Haus seines Vaters erreichte und das Pony in den Stall gebracht hatte, fand er es bereits sehr schwierig, sich auf den morgigen Tag zu freuen – nein, nicht morgen, denn als er beim Betreten des Hauses auf die große Standuhr am Fuße der Treppe blickte, bemerkte er, dass Mitternacht vorbei war. Seine Mutter war zu Bett gegangen, aber das Pech wollte es, dass der Squire noch munter war und aus der Bibliothek rief: »Bist du es, Tom?«
Er musste hineingehen, und da saß sein Vater und war nicht einmal allein. Er spielte mit Sir John Frith Schach. Für Tom war Sir John ein Onkel und er schätzte ihn sehr, doch im Augenblick gab es kaum jemanden, den er weniger zu sehen wünschte.
»Du bist früh zurück«, bemerkte der Squire und warf ihm unter den buschigen Brauen einen Blick zu.
»Ja, Sir«, erwiderte er beiläufig, »es war ein solches Gedränge – und Harry und ich wollen morgen zeitig im Brown-Teich fischen gehen.«
»Oh«, sagte der Squire, den Kopf schon wieder über das Schachbrett gebeugt, »ich glaube, John, du hast mich erledigt.«
»Ich glaube auch«, stimmte sein Gast zu. »Geht Jack mit euch, Tom?«
Tom spürte, wie eine verräterische Röte in seine Wangen stieg. »Ja – ja, natürlich«, stotterte er und kam sich vor wie Judas; nur würde wahrscheinlich er und nicht Jack in wenigen Stunden auf einer Bahre nach Hause gebracht werden.
»Das freut mich!«, sagte Sir John. »Besser, als in eurem Alter einem Weiberrock nachzulaufen, ihr zwei Narren!«
Das war die Art und Weise, wie Greise von fünfundvierzig (vielleicht sogar mehr) Jahren zu einem sprachen; so senil, dass sie ganz vergessen hatten, was es hieß, jung und verliebt zu sein! Tom verkündete steif, dass er zu Bett gehe.
»Ja, geh nur«, stimmte sein Vater zu. »Gute Nacht, mein Junge. Weck nicht den ganzen Haushalt auf, wenn du hinaufgehst! Mein Irrtum, John, war der Zug mit der Königin.«
Völlig unbemerkt von den beiden gefühllosen Alten, die das Spiel bereits nochmals spielten, zog sich Tom zurück. Natürlich sollte keiner von ihnen die Wahrheit erfahren, es ärgerte ihn aber doch, dass sie so ahnungslos waren.
Als er zu Bett ging, hoffte er, dass Harry nicht verschlafen würde. Harry sollte ihn in seinem Gig abholen, und es wäre furchtbar, wenn er sich zu spät an dem vereinbarten Ort einfinden oder gar selbst verschlafen würde. Der Herr aus London würde seinen Mann bestimmt pünktlich zum Rendezvous bringen. Sehr bald stellte er fest, dass seine Sorge, er könne verschlafen, überflüssig war. An Schlaf war gar nicht zu denken. Er wälzte sich im Bett hin und her; er warf die Decke hinunter; er zog sie wieder über sich; er boxte die Kissen zurecht – alles ohne Erfolg. Er blieb hellwach, und so viele Gedanken stürmten auf ihn ein und bedrängten ihn, wie er es noch niemals erlebt hatte.
Angst hatte er keine, fand er, oder zumindest nicht mehr, als wenn er in Eton den Kricketplatz betrat; aber sein Vater tat ihm leid, der beim Frühstück die erfreuliche Nachricht vernehmen würde, dass die Hoffnung seines Hauses entweder eine Leiche oder furchtbar verletzt sei. Seine Mutter würde sich von diesem Schlag niemals erholen; und wie schrecklich würde es für Sir John und Lady Frith sein, wenn der einzige Erbe das Land verlassen musste und jede Verbindung mit dem Haus des Squires von diesem Augenblick an abgeschnitten war. Armer törichter Onkel John, der so nichts ahnend fragte, ob auch Jack fischen ginge!
Als ihm dieser Gedanke kam, wurde er plötzlich von einem anderen verdrängt: wenn es bloß wahr wäre und er und Jack tatsächlich durch den taufrischen Morgen stapfen würden, Sandwiches in der Tasche, Angel in der Hand, Fischkorb auf dem Rücken und nichts zwischen ihnen als das gemütliche, unbeschwerte Geplauder von Freunden! Harry war auf einem solchen Ausflug nicht unbedingt nötig; eigentlich fehlte er besser, aber natürlich konnte er mitkommen, wenn er wollte, denn er war ein anständiger Kerl – ein wirklich treuer Freund, mit Jack allerdings nicht zu vergleichen. Harry neigte dazu, hin und wieder im Weg zu sein, so wie gestern, als er mit ihnen ging – rasch unterdrückte Tom den Gedanken. Fatal, sich an alle Dinge zu erinnern, die er und Jack zusammen unternommen hatten, und an den Spaß und die vielen Abenteuer, die sie miteinander erlebt hatten. Das alles war vorbei; und selbst wenn das Treffen nicht mit dem Tod eines von ihnen endete, würde es nie mehr zwischen ihnen so sein wie früher. Er konnte die Erinnerungen jedoch nicht verjagen und es half auch nichts, an Jacks heutigen abscheulichen Verrat zu denken, denn ob Jack Marianne hinter dem Rücken seines Freundes Blumen schenkte oder ob er sich so korrekt benahm, wie man es von ihm erwartete, blieb er doch der Freund, mit dem man jeden Gedanken geteilt, der einem aus jeder Verlegenheit geholfen hatte, und der kam, wenn er selbst Hilfe brauchte, so dass man an seiner Loyalität ebenso wenig wie an der des eigenen Vaters zweifeln konnte.
Und das alles wegen der kleinen sommersprossigen Marianne Treen, die, wenn man die Dinge objektiv betrachtete, mit allen jungen Männern spielte, und vermutlich für keinen von ihnen sehr viel übrig hatte! Jedem hatte sie an diesem Abend bloß einen Tanz – und nur Volkstänze! – gegönnt, sie hatte jedoch zweimal mit Sir Gavin Kilham Walzer getanzt, und mit einem anderen Stadt-Laffen die Quadrille! Wenn man bedachte, wie viel Zeit man verschwendet hatte, ihr Interesse zu erwecken – ja, verschwendet war das richtige Wort! Alle diese Sommermonate, in denen er und Jack so viel Besseres zu tun gehabt hätten, sinnlos damit zu vergeuden, einem jungen Ding zu hofieren, das beiden im Grunde höchst langweilig war!
Je mehr er daran dachte, desto mehr verblasste Mariannes heutiges Bild, desto lebhafter wurde die Erinnerung an ein aufdringliches Mädchen mit Sommersprossen, die jeden Spaß verdarb, weil sie überall dabei sein wollte, und dann in einen Bach fiel oder klagte, dass sie müde sei, oder sich nicht traute, ein Feld zu überqueren, weil dort Kühe grasten. Die Vorstellung, dass er und Jack – Jack! – wegen Marianne Treen aufeinander schießen würden, wäre ein gigantischer Witz, wenn das Ganze nicht so tragisch wäre. Und angenommen, dass durch irgendeinen Zufall nicht Jacks Kugel ihr Ziel traf, sondern seine? Nun, wenn das geschah, dann würde er sich selbst eine Kugel in den Kopf jagen, denn für Jacks Freund bliebe dann nichts anderes mehr übrig auf dieser Welt!
Wann seine Gedanken sich in unruhige Träume verwandelten, wusste er nicht, aber er musste eine Weile gedöst haben, denn als er die Augen öffnete, stellte er fest, dass nicht mehr der Mondschein durch den Spalt zwischen den Vorhängen fiel, sondern ein unangenehmes kaltes Morgenlicht. Seine Uhr sagte ihm, dass fünf Uhr vorbei war, also sprang er rasch aus seinem zerwühlten Bett. Als er vorsichtige Schritte auf dem Kies unter seinem Fenster hörte, war er angekleidet und beugte sich hinaus, um Harry zu begrüßen. Harry wollte eben ein paar Kieselsteine gegen sein Fenster werfen; jetzt ließ er sie fallen und bedeutete ihm, dass es Zeit zur Abfahrt sei.
Tom schlich die Treppe hinunter und schlüpfte durch eine Seitentür aus dem Haus. Nichts rührte sich. Schweigend gingen die beiden die Einfahrt entlang zu Harrys Gig.
Harry löste die Zügel vom Torpfosten und sagte: »Mir gefällt das ganz und gar nicht, alter Junge.« Von einem Duell konnte man nicht zurücktreten, vor allem wenn es das erste war und man noch nie Gelegenheit gehabt hatte, seinen Mut unter Beweis zu stellen. »Glaubst du denn, ich werde mich drücken?«, fragte Tom.
»Nun, ich weiß nicht recht«, sagte Harry und kletterte zu ihm ins Gig. »Schließlich bist du und Jack–« »Verschwende deine Sprüche nicht an mich«, empfahl Tom. »Sieh zu, was Jack dir sagen wird! Wenn ich ihn recht kenne, wird seine Antwort sehr kurz sein!« »Du kannst nicht erwarten, dass Jack sich zurückzieht«, sagte Harry.
»Das tue ich auch nicht.«
»Nein, ich meine, er war ja nicht der Herausforderer! Du warst es, Tom – du hast dich hinreißen lassen.«
»Nein.«
»Zum Teufel, einen Menschen herauszufordern, bloß weil er dich, ohne es zu wollen, gestoßen hat –«
»Darum ging es nicht«, erwiderte Tom. »Und es ist sinnlos, mich zu belehren. Ich will nichts hören!« Harry sprach also nichts mehr, und der Rest der Fahrt verlief in Schweigen. Pünktlich erreichten sie den Ort, und gleichzeitig mit ihnen kam ein weißer Wagen mit zwei herrlichen Füchsen die breite Fahrbahn herauf. Nur zwei Männer saßen darin, ein Arzt war nirgends zu sehen. Tom fragte sich, ob sein braver Sekundant Sir Gavin auf diesen Mangel aufmerksam machen würde. Es war nicht seine Sache, fand er, darauf hinzuweisen. Er warf einen kurzen Blick auf Jack, der eben aus dem Wagen stieg und seinen grauen Mantel ablegte, und wandte die Augen wieder ab. Jacks Gesicht schien immer noch wie aus Granit, und seine Augen wurden um keinen Grad wärmer, als sich ihre Blicke einen Augenblick lang trafen. Stattdessen betrachtete Tom die beiden schönen Füchse und dachte, wie gern er Jack fragen würde, ob sie ebenso gut trabten, wie sie aussahen, und ob Sir Gavin ihm erlaubt habe, die Zügel zu nehmen. Sir Gavin ging gemessenen Schrittes über die Lichtung auf Harry zu. Er trug hohe Stiefel, so gut poliert, dass man sich fast in ihnen spiegeln konnte, und ein reiches Cape. Unter dem Arm hatte er einen Unheil verkündenden Koffer. Er und Harry sprachen kurz miteinander, inspizierten die bösartig aussehenden Waffen in dem Koffer und gingen das Terrain ab. Tom fühlte sich elend und kalt, ein bleiernes Gewicht schien sich auf seine Brust gesenkt zu haben. Er wünschte, die Sekunden würden rascher vergehen; sie ließen sich schrecklich viel Zeit. Ein zweiter Blick auf Jack zeigte ihm, dass dieser völlig ruhig und gesammelt war, wenn auch etwas blass.
Harry trat auf ihn zu, um ihn zu seinem Standort zu führen. Sir Gavin hielt die Pistolen an den Läufen. Jack nahm eine in seine Rechte und stand, den Lauf nach unten, seitlich abgewandt von seinem Gegner. Sir Gavin reichte Harry die zweite Pistole. Er sah, dass sie gespannt war, nahm sie vorsichtig und war froh, dass seine Hand nicht zitterte. Er hörte Sir Gavin sagen, dass er ein Taschentuch würde fallen lassen, und nickte. Dann traten Sir Gavin und Harry zurück, und er sah über ein, wie ihm schien, breites Stück Grünfläche direkt auf Jack.
Das Taschentuch flatterte ein wenig in der leichten Brise; es fiel zu Boden, und Tom schoss absichtlich hoch in die Luft. Seine Augen fixierten Jack, und noch bevor er begriff, dass seine Pistole versagt hatte, sah er, wie Jacks Hand sich hob, so dass auch seine Waffe gegen den Himmel zeigte. Doch Jack schien sich nicht einmal die Mühe zu nehmen, abzudrücken, denn es geschah nichts – überhaupt nichts. Plötzlich war Tom wütend auf Jack, dass er sich so heroisch benahm, warf seine Pistole fort, und rief, auf ihn zugehend: »Was, zum Teufel, soll das heißen? Verdammt noch mal, schieß doch – nicht einmal abzudrücken –!«
»Ich drückte ab«, erwiderte Jack. »Das verflixte Ding versagte. Du hast nicht geschossen! Du verdammter Esel, ich hätte dich töten können!«
»Du hast in die Luft gezielt«, sagte Tom. »Wäre dir recht geschehen, wenn ich dich erschossen hätte! Verdammt, das ist beleidigend!«
»Du hast auch in die Luft geschossen!«, schrie ihn Jack an. »Und du hättest ebenso gut auf mich zielen können, weil du auf acht Meter nicht einmal eine Mauer triffst.«
»Ach, wirklich?«, rief Tom.
»Nein, nicht einmal auf vier Meter.«
»So?«, sagte Tom. »Nun, es gibt etwas, das ich sehr gut kann, und das ist: dich verprügeln.«
»Du kannst es versuchen!«, sagte Jack, warf seine Pistole fort und hob die Fäuste.
Mit Begeisterung stürzten sie sich aufeinander, ohne in ihrer Ungeduld die Jacken abzulegen. Es war ein mühsamer Kampf, denn die Jacken behinderten sie; teils aus Erleichterung, teils aus Zorn schlugen sie wild um sich, und bald versuchten sie einander in einem Clinch zu Boden zu bringen. Da Tom der größere und stärkere war, blieb über den Ausgang kaum ein Zweifel.
»Du Hund!«, keuchte Jack, stand mühsam auf und rieb sich den Ellbogen.
Sie blickten einander an. Toms Fäuste sanken herab. »Jack«, sagte er unsicher, »wir – wir kamen, um uns zu duellieren!«
Jacks Mund zuckte. Er biss sich in die Unterlippe, aber es half nicht. Wenn Tom nicht zu grinsen begonnen hätte – Clown, der er war –, hätte er Haltung bewahren können, aber Tom grinste, und das große Gelächter, das in Jack aufstieg, war nicht mehr zurückzuhalten.
Als sie endlich zu lachen aufhörten und ihre tränenden Augen trockneten, kam ihnen beiden der gleiche Gedanke. »Beide Pistolen versagten!«, sagte Jack.
»Natürlich, du hast recht!«, sagte Tom und drehte sich zu den Sekundanten um.
Als der Faustkampf begann, hatten er und Jack völlig den Herrn aus London vergessen. Zwischen Ärger über seinen vermeintlichen Betrug und Angst vor seiner Verachtung wegen ihres schulbubenhaften Benehmens hin und her gerissen, starrten sie ihn erhitzt und noch immer außer Atem an.
Sir Gavin, der lässig auf einem Baumstumpf gesessen hatte, stand auf, kam auf sie zu und sagte beifällig: »Ausgezeichnet! Manchmal offensichtlich ganz daneben, aber ich würde euch beide gern ohne Jacken kämpfen sehen. Wenn ihr nach London kommt, müsst ihr es mich wissen lassen, und ich werde euch in Jacksons Boxing Saloon mitnehmen.«
Diese schmeichelhafte Einladung von einem bekannten Förderer des Boxsportes besänftigte die verletzten Gefühle der Kombattanten. Doch der Anstand musste gewahrt werden. »Sir«, sagte Jack vorwurfsvoll, »weder die Pistole meines Freundes noch meine waren geladen!«
»Wisst ihr, diese Idee ist mir soeben auch gekommen«, sagte Sir Gavin. »Ich habe ein so schlechtes Gedächtnis! Ich muss mich wirklich entschuldigen, aber ich bin berühmt für meine Versäumnisse, und ihr müsst mir verzeihen.«
Obwohl sie den Verdacht hegten, dass man sie zum Narren hielt, war es schwer, mit dem Herrn aus London Streit zu beginnen. Tom löste das Problem, indem er sich an Harry wandte und grimmig sagte: »Du hättest die Waffen prüfen müssen. Du bist mein Sekundant.«
»Das tat ich!«, sagte Harry und brach in wieherndes Gelächter aus.
Es mochte schwer fallen, mit dem Herrn aus London richtig umzugehen, aber was Harry gebührte, stand außer Zweifel; Harry, der die Frechheit hatte, zwei Menschen zum Narren zu halten, die ihm aus purem Mitleid gestattet hatten, hin und wieder an ihren illustren Unternehmungen teilzunehmen. Sie maßen ihn mit ihren Blicken und gingen dann in klarer Absicht auf ihn zu.
Der Herr aus London stand plötzlich im Weg. Er erklärte: »Der Fehler liegt ausschließlich bei mir. Übrigens – hatten Sie die Absicht, sich gegenseitig umzubringen?«
»Nein!«, sagte Jack. »Und es war – es war sehr zuvorkommend von Ihnen, die Pistolen nicht zu laden, Sir, denn wir hatten die ganze Zeit die Absicht gehabt, bloß so zu tun, als ob!«
»Mein fehlendes Taktgefühl lässt mich oft nicht schlafen«, entschuldigte sich Sir Gavin. »Wissen Sie, eine Dame bat mich, in Ihren Streit einzugreifen, also was blieb mir anderes übrig?«
Jack blickte Tom verdutzt an, während er sich die Ereignisse des letzten Abends ins Gedächtnis zurückrief. »Warum nur, Tom?«, fragte er.
Tom errötete. »Es hat nichts zu bedeuten. Natürlich ist im Krieg und in der Liebe alles erlaubt, aber die Rosen! Ich hätte nie gedacht, dass du so etwas tun könntest.«
»Welche Rosen?«, erkundigte sich Jack.
»Deine. Die Rosen, die sie trug.«
»Das waren nicht meine!«, rief Jack mit blitzenden Augen. »Beim Zeus, Tom, ich hätte Lust, dich zu fordern, da du mir so etwas Niederträchtiges zutraust! Das übersteigt wirklich alles!«
»Nicht deine?«, brachte Tom hervor.
Sir Gavin hüstelte leise. »Wenn Sie von den Rosen sprechen, die Miss Treen gestern Abend trug, so waren das meine!« Sie starrten ihn an. »Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von euch beiden gefordert«, meinte er, »aber es verhält sich so, dass Miss Treen mir die Ehre gab, meine angetraute Gattin zu werden. Die Verlobung wurde gestern Abend beim Dinner bekannt gegeben.«
Das war eine schockierende Nachricht. Jeder der erfolglosen Freier versuchte sich einzureden, dass sein Leben zerstört sei. Tom sagte würdevoll: »Das hätten Sie uns bereits gestern Abend mitteilen können, Sir.«
»Natürlich, aber ich war eigentümlicherweise überzeugt, dass es nicht das Geringste genützt hätte«, bekannte Sir Gavin.
Die beiden dachten eine Weile nach. Ein widerwilliges Grinsen überlagerte Toms krampfhafte Würde. »Nun, vielleicht haben Sie recht«, gab er zu.
Jack vollführte seine schönste Verbeugung. »Wir erlauben uns, Ihnen zu gratulieren, Sir«, sagte er großzügig.
»Ich danke Ihnen sehr«, erwiderte Sir Gavin mit vollendeter Höflichkeit.
»Ich fürchte«, sagte Tom errötend, »Sie sind der Meinung, dass wir uns lächerlich machten, nicht wahr, Sir?«
»Keineswegs«, versicherte Sir Gavin, »Sie haben sich außerordentlich korrekt verhalten, und ich schätze mich glücklich, in einer Ehrenaffäre geholfen zu haben, die für beide Parteien so rühmlich war. Lasst uns zu dem Gasthaus jenseits dieser reizenden Lichtung gehen und ein Frühstück zu uns nehmen! Ich bestellte es vor einer halben Stunde und bin sicher, dass es uns bereits erwartet. Außerdem lasse ich meine Pferde nicht gern länger stehen.«
»Ach, natürlich nicht!«, rief Tom aus. »Ich muss sagen, Sir, ein wirklich tolles Gespann. Ganz große Klasse!«
»Es freut mich, dass es Ihnen gefällt«, sagte Sir Gavin, »und ich bitte Sie, die Pferde bis zum Gasthaus zu übernehmen! Wenn Sie erlauben, fahre ich im Gig.«
Es wäre kaum zu erwarten gewesen, dass zwei fröhliche Jungen ihre gebrochenen Herzen hätscheln, wenn sie die Chance haben, ein Paar Vollblutpferde zu kutschieren. Tom und Jack dankten Sir Gavin rasch und begeistert, liefen zum Wagen und stritten hitzig, wer als erster die Zügel nehmen dürfe. Sir Gavin hoffte von Herzen, dass sein Vertrauen in die Kutschierkünste der beiden nicht enttäuscht werden möge, nahm den zweiten Sekundanten beim Arm und schob ihn sanft in Richtung des bescheidenen Gigs.
2. EINE HEIMLICHE AFFÄRE
Miss Tresilian betrachtete das junge, vor ihr stehende Paar mit Sorge in ihren sonst so munteren grauen Augen. Nicht dass am Anblick, den Mr. Rosely und Miss Lucy Tresilian boten, etwas gewesen wäre, das den strengsten Kritiker gestört hätte, denn ein besser aussehendes Paar war nicht leicht zu finden: die junge Dame war eine strahlende Brünette, der junge Herr ein hübscher Bursche mit goldenen Locken, klassischen Zügen und einer guten Figur. Er trug, korrekt für einen vormittäglichen Besuch gekleidet, einen blauen Rock mit hellen Beinkleidern und hohen Stiefeln; und wenn die Falten seines Halstuchs auch nicht mit der Perfektion eines Dandys gelegt waren, so konnte man doch leicht erkennen, dass er sie mit großem Bemühen arrangiert hatte. Mit einem Wort, Mr. Roselys Kleidung entsprach dem einmaligen Anlass seines Besuches: Er war gekommen, Miss Tresilian um die Hand ihrer Nichte zu bitten.
Mit schüchternem Lächeln sagte er: »Es kann, glaube ich, keine Überraschung für Sie sein, Madam! Sie waren so liebenswürdig, dass ich überzeugt bin – das heißt, ich wage zu hoffen, dass Sie keine Einwände haben.«
Es war auch tatsächlich keine Überraschung für Miss Tresilian. Beinahe ein Jahr war vergangen, seit Mr. Rosely Lucy in Bath vorgestellt worden war; und obwohl es Lucy nicht an Bewunderern fehlte, und man kaum annehmen konnte, dass es jemandem, der vom Schicksal mit so gutem Aussehen und ansehnlichem Vermögen bedacht war wie Mr. Rosely, an guten Partien ermangeln konnte, hatte sich seit diesem Augenblick an der Verbundenheit der beiden nichts geändert. Auch konnte Miss Tresilian nicht leugnen, dass sie den Bund begünstigt hatte; er war ihr außerordentlich standesgemäß erschienen.
»Natürlich hat sie keine Einwände!«, sagte Lucy. »Du wusstest von Anfang an, wie es steht, nicht wahr, Tante Elinor?«
»Ja«, gab Miss Tresilian zu, »aber erst als ich dich nach London brachte, erfuhr ich, dass Arthurs Familie die Verbindung nicht billigt.«
»Oh nein«, sagte er rasch. »Das trifft bloß auf Iver zu! Meine Schwester ist ganz entzückt.«
»Und Lord Iver ist nur Arthurs Cousin«, sagte Lucy. »Außerdem ein entfernter Cousin! Eigentlich kaum ein Verwandter.«
Schüchtern wandte er ein: »Nun, er ist etwas mehr als das, er ist nämlich mein Vormund, musst du wissen. Ich möchte ihn um nichts in der Welt kränken, nur in diesem Fall meint er, wir seien beide zu jung – oder einen ähnlichen Unsinn! Er wird sich umstimmen lassen! Vor allem, wenn ich ihm sagen kann, dass Sie die Heirat nicht missbilligen, Madam!« »Nein, ich missbillige sie nicht«, sagte Miss Tresilian, »aber ich pflichte Lord Iver bei, dass ihr sehr jung seid. Das ist Lucys erste Saison, wissen Sie, und –«
»Wie kannst du so etwas sagen, Tante?«, protestierte ihre Nichte. »Zwar wurde ich erst vor einem Monat bei Hof vorgestellt, aber du weißt doch, dass du mich bereits vor einem Jahr in die Stadt gebracht hättest, wenn Tante Clara nicht behauptet hätte, sie wäre zu indisponiert, um allein gelassen zu werden. Schließlich bin ich neunzehn und besuche seit mehr als einem Jahr in Bath Gesellschaften!«
»Ja, meine Liebe, aber ich weiß erst seit kurzem, in welcher Situation sich Arthur befindet. Ich wusste nicht, dass er einen Vormund hat, und noch viel weniger –»
»Nein, nein, Madam«, unterbrach Mr. Rosely sie ängstlich. »Jetzt, da ich mündig bin, ist Iver nicht mehr mein Vormund, sondern bloß mein Treuhänder! Er hat keine Möglichkeit, diese Ehe zu verhindern – er hat keine Gewalt über mich!«
»Es scheint mir, dass er, da er bis zu Ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr über Ihr Vermögen verfügt, sehr viel Gewalt über Sie hat«, erwiderte Miss Tresilian trocken.
Er sah verwirrt aus, meinte aber: »Das würde er nie ausnützen – ich weiß es. Die Leute halten ihn für tyrannisch, aber zu mir war er es niemals. Der reizendste aller Vormunde – und dabei muss er mich zum Teufel gewünscht haben, denn ich war erst acht Jahre alt, als mein Vater starb, und er nicht viel älter als fünfundzwanzig. Ich wundere mich, dass er mich nicht in meinem Haus erziehen ließ, denn ich war gewohnt, ihm auf Schritt und Tritt zu folgen wie ein Hündchen.«
Dazu äußerte sich Miss Tresilian nicht. Es schien ihr unwahrscheinlich, dass Mr. Rosely seinem Vormund Iver jemals Grund gegeben haben könnte, eine tyrannische Veranlagung zu zeigen; denn obwohl sie die liebenswürdige Sanftmut seines Naturells nicht leugnen konnte, hatte sie nicht das Gefühl, dass Entschlusskraft unter seinen vielen Tugenden zu finden sei. In seinem bescheidenen Auftreten ließ sich keine Spur eines starken Willens entdecken, auch nicht die entschlossene Energie, die Lucy charakterisierte.
»Und selbst wenn er seine Zustimmung nicht gibt, wird es irgendwie gehen«, sagte Lucy fröhlich. »Schließlich besitze ich auch ein hübsches Vermögen, und davon können wir leben, bis das dumme Treuhandverhältnis zu Ende geht.«
Doch hier widersprach Miss Tresilian und erklärte mit Bestimmtheit, dass weder sie noch Lucys Papa eine Verlobung zulassen könnten, die nicht die Billigung Lord Ivers fand. Lucy sagte geradeheraus wie immer: »Meine Liebe, du weißt, das ist Unsinn! Papa würde bloß sagen, dass du die Dinge so regeln sollst, wie du es am besten findest.«