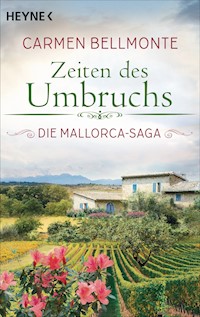6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Mallorca-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Das große Finale der Delgado-Saga
Mallorca 1953: Noch immer schwelt der alte Hass unter den Delgados, der Familienfrieden ist noch lange nicht greifbar. Die Weingüter stehen in Konkurrenz zueinander, jahrelang gehütete Geheimnisse brodeln unter der Oberfläche, und fast jeder trägt eine heimliche Schuld mit sich. Können sie sich endlich gegenseitig vergeben? Oder wird der Clan endgültig auseinandergerissen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Ähnliche
Das Buch
Mallorca 1953: Noch immer schwelt der alte Hass unter den Delgados, der Familienfriede ist noch lange nicht greifbar. Durch Höhen und Tiefen sind sie über Generationen hinweggegangen; zahlreiche Verluste haben die Gemüter erhärtet. Aber sie haben auch Neues erwachsen lassen. Aus dem Weinhandel und dem Hotelgeschäft auf der Balearischen Insel ist die Familie nicht wegzudenken. Doch jahrelang gehütete Geheimnisse brodeln unter der Oberfläche, fast alle tragen eine heimliche Schuld mit sich herum. Können sie sich endlich gegenseitig vergeben? Oder wird der Clan endgültig auseinandergerissen?
Die Autorin
Hinter Carmen Bellmonte stehen die Autorinnen Elke Becker und Ute Köhler. Zusammen bringen sie 35 Jahre Inselerfahrung auf Mallorca mit. Die beiden sind seit über zehn Jahren befreundet, lieben das Reisen und guten Wein und schreiben beide Bücher, die auf ihrer paradiesischen Balearischen Insel spielen. So lag es nahe, sich zusammenzutun und all ihre Vorlieben in einer großen epischen Geschichte zu vereinen.
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschütztenInhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 bUrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 08/2023
Copyright © 2023 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ingola Lammers
Covergestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock.com (Somy Volodymyr, Maija Luomala, leoks, Nella, vicenfoto); AdobeStock (pwmotion))
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-27174-9V002
www.heyne.de
1953
1
Die milde Januarsonne Kaliforniens stand am wolkenlosen Himmel. Antonia Delgado sah zu ihrem Mann in den parkähnlichen Garten des Anwesens der Fitzgeralds, das in den letzten Jahren zu ihrem Zuhause geworden war. Federico schlief in der Hollywoodschaukel. Normalerweise legte er sich erst nach dem Mittagessen für eine Stunde hin. Nicht an diesem Tag. Das Packen für den Umzug nach Mallorca schien ihn erschöpft zu haben. Vielleicht auch das Fußballspiel mit Victor. Der Achtjährige kannte seinem Großvater gegenüber keine Gnade. Ihre Schwiegertochter Adriana hatte ihn zu etwas mehr Ruhe gemahnt. Die Bitte hatte der Junge innerhalb weniger Minuten vergessen, was Federico nun den Tribut eines vorgezogenen Schläfchens kostete.
»Mamá, du solltest dich ebenfalls ein bisschen ausruhen.« Adriana war unbemerkt zu Antonia auf die Terrasse getreten. »Es ist alles abholbereit.«
Antonia fühlte sich munter. Die Aussicht, in Zukunft bei Carla zu leben, hielt sie wach. »Erst das Mittagessen.« Sie legte den Arm um ihre Schwiegertochter. »Ihr kommt uns bald besuchen?«
»Versprochen.«
Die Hoffnung, David samt Familie zu einem Umzug nach Mallorca zu überreden, hatte sie längst aufgegeben. Sie waren im Napa Valley zu Hause. July und Liam arbeiteten nicht mehr in der Bodega. Seit zwei Jahren reisten sie viel. David übernahm das Weingut der Schwiegereltern in der kommenden Saison, was die Ambitionen für ein eigenes auf Mallorca eindämmte. »Ich werde euch vermissen.«
»Wir euch auch.«
Victor jagte einer Katze hinterher, die vor ihm in die Büsche flüchtete.
»Es ist ruhig hier seit Christophers und Isabels Aufbruch nach Mallorca.« Adriana zeigte auf das Wohnhaus. »Und es wird noch weniger los sein, wenn ihr auszieht.«
Aaron und Mary lebten im Anwesen mit ihren drei Kindern. Mary begeisterte sich sehr für den Weinanbau. Gemeinsam mit Aaron würden sie die Bodega führen. Christopher stünde ihnen als Ratgeber zur Verfügung, wobei er Mary längst all sein Wissen vermittelt hatte. Als Erstgeborenem stand ihm der Grundbesitz zu, doch die Ambitionen von Antonias Schwiegersohn drehten sich darum, erfolgreich ein eigenes Weingut zu erschaffen. Nach seinen Vorstellungen. Von der Pflanzung der Zöglinge an. Isabel verstand ihren Mann, hatte seine Idee unterstützt, obwohl sie Mallorca nie gesehen hatte. Ohne zu zögern, hatte sie ihre Kinder und Sachen gepackt, war in ein Flugzeug gestiegen und mit ihrem Mann ans andere Ende der Welt gereist, wie es Antonia vor vierzig Jahren getan hatte. Nach einigen harten Zeiten hatte sie ihr Glück gefunden. In Federico.
Erst war sie ihm zuliebe in Havanna geblieben, nun begleitete er sie aus Liebe in ihre alte Heimat. Antonia blickte über die zurückgeschnittenen Weinfelder. Die einzige Konstante in ihrem Leben blieb der Wein.
»Das Mittagessen ist fertig.« David umarmte Adriana. »Papá? Kommst du?« Dann pfiff er durch die Finger.
Victor kam angerannt wie ein gut trainierter junger Hund, was Antonia laut lachen ließ. »Wenn er irgendwann apportiert, geht ihr zu weit.«
»Hol deinen Abuelo, vale?« Adriana wuschelte ihm durch das lockige Haar.
»Vale.« Er rannte los, flog förmlich die Treppenstufen in den Garten hinunter und brachte mit seinem Hechtsprung an die Sitzfläche die Hollywoodschaukel zum Schwingen. »Abuelo, aufwachen.«
Antonia wunderte sich über Federicos tiefen Schlaf.
Victor rüttelte an seinem Großvater.
Nichts.
»Nicht so stürmisch«, rief Adriana.
»Er wacht nicht auf.« Victor sah zu ihnen hinüber.
Eine kalte Angst ergriff Antonia. »Holt den Jungen.« Sie eilte zu ihrem Mann.
David begriff. Er nahm zwei Stufen auf einmal, rannte über die Rasenfläche und erreichte die Schaukel vor Antonia. »Geh zu deiner Mutter.«
»Was ist mit dem Abuelo?«
»Geh, habe ich gesagt.«
Victor gehorchte.
Antonia kniete neben der Schaukelbank nieder, strich Federico über die Wange, fühlte den Puls.
Nichts.
David wiederholte die Kontrolle. Er hielt noch den Zeigefinger unter die Nase seines Vaters. David schüttelte den Kopf. Kein wärmender Atemzug, kein Herzschlag war zu spüren.
»Soll ich den Arzt anrufen?« Victor stand bei Adriana, die besorgt zu ihnen sah.
»Er kann für Papá nichts mehr tun. Ruf ihn trotzdem.« David setzte sich neben Antonia. »Er sieht friedlich aus.«
Sie nickte.
Ihr fehlten die Worte.
Federico.
Tot.
»Ich kann es nicht glauben«, sagte David. »Noch vor einer Stunde hat er mit Victor Fußball gespielt.« Er sprach das für Antonia Unaussprechliche aus.
»Was soll ich nun tun?« Sie betrachtete die schlaffen Gesichtszüge ihres Mannes. »Wie kannst du mich allein lassen?«
David schloss sie in die Arme. »Das wirst du nie sein. Wir sind hier. Deine Familie ist immer bei dir. Ob hier oder auf Mallorca. Das verspreche ich dir.«
Antonia sah ihrem Sohn an, wie er gegen die aufsteigenden Tränen ankämpfte, während sie selbst diesen Kampf verloren hatte. Unkontrolliert liefen sie ihr über die Wangen. Trotzdem rang sie sich ein Lächeln ab. »Weinen ist in Ordnung. Auch als Mann.«
Ihre Worte ließen seinen Damm brechen. Auf der Terrasse erschienen Peter und Caroline. Entsetzen stand in ihren Gesichtern. Behutsam näherten sie sich. Fast als fürchteten sie, Federico in seinem Todesschlaf zu stören und damit böse Geister zu rufen.
Sie blieben stumm neben Antonia und David stehen, bis Doktor Porter die Treppen herunterkam. »Mein Beileid.«
»Danke.« Sie erhob sich, um dem Arzt Platz zu machen.
David reichte ihr ein blütenweißes Taschentuch, um sich die Tränen zu trocknen. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Wangen.
»Kann man feststellen, woran er gestorben ist?«, fragte Caroline.
»Gibt es einen Grund, warum Sie das fragen?« Doktor Porter öffnete seine Tasche, holte ein Stethoskop heraus und hörte den Brustkorb ab. »Ich nehme einige Untersuchungen vor, wenn Sie das wünschen.«
Es kam Antonia falsch vor. Er war mit Blick auf seinen spielenden Enkelsohn verstorben. Es gab nichts zu klären. »Nein. Tun Sie, was notwendig ist. Ich werde ihn waschen und für die Aufbahrung anziehen.«
»Lass mich dir helfen«, bot David sich an.
»Das ist Frauensache«, erwiderte Caroline.
Antonia schätzte die Gesten, doch sie wollte sich in Ruhe von ihrem Mann verabschieden. Allein. »Das übernehme ich.« Sie wandte sich an David. »Fährst du mich zum Bestatter? Um den Sarg auszusuchen und die Beisetzung zu planen?«
»Natürlich.«
Isabel würde sich vorwerfen, nicht geblieben zu sein, wie sie es angeboten hatte. Antonia hatte darauf bestanden, dass ihre Tochter dieses Mal ihren Ehemann begleitete. Eine so junge Familie sollte sich nicht über mehrere Wochen trennen. Möglicherweise war es vorherbestimmt. So erinnerte sich Isabel an ihren Vater als agilen und lebensfrohen Mann und behielte nicht das letzte Bild von ihm in einem Sarg im Gedächtnis.
Die kommende Zeit verbrachte Antonia wie durch einen Nebelschleier. Selbst der Tag der Beerdigung konnte ihr nicht vollständig die irrationale Hoffnung auf einen bösen Traum nehmen, aus dem sie nur aufwachen müsste. Jeden Morgen drehte sie sich zu seiner Bettseite. Ihre große Liebe war von ihr gegangen. Vielleicht war es gut, nach Mallorca zu gehen, wo sie so viele schöne Stunden verlebt hatten. So könnte sie die Erinnerung an ihn bewahren. Die Orte aufsuchen, die sie gemeinsam besucht hatten. Im Napa Valley gab es diese Erinnerungsorte nicht. Federico hatte die Bodega selten verlassen. Zu zweit hatten sie kaum etwas unternommen. Das hatte sich erst auf Mallorca wieder geändert. Und nun würde sie ohne ihn dort ihre letzte Lebenszeit verbringen. Doch zuvor musste sie eine Reise unternehmen. Der Jahrestag von Valentinas Tod stand an. Vor ihrem Umzug würde sie sich am Grab ihrer Tochter ebenfalls von ihr verabschieden. Von ihr und ihrem Schwiegersohn William.
Auch den Weg wollte sie allein gehen.
»Ich lasse dich ungern ohne Begleitung fliegen.« David, der sie zum Flughafen gefahren hatte, sah sie zweifelnd an.
Seit Valentinas Tod akzeptierte sie, wie wenig sie den Lauf der Welt beeinflussen konnte. Ihre Spielzeit auf Erden war endlich. Jeder Tag mit seinen Liebsten ein Geschenk. »Es ist in Ordnung.« Sie umarmte ihren Sohn. »Ich bin dankbar für alles, was mir im Leben zuteilgeworden ist. Valentina hätte ich mehr Zeit gewünscht. Mehr Zeit zum Leben und mit William.«
David sah sie nachdenklich an. »Ich hoffe, ich besitze deine Stärke.« Er drückte sie an sich, bevor sie sich aus der Umarmung lösten.
»Die hast du.« Antonia lächelte. »Ich muss los. Übermorgen bin ich wieder zurück.«
»Ich hole dich pünktlich ab. Grüße William von uns.« David winkte ihr zum Abschied.
Antonia hob die Hand, schritt durch die Sicherheitskontrolle und wurde von der Menge verschluckt. Erst jetzt ließ sie ihre wahren Gefühle zu. Ihre mühsam aufrechterhaltene Körperspannung fiel in sich zusammen wie die Kleidung einer Vogelscheuche, der man das hölzerne Gerippe entzog. Mit hängenden Schultern ging sie zum Abflugschalter und setzte sich in den Wartebereich. Die Tasche und ihren warmen Wintermantel auf dem Schoß, kauerte sie auf dem Sitz und starrte zu Boden. Natürlich hatte sie ihren Sohn nicht angelogen, sie war dankbar für all die glücklichen Tage, dennoch umklammerte die Trauer ihr Herz wie ihre Faust den Gurt ihrer Handtasche. Erst Valentina. Rodrigo blieb seit Monaten vom Erdboden verschwunden. Und nun Federico. Umso mehr sehnte sie sich danach, bei ihrer Schwester auf Mallorca zu leben. Sie noch besser kennenzulernen, nach all der verpassten Zeit. Federicos Verlust lehrte sie, nichts aufzuschieben. Kein Treffen, keine Reise, keine Liebkosung, keine Feier, auch wenn einem die Kraft fehlte. Am Ende seiner Tage bereute man nur die Dinge, die man nicht getan hatte. Ob aus Angst, Zeitmangel, Stolz oder falscher Rücksicht.
Durch die Lautsprecher hörte Antonia, dass ihr Flugzeug bereit zum Einsteigen war. Sie stand auf und reihte sich bei den wartenden Fluggästen ein. In ihrem Magen rumorte es. Alles in ihr rebellierte. Hoffentlich beruhigte sich ihr Innerstes, bis sie William traf. Auch ihm gegenüber wollte sie Stärke demonstrieren. Ihn hatte Valentinas Tod für lange Zeit aus dem Leben gerissen. Erst beim letzten Besuch in Chicago hatte er wieder lebendig gewirkt. Weit entfernt von seiner bisherigen Fröhlichkeit, aber aktiv am Leben teilhabend, was ein immenser Fortschritt war. Antonia stieg über die Gangway ein, setzte sich auf ihren Sitz und hing bis auf die wenigen Unterbrechungen der Flugbegleiterin ihren Gedanken nach. Die Maschine landete am frühen Nachmittag.
Mit einem Taxi fuhr Antonia zum Rosehill Cemetery. Den Weg zum imposanten Familiengrab fand sie umgehend. Williams Bruder lag in derselben Grabstätte wie Valentina. Beide waren im gleichen Kugelhagel gestorben, die Hinterbliebenen sollten ihnen gemeinsam an einer Stelle gedenken können. Antonia hatte John nur selten gesehen. Sie verachtete die Art, wie er sein Geld mit den illegalen Geschäften seines Vaters verdiente, dennoch konnte sie dem Jungen nicht die Schuld geben. Es war schwer, sich dem Einfluss des eigenen Vaters zu entziehen.
Er hatte seine Vergehen mit dem Leben bezahlt. Antonia trug ihm nichts nach. »Ich komme, um mich von dir zu verabschieden.« Für ein paar Minuten hielt sie eine stumme Unterhaltung mit ihrer Tochter. Schritte auf dem Kiesweg rissen sie aus ihrer Zwiesprache.
»Mutter? Was tust du hier?«
Antonia fuhr herum und blickte in die Augen von Rodrigo. »Das sollte ich dich fragen.« Glück und Wut mischten sich wie Milch in Kaffee. »Wo zum Henker hast du dich die letzten Jahre herumgetrieben?« Am liebsten hätte sie ihrem Sohn eine saftige Ohrfeige verpasst. Stattdessen zog sie ihn in ihre Arme. »Ich bin so froh, dich gesund zu sehen. Wie oft dachte ich, man hätte dich irgendwo verscharrt. Einzig der Gedanke, dass du vor Monaten Geld bei Raymundo abgeholt hast, hat mich nie die Hoffnung aufgeben lassen.«
»Mir geht es gut.« Rodrigo hielt sie fest umschlungen. »Mach dir um mich keine Sorgen.«
»Bist du im Untergrund?« Sie musterte sein Gesicht. Das dunkle Haar trug er schulterlang. Wild sah er aus. Auch der Bart schien länger nicht mehr in Form gestutzt worden zu sein.
»Wenn du es so nennen willst.« Rodrigo zog sie mit sich auf eine Bank, die am Rande des Friedhofs stand. »Irgendjemand muss ja etwas unternehmen. Sie zerstören unser Kuba. Das können wir nicht zulassen.«
»Und dennoch bist du hier. In Amerika.«
»Nur, um Valentina zu sehen.« In seiner Stimme schwang Hass mit. Sehr viel Hass.
»Versprich mir, dass du keine Dummheiten begehst.«
Rodrigo sah zu Boden. »Was für dich Dummheiten sind, ist für mich ein Kampf, um Kuba zu befreien.«
Sie verstand ihren Sohn. Die Korruption in der Regierung ließ die Bevölkerung verarmen, während die Mafia die amerikanische Upper-Class mit Casinos und Nachtklubs auf die Insel lockte. Trotzdem verrannte er sich in eine fixe Idee, die nichts mit seinem Leben zu tun hatte. »Du kannst dich auf Kuba frei bewegen, hast durch das Weinfeld dein Auskommen. Was willst du mehr?«
»Gerechtigkeit.« Er reckte sein Kinn. »Die Amerikaner müssen aus Kuba verschwinden, bevor sie uns alles nehmen.«
Antonia konnte seine Gedanken kaum nachvollziehen. »Was haben sie dir genommen?«
»Valentina.« Er klopfte auf sein Bein. »Meine Ehre. So behandelt man Menschen nicht.«
»Du hast dich mit den falschen Personen umgeben. Wie Valentina.« Wie sollte sie ihm den Unterschied nur klarmachen? Jeder trug seine eigene Schuld mit sich herum. Rodrigo schob sein Unglück anderen unter, dabei war es seine freie Entscheidung gewesen, in diesen Rennwagen zu steigen. »Sponsoren sind keine Freunde. Die Fitzgeralds schon. Und Valentinas Mann ist ebenfalls ein Ehrenmann. Er schaffte es, sich von seinem Vater abzuwenden und Gutes zu bewirken. Zusammen mit Valentina.« In dem Moment schnitt ihr ein brennend heißer Gedanke ins Gedächtnis. Rodrigo wusste nichts vom Tod seines Vaters.
»Will.« Ihr Sohn schnaubte unwillig auf. »Der hat nur ein paar Fäden durchgeschnitten. Trotzdem bleibt er die Marionette seines Vaters.«
»Cariño, komm mit mir nach Mallorca. Zu deiner Familie. Du musst nicht auf Kuba bleiben.« Vielleicht gelang es ihr, ihn zu überreden. »Du könntest auf Mallorca ein neues Leben beginnen. Dir etwas aufbauen. Heiraten.«
»Was soll ich da? Ich kenne dort niemanden.« Rodrigo küsste seine Fingerspitzen und tippte sie auf die Steinplatte mit Valentinas Namen. »Außerdem bin ich in Havanna Verpflichtungen eingegangen.«
»Und weshalb bist du hier?«
Rodrigo sah schweigend zu Boden. »Ich wollte mich von ihr verabschieden. Das bin ich meiner Schwester schuldig.«
Er war der Beerdigung ferngeblieben. Wie auch Isabels Hochzeit.
»Bevor ich mich dem Widerstand anschließe.«
Antonia sah ihn flehend an. »Tu das nicht. Das nimmt kein gutes Ende.«
»Prío Socarrás hat sich die Taschen vollgestopft und lebt wie ein König in Miami.«
Antonia hatte gehört, dass sich der Socarrás nachfolgende Präsidentschaftskandidat Eduardo Chibás während seiner wöchentlichen Radiosendung vor den Ohren aller Zuhörer durch einen Schuss tödlich verletzte, um einen Aufstand anzuzetteln, der jedoch im Wahlergebnis dem Gegner in die Karten gespielt hatte. Ihr Sohn hatte Chibás aufgrund seiner kommunistischen Ansichten verehrt. Batista putschte erfolgreich drei Monate später und unterdrückte seither die Einheimischen. Prío Socarrás musste nach dem Putsch durch Batista fliehen. »Du willst zum ehemaligen Präsidenten?«
»Ja. Er hasst Batista.« Er zuckte die Schultern. »Die Feinde des Feindes sind Freunde. Er wird uns unterstützen, Batista loszuwerden.«
»Du irrst. Er wird dir kein Gehör schenken.« Antonia fürchtete, er könnte diesen Aktionismus nicht überleben.
»Versteh doch, wenn die Gesetze nicht greifen, muss man selbst handeln. Fidel Castros Klage gegen die Putschisten wegen Verfassungsbruch wurde abgewiesen. Wie zuvor die Klage gegen Prío.« Er schüttelte den Kopf. »Wenn wir nichts unternehmen, richten die Amerikaner uns zugrunde.«
»Dich nicht. Du hast dein Auskommen.« Antonia versuchte, ihren Sohn mit vernünftigen Argumenten umzustimmen.
»Du kannst mich nicht aufhalten.« Er zögerte einen Moment. »Ich bin mit einer Frau hier. Mit Yeyé.«
»Mit Heydée Santamaría? Die Tochter von Benigno? Dem Zuckerrohrbauer aus Pinar del Río? Der uns bei der Tabakernte geholfen hat?« Die Kinder hatten damals zusammen im Dorf gespielt. Das lag lange zurück. »Wie habt ihr euch wieder getroffen?«
»In Havanna letzten August. Bei der Gedenkfeier von Eduardos Todestag. Yeyé ist eine mutige Frau, an der sich viele ein Beispiel nehmen sollten. Abel ist ihr Vorbild.«
»Ihr eigener Bruder zieht sie in den Kampf hinein?« Blankes Entsetzen breitete sich in Antonia aus. »Warum?«
»Weil sie beide wissen, dass es richtig ist.«
Der Stolz, der in seiner Stimme mitschwang, ängstigte sie. Ihr Sohn war zu einem Fanatiker geworden. »Rodrigo, warum tust du das?«
»Weil es sonst niemand tut.« Er sah sich um. »Warum ist Vater nicht hier?«
Nun blieb ihr keine Möglichkeit, die Nachricht länger zurückzuhalten. »Dein Vater ist vor zehn Tagen gestorben. Ich habe dir ein Telegramm schicken lassen. Raymundo wird es auf den Küchentisch zu allen anderen Briefen gelegt haben.«
»Vater ist tot?« Aus seinem Gesicht wich jegliche Farbe. »Wie?«
»Er ist in der Hollywoodschaukel eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Wir hatten beschlossen, nach Mallorca zu ziehen. Kalifornien ist mir fremd.« Antonia kämpfte mit sich. »Familie ist wichtig. Darum hätte ich dich gerne bei mir. Begleite mich. Tu es für Vater.«
»Er hat den Lebenswillen verloren. Nach Valentinas Tod war er nicht mehr derselbe.« Eine heftige Wut kochte in ihrem Sohn hoch. Auf der zuvor bleichen Gesichtshaut tauchten rote Flecken auf, die sich wie ein ausgegossenes Glas Rotwein auf einer blütenweißen Damasttischdecke abzeichneten. »Cunningham. Er trägt die Schuld an Papás Tod. Er würde noch leben, gäbe es dieses miese Schwein nicht. Erst hat er uns Valentina genommen und nun Vater!« Er wandte sich um, wollte vor ihr davonlaufen.
Sie griff nach seinem Handgelenk. »Bleib hier. Beruhige dich. Cunningham hat mit Vaters Tod nichts zu tun.«
»Und ob er das hat.« Er riss sich los und stürmte davon.
»Rodrigo!«
Ihre Rufe ignorierend, rannte er vom Friedhof. Antonia hörte eine Autotür knallen und ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen davonfahren.
Resigniert sackte sie in sich zusammen. »Ach, mein Mädchen. Wann ist die Welt so kompliziert geworden?« Sie zupfte am Rand der Grabstätte Unkrauthalme aus der Erde. »Es ist an der Zeit, in die kleine Welt meiner alten Heimat zurückzukehren. Dir hätte es gefallen.« Sie ließ das Unkraut fallen und trat zwei Schritte zurück. »Ich werde nun gehen. In Gedanken wirst du mich ewig begleiten.« Ob sie ihren Sohn wiedersehen würde? Oder war dies hier ein Abschied für immer gewesen?
Erneut hörte Antonia Schritte. Sie fuhr herum.
»Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen.« William stand neben einer hübschen Dame auf dem Weg. Die Frau sah zu Boden.
»Ich lasse euch allein.« Die Fremde drehte sich um.
Antonia wollte wissen, wer die Fremde am Grab ihrer Tochter war. »Bleiben Sie. Wer sind Sie?«
»Hope Snider.« Sie wandte sich ihr zu und gab ihr die Hand. »Buchhändlerin. Eventuell hat Ihre Tochter von mir erzählt.«
»Das hat sie.« Antonia reichte ihr ebenfalls die Hand. Sie erinnerte sich, mit welcher Begeisterung sich Valentina in ihr Hilfsprojekt für Waisenhäuser gestürzt und von Hope Sniders Unterstützung geschwärmt hatte.
Will umarmte Antonia herzlich. »Kommt ihr zum Essen?«
Irritiert schwieg sie. William wusste noch nichts vom Tod seines Schwiegervaters. Sie hatte es ihm persönlich sagen wollen. »Federico ist tot. Ich bin ohne ihn hier.«
»Wann? Wie?« William sah ihr fest in die Augen. »Es tut mir unglaublich leid. Ich habe ihn sehr gemocht.«
»Ich weiß.« Es war die Wahrheit. Ihr Mann hatte seinen Schwiegersohn gern gehabt, obwohl seine Familie Unglück über sie gebracht hatte. »Nun werde ich ohne ihn zurück in meine Heimat gehen. Er ist friedlich eingeschlafen.«
»Es ist gut, dass du gehst. Du musst auch keine Rücksicht auf mich nehmen.« William fasste sie an den Schultern. »Das Zimmer im Hotel ist vorbereitet. Essen um acht Uhr? Ich möchte etwas mit dir besprechen.«
»Meinetwegen.« Antonia ließ sich überreden. »Wenn du mich noch einen Moment alleine lässt.«
»Ich war heute Morgen schon hier.« Er zeigte auf die roten Rosen.
Antonia zählte zehn Stück. Für jedes Ehejahr eine. »Das habe ich gesehen. Und trotzdem bist du nochmals hier.«
»Ich habe Valentina geliebt. Mehr als mein Leben. Das weißt du.«
Antonia schnitten seine Worte ins Herz. »Du musst sie gehen lassen. Mit deinem Leben weitermachen.«
William suchte Hopes Blick. Sie legte den Kopf schief, als würde sie eine Entscheidung abwägen, bevor sie sanft nickte. »Antonia, das tue ich bereits. Hope und ich … wir haben in unserer Trauer zueinandergefunden.«
Hatte Valentina nicht gesagt, Hope hätte einen Mann mit zwei Kindern geheiratet? »Das ist schön. Erzählt mir davon beim Abendessen, ja?«
»Du bist damit einverstanden?« Die Erlösung in Hopes Stimme war deutlich zu hören.
Antonia lächelte. »Valentina würde sich für euch freuen.«
»Das glaube ich auch«, bestätigte Hope. »Sie hat mir einen guten Mann gewünscht. Meine erste Wahl zeigte sein hässliches Gesicht erst nach der Hochzeit.«
William nahm Hopes Hand. »Er hat sie geschlagen. Das konnte ich nicht zulassen.«
Ihr Schwiegersohn beschützte Valentinas beste Freundin, nachdem ihre Tochter es nicht mehr konnte. Antonia dachte an ihren ersten Mann Mateo. »Es gibt Entscheidungen im Leben, die muss man korrigieren.«
Die Erleichterung in ihren Mienen bewies Antonia, wie sehr sie mit sich gerungen hatten. William bot Hope den Arm an. »Danke, Antonia. Dein Verständnis erleichtert mich.«
»Du hast verdient, glücklich zu sein.« Sie sah von ihm zu ihr. »Ihr habt es verdient.« Beide leiteten die Stiftung in Valentinas Namen. Was sollte sie mehr erwarten?
»Dann bis um acht.« William verließ die Grabstätte.
Für einige Sekunden blickte sie dem Paar hinterher, bevor sie sich abwandte. »Bist du einverstanden?«
Antonia lauschte tief in sich hinein, suchte nach der Stimme Valentinas, glaubte sie zu vernehmen. Wie sie ihre Tochter kannte, wäre sie zufrieden mit Williams Wahl. Die Menschen, die ihr am nächsten gestanden hatten, würden das Andenken an sie weitertragen. Ihr Name stünde weiterhin in Chicago für Hilfe für Kinder in Not.
Antonia zupfte das letzte Unkraut aus der Erde, unterhielt sich mit Valentina, bevor sie sich von ihr verabschiedete. Den Weg zum Hotel legte sie zu Fuß zurück. Die kleine Reisetasche wog leichter als ein Federbett, denn sie brauchte für diesen Aufenthalt nur wenig. Sie schlenderte durch den Park vor dem Hotel am See entlang. Setzte sich auf die Holzbank, auf der sie mit ihrer Tochter in die Sonne geblinzelt hatte, bevor sie in Wills Geschäft für Federico Hemden und Krawatten erstanden hatte. Nur einige Jahre lagen dazwischen, und doch kam es ihr vor wie aus einem anderen Leben. Die Luft war winterlich kalt. Es roch nach Schnee. Erst jetzt bemerkte sie, wie sie fror. Sie stand von der Bank auf, schlug den Mantelkragen hoch und bezog ihr Hotelzimmer. Eine warme Badewanne entspannte ihre durchgefrorenen Glieder.
Pünktlich um acht Uhr betrat sie den Speisesaal. William begrüßte sie, führte sie an die Bar. »Setz dich.«
Antonia nahm Platz.
William nippte an einem Glas Whisky. Er trank selten. »Du wolltest mir etwas sagen. So schwer wird es nicht werden.«
»Es geht nicht um Hope.« Er zog sich einen Barhocker heran. »Zwischen ihr und mir ist es anders als mit Valentina und mir.«
Den Unterschied kannte sie. Mateo hatte sie geglaubt zu lieben, Federico hingegen geliebt. Die Nuance fühlte man erst, wenn man wahrhaftig liebte. Das hatte William getan. Ob er Hope jemals so lieben würde? Sie wünschte es ihm. Und Hope. »Das verstehe ich. Du musst dich nicht entschuldigen.«
»Das tue ich auch nicht.«
»Was ist dann?« Antonia ließ ihren Whisky unberührt stehen.
Er schien sich sammeln zu müssen. Auf Wills Gesicht spiegelten sich widersprüchliche Gefühle. »Mein Vater. An Valentinas und Johns Todestag hasse ich ihn noch mehr.«
Antonia schwieg. Dem Mann, der so viel Leid über seine eigene Familie und die ihre gebracht hatte, wünschte sie ebenso wenig Gutes wie sein eigener Sohn. Er hätte sterben sollen. Vor vier Jahren. Nicht Valentina. Oder John. »Es tut mir leid für dich.«
»Mir nicht. Er war mir nie ein guter Vater.« Will stürzte den Whisky hinunter. »Niemals werde ich seine Geschäfte weiterführen. Nach seinem Tod werde ich seine Hotels und Casinos verkaufen. Hope wird mir helfen, mit dem Geld den Menschen in Chicago etwas zurückzugeben. Vielleicht gründen wir eine Entzugsklinik. Ich weiß es nicht.« Er bestellte einen weiteren Whisky.
Antonia schob ihm ihr Glas zu. »Für mich bitte Rotwein.«
Sie betrachtete ihren Schwiegersohn. »Wie geht es deiner Mutter?«
»Sie hofft heimlich seit Jahren auf seinen Tod.« Will nippte an seinem Getränk. »Mutter weiß, dass ich ihr Haus erst wieder betrete, wenn mein Vater tot ist. Irgendwann wird ihn eine Kugel niederstrecken.«
Der rauchige Whiskygeruch stieg Antonia in die Nase.
Er sah an ihr vorbei. »Hope kommt.«
Hope setzte sich zu ihnen. »Wollen wir nun essen?«
»Gerne.« Antonia erhob sich. Weder ihr noch Will schien das vorangegangene Gespräch auf den Magen geschlagen zu sein. Im Gegenteil. Sie aßen mit Appetit. Der Abend stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Neuanfänge.
2
Selten kochte die Wut in Rodrigo hoch wie in diesem Moment. Seine trauernde Mutter an Valentinas Grab anzutreffen, ließ seinen Zorn anschwellen wie eine Springflut. Cunningham trug die Schuld am Unglück seiner Familie. Er und die Amerikaner, die sich auf Kuba bereicherten. Wie sollte seine Mutter seine Not verstehen? Die Amerikaner nahmen ihm alles. Seinen Erfolg, seine Karriere, seine Familie, seine Geschäfte, seine Ehre. Er wollte nicht mehr geben. Es war Zeit, die Ausbeutung zu stoppen und sich alles zurückzuholen. Für sich und seine Landsleute.
Für Yeyé.
Und ihren Bruder Abel.
Seit Rodrigo Yeyé kannte, besaß sein Leben wieder einen Sinn. Die Zusammenkünfte im Quartier 603, wo sie die Artikel für den El Acusador verfassten, schenkten ihm Hoffnung. Die Geschwister machten ihm Mut, obwohl die Verbreitung der Zeitung gefährlich war. Trotzdem unterstützte er die beiden und den Anwalt Fidel Castro. Yeyé hatte die verwegene Idee, direkt den ins Exil geflohenen Präsidenten Prío Socarrás um Hilfe zu bitten. Deshalb weilte Rodrigo in den Vereinigten Staaten. Die einmalige Gelegenheit, sich von seiner Schwester zu verabschieden, hatte er nicht ungenutzt lassen können.
Das Zusammentreffen mit seiner Mutter zerrte an seinem Gewissen. Er liebte sie, aber sie verstand ihn nicht. Das hatte sie nie getan. An manchen Tagen schaffte er es selbst nicht. Noch weniger, wenn er an seine Zeit als Rennfahrer zurückdachte. Dieses oberflächliche Leben, das ihm einst so schillernd und verlockend erschienen war, lenkte vom echten Dasein ab. Freundschaften existierten nicht. Alle hatten ihn fallen gelassen. Seine jetzigen Kameraden würden das nie tun. Das hatte Abel erfolgreich bewiesen. Selbst unter der Folter hatten einige Mitkämpfer geschwiegen, niemanden verraten. Bis hin zur Exekution. Yeyé schwor Rache für die Verbrechen an ihren Freunden. Rodrigo bewunderte sie dafür.
Wie sollte seine Mutter das verstehen? Sie lebte ihr behütetes Leben. Immer schon. Hätte sie schwere Zeitspannen durchstehen müssen, würde sie anders über die Lage auf Kuba denken. Oder über die Amerikaner. Er verachtete sie. Fast alle. Und Cunningham würde nun seinen Zorn zu spüren bekommen. Er würde ihm die Nase brechen und die Zähne ausschlagen.
Rodrigo lenkte den Wagen in Richtung Cunninghams Villa. Er fuhr am Stadtpark vorbei. Die Dämmerung brach herein. Trotzdem erkannte er zweifelsohne den Mann, der ihm auf dem Gehweg entgegenkam. Feinster Zwirn, edler Hut, eleganter Gehstock. Mit arroganter Miene führte er den Hund spazieren. Einen ausgewachsenen Dobermann. Mit dem Tier an seiner Seite fühlte er sich sicher. Die Art wie Cunningham stolz den Kopf reckte, ließ in Rodrigo einen Damm brechen, der wie eine Springflut mit einer Hasswelle über ihn hinwegrollte. Er hörte den Motor aufheulen, sah nicht, wohin er steuerte. Rodrigo spürte lediglich den harten Aufprall, vernahm einen grellen Schrei, gefolgt von einem dumpfen Schlag, bevor er sich mit dem Fahrzeug ohne einen Blick in den Rückspiegel entfernte. Menschen riefen um Hilfe.
Rodrigo setzte seinen Weg fort. Die alles verschlingende Welle ebbte ab und gab einer tiefen Zufriedenheit Platz. Ein paar gebrochene Knochen waren für Cunninghams Schuld ein viel zu geringer Preis.
Nach langer Fahrt in Richtung Süden hielt er in Jacksonville in einer Seitenstraße und schlief zwei Stunden.
Bei Sonnenaufgang fuhr Rodrigo an eine Tankstelle. Der Mitarbeiter tankte den Wagen voll. Rodrigo bezahlte. »Wo kann ich ein Bärenfell kaufen?«
Der Tankwart rieb sich über das Kinn. »Vielleicht hat Mitchell eines. Wobei die sehr begehrt sind.«
»Wo finde ich diesen Mitchell?«
Der Mann erklärte ihm den Weg. Die Farm lag außerhalb, was Rodrigo entgegenkam. Ein Mann führte ein Pferd von der Koppel. »Sind Sie Mitchell?«
Der Kerl spuckte etwas Undefinierbares aus. »Wer will das wissen?«
»Einer, der ein Bärenfell sucht. Haben Sie eines?« Rodrigo stieg aus dem Wagen und lehnte sich an den Koppelzaun.
Ein zustimmendes Grunzen. »Schwarzbär. Es hat mehrere Einschusslöcher. Ein Stümper. Deshalb liegt es noch hier. Wenn Sie das nicht stört.«
»Nein. Das wird vor dem Kaminfeuer niemand entdecken.« Rodrigo hatte nicht vor, das Fell an irgendeinem Kamin auszulegen. Sein Plan sah ganz anders aus.
Mitchell band die Fuchsstute am Zaun fest. »Kommen Sie mit.«
Sie wurden sich schnell einig. Der geforderte Preis war aufgrund der mangelnden Qualität gering. Rodrigo bezahlte. »Danke. Da wird sich meine Frau freuen.«
Mitchell hustete. »Dann haben Sie eine besondere Frau zu Hause. Die meisten wollen so ein Ding nicht im Wohnzimmer.«
»Meine schon.« Mühsam verstaute Rodrigo das Fell mit dem Bärenschädel daran im Kofferraum. Sein Bein schmerzte unter dem Gewicht.
Rodrigo hupte zum Abschied und fuhr vom Hof. Er suchte sich ein abgelegenes Waldstück, parkte, packte den Pelz aus und ging nach vorn. Der Schaden am rechten Kotflügel und der Motorhaube war beträchtlich. Er schlug das Fell mehrfach gegen den Wagen, rieb die Haare an die verbeulten Stellen, an die Stoßstange, bis er glaubte, genug Fellbüschel verteilt zu haben, um einen nächtlichen Unfall mit einem Bären vorzutäuschen. Der zerbrochene Scheinwerfer hielt die Bärenhaare am besten. Zufrieden mit seinem Werk, warf er den minderwertigen Pelz in den Wald und begab sich auf den Weg nach Miami, wo Yeyé in Fort Lauderdale auf ihn wartete. Es verwunderte Rodrigo wenig, dass Prío Socarrás nicht bei seinen Mitbürgern in Little Havanna lebte, sondern sich unter die Amerikaner mischte, wo er keine Feinde befürchten musste.
Das Riverside Hotel in Fort Lauderdale kostete ein Vermögen, aber so konnten sie sich unauffällig zwischen den Reichen bewegen, um keinen Verdacht zu erwecken. Das beliebte Hotel war von zwei Brüdern aus Chicago gegründet worden, die es nach einem Fischerurlaub eröffnet hatten. Rodrigo lernte Preston Wells am Tag ihrer Ankunft in der Lobby kennen. Der kannte Valentina und ihren Mann, er wusste auch um das Schicksal von Rodrigos Schwester. Das Zusammentreffen mit ihm hatte in ihm den Wunsch geweckt, sich von Valentina zu verabschieden, bevor er in den Kampf zog. Preston hatte Rodrigo spontan seinen Wagen für diesen Besuch geliehen. Rodrigo hatte ihm gegenüber Flugangst vorgegeben. Angst hatte er. Jedoch nicht vor dem Fliegen. Vielmehr davor, von den Häschern Batistas gefasst zu werden, da sie die Flugzeuge auf Kollaborateure kontrollierten.
Die Wells-Brüder kannten die Guerrera-Stiftung aus Chicago. Ihr Vater ging jährlich in der Weihnachtszeit zur Spendengala. Seither genossen Rodrigo und Yeyé jegliche Annehmlichkeiten auf Kosten des Hauses. Während Rodrigo der Bevorzugung mit gespaltenen Gefühlen gegenüberstand, wertete Yeyé die Vorzüge als eine Spende für ihre gute Sache.
Rodrigo stellte das Fahrzeug auf dem Hotelparkplatz ab.
»Ist Preston Wells zu sprechen?« Den Schaden wollte er umgehend melden und die Bezahlung für die Reparatur anbieten.
»Moment, Mr. Guerrera.« Der Rezeptionist erkundigte sich per Telefon, lächelte Rodrigo an. »Er empfängt Sie in seinem Büro.«
»Vielen Dank.« In wenigen Augenblicken wäre er den Buick los, und niemand würde ihn mit dem Unfall in Chicago in Verbindung bringen. Cunningham würde nicht ruhen, den Fahrer ausfindig zu machen, sobald er sich von seinen Verletzungen erholt hatte. Davon war Rodrigo überzeugt. Gesehen konnte er ihn nicht haben. Den Wagen würde er niemals finden.
»Rodrigo! Welche Freude! Du bist schon zurück?« Preston erhob sich hinter seinem Schreibtisch.
»Ja, der Besuch am Grab war kurz. Die Kälte hat mich rasch vertrieben. Und ich fahre gerne schnell Auto. Das weißt du ja.« Rodrigo spielte auf seine frühere Karriere an. »Leider zu schnell. Ich habe einem Bären das Fell abgezogen. Für den Schaden komme ich selbstverständlich auf.«
Preston zog die Augenbrauen hoch. »Der Buick fährt noch?«
»Natürlich. Er steht auf dem Parkplatz.« Rodrigo wies aus dem Fenster. »Willst du ihn dir ansehen?«
»Nein. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. So habe ich nun eine tolle Geschichte, die ich zum Besten geben kann.« Er schlug ihm jovial auf die Schulter. »Lass uns einen Drink nehmen. Erzähl mir von der Fahrt.«
»Da gibt es nicht viel zu sagen.« Die Einladung zum Drink nahm er dennoch an. Den konnte er gut vertragen. So glimpflich davonzukommen, erleichterte ihn sehr. Vermutlich hätte er das Bärenfell zur Vertuschung gar nicht benötigt. Preston schien der Schaden nicht zu ärgern. Rodrigo sah es in diesem Fall wie Yeyé. Eine Spende im Kampf gegen das Unrecht.
Nach einer Dusche und einem Kleidungswechsel ging er hinüber zu Yeyés Hotelzimmer und klopfte an.
Die Tür schwang auf. Sie sah ihn überrascht an. »Mit dir habe ich nicht vor morgen gerechnet. Komm rein.«
»Die Fahrt ging schneller als erwartet.« Er betrat das Zimmer und setzte sich hinaus auf die Terrasse. Der Blick raubte ihm erneut den Atem. Ein üppig angelegter Palmengarten, dahinter der dunkelblau in der Sonne schimmernde Fluss. Ein Raddampfer lag an der gegenüberliegenden Anlegestelle. Der Wind wehte die Trompetenklänge der Livemusik herüber. »Hast du in der Zwischenzeit etwas erreicht?«
»Nein. Er gibt uns keinen Termin.« Yeyé holte sich aus dem Barfach eine Cola und goss sich großzügig Rum dazu ins Glas.
»Mierda.« Rodrigo fuhr sich über den Bart. »Wir müssen mit Little Havanna anfangen. Ich besitze Adressen von Exilkubanern, die unsere Sache unterstützen. Eventuell weiß jemand von ihnen, wie man an Prío herankommt.«
»Er muss ein Interesse daran haben, Batista loszuwerden!«
Rodrigo hatte fest mit den finanziellen Mitteln von Prío gerechnet. »Wenn er uns nicht jetzt unterstützt, dann vielleicht später.«
Das tat er nicht.
Unverrichteter Dinge, was Prío anbelangte, aber mit einigen Tausend Dollar an Spendengeldern reisten sie per Schiff zurück nach Kuba. Unbehelligt erreichten sie im Morgengrauen den kleinen Hafen von Mantanzas, wo ein Wagen auf sie wartete und sie in die Wohnung in Vedado fuhr. Die Universität lag in unmittelbarer Nähe, was die Verteilung ihrer Schriftstücke in Havannas Studentenviertel beträchtlich erleichterte. Abel führte das Studium trotz der Widerstandsarbeit und seiner Stelle bei Pontiac fort. Rodrigo sah zu ihm auf. Der Mann schien keinen Schlaf zu brauchen.
Im Apartment trafen sie auf Abel, der, gebeugt über die Schreibmaschine, eine weitere Schrift verfasste. »Ihr seid zurück. Lief alles gut?«
»Wie man es sieht.« Yeyé warf ihre Tasche auf den abgewetzten Sessel und ging zur Küchenzeile, um Kaffee zu kochen. »Prío ziert sich. Ihm scheint der Sinn nicht nach Rache zu stehen.«
»Das kommt«, mutmaßte Abel. »Es liegt viel Arbeit vor uns.« Er wandte sich an Rodrigo. »Du solltest einige Zeit untertauchen. Man fragt hier zu oft nach dir. Fahr auf dein Weinfeld, und verhalte dich ruhig. Wir holen dich, sobald es losgeht.«
»Ich soll mich verstecken?« Rodrigo wollte nicht gehen. Was sollte er auf dem Feld? »Und was ist mit euch?«
»Nach uns hat niemand gefragt. Gib vor, ein zufriedenes Leben in Viñáles zu führen, so wie du es tun würdest, wenn du unpolitisch wärst. Und akquiriere unter den Bauern weitere Leute, die sich unserer Partei anschließen wollen. Wir brauchen jeden Einzelnen.«
»Gut. Ich will euch nicht in Gefahr bringen.« Nur deshalb würde er sich für ein paar Wochen zurückziehen. »Ich möchte aber mehr tun, als die Campesinos zu überzeugen.«
»Dann sammle Spenden. Für den Aufstand benötigen wir Waffen. Die kosten Geld.« Abel stand auf, klopfte ihm freundschaftlich auf die Schultern. »Wir sehen uns bald, Kamerad.«
Stolz, der Partei anzugehören und seinen Beitrag leisten zu können, verabschiedete er sich von den Geschwistern. Yeyés Nähe würde er vermissen. Die Frau gefiel ihm, obwohl sie zwei Jahre älter war als er. Ihre kräftige Nase passte zu ihrer Tatkraft, der Pagenschnitt schmeichelte ihrer Kinnlinie. Der rote Lippenstift gab ihr etwas Sinnliches. Rodrigo hatte sie schießen sehen. Sie stellte die Trefferquote vieler Männer in den Schatten. Er wollte zu Hause üben. Es konnte nicht angehen, dass eine Frau besser schoss als ein Mann. Nicht treffsicherer als er. »Holt mich, sobald ich euch behilflich sein kann. In der Zwischenzeit rekrutiere ich weitere Cubanos.«
»Ausgezeichnet.« Abel drückte Rodrigo kurz an sich, bevor er sich von ihm löste. »Nimm den nächsten Zug. Ich weiß, wo ich dich finde.«
Mit einer Umarmung verabschiedete sich Rodrigo von Yeyé. »Pass auf dich auf.«
Sie lächelte, als wollte sie sagen, das täte sie immer.
Er verließ die Wohnung, stoppte ein Taxi und ließ sich zum Bahnhof fahren, wo er den Zug nach Pinar del Río bestieg. Die kommenden Stunden zogen die sanften Hügel des Tals von Viñales an seinem Fenster vorüber. Dazwischen ragten hin und wieder die weit über die Landschaft verstreuten Mogotes auf. Die Kegelkarstberge verhießen die baldige Ankunft. Die milde Januarluft wehte den Duft von sattem Grün ins Wagoninnere. Es musste vor Kurzem geregnet haben. Der Geruch verriet es Rodrigo. So roch für ihn Heimat.
Für die Weiterfahrt wartete er nicht auf einen Bus, sondern ließ sich von einem Jugendfreund mit der Pferdekutsche bringen. »Wie läuft es hier?«
Berto schnalzte mit der Zunge. »Gar nicht. Es gibt wenig Arbeit. Wie immer.«
»Schließ dich uns an.«
»Unmöglich. Meine Familie braucht mich, wenn ich erschossen werde, sterben auch sie. Das kann ich nicht verantworten.« Sein Freund aus Kindertagen starrte stumpf vor sich auf den Weg. Er schien älter, als er es an Jahren vorweisen konnte. Die Not mergelte die Menschen aus.
Rodrigo verstand ihn nicht. »Willst du für deine Kinder das gleiche Elend? Für deine Enkelkinder?«
»Ich bin kein mutiger Mann.« Er sah kurz hoch. »Und du solltest es auch lassen. Du hast doch alles, was man für ein glückliches Leben benötigt.«
»Ich will die Amerikaner von der Insel haben.« Sie näherten sich dem neuen Wohnhaus auf dem Weinfeld. Aus dem ehemaligen Wohngebäude stieg Rauch auf. Raymundo musste zu Hause sein. Die Dämmerung brach bereits herein. »Vorher wird der Hunger auf dem Land nicht enden. Das ist meine Menschenpflicht. Gerade weil ich ein Auskommen habe, muss ich diesen Kampf unterstützen.«
Berto sah ihn verständnislos an. »Was haben die Amerikaner damit zu tun? Unsere Politiker sind korrupt.«
Es war müßig, mit Berto darüber zu sprechen. Er begriff die Zusammenhänge nicht. »Alles. Wenn sie nicht bestechen, um unbehelligt in Havanna ihrem Vergnügen nachzugehen, würde es uns besser gehen.«
Sein alter Freund brummte. »Als ob das Geld dann bei uns ankommen würde.«
Rodrigo hüpfte vom Kutschbock. »Danke fürs Fahren. Willst du noch auf ein Cerveza reinkommen?«
»Nein, kein Bier. Ich muss zurück.« Berto tippte sich an den Strohhut, wendete den Pferdewagen und begab sich auf den Rückweg.
Seine Reisetasche ließ Rodrigo auf der Veranda stehen. Er sperrte die Tür auf, schaltete das Licht an und öffnete die Fenster, um die kühle Abendluft ins Haus zu lassen. Raymundo kümmerte sich um das Anwesen. Das sah man ihm an. Obwohl er seit mehreren Monaten nicht hier gewesen war, roch es frisch, kein Staubkorn bedeckte die Möbel. Einzig der Kühlschrank war ausgesteckt, da er bis auf ein paar Bierflaschen leer war. Rodrigo nahm sich ein lauwarmes Bier und steckte den Stecker ein. Der Motor brummte, und das Licht leuchtete auf. Er schloss die Tür. Bis er am kommenden Tag einkaufen ginge, wäre der Schrank heruntergekühlt. Dieses Mal lohnte es sich, nicht wie sonst, wo er nur kurz kam, die Briefe las, das Geld einsteckte und sich meist unbemerkt wieder verdrückte.
Mit dem Bier in der Hand setzte er sich an den Küchentisch. Zwei Telegramme lagen obenauf. Die Nachricht seiner Mutter zum Tod des Vaters. Er legte es beiseite und öffnete das zweite: William Cunningham senior tot – Unfall – Mutter
Für einen Moment stolperte sein Herzschlag. Tot? Damit hatte er nicht gerechnet. Er hatte ihn verletzen wollen, das ja, aber töten? Die Nachricht verschaffte ihm keine Genugtuung, keine Erleichterung, auch kein schlechtes Gewissen. Cunninghams Tod berührte ihn nicht.
Die Kuverts sortierte er nach Datum. Alle von seiner Mutter. Fünf Stück, im Rhythmus von acht Wochen schrieb sie ihm, obwohl sie nie eine Antwort von ihm erhielt. An manchen Tagen plagten ihn Schuldgefühle, auf der anderen Seite konnte er ihr keine Briefe schicken, um sie wissen zu lassen, wo er sich aufhielt. Es würde ihn und seine Kameraden in Gefahr bringen.
Sie berichtete, wie schön es auf Mallorca gewesen war, von der Familie und den Weinfeldern dort. Oder wie Tante Carla auf der Messe in Barcelona Isabel und Christopher kennengelernt hatte, und auch von dem geplanten Umzug nach Spanien. Rodrigo trank einen Schluck, lehnte sich zurück und überlegte. Er wollte für seine Mutter einen Brief verfassen, ihr vom Weinanbau erzählen, davon, dass er sich nun um die Felder kümmerte. Das würde sie erleichtern, obwohl er nicht vorhatte, seine ursprünglichen Pläne aufzugeben. Aber besser, er verschwieg diesen Punkt. Die Adresse auf Mallorca lag vor. Dorthin konnte er schreiben, wenn er die Umschläge direkt bei der Post aufgab. Sie hatte verängstigt ausgesehen, ihn angefleht, mit ihr zu reisen. Er musste sie beruhigen. Zufrieden mit dem Entschluss, leerte er sein Bier.
»Rodrigo? Bist du das?« Raymundos Stimme drang ins Innere.
»Ja, ich bin hier.« Er stand auf. »Komm herein.«
Raymundo betrat das Haus. In der Eingangshalle trafen sie aufeinander. »Ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Dein Bart ist sehr lang.«
Mit der rechten Hand rieb sich Rodrigo darüber. »Er ist etwas aus der Form geraten. Das ändere ich.«
»Das würde ich dir empfehlen, sonst siehst du aus wie einer der Revolutionäre.« Raymundo ging hinaus auf die Veranda.
Die untergehende Sonne ließ die Kuppen der wie Würfel hingeworfenen Mogoteshügel feuerrot leuchten. »Was weißt du schon davon?«
»Weit mehr, als du denkst.« Raymundo zeigte auf das ursprüngliche Haupthaus, das er mit seiner Familie bewohnte. »Meine Frau hat gekocht, und ein kaltes Cerveza erwartet uns dort ebenfalls.«
Rodrigo nahm das Angebot an.
Nach dem Abendessen saßen die Männer bei einem kühlen Bier auf der Terrasse und lauschten in die Dunkelheit. Rodrigo vermochte nicht, seine Neugierde zu zügeln. »Wie hast du das vorhin gemeint?«
Raymundo schwieg einige Sekunden. »Du bist Mitglied in der orthodoxen Partei?«
»Seit drei Jahren, warum fragst du?« Er kannte Raymundo unpolitisch, er sprach nie über seine Einstellung. Im Grunde wusste Rodrigo nichts über den Mann, der seit Jahren sein Weingut verwaltete. Nur eine Tatsache stand fest. Seine Mutter vertraute ihm blind.
»Bist du in Havanna aktiv?«
Warum fragte er das? Raymundo war lediglich ein Angestellter. »Willst du mich aushorchen?«
»Im Moment sitzt du auf meiner Terrasse. Wenn du aus Havanna fliehen musstest, habe ich das Recht, das zu erfahren.«
Die Furcht konnte Rodrigo nachvollziehen. Batista verfolgte seine Feinde gnadenlos. »Ja, ich musste aus Havanna fort. Es droht euch keine Gefahr. Sollte sich das ändern, werde ich es dir sagen.«
»Das erwarte ich von dir. Meine Kinder leben hier in Sicherheit, das soll so bleiben.« Raymundo holte zwei weitere Flaschen Bier. »Meine Frau kennt sich inzwischen auf dem Feld so gut aus wie ich. Es wird hier weitergehen, sollte man mich festnehmen. Ich habe hier einige Bauern für die Sache gewinnen können. Wir warten auf den großen Tag und bereiten uns darauf vor.« Anschließend erzählte Raymundo aus seiner Vergangenheit. Von seinen Kontakten in Havanna. Dem Kampf, den er seit Jahren gegen die Korruption führte, die kein Ende zu nehmen schien. Wie ihn Rodrigos Mutter nach Viñales geschickt hatte, um ihn aus der Schusslinie zu halten. Vom Tod des besten Freundes und warum er seinem Dorf fernblieb, außer zu wenigen Familienbesuchen.
Mit jedem Satz stieg Raymundo in Rodrigos Achtung. In dem Mann steckte weit mehr, als er angenommen hatte: Ein unerwarteter Verbündeter.
»Weiß Magdalena davon?« Er kannte Raymundos Tante, obschon er sie lange nicht gesehen hatte. Ob sie mittlerweile verheiratet war? Bis zum Wegzug von Rodrigos Eltern hatte sie zum Haushalt der Guerreras gehört. Sie war der Grund gewesen, um über den elitären Tellerrand hinauszusehen, wenngleich er sich während seiner Rennfahrerzeit vom Luxus hatte blenden lassen.
»Nein. Meine Tante ahnt es, das genügt.« Raymundo zeigte ins Haus. »Meine Frau ist informiert, sie unterstützt mich, damit ich an manchen Tagen unbehelligt fortbleiben kann.«
»Wo bist du in der Zeit?«
»Offiziell zu Verhandlungen in Havanna.«
Nun wurde Rodrigo neugierig. »Und inoffiziell?«
»Im Zentralbüro der Orthodoxen Partei am Prado 109. Castro ist oft anwesend, er streut Falschinformationen, um zu sehen, wem er trauen kann. Ich berichte ihm aus Pinar del Río. Wir haben vier Gruppen in verschiedenen Stationen.« Raymundo sah ihn an. »Alles, was ich dir sage, darf diese Veranda nicht verlassen. Sonst gefährdest du die Planung.«
Das fürchtete Abel ebenso, deshalb hatte er Rodrigo nach Viñales geschickt, um dort eine Truppe zu rekrutieren und zu leiten. »Von mir erfährt niemand ein Wort.« Dabei fiel ihm auf, wie wenig Raymundo tatsächlich preisgab. Besser, er wechselte das Thema. »Kann Aida meinen Haushalt erledigen, oder soll ich jemand aus dem Dorf fragen?« Er kannte Raymundos Frau nur flüchtig. Sie kümmerte sich während seiner Abwesenheit um das Haus, wobei es nicht viel zu tun gab. So blieb ihr ausreichend Zeit, sich um ihre halbwüchsigen Jungs zu kümmern.
»Wenn du auf dem Feld hilfst, kann sie das übernehmen. Die Arbeit ist für sie auch leichter. Sie wird deinen Haushalt gerne führen. Die Jungs helfen nur am Wochenende. Sie brauchen eine gute Schulbildung.« Raymundo rief nach Aida, die seinem Vorschlag zustimmte und anschließend wieder verschwand, um die Männer allein zu lassen.
Rodrigo erinnerte sich nicht an Raymundos Söhne. Er hatte sich nie für sie interessiert. Nun schämte er sich dafür. Immerhin kämpfte Raymundo zum Wohl seiner Söhne für die gerechte Sache. In den kommenden Wochen wollte er sie kennenlernen.
Rodrigo ging mit Raymundo zu klandestinen Zusammenkünften, bis er letztlich die kleine Lokalgruppe führte und ausbildete. Nach einigen Monaten kam Bewegung in ihre Pläne. Castro erklärte nach Ausschöpfung aller legalen Mittel das in der Verfassung enthaltene Widerstandsrecht. Er begann mit den Vorbereitungen, bildete tausendzweihundert Kämpfer aus, um sein Vorhaben zu verwirklichen.
Der Versuch der Erstürmung der Columbia-Kaserne in Havanna scheiterte an der Geschwätzigkeit eines Professors, der glaubte, er hätte genug Unterstützer. Anstatt die Kaserne einzunehmen, stürmte zuvor das Militär die Häuser der Widerständler und verhaftete sie. Dies zeigte Castro deutlich, wie wenig er verraten durfte. Aus diesem Grund erfuhr Rodrigo kein Wort über die genaue Planung. Selbst nicht von Abel, der dicht mit dem Anwalt zusammenarbeitete. Die Bauern und Armen standen bereit, wie auch Rodrigo. Er konnte es kaum abwarten, endlich den verfassungsmäßigen Status wiederherzustellen und rechtmäßige Wahlen zu ermöglichen, die Batista durch den Putsch im März verhindert hatte, um nicht zu unterliegen. Rodrigos Hoffnung wuchs ins Unermessliche. Sie würden siegen. Die orthodoxe Jugend glaubte an die Sache. Diszipliniert und als Einheit erwarteten Rodrigos junge Kameraden weitere Anweisungen. Den Großteil der Männer kannte er. Ihre Väter hatten auf den Tabakfeldern von Artemisa bei der Ernte geholfen. Auf den Feldern seines Vaters. Oft hatte er die Pausen mit ihnen verbracht, nachdem seine Eltern ihn zu der Ausbildung als Tabakfabrikant gezwungen hatten, bevor er in den Rennwagen gestiegen und diesem Zwang davongefahren war. Nun stand er wieder hier. Neugeboren. Ungeduldig und einsatzbereit, mit siebenundzwanzig kampfbereiten Freunden.
Raymundo kam zu ihm auf das Weinfeld. Noch hing die Julisonne tief am Himmel und würde die Ebene zur Mittagszeit in einen Glutofen verwandeln, weswegen er die harten Arbeiten nachts oder in den frühen Morgenstunden erledigte. Zeit, sich auszuruhen und sich schlafen zu legen. »Es ist so weit.«
»Ja, ich weiß. Ich kontrolliere nur noch diese Reihe.« Er fächelte sich Luft zu.
Raymundo grinste. »Das meinte ich nicht.«
In dem Moment begriff er. »Es geht los?«
»Ja, ihr trefft euch in zwei Stunden am Bahnhof und fahrt nach Santiago. Dort holt euch jemand ab und bringt euch in eines der Gasthäuser.« Raymundo klopfte ihm auf die Schulter. »Viel Erfolg. Und pass auf dich auf!«
»Danke.« Rodrigo eilte ins Haus, duschte rasch, zog sich seinen besten Anzug an und ging ohne Gepäck zum Bus, der ihn zum Bahnhof von Pinar del Río brachte. Zwischen den sechsundzwanzig Männern, die in den Zug stiegen, wirkte er wie ein Geschäftsreisender. Das erschien ihm die perfekte Tarnung.
Nur einer aus seiner Lokalgruppe fehlte: Gustavo. Warum auch immer. Vielleicht hatte man ihn nicht erreicht. Ob es dieses Mal tatsächlich losgehen sollte, würde sich zeigen. Mehrfach waren sie schon zu einem Versammlungsort gerufen worden, um anschließend unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt zu werden. An jenem Tag fühlte es sich besonders an. Die Stimmung schien anders. Und das lag nicht daran, dass in Santiago die jährlichen Karnevalsfeiern stattfanden.
Die Kameraden verteilten sich wie gewohnt auf unterschiedliche Abteile, um nicht den Eindruck zu erwecken, gemeinsam zu reisen. Die Stunden der Zugfahrt krochen dahin. Rodrigo fühlte keine Müdigkeit. Zu sehr klopfte sein Herz aus Vorfreude auf einen gerechten Sieg. Was auch immer sie in Santiago de Cuba erwartete, es würde sie in eine neue Ära führen.
Ein Kontaktmann brachte sie nach einer kurzen Schlafpause in einem Gästehaus am Stadtrand gegen dreiundzwanzig Uhr auf eine außerhalb der Stadt liegende Farm. Mehrere Autos standen auf dem Gelände verstreut. An einigen wehte die Fahne der Batista-Anhänger. Die perfekte Tarnung.
Rodrigo spürte förmlich, dass sie an diesem Samstag Geschichte schreiben würden. Die Stimmung übertrug sich auf die Männer. Auf der Farm im Vorort Siboney trafen sie auf rund einhundertundsechzig Mitstreiter. Fidel Castro begrüßte sie alle. »Um es kurz zu machen, in ein paar Stunden greifen wir die Moncada-Kaserne mit hundertzwanzig Männern und Frauen und die von Bayamo mit den restlichen Leuten an. Den Tag haben wir bewusst ausgewählt. In der Stadt wird ausgelassen gefeiert, die Soldaten werden müde sein und wir siegreich.«
Rodrigo wusste, wer unter den Frauen war. Yeyé und Melba. Er suchte nach Yeyé. Sie stand neben Abel, und er ging hinüber, um sie zu begrüßen. »Ich hoffe, wir sind für den gleichen Sturm eingeteilt.«
Abel klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Sind wir, mein Freund.«
Er fing Yeyés Blick auf, der ihm durch die Eingeweide fuhr. Sie und Melba trugen Männerkleidung.
Applaus brandete auf.
Bis auf fünf Studenten, die kalte Füße bekamen, klatschten alle.
Castro sah sie verächtlich an. Sie stahlen anderen den Platz und zogen nun den Schwanz ein.
Castro wandte sich ihnen zu. »Ihr müsst mitkommen, ich kann euch hier nicht zurücklassen. Geht ans Ende der Gruppe für den Angriff auf die Moncada-Kaserne. Ich werde euch nicht zwingen zu kämpfen, aber ihr müsst uns folgen.«
Darauf einigten sie sich.
Die Vorbereitungen liefen reibungslos ab. Zwei Männer stiegen über eine Strickleiter in den Brunnen neben dem Wohnhaus hinab. Anschließend ließ Abel einen Strick hinunter. Wenig später zogen sie die dort versteckten Waffen nach oben.
Hühner gackerten in einem Stall, hinter dem die Männer aus den ankommenden Fahrzeugen die Schusswaffen ausluden. Ein Mann namens Renato Guitart erteilte die Anweisungen. Er war der einzige Teilnehmer aus Santiago. Alle anderen Mitkämpfer kamen aus dem Westen. Rodrigo verstand die Gründe. Nur ein einziger Mann aus Santiago de Cuba kannte den Plan. Und der gab vor, ein Hühnerzüchter auf dieser Farm zu sein. Niemand erweckte Verdacht.
In den frühen Morgenstunden ging es los. Rodrigo trug ein belgisches Jagdgewehr Kaliber 12. Jeder Schuss feuerte jeweils neun Kugeln ab, was auf kurze Distanz den maximalen Erfolg versprach, denn ein Projektil würde den Gegner immer treffen. Woher die Waffen stammten, entzog sich Rodrigos Kenntnis.
Es lag gut in der Hand. In der Unteroffiziersuniform eines Batista-Soldaten, die Melba und Yeye in Havanna genäht hatten, fühlte er sich unwohl. Er kam sich verkleidet vor.
Fidel gab die Anweisungen. »Abel, du bleibst im hinteren Teil. Nimmst den Gerichtssaal ein, dort wirst du keine Probleme haben. Ich werde mit einigen Mitstreitern den Eingang besetzen, die Ketten entfernen, um die Zufahrt mit dem Auto freizugeben.« Er sah zu Rodrigo. »Du wirst ihn mit acht Männern aus eurer Gruppe von Artemisa begleiten. Ihr seid gut ausgebildet.«
Rodrigo durchflutete eine Welle des Stolzes. Er kämpfte mit seinen Leuten an Castros Seite. Yeyé zwinkerte ihm zu.
Viertel vor fünf brachen sie auf. Mit jeder vergehenden Minute, in der sie sich der Moncada-Kaserne näherten, steigerte sich Rodrigos Nervosität. Das Blut rauschte in seinen Ohren, sein Mund trocknete aus, und ein ihm sehr bekanntes Kribbeln durchzog seinen Körper. Er fühlte sich wie vor dem Start eines Rennens. Auch dort war es für ihn jedes Mal um den Sieg gegangen. Hoch konzentriert beobachtete er seine Gruppe, die zusammengepresst in einem Fahrzeug saß. Die Soldaten würden noch schlafen. Denen stand die größte Überraschung ihres Lebens bevor.
Rodrigo bemerkte, dass der erste Wagen am Ziel hielt. Die Männer stiegen aus, entwaffneten und neutralisierten die Wachen am Eingangstor, doch eine Patrouille mit Maschinengewehren näherte sich. Castro gab Gas. Er schien die Wachleute stoppen zu wollen, um sie vom Schießen abzuhalten. Die Männer fuhren überrascht herum, legten an, verwarfen ihr Vorhaben jedoch, als sie alle Insassen mit angelegten Waffen aus dem Wagen springen sahen. Ein Schuss zerriss die nächtliche Ruhe. Die Mitfahrenden der nachfolgenden Fahrzeuge verließen ebenfalls die Autos.
Weitere Schüsse fielen.
Ein Alarm schrillte los, verschmolz mit den durch die Nacht peitschenden Gewehrsalven. Rodrigo schützte sich mit der Beifahrertür vor den einschlagenden Kugeln. Erwiderte das Feuer. Sah nicht, ob er traf.
Jemand brüllte Kommandos. »Ins Krankenhaus! Organisiert euch neu!«
Der Trupp kam in Bewegung. Rodrigo folgte einer Gruppe, die nicht seine war. Im Chaos fand er sie nicht, wollte jedoch nicht auf dem Zufahrtsweg zur Bastion zurückbleiben. Sie liefen zum Waffenarsenal. Dort weckten sie die Militärkapelle, die neben aufgereihten Musikinstrumenten auf den Pritschen lag.
Das Überraschungsmoment, alle Soldaten in der Kaserne zu überwältigen, war missglückt. Der Hauptkampf fand vor der Kaserne und nicht in ihr statt. Rodrigo vernahm die Schüsse der Gegner. Er sah einige nur in ihrer Unterwäsche und barfuß auf sie schießen. Rodrigo feuerte zurück. Auf der weißen Wäsche erschienen dunkelrote Flecken wie ein abstraktes Gemälde. Die Gegenwehr steigerte sich. Die Soldaten der Kaserne erholten sich rascher vom Angriff als angenommen, was Rodrigo zum ersten Mal am Erfolg der Mission zweifeln ließ.
Die Alarmsirene hörte sich für ihn zwischenzeitlich wie das Signal zum Rückzug an. Er schoss. Die Kugeln trafen einen Soldaten an der Schulter und im Brustbereich. Die sich ausbreitenden Punkte wirkten wie zu schnell erblühte Blumen. Der Mann sackte in die Knie.
Den Treffer quittierten dessen Kollegen mit einem wahren Kugelhagel. Die näher kommenden Einschläge zwangen Rodrigo in die Deckung. Trotzdem streifte ihn ein Schuss am linken Oberarm. Der Schmerz brannte wie ein glühendes Kohlenstück auf blanker Haut. Automatisch ließ er das Gewehr sinken.
Ein Kamerad zerrte an seiner Schulter.
Rodrigo sah ihn an.
»Rückzug.«
Er gehorchte, rannte zurück zur Zufahrt und sprang in einen der herumstehenden Wagen, der mit voller Besetzung die Flucht antrat. Rodrigo befand sich inmitten fremder Männer. Blut rann ihm den Arm hinunter. Das Fahrzeug bog nach Siboney ab, zur Farm, von der sie gestartet waren. »Werden wir verfolgt?«
Die Männer auf der Rückbank drehten sich um. »Sieht nicht so aus. Wo sind die anderen?«
Rodrigo hatte keine Ahnung. Er wusste nur eines: Man würde sie jagen. Bis man sie fand. Und man würde sie töten. »Wir müssen untertauchen.«
Seine private Kleidung lag noch am Baumstamm, wo er sich umgezogen hatte. Er riss das Hemd der Uniform in Streifen, verband seine Schusswunde und hoffte, sie würde aufhören zu bluten.
In Windeseile zog er sich um, warf das Gewehr in den Brunnen und schlug sich zu Fuß durch bis Santiago de Cuba. Der Bahnhof wurde überwacht, wohin man sah, standen Wachen herum. Vom Angriff auf die beiden Kasernen wusste zwischenzeitlich jeder, auch von der missglückten Eroberung. Rodrigo überprüfte den Behelfsverband, den seine Jacke vor Blicken verbarg. Er hielt.
Überall sprachen die Menschen über Festnahmen und Tote. Ihm bekannte Namen fielen. »Wo wollen Sie hin?«
»Nach Viñales.« Er besann sich auf die prominenten Freunde seiner Familie. »Die Bacardís hatten mich zum Karneval eingeladen. Nun muss ich zurück auf meine Felder.«
»Nennen Sie Ihren Namen«, bellte der Oberoffizier.
»Rodrigo Guerrera Delgado aus Havanna. Ich lebe zurückgezogen auf dem Weinfeld.« Seine Stimme klang fest, dabei zitterte er am ganzen Körper, als er die Lügen aussprach.
»Gut, Sie können fahren.« Der Offizier notierte seinen Namen auf einem Block und bedachte ihn erneut mit einem prüfenden Blick. »Bleiben Sie auf dem Weingut, falls wir Sie nochmals sprechen müssen.«
»Natürlich, wohin sollte ich sonst gehen.« Künftig musste er auf der Hut sein. Die Bacardís würden seine Aussage bestätigen. Davon war er überzeugt.
Mit wackeligen Knien stieg er in den Zug nach Havanna. Als sein Hintern den Sitz der Bank berührte, entspannte sich Rodrigo zum ersten Mal seit seiner Abfahrt nach Santiago. Die Enttäuschung, versagt zu haben, wich der Erleichterung, noch am Leben zu sein. An jeder Station, an der der Zug hielt, rechnete Rodrigo damit, verhaftet zu werden. Der Ärmel der schwarzen Anzugjacke nässte durch. Das Blut erkannte man nicht, solange er die Jacke anbehielt.
Erst als er in Havanna umstieg und weiter Richtung Osten fuhr, ließ die ihn alles umfassende Angst neue Gedanken zu. Würden die Bacardís zu ihm halten? Die festgenommenen Kameraden schweigen? Er hoffte es.
Am Bahnhof von Pinar del Río bemühte er sich um einen normalen Gang. Keiner seiner Kameraden aus dem Ort hatte im Zug gesessen.
Am liebsten wäre er zu Berto gelaufen, um sich schnellstmöglich nach Hause fahren zu lassen. Er zügelte seinen Impuls. »Rodrigo, wie geht es dir? Warst du in Havanna?«
»Ja, ich habe mich mit einem Weinhändler getroffen«, log er mit fester Stimme.
»Deshalb der feine Zwirn.« Bertos Nachbar lehnte sich an den morschen Lattenzaun. »Hast du erfolgreich Geschäfte getätigt?«
Seine Ausrede, eine Geschäftsreise unternommen zu haben, ging auf. »Wird man sehen. Manche brauchen ewig, um sich zu entscheiden.« Er zuckte die Schultern, als würde ihm das Sorge bereiten. »Aber zum Leben reicht es aus. Ich will nicht klagen.«
»Du hast Glück. Wie geht es deiner Familie?«
Da Rodrigo die Briefe gelesen hatte, konnte er ihm einiges berichten. »Vielleicht gehe ich sie in Spanien bald besuchen.« Das würde seine Abwesenheit erklären, sollte er untertauchen müssen. »Ob Berto mich fahren kann?«
»Er ist zu Hause. Hat mich gefreut, dich zu sehen. Grüße deine Familie von mir.« Er tippte sich an den Strohhut und wandte sich ab, um sich um die festgebundene Ziege zu kümmern, die mit vollem Euter herumstand.
»Mach ich.« Rodrigo klopfte an Bertos Haustür.
Er öffnete. Überrascht sah er ihn an. »Holt dich Raymundo gar nicht mit dem Auto ab?«
»Er weiß nicht, dass ich einen früheren Zug genommen habe.« Wie er geistesgegenwärtig log, wunderte ihn selbst. In diesem Dorf würde ihn niemand verraten. Sie kannten sich seit vielen Jahren. Trotzdem versuchte er sich zu schützen. Berto erzählte er dieselbe Geschichte wie seinem Nachbarn. Er gab vor, nur eine kurze Geschäftsreise in die Hauptstadt unternommen zu haben, und erzählte begeistert von der neuesten Theatervorstellung im Tropicana.
Vor seinem Haus bedankte er sich bei Berto, bezahlte ihm einen großzügigen Fahrpreis und stieg vom Kutschbock. Er sah ihm nach. Erst als Berto außer Sicht war, zog Rodrigo die Anzugjacke aus und begutachtete seinen blutenden Arm. Lange hätte er die Schusswunde nicht mehr geheim halten können. Die Streifen waren durchgeweicht. Das weiße Hemd blutdurchtränkt. Bald wäre ihm das Blut den Arm entlanggelaufen.
»Verflucht.« Raymundo stand plötzlich neben ihm. »Es ist schiefgegangen.« Mit zwei Sätzen überwand er die Verandastufen. »Lass mich das ansehen.« Er blickte sich um. »Besser drinnen.«
Rodrigo gab ihm recht.
In der Abenddämmerung ließ sich nur wenig erkennen. Raymundo machte Licht.
Er setzte sich an den Küchentisch, zog das Hemd aus, löste die Stoffstreifen und tupfte damit über die blutende Stelle. »Wenn sie mich so sehen, bin ich fällig.«
»Hast du Jodtinktur im Haus? Das muss desinfiziert werden.« Raymundo betrachtete die klaffende Wunde. »Genäht werden muss sie auch.« Er wandte sich zum Gehen. »Ich bin gleich zurück.«