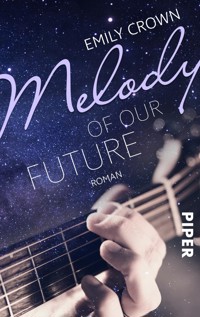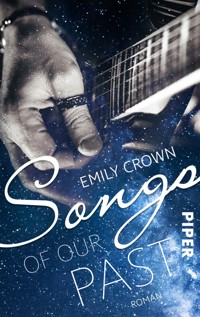13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Evelyn und Gabriel. Zwei Bände in einem Ebook Bundle.
Zwischen uns das Feuer.
Evelyn und Gabriel - werden ihre Gefühle die Schatten der Vergangenheit besiegen?
Evelyn liebt ihre Arbeit in einem Waisenhaus in New Orleans und das Leben in dieser bunten Stadt. Als Gabriel in ihre WG zieht, gerät Evelyns Gefühlsleben durcheinander, denn vom ersten Augenblick an fliegen Funken zwischen ihr und dem Fotografen. Doch Evelyn hat Angst. Angst vor ihren Gefühlen, Angst zu vertrauen und Angst enttäuscht zu werden. Auch nach ihrer Rückkehr nach Boston geht ihr Gabriel nicht aus dem Kopf und als er sie in ihrer Heimatstadt überrascht ist Evelyn überglücklich. Doch Gabriel verheimlicht ihr etwas und als Evelyn sich mit ihm aussprechen möchte, kommt es zur Katastrophe ...
Zwischen uns der Himmel.
Evelyn und Gabriel - eine Liebe, die niemals sein sollte?
Für Gabriel ist eine Welt zusammengebrochen. Evelyn bedeutete ihm alles und niemals wollte er, dass sein Geheimnis ihre Beziehung zerstört. Gabriel möchte nur noch eines: weg aus Boston und von den Erinnerungen. Zurück lässt er nur eine Schachtel mit Briefen an Evelyn, in denen er ihr endlich alles erklärt und von seinen wahren Gefühlen erzählt. Doch Gabriel weiß: Diese Briefe schrieb er zu spät …
"Eine Geschichte, die mich auf jeder Ebene berührt, mein Herz zerrissen und Stück für Stück wieder zusammengesetzt hat. Tiefgründig, mitreißend, dramatisch und süchtigmachend bis zur letzten Seite." Maren Vivien Haase.
Die ersten beiden Bände der "Zwischen uns das Leben“-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Zwischen uns das Feuer
Evelyn und Gabriel - werden ihre Gefühle die Schatten der Vergangenheit besiegen?
Evelyn liebt ihre Arbeit in einem Waisenhaus in New Orleans und das Leben in dieser bunten Stadt. Als Gabriel in ihre WG zieht, gerät Evelyns Gefühlsleben durcheinander, denn vom ersten Augenblick an fliegen Funken zwischen ihr und dem Fotografen. Doch Evelyn hat Angst. Angst vor ihren Gefühlen, Angst zu vertrauen und Angst enttäuscht zu werden. Auch nach ihrer Rückkehr nach Boston geht ihr Gabriel nicht aus dem Kopf und als er sie in ihrer Heimatstadt überrascht ist Evelyn überglücklich. Doch Gabriel verheimlicht ihr etwas und als Evelyn sich mit ihm aussprechen möchte, kommt es zur Katastrophe …
Zwischen uns der Himmel
Evelyn und Gabriel - eine Liebe, die niemals sein sollte?
Für Gabriel ist eine Welt zusammengebrochen. Evelyn bedeutete ihm alles und niemals wollte er, dass sein Geheimnis ihre Beziehung zerstört. Gabriel möchte nur noch eines: weg aus Boston und von den Erinnerungen. Zurück lässt er nur eine Schachtel mit Briefen an Evelyn, in denen er ihr endlich alles erklärt und von seinen wahren Gefühlen erzählt. Doch Gabriel weiß: Diese Briefe schrieb er zu spät …
»Eine Geschichte, die mich auf jeder Ebene berührt, mein Herz zerrissen und Stück für Stück wieder zusammengesetzt hat. Tiefgründig, mitreißend, dramatisch und süchtigmachend bis zur letzten Seite.« Maren Vivien Haase
Die ersten beiden Bände der »Zwischen uns das Leben« Trilogie.
Über Emily Crown
Emily Crown, geboren 1998, lebt als freie Autorin und Sprecherin am Bodensee. Schon als Kind liebte sie es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich in ferne Welten zu träumen. Nicht verwunderlich also, dass sie ihre erste große Liebe in der Literatur fand. Es folgten einige Jahre als begeisterte Leserin, ehe sie im Alter von 12 Jahren begann, eigene Geschichten zu Papier zu bringen. Heute schreibt sie über die Höhen und Tiefen der Liebe und all die Gefühle dazwischen.
Auf ihrem Instagram-Kanal @autorin_emilycrown tauscht sie sich mit ihren Leser:innen aus.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Emily Crown
Zwischen uns das Feuer & Zwischen uns der Himmel
Evelyn und Gabriel - Zwei Bände in einem Ebook Bundle!
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Newsletter
Zwischen uns das Feuer
Playlist
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Zwischen uns der Himmel
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Impressum
Emily Crown
Zwischen uns das Feuer
Für Moritz,
den Mann, der mein sicherer Hafen ist.
Für den Menschen, der alle Zweifel im Nichts auflösen kann.
Der mir ein Bad einlässt, wenn ich glaube eine Schreibblockade zu haben.
Der mir den Schreibtisch herrichtet,
wenn ich mich vor dem drücken will, was ich liebe, aus Angst, nicht gut genug zu sein.
Für den Menschen, dem ich blind vertraue und ohne den ich diese Reihe wohl nie beendet hätte.
Playlist
Toploader –
Dancing in the Moonlight
Portugal. The Man –
Atomic Man
Jason Mraz –
I’m Yours
Matt Meason –
Cringe – Stripped
Hozier –
NFWMB
Matt Corby –
Breathe
AJR – Pretender –
Acoustic
The Ronettes –
Be My Baby
We Are the Guests –
House a Habit
Hozier –
Sunlight
Dermot Kennedy
– Power over Me – Acoustic
Prolog
Gabriel
Januar 2016
Unter Tod versteht man das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionsabläufe. Das Versagen von Leber, Niere, Lunge, Herz. Der Mensch stirbt, wenn das Herz stehen bleibt, Blut nicht mehr durch Venen und Arterien gepumpt wird, die Seele dem Körper entgleitet, die Luft zum Atmen ausbleibt.
Es läutete.
Das musste das Essen sein. Eilig klappte ich das Buch zu und erhob mich. Doch jemand kam mir zuvor. Ich hörte Stimmen, nur das es nicht der Pizzadienst war, der dort stand. Es war sie.
Ihr Blick traf mich wie ein Blitzschlag. So viel Schmerz. Trauer. Enttäuschung. Ein Hurrikan der Gefühle.
Und wenn man von einem Hurrikan getroffen wurde, gab es nur zwei Optionen. Schockstarre oder Flucht.
Sie entschied sich für Letzteres. Ich mich für Ersteres. Einige Herzschläge lang stand ich einfach nur da und vernahm ein dumpfes Fiepen in meinen Ohren. Doch dann realisierte ich mit einem Mal, was gerade passiert war. Ich blinzelte, ehe ich rannte. Ich rannte, als hinge mein Leben davon ab, und zugegeben – das tat es auch. Sie war mein Leben. Ich rief ihren Namen, doch sie ignorierte mich. Als ich das Treppenhaus hinuntersah, erblickte ich ihre Hand, die schnell übers Treppengeländer glitt. Sie war nur eine Etage unter mir. Ich nahm mehrere Stufen auf einmal und folgte ihr. Aber ich konnte sie nicht mehr einholen, und gerade als ich die schwere Eingangstür ins Schloss fallen hörte, ertönte ein dumpfer Knall.
Gefolgt vom Schrei der Bremsen, die bereits wussten, dass sie diesen Kampf verloren hatten.
Die Welt um mich herum verlangsamte sich. Noch immer hörte ich den Nachhall meiner Schritte auf den Treppen. Spürte die Vibration der vorbeifahrenden Straßenbahn. Sah, wie große Flocken, unberührt von den Ereignissen, in schläfriger Ruhe, vom Himmel rieselten. Ich nahm meine Umgebung wahr, und trotzdem war es, als träumte ich.
»Nein!«, schrie jemand, als würde das rückgängig machen, was bereits geschehen war. Ich erkannte, dass ich es war, der schrie. Doch ich schien der Zeit hinterherzuhinken. Mein Geist begriff nicht.
Der Schnee knarzte, als sich meine Füße hineingruben, ein weit entferntes Geräusch in einer bewölkten Nacht, begleitet von panischen Stimmen, dem Ertönen aufgeregter Sirenen irgendwo am Ende der Stadt, meinem abgehackten Atem.
Wie in Trance überquerte ich den Fußweg, stieß einige Leute beiseite, fiel vor ihr auf die Knie.
»Evelyn …« Ein Flüstern inmitten der Hektik einer Tragödie. Ihre Lider flatterten, Blut floss aus ihrer Nase. »Evelyn«, krächzte ich erneut. Meine Hand fand die ihre. Sie drückte sie sanft, so sanft, dass es mir vorkam, als wäre ihre Seele bereits aus ihrem Körper gewichen. Die Berührung eines Geists, leicht und flüchtig. Schneller vergangen als ein Wimpernschlag.
»Es tut mir so leid«, wisperte ich. Ihr Blick fand den meinen. Ich erkannte die Angst darin, konnte förmlich sehen, wie sie nach Rettung suchte. Etwas, woran sie sich festhalten konnte. Etwas, das ihr Trost spendete.
Sie hustete, und Blut spritzte auf den festgefahrenen Schnee, der die Straße bedeckte.
»Ich bin bei dir, alles wird gut. Du darfst nur die Augen nicht schließen, okay? Bleib bei mir!« Eine Träne fiel auf ihr Gesicht, es musste wohl meine sein. »Ich bin bei dir«, flüsterte ich, bevor ich mich zu hier hinunterbeugte, meine Stirn zärtlich an ihre legte. Ihre war eiskalt, meine fürchterlich heiß. Zwei Gegensätze. Tag und Nacht. Feuer und Eis.
Alles wie immer. Beinahe. Und doch war nichts wie zuvor.
»Ich liebe dich.« Drei Worte. Zwölf Buchstaben. Ein leises Versprechen. Ein stummer Abschied. Ihr Abschied von mir, wie mir klar wurde.
»Nein, sag das nicht«, murmelte ich und strich ihr immer wieder über die Haare. »Alles wird gut, okay?« Ich rutschte herum und versuchte, ihren Puls zu ertasten, doch meine Hand zitterte zu sehr, als dass ich sie lange genug auf ein und derselben Stelle hätte belassen können. Evelyns Augenlider flatterten.
»Bleib bei mir. Sieh mich an Evelyn!« Ihre Atmung ging flach, und ihr Blick wurde träge.
»Nein, nein, nein!« Die Geräusche um uns herum wurden lauter, kräftige Hände bohrten sich in meine Arme. Ich scheiterte in dem verzweifelten Versuch, sie abzuschütteln, doch sie packten nur kräftiger zu, zogen mich weg.
»Sir, lassen Sie uns durch!«
»Bitte … nicht!«, hörte ich mich sagen, doch es änderte nichts. Wie aus der Ferne beobachtete ich, wie man mich von ihr fortzerrte, sah, wie zwei Leute in neongelben Jacken zu ihr rannten, sich gegenseitig irgendetwas Unverständliches zuriefen.
Die Sanitäterin ging auf die Knie, schob Evelyns Shirt nach oben. Einer von ihnen maß den Puls. »Herzstillstand, beginne mit Herzdruckmassage! Mach die Paddels fertig!«, erklärte er.
Seine Kollegin drückte eine gelartige Flüssigkeit auf zwei Paddels. Sie verrieb es auf den Metallplatten und wartete, dass das Gerät sich auflud, während ihr Kollege beständig die Herzdruckmassage ausführte und Luft in ihre Lungen pumpte.
»Die Paddels sind fertig«, erklärte seine Kollegin. Der Mann nahm sie ihr ab. Es zischte. Leise und bedächtig, wie ein aufkeimender Sturm. Just in diesem Moment drückte der Sanitäter die Paddels auf Evelyns Brust. Ihr Körper erzitterte heftig, bebte unter den Schockwellen, die ihr neues Leben einhauchen sollten. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, wie sie da lag, irgendwo gefangen zwischen Leben und Tod.
»Wir haben einen Herzschlag!« Sie riefen sich weiter Begriffe zu, aber ich konnte sie nicht verstehen. Es war, als hätte ich die Bedeutung der Worte vergessen. Jemand holte eine Trage aus dem Wagen.
Wie ein unbeteiligter Dritter kniete ich da, konnte nichts als starren. Der Schnee rieselte langsam und beständig auf sie nieder, als wolle er das Geschehen unter sich begraben.
Man legte ihr etwas um den Hals, schob sie auf eine Trage. Sie verschwand im Krankenwagen. Verzweifelt stemmte ich mich gegen die Hände, die mich noch immer zurückhielten.
»Sir, bleiben Sie hier!«
Endlich riss ich mich los, rannte in Richtung des Krankenwagens. »Ich muss mitfahren, bitte!« Man half mir in den Wagen, schloss die Türen hinter mir. Ich wünschte, ich wäre zurückgeblieben. Noch nie in meinem Leben hatte ich mich so hilflos gefühlt. Über meinen Kopf hinweg wurde es laut. Stimmen schallten mir in den Ohren, doch ich konnte die Worte noch immer nicht begreifen. Die Sanitäter wirkten ruhig. Routiniert. Doch in mir war es nur laut. Hektisch. Panisch.
Eins. Zwei. Drei. Als ich die Augen das nächste Mal aufschlug, waren wir bereits im Krankenhaus. Mehrere Leute schoben Evelyn in Richtung einer großen Tür. Weiß mit den roten Lettern: OP-Bereich. Kein Zutritt.
»Gehören Sie zur Familie?« Jemand packte mich am Arm.
»Ich bin ihr Freund.«
Die Schwester sah mich an, dann schüttelte sie den Kopf. »Sind Sie verheiratet?«
»Nein, aber Sie verstehen nicht. Ich bin ihre Familie!« Ihr Blick fand den meinen, und ich erkannte einen Ausdruck des Bedauerns darin.
»Es tut mir leid.«
»Aber ich …«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie können sie nach der OP sehen.« Die Flügel der Tür schlossen sich und verschluckten die Schwester. Nie würde ich das dumpfe Geräusch der Endgültigkeit vergessen.
In meinem Kopf hallte noch immer das Echo der jammernden Sirenen, die ebenso über ihren Verlust zu weinen schienen wie ich selbst. Ich sank auf die Knie, hilflos und dazu gezwungen, dabei zuzusehen, wie ein Teil meiner Selbst mir entglitt.
Die Welt um mich herum hörte auf sich zu drehen. Mir blieb die Luft weg. Wo vorher mein Blut in lauten, gleichmäßigen Strömen durch meine Ohren gerauscht war, herrschte plötzlich Stille.
Unter Tod versteht man das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionsabläufe. Und obwohl ich am Leben schien, war ich mir sicher, gestorben zu sein.
Ein halbes Jahr zuvor Juni 2015
Kapitel 1
Evelyn
Es gibt verschiedene Ansätze, eine Geschichte zu erzählen. In der Drei-Akt-, Fünf-Akt- oder Sieben-Akt-Struktur. Ich verwende meistens die Drei-Akt-Struktur. Das liegt daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder nicht für mehr reicht. Ich bin keine Autorin im klassischen Sinne. Um genau zu sein, bin ich gar keine Autorin, aber auch wenn bis auf meine Kinder bis jetzt noch niemand meine Geschichten zu hören bekommen hat, übe ich mich darin, sie alle zu notieren. Manchmal versuche ich mich auch an einem Gedicht, doch in den meisten Fällen klingt es, als hätten Worte vergessen, wie sie einen Satz bilden. Sie verlieren ihren Klang.
Geschichten zu erzählen fällt mir deutlich leichter. Ich tue es einfach. Und anstatt dass ich nach Worten suche, kommen sie meist von ganz allein zu mir. In meinem Job ist das Erzählen von Geschichten sogar noch einfacher, denn wenn sie doch einmal langweilig sein sollten, hat das keine schwerwiegenden Konsequenzen. Meine Geschichten existieren, um die Kinder in den Schlaf zu wiegen. Weil das allein jedoch keine gute Geschichte ausmacht, versuche ich, sie noch etwas über das Leben zu lehren. Aber letzten Endes verfolgen all diese Geschichten nur einen Zweck, nämlich dass die Kinder den Alltag vergessen und schließlich an einen Ort gehen, um den ich sie beneide - das Land der Träume.
Die Wendungen der Geschichte sind vor allem für mich und die, die nicht so schnell bereit sind, den Tag loszulassen. Die, die dem Tag noch hinterherhängen, deren Gedanken die Stille des Abends überschatten.
Und so sitze ich jeden Abend in dem roten Sitzsack unter dem warmen Licht der wackligen Stehlampe, deren Lampenschirm schief hängt, und erzähle unermüdlich von mutigen Prinzen, tapferen Prinzessinnen und bösen Monstern, die das Glück dieser Welt zerstören wollen. Manchmal schaffe ich es sogar selbst, dem Sog der Wörter zu erliegen. Denn jeden Abend, wenn die Stille der Nacht sich über das Waisenhaus legt und das fröhliche Gelächter der Kinder mit sich nimmt, bin ich es, die in eine andere Welt abtauchen muss. Und sei es bloß für einen kurzen Augenblick. Ich bin es, die diese Geschichten braucht, denn in ihnen schlummert, wonach ich mich sehne. Ich kann mich treiben lassen, der Naivität eines Kindes erliegen, meinen Worten Glauben schenken. Und das alles, ohne dass mich jemand dafür verurteilt oder belächelt. Es gelingt mir, die Ungerechtigkeit dieser Welt zu vergessen und das Happy End zu erschaffen, das ich jedem einzelnen der Zwerge so sehnlich wünsche. Das Happy End, das ich selbst nie bekommen habe.
»Und wenn sie nicht gestorben sind …«
»Dann leben sie noch heute!«, riefen Daniel und Maximilian zeitgleich.
»Psssscht«, zischte ich. Ihre Augen weiteten sich, und Daniel drückte Berny, seinen Plüschhasen, noch fester an die Brust.
»Ganz genau so ist es«, sagte ich leise und sah zu Sandy und Melody, die bereits eingeschlafen waren. Schweren Herzens klappte ich das Märchenbuch zu, das ich der Authentizität halber stets auf meinem Schoß liegen hatte, und hievte mich aus dem Sitzsack.
»Und jetzt ist es Zeit fürs Bett.« Die beiden kannten jede meiner Geschichten. Einige der Kinder hörten manchmal zu, andere nicht. Doch Daniel und Maximilian fanden sich an jedem Abend, den ich Spätschicht hatte, im Wohnzimmer ein und lauschten mir. Sie waren nie müde, schreckten nie vor der Moral zurück. Sie hörten einfach zu. Ich war mir sicher, dass sie eines Tages, wenn sie alt genug sein würden, verstünden, was ich versuchte, ihnen heut so verzweifelt zu erzählen - das jeder Mensch auf seine Weise wertvoll ist, egal, was ihm in der Vergangenheit passiert ist.
»Aber Evelyn …«, jammerte Maximilian, wobei er Alf, einem einäugigen Bieber-Plüschtier, den Arm verdrehte. »Kannst du uns nicht noch eine Geschichte erzählen?« Lächelnd wandte ich mich Daniel zu. Ob er auch noch eine Geschichte hören wollte? Als hätte er meine Gedanken gelesen, nickte er. Seine Lippen blieben allerdings verschlossen, stattdessen ruhte sein Blick nur abwartend auf mir, sprang zwischen mir und seinem Plüschtier hin und her. Daniel zeigte eine Unsicherheit, die mich an meine Kindertage erinnerte. Da war diese Angst, Distanz und vor allem Skepsis mir gegenüber, die er sich nicht zu überwinden traute, obwohl ich ihm ansah, dass er es wollte. Er sehnte sich regelrecht nach etwas Wärme. Nach Geborgenheit.
»Willst du auch noch eine Geschichte hören, Daniel?« Ich sah dem kleinen Lockenschopf direkt in die braunen Augen. Beobachtete, wie sich seine schmalen Lippen kurz öffneten, eine Zahnlücke entblößten, sich jedoch sofort wieder schlossen. Er nickte noch einmal, sah auf Bernys Ohren. Lächelnd klappte ich das Buch erneut auf.
Just in diesem Moment wurde die Tür geöffnet.
»Ich hoffe, du lässt dich von den beiden nicht wieder dazu hinreißen, die nächsten drei Stunden hier zu sitzen und dir Geschichten auszudenken«, ermahnte mich eine leise Stimme. »Da wartet nämlich jemand auf dich«, erklärte Theresa, wobei sie sich eine hellbraune Strähne hinter die Ohren strich und mich aus ihren sturmgrauen Augen heraus auffordernd ansah.
»Außerdem müssen wir Melody und Sandy ins Bett bringen!« Sie deutete auf die zwei Mädchen, die eng aneinandergeschmiegt auf dem Sofa saßen und bereits eingeschlafen waren. »Und für euch zwei Herren ist es auch an der Zeit!« Sie warf Daniel und Maximilian einen strengen Blick zu, den die beiden geflissentlich ignorierten, indem sie an ihren Kuscheltieren herumfummelten.
»Außerdem solltest du schon längst im Feierabend sein! Geschichte hin oder her!«, erklärte Theresa und sah mich nachdrücklich an.
Ich hatte heute eigentlich Frühschicht, aber als ich Theresa nach der Übergabe fragte, ob ich am Abend noch einmal wiederkommen dürfte, um den Kindern noch eine Geschichte zu erzählen, hatte sie eingewilligt.
Einen Moment zögerte ich, dann stemmte ich mich hoch und ging leise zu ihnen.
»Ihr habt Theresa gehört. Zeit für euch, ins Bett zu gehen.« Die beiden ließen ihre Beine über die Sofakante hängen, ehe sie schmollend heruntersprangen und gemeinsam mit ihren zwei Kuscheltieren aus dem Wohnzimmer liefen.
Ich wusste, dass es keinen Sinn hatte, mit Theresa zu diskutieren. Sie war eine der wenigen Angestellten hier, mit denen ich mich auf Anhieb gut verstanden hatte. Sie liebte den Job ebenso sehr wie ich, und Liebe verband irgendwie.
»Du nimmst Melody, ich Sandy?«, schlug Theresa vor, nachdem die Jungs weg waren.
»Okay!«, erklärte ich nickend. Leise ging ich zu Melody. Ihre dunkelblonden Haare hingen ihr ins Gesicht und verbargen die kleine Stupsnase. Ihr schmaler Brustkorb hob und senkte sich gleichmäßig. Vorsichtig zog ihr die hellgraue Fleecedecke vom Körper und hob sie auf meine Arme, dann nickte ich Theresa zu und wir verließen das Wohnzimmer. Im Flur angekommen, stellte ich fest, dass eine Glühbirne ausgefallen war. Halb im Dunkeln trug ich das kleine Mädchen die Treppe hinauf und brachte sie schließlich in ihr Zimmer, wo ich sie behutsam zudeckte und ihr Plüschkrokodil Thea neben sie legte. Anschließend verließ ich ihr Zimmer. Aus dem Bad einige Räume weiter schallte leises Geplapper herüber, und ein heller Lichtkegel fiel in den Flur. Ich ging hinüber. Theresa und Michael standen im Bad und überwachten, wie Theodor, Derek und Finnja sich die Zähne putzten. Sie waren zwischen 8 und 9 und gingen derzeit neun Uhr abends ins Bett. Ein Blick auf meine Uhr verriet mir, dass es in einer halben Stunde so weit sein würde.
»Okay, ich gehe wieder«, rief ich ins Bad hinein, und mehrere Hände winkten mir.
Leise schloss ich die Badezimmertür hinter mir. Die Dielen unter meinen Füßen knarzten bedächtig, als hätten sie einen anstrengenden Tag gehabt. Als ich aufsah, begegnete ich dem Blick von Amanda, oder Nana, wie ich sie lieber nannte, die mit vor der Brust verschränkten Armen an der Wand lehnte und mich angrinste. Ihre blonden, langen Haare fielen ihr über die Schulter wie eine Decke, und ich fragte mich, wie sie ihre Mähne bei dieser Hitze offen tragen konnte. Just in diesem Moment öffnete sich die Badezimmertür erneut, und Theresa stolperte mit Finnja an der Hand heraus. Seufzend warf ich ihr einen vernichtenden Blick zu, weil sie Nana reingelassen hatte. Aber sie lachte nur und zuckte mit den Schultern.
»Sie hat recht. Es ist wirklich Zeit, in den Feierabend zu gehen.« Theresa mochte gesprochen haben, aber ich hätte wissen müssen, dass es auf Nanas Mist gewachsen war. Es war nicht das erste Mal, dass meine beste Freundin ins Waisenhaus kam und den Spielverderber mimte, wenn ich mal wieder freiwillig unbezahlte Überstunden schob. Manchmal kam es mir so vor, als wäre sie meine Chefin, doch auch wenn ich es mir nicht gern eingestand, war ich ihr dankbar dafür. Sie war einer der wenigen Menschen, die mich davon überzeugen konnten, auch mal an mich selbst zu denken. Das war schon immer so gewesen. Selbst in der Schule. Sie war es gewesen, die mich nach Stunden des Lernens darauf hinwies, dass ich etwas essen sollte. Sie war diejenige, die mir mein schlechtes Gewissen nahm, wenn ich einen Arzttermin hatte und die Arbeit frühzeitig verlassen musste. Sie war diejenige, die mir immer sagte, dass alles okay werden würde. Und sie war die Einzige, der ich es wirklich glaubte.
Vielleicht war sie auch deswegen mit mir nach New Orleans gekommen. Im Frühjahr diesen Jahres hatte Miranda, meine ehemalige Chefin im Waisenhaus in Boston, uns mitgeteilt, dass sie eine Mitarbeiterin suche, die für unbestimmte Zeit bereit sei, in New Orleans zu arbeiten. Ihre Schwester, die dort ebenfalls ein Waisenhaus führte, hatte Personalmangel, und sie wollte sie entlasten. Da ich nach 26 Lebensjahren bereit war, mehr von den Staaten zu sehen als nur Boston, fiel es mir nicht schwer, meine Siebensachen zu packen. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass meine beste Freundin ihren Job als Assistant Manager bei Hugo Boss an den Nagel hängen und mich begleiten würde. Zwar hatte ich mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen können. Trotzdem war ich überrascht, als sie mich fragte, ob sie mitkommen dürfte. Sie tarnte ihre Frage mit dem Vorwand, mal eine Auszeit zu brauchen. Erst später wurde mir klar, dass ihre Auszeit viel mehr als das war. Sie nähte wie besessen, und ich war mir fast sicher, dass sie einen Weg zurück in die Selbstständigkeit suchte, die sie einst hatte aufgeben müssen. Anders konnte ich mir auch nicht erklären, dass sie ihr finanzielles Polster so leichtfertig aufbrauchte. Hinzu kam sicher, dass sie die Leere unseres Hauses in Boston ebenso wenig hätte ertragen können wie ich. Und so fuhren wir gemeinsam nach New Orleans. Das Abenteuer zweier Freundinnen.
»Nana …«, setzte ich an.
»Was denn? Du musst auch mal wissen, wann es Zeit ist, Feierabend zu machen. Ich weiß, du liebst diesen Job. Aber das bedeutet nicht, dass du kein Privatleben mehr haben darfst. Und wenn man bedenkt, dass es fast neun Uhr abends ist, läuft es genau darauf hinaus. Was denkst du, wieso ihr in Schichten arbeitet?«, fragte sie mit einer hochgezogenen Augenbraue, die im Gegensatz zu meinen perfekt gezupft war. Ich ließ ihre Aussage unkommentiert. Sie hatte ja recht, aber ich konnte einfach nicht anders. Zurzeit waren zwölf Kinder im Waisenhaus zwischen fünf und sechzehn Jahren. Mittlerweile kannte und liebte ich jedes einzelne von ihnen. Wie also hätte ich ihnen meine Gutenachtgeschichte abschlagen können, nur weil ich keine Schicht hatte?
»Du weißt doch, wie sehr ich meine Arbeit liebe. Wieso sitzt du nicht vor der Nähmaschine?«, startete ich ein Ablenkungsmanöver.
»Lenk das Thema nicht auf mich, Fräulein!«, ermahnte sie mich sofort. Seufzend sah ich sie an.
»Sie haben doch niemanden außer uns«, erwiderte ich und sah zu den Regenbogentüren, von denen die meisten schon verschlossen waren.
Nana legte den Kopf in den Nacken und stöhnte wie jemand, der einen Marathon gelaufen war. »Sie haben dich. Aber du musst nicht 24 Stunden bei ihnen sein, okay?« Sie war diese Unterhaltung leid. Ich ebenfalls. Und trotzdem führten wir sie fast jeden Abend. Es war unser Ritual, um in den Feierabend zu starten.
Noch einmal dachte ich über unsere Unterhaltung nach.
»Sie haben doch niemanden außer uns.«
»Sie haben dich.«
Mich. Ich war ihr Zuhause. Ihr Halt. Aber ich würde irgendwann gehen. So wie auch die House Parents zuvor irgendwann gegangen waren. Und so, wie auch ihre Eltern gegangen waren.
»Okay, also … Lust auf ein Gläschen dunkelrote Entzückung?«, fragte Nana und verzog ihre vollen Lippen zu einem Grinsen.
Ich lachte leise auf. »Ich verzichte.«
»Aber du wirst mich doch wohl begleiten?« Fragend legte sie den Kopf schief.
»Na los.«
Wir verließen die erste Etage, auf der die Zimmer der Kinder sowie die Waschräume waren, und gingen die Treppe hinunter in den Wohnbereich. Zumindest nannte ich es so, weil hier all die Räume waren, die man auch in einem normalen Haus fand: Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Spielzimmer. Der einzige Unterschied war, dass hier alles für viel mehr Kinder ausgestattet war und es einen zusätzlichen Raum gab, in dem die Kinder ihre Hausaufgaben machen konnten. Doch ansonsten war es fast ein normales Haus.
Wir liefen um die Treppe herum und hielten auf den schmalen Eingangsbereich zu. Dort griff ich nach meiner Tasche, die über dem Schuhregal der Kinder hing, neben gelben, roten und blauen Regenjacken in Einheitsgröße. Einheitsgröße, als wären alle aus demselben Holz geschnitzt. Als hätten sie alle dieselbe Größe. Hastig verdrängte ich den Gedanken und hängte mir lächelnd die Tasche um. Ich lächelte jeden Abend, wenn ich das tat. Eines der Kinder hatte ein entzückendes Bild auf das Kunstleder meiner Tasche gemalt. Zwei händchenhaltende Strichmännchen. Eines davon hatte eine Blume in der Hand. Ich wusste nicht, wer der Künstler oder die Künstlerin war, glaubte aber zu wissen, dass es Daniels Art war, mit mir zu kommunizieren. Obwohl die Farben mittlerweile leicht verschmiert und verblasst waren, hatte ich es nicht über mich gebracht, sie zu entfernen. Und ich würde es wohl auch nie. Dieses Bild war ein Beweis der Zuneigung, ein Beweis, dass irgendeines der Kinder mich mochte. Wie konnte ich diesen Schatz vernichten, als wäre es mir egal?
Ich lief entlang der mit Zeichnungen gespickten Wände zur Garderobe und schnappte mir wenig motiviert meine rote Lederjacke.
»Na schön. Los geht’s!« Nana wackelte kurz herum, die verkürzte Form eines Freudentanzes, dann lief sie mit einem breiten Grinsen an mir vorbei.
»Es wird dir guttun, mal wieder rauszukommen. Du warst schon das ganze Wochenende hier drin.«
Sie hatte recht. Man sollte annehmen, mit meinen 26 Jahren hatte ich langsam gelernt, Beruf und Privates zu trennen, oder war bereits an dem Punkt angekommen, wo ich der täglichen Arbeit müde wurde. Aber ich hatte das Gefühl, je älter ich wurde, desto schwerer fiel es mir, mich von den Kindern zu trennen. Mit jedem weiteren Tag wollte ich mehr, wurde mein schlechtes Gewissen größer, wenn ich dann irgendwann ging. Sie allein ließ. Die Kinder brauchten mich. Sie lauschten meinen Geschichten, vertrauten mir ihre Geheimnisse an, weihten mich in ihre Gedanken ein.
Ich war wie ihre große Schwester, beste Freundin und Mutter zugleich. Und das war kein Privileg, das man acht Stunden am Tag machte, und dann wandte man sich ab und verschwand. Je mehr Zeit man mit ihnen verbrachte, desto wichtiger wurde man für sie. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Und jedes Mal, wenn ich die Tür schloss, sah ich die Angst darin aufblitzen. Die Angst, dass ich vielleicht nie mehr zurückkäme. Ich kannte dieses Gefühl. Zu gut.
Vielleicht war es auch das, was Nana und mich so grundlegend verschieden machte. Sie hatte keine Ahnung, wie es war, jeden Tag mit diesen Kindern zu verbringen.
»Und los!« Nana riss die Tür auf und schob mich hinaus. Ich gab ihrem leichten Anstoß nach und eilte die Verandastufen hinunter, heraus aus meinem Versteck, hinein in die echte Welt.
»Brauchst du noch was von drüben?« Sie deutete mit dem Kopf auf unser kleines Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das sich schon anfühlte wie zu Hause.
Angelique hatte es nach Hurrikan Katrina gekauft, um Teilzeitbetreuer, wie ich es war, unterzubringen. Allerdings war in dem Haus weit mehr Platz als nur für eine oder zwei Personen. Hin und wieder wurden freie Zimmer vermietet, aber momentan lebten wir darin allein. Ein besonderes Highlight war der gelbe Chevrolet, der den Mietern zur Verfügung stand. Mein Blick fiel auf den Maiblumenstrauch, den ich vor vier Wochen gepflanzt hatte und dessen Blüten majestätisch weiß blühten. Selbst von hier erkannte ich, dass die Erde trocken war, was bedeutete, Nana hatte ihn wieder einmal nicht gegossen - so war das, wenn man mit jemandem zusammenlebte, der einen schwarzen Daumen hatte. Kopfschüttelnd sah ich sie an und fügte meiner imaginären To-do-Liste einen weiteren Punkt hinzu.
»Nein, ich habe alles dabei«, sagte ich, wobei ich zielstrebig auf das massive Eisentor zulief, das das Grundstück des Waisenhauses begrenzte.
»Du hast recht, mehr als dein schönstes Lächeln brauchst du ja sowieso nicht.«
Ich verdrehte grinsend die Augen. »Hast du denn alles? Der heiße Barkeeper ist sicher wieder da, und dir klebt da noch etwas Schokolade in den Haaren.« Kurz bevor ich unser Haus verlassen hatte, um noch einmal zu den Kindern zu gehen, hatte ich Nana dabei beobachtet, wie sie heimlich einen Reese’s nach dem anderen gegessen hatte. Und dass, obwohl sie seit zwei Tagen angeblich zuckerfrei lebte, da Zucker schlecht für den Körper sei. Erschrocken blieb sie stehen und fuhr sich durch die lange, blonde Mähne. Nana war schon seit Wochen hinter Dave her. Aber bislang hatte er ihr nicht mehr Beachtung geschenkt als einer Fremden an der Bushaltestelle.
Ich lachte. »Ich mache nur Witze.«
»Evelyn!« Sie stampfte wütend mit dem Fuß auf, dann zog sie leise lachend das schwarze Messingtor auf. »Komm schon, ich habe Durst!«
Lachend schüttelte ich den Kopf, dann schloss ich das Tor hinter mir und folgte ihr auf den Fußgängerweg. Erstaunt stellte ich fest, dass im Haupthaus noch Licht brannte. Neben einem Wohnhaus verfügte das Grundstück des Waisenhauses noch über ein Haupthaus, in dem unter anderem Angeliques Büro, Aktenräume und ein Therapieraum Platz fanden. Ich zuckte mit den Schultern, dann folgte ich Nana.
Wir kamen an einigen Autos vorüber, und ich stoppte kurz, betrachtete mich in der Spiegelung eines Seitenfensters. Bei meiner Arbeit spielte es keine Rolle, wie ich aussah. Ich achtete darauf, gepflegt zu sein, machte mir aber nicht die Mühe, mich zu schminken. Wenn ich Frühschicht hatte, musste ich 5:30 morgens drüben sein. Keine Zeit, zu der man gesteigerten Wert auf sein Äußeres legte. Als ich die dunklen Ringe unter meinen Augen bemerkte, wünschte ich mir allerdings, ich hätte es heute Morgen doch getan. Dafür lagen meine Haare nahezu perfekt – was nur selten der Fall war. Seit einiger Zeit trug ich meine braunen Locken auf Kinnlänge, was mir jede Menge Zeit und vor allem Nerven ersparte. Meine Großmutter hatte immer gesagt, ich hatte das Pferdehaar meiner Mutter geerbt. Nana meinte, der Schnitt verlieh mir einen französischen Touch, vor allem in Kombination mit meinem Pony, und hatte bereits mehrfach vergeblich versucht, mich zum Tragen einer Baskenmütze zu überreden.
»Willst du roten Lippenstift?«, fragte Nana, die ebenfalls angehalten hatte. »Das betont deine Augen so schön. Wie Schneewittchen.«
Ich zog eine Braue hoch. Meine Augen kamen in dunklem Braun daher, und meiner Meinung nach sahen sie auch nicht anders aus, wenn ich roten Lippenstift trug, aber Nana wurde nicht müde, mich darauf hinzuweisen.
»Na schön!« Ich beugte mich etwas näher an die Scheibe und tupfte den Lippenstift vorsichtig auf. Nachdem ich fertig war, reichte ich ihn ihr zurück und setzte mich wieder in Bewegung. Das Wilson-Sister’s Home in New Orleans war in einem der meiner Meinung nach schönsten Distrikte der Stadt angesiedelt, direkt zwischen dem Garden District und dem Irish Channel, und wann immer wir das Haus verließen und uns durch die Straßen treiben ließen, kamen wir an imposanten Gründerzeitvillen mit gigantischen Gärten vorbei. Hier zu leben musste sich anfühlen, wie in der Zeit gereist zu sein. Aber Hurrikan Katrina hatte auch hier seine Spuren hinterlassen. Die Straßen und Fußgängerwege innerhalb New Orleans hatten sich quasi verselbstständigt. Kein Gehweg war mehr gerade. Alles war uneben, und hier und da ragte ein Pflasterstein in stummer Rebellion aus dem Boden. Selbst der Asphalt war zu einer kleinen Hügellandschaft geworden. Als liefe man über eine Wiese voll mit Maulwurfshügeln. Was ich zu Beginn als nervig empfunden hatte, bedeutete für mich mittlerweile Normalität. Ich liebte alles hier. Den unebenen Boden genauso wie die bunten Häuser und die melodischen Jazzklänge, die New Orleans wie Magie umgaben. Und zugegeben, die kleinen Macken machten diese Stadt erst zu dem, was sie war, und taten ihrer Schönheit in keinster Weise Abbruch. Die Gärten hatten sich wieder erholt und strahlten in saftigem Grün, die Mauern der Häuser im Garden District waren wieder in edlem Weiß gestrichen, und selbst die Bäume und Sträucher blühten wieder um die Wette.
Heute war ein milder Abend, der von einer frühsommerlichen Brise gezeichnet wurde, die den Duft von Hortensien und Barbecue Grillabenden mit sich trug.
Nana nahm meine Hand und zog mich durch die wolkenlose Nacht in Richtung unseres Stammpubs. Als wir das Rendezvous erreichten, machte sich ein Gefühl der Vorfreude in mir breit. So war es jedes Mal. Jedes Mal aufs Neue verliebte ich mich in das Klacken, wenn die Billardkugeln zusammenstießen und nervös über den Tisch tänzelten. In die tiefen Stimmen der Männer, die lautstark über die nächste Footballsaison stritten. In das Geräusch der Gläser, wenn sie kraftvoll auf den Tresen gestellt wurden. Und nicht zuletzt in die Jazzklänge, die jeder noch so verrotteten Kneipe etwas Edles verliehen.
Einige der Besucher hatten sich an die Wand vor dem Eingang gelehnt, bliesen ihren Zigarettenrauch den Sternen entgegen, lachten über die Liebe und das Leben. Unbeschwertheit. Das war es, was dieser Ort versprach, und das war es, was man bekam.
Wir eilten die Treppe hinauf, dann hielt mir Nana die dunkelrote Tür auf. Ich trat ein und wurde von dem Geruch von frisch gezapftem Bier, Altmännerschweiß und Rauch begrüßt. Der Pub war bereits gut gefüllt. Ich schob meinen Ellenbogen vor und drängte mich entschuldigend an einigen der Gäste vorbei.
Als wir die Theke erreichten, zogen wir uns zwei Hocker heran und ließen uns seufzend in die weichen Polster sinken. Einen Moment sah ich mich um, ließ die ausgelassene Stimmung auf mich wirken.
»Ach, ich freu mich«, quietschte Nana und grinste mich zufrieden an. Es machte mich glücklich, wenn sie glücklich war. Das war sie in letzter Zeit viel zu selten. »Du siehst heute umwerfend aus«, stellte sie fest, ehe sie sich leicht vorbeugte und mein Shirt etwas herunterzog. »Und jetzt ist es sogar noch besser!«
Eilig schlug ich ihr auf die Finger. »Lass das!« zischte ich, doch rang ihr damit lediglich ein Lachen ab. Sie warf die blonden Haare über die Schulter und strahlte mich an.
»Ich will ja nur, dass dieser Abend so günstig wird wie irgend möglich«, erklärte sie schulterzuckend, bevor sie die Hand hob. Ich warf einen Blick über die Schulter und grinste wissend, als Dave zu uns herüberkam. Er war groß, brünett und hatte den Körperbau eines Schwimmers. Ich persönlich konnte dem nicht wirklich viel abgewinnen, aber Nana stand auf Muskeln. Sie hatte mir mal erklärt, dass sie es liebte, wenn sie ihre Nägel beim Sex in das harte Fleisch krallen konnte.
»Ich hätte gern einen trockenen Riesling.« Sie klimperte mit den Wimpern, doch wie jedes Mal, wenn wir hier waren, schien Dave durch sie hindurchzusehen. Mit gerunzelter Stirn beobachtete ich, was sich da vor meiner Nase abspielte. Meine unfassbar hübsche Freundin, die mit ihren langen blonden Locken nahezu jeden Mann um den Finger wickelte, und Dave, der sie nicht einmal zu bemerken schien, obwohl er mit ihr sprach. Nana erwiderte meinen Blick, und ich konnte so etwas wie Enttäuschung in ihrem lesen.
»Für mich nur eine Cola light, danke.« Ich schlug die Karte zu.
»Du schaust jedes Mal in die Karte und bestellst doch immer dasselbe«, brummte jemand. Kurz zögerte ich, dann hob ich den Blick in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Dave sah mich aus blauen Augen heraus an. Es lag ein merkwürdiges Funkeln darin.
»Ist wohl Gewohnheitssache«, murmelte ich und drehte mich zu Nana. Einen Moment sah sie Dave noch nach, dann erst schaute sie wieder zu mir.
»Ich fasse es nicht«, flüsterte sie dann, bevor sie sich zurücklehnte und ergeben die Hände in die Luft warf.
»Seitdem wir das erste Mal hier waren, versuche ich, diesen Typen für mich zu gewinnen, und jetzt plötzlich steht er auf dich?«
»Nana, was redest du da?« Hilfesuchend blickte ich mich nach etwas um, womit ich meine Hände beschäftigen konnte, bis auf die Karte war aber nichts in greifbarer Nähe. Also zupfte ich am Papier der Karte herum.
»Natürlich! Kein Wunder, dass er auf meine Flirtversuche nie eingeht!«, jammerte sie.
»Vielleicht hättest du mein Shirt nicht herunterziehen sollen«, erwiderte ich grinsend.
»Eigentlich hatte ich gehofft, dass du damit die älteren Herrschaften hier entzückst, aber das ist wohl nach hinten losgegangen«, antwortete sie so trocken, dass ich mir ein Lachen nicht verkneifen konnte.
»Nein, nein«, sagte sie schließlich, bevor sie in ihre Tasche griff und sich etwas Lippenbalsam auftrug.
»Ich gönne ihn dir, mein Schatz.« Ich zog eine Braue hoch, wandte mich schließlich ab und sah stattdessen, wie weit Dave mit meiner Cola war. Ich brauchte dringend einen Strohhalm. Etwas zwischen den Fingern.
»Was redest du da?«, fragte ich, weil ich wusste, dass sie es von mir erwartete. Sie lehnte sich wieder nach vorn, kam mir ganz nah. Wir mussten wirken wie zwei Teenager, die etwas ausheckten.
»Sieh ihn dir doch nur mal an!«, flüsterte sie ehrfürchtig, als glaubte sie, dass ich es nicht schon längst getan hätte.
»Ja, er sieht gut aus. Na und?«
»Gut? Er sieht nicht einfach nur gut aus! Ich meine, diese Muskeln. Sieh nur, wie sie sich bewegen, wenn er mit den Flaschen hantiert.« Sie stützte das Kinn auf ihre Hand, beobachtete ihn. Ihre blauen Augen hatten dasselbe Funkeln, das ich auch in seinen gesehen hatte.
»Und diese Augen. Sie sind so blau, ich will darin schwimmen gehen.« Ich prustete los.
»Ich glaube, du bist verrückt geworden!« Obwohl das Licht im Pub gedämmt war, konnte ich sehen, wie ihre Wangen sich rot färbten.
»Ich mein ja bloß! Es wäre eine Verschwendung, wenn dieser Typ uns beiden verloren geht!« Dave kam zu uns herüber und stellte die Getränke ab.
»Bitte sehr, Ladys. Ich nehme an, ihr bezahlt wie immer erst nachher?«
»Ja«, erwiderte Nana, ehe sie meine Cola nahm und lasziv an dem Strohhalm saugte. Sie sah Dave dabei demonstrativ in die Augen. Als ich seinen Blick sah, war ich sichtlich bemüht, nicht loszulachen. Er sah aus wie ein kleiner Junge, dem man gerade erzählt hatte, dass es den Weihnachtsmann doch gab, und lächelte verlegen. Nun hatte er wohl begriffen. Eilig wandte er sich ab und nahm eine weitere Bestellung auf. Doch plötzlich wirkte er gar nicht mehr so desinteressiert, stattdessen schien er vielmehr nervös.
Ich stieß ihr sanft einen Ellenbogen in die Seite. »Du bringst ihn in Verlegenheit!«
»Na endlich. Eine Gefühlsregung!« Sie lachte, und ich stimmte kopfschüttelnd mit ein. Und so verlief der Abend in albernem Gelächter, Zigaretten und viel zu viel Wein für Nana. Und während sie irgendwann mit Dave ins Gespräch kam, hatte ich nur einen Gedanken: Ich musste meine Geschichte heut Abend noch aufschreiben, damit sie mir nicht verloren ging.
Kapitel 2
Gabriel
Es waren die grellen Strahlen der Sonne, die mich wach kitzelten und über mein Gesicht tanzten, als wollten sie irgendjemanden mit dieser Choreografie beeindrucken. Kurz kniff ich die Augen zusammen und blinzelte. Einige Wolken schoben sich vor die Sonne, erlaubten es mir, erst mal wach zu werden. Ich rieb mir übers Gesicht und lehnte träge den Kopf gegen den rauen Stoff der Flugzeugwand. Trügerisch langsam glitten wir durch die weißen Plüschformationen des Himmels, und mich überkam das kindliche Bedürfnis, aus dem Flugzeug zu springen und mich hineinfallen zu lassen. Nur dass Wolken eines der tückischsten Konstrukte der Natur waren. Was uns Halt und Weichheit versprach, war nichts anderes als winzige Wassertröpfchen. Das Flugzeug sackte leicht ab, und wir durchbrachen die weiße Decke. Die Sonne kam wieder hervor, kämpfte sich durch die Wolkenformation, schien mir erneut ins Gesicht. Sie neigte sich träge dem Horizont zu, brachte die Erde unter uns zum Erstrahlen. Ich sah genauer hin und erkannte, dass wir bereits in Louisiana waren. Ich drückte mich an die kühle Wand, als könnte ich dann besser sehen, lugte durchs Fenster. Mein Blick viel auf New Orleans. Die Stadt präsentierte sich stolz in den Strahlen der untergehenden Sonne und zeigte sich von ihrer besten Seite.
Es erschien mir wie ein Wunder. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich hierherkomme. Als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal diese Route geflogen war, hatte ich New Orleans nur kurz vor der Landung gesehen. Gebäude und Laternen, die trotzig aus den Wassermassen emporragten. Büsche, Gartenzäune und Autos, die den Kampf bereits aufgegeben hatten, sich wortwörtlich treiben ließen.
New Orleans hatte sich in ein neumodisches Atlantis verwandelt, eine Stadt, die um das blanke Überleben kämpfte.
Von oben hatte es beinahe friedlich ausgesehen. Das trügerische Schaubild einer Stadt, die dabei war, unterzugehen.
Nie würde ich vergessen, was sich damals hier ereignet hatte. Tiere, die verzweifelt um ihr Leben kämpften, Menschen, die sich auf die Dächer ihrer Häuser retteten, das Geschrei kleiner Kinder, die nicht wussten, was geschah. Hurrikan Katrina hatte einer ganzen Stadt den Atem geraubt. Ein unvorhergesehener Angriff, der viele Menschen das Leben kostete.
Meine Freunde und Familien hatten nicht verstehen können, dass ich mich freiwillig der Gefahr aussetzte, hierherzukommen. Doch als ich mit nichts als einer kleinen Reisetasche und meiner alten Nikon D 2500 aus dem Flugzeug gestolpert war, wusste ich, weshalb ich hier war. Weswegen ich hier sein musste. Irgendjemand musste festhalten, was niemand hatte glauben wollen – dass nicht nur Menschen, sondern ganze Städte ertrinken können.
Es gab ein paar, die mir unterstellten, sensationsgeil zu sein. Mich an der Grausamkeit zu erfreuen, meinen Vorteil daraus zu ziehen. In meinem Job hatte ich immer wieder mit diesem Vorurteil zu kämpfen. So war das wohl, wenn man eine Kamera in der Hand hielt. Mittlerweile entlockte es mir nur noch ein müdes Lächeln, ein Kopfschütteln. Solche Leute hatten nichts verstanden. Es gab einen Unterschied zwischen Sensationsgeilheit und Dokumentation.
Bei meiner Arbeit ging es nicht darum, die Neugier der Menschen zu befriedigen. Vielmehr ging es darum, Augen zu öffnen, die Leute zum Hinsehen zu zwingen. Unsere Spezies ist wahnsinnig gut darin, die Augen vor den wirklich wichtigen Dingen im Leben zu verschließen, vor Affären, toxischen Menschen, Kriminellen, Krankheiten, dem Klimawandel. Katrina war Gesprächsthema Nummer eins gewesen, aber wie lange? Wie lange hatte man darüber gesprochen, bevor es niemanden mehr interessiert hatte?
Auf der Welt passierten tagtäglich schlimme Dinge. Doch irgendwann wollte es niemand mehr sehen. Es frustrierte die Leute. Und solange sie nicht betroffen waren, wandten sie lieber den Blick ab.
So war es immer. Die Welt mochte durch solche Ereignisse kurz stehen bleiben, doch nach einigen Tagen drehte sie sich in gewohntem Tempo weiter. Und nur wenige stellten das infrage. Es betrifft mich ja nicht. Eine der meist erzählten Lügen.
Aber ich konnte das nicht akzeptieren. Die Welt musste lernen, ihre Augen nicht länger zu schließen, sondern hinzuschauen.
Also blieb ich in New Orleans. Reiste an Tag eins an und blieb weitere 365 Tage. Ich machte Fotos, hielt fest, wie die Bewohner einer Stadt sich gegen die Kraft der Natur wehrten, wie sie der Hoffnung nachrannten, kämpften und schließlich losließen, was ohnehin zerstört war.
Ich war ein stummer Beobachter, in einem Krieg, den niemand als solchen betrachtete. Dabei kämpften die Menschen tagtäglich.
Gegen das Wasser. Für ihre Familie. Ihr Hab und Gut.
Aber es war ein Kampf, den die meisten nur verlieren konnten.
Die Menschen mussten dabei zusehen, wie ihre Häuser davongespült wurden, Erinnerungen an ihre Vergangenheit, Andenken geliebter Menschen, die Zukunft, die sie sich erhofft und ausgemalt hatten.
Zu sehen, wie ein Mensch alles verlor, was ihm heilig war, änderte die eigene Einstellung zum Leben.
Es war der Klang des mir nur allzu vertrauten Zeichens, sich anzuschnallen, welches mich zurück in die Gegenwart brachte.
»Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns nun im Landeanflug und werden New Orleans erreichen. Bitte bringen Sie Ihre Sitze und Tische in Ausgangsposition. Öffnen Sie die Fensterblenden und schnallen Sie sich an.« Ich tat wie geheißen und ließ mich zurück in den Sitz sinken. Erneut fiel mein Blick auf New Orleans.
Eine Stadt, die für mich symbolisch für den Phönix stand, der sich aus seiner Asche erhob. Eine Stadt voller zerbrochener Träume, zerstörter Leben. Eine Stadt voller Kampfgeist und voller Hoffnung.
Als ich das Wilson-Sister’s Home sah, musste ich unweigerlich lächeln. Mittlerweile hatte man die Holzpanelen gelb gestrichen, und wo vor zehn Jahren nur Wasser und Schlamm gewesen waren, erstrahlte nun eine grüne Rasenfläche, die von einem schwarzen Messingzaun eingerahmt wurde. Angelique, die Leiterin des Heims, stand bereits am Eingangstor und winkte aufgeregt.
Eilig drückte ich dem Fahrer ein paar Scheine in die Hand, bevor ich mich aus dem Taxi schwang und die laue Abendluft einatmete. Es mochte lächerlich klingen, doch ich hatte den Eindruck, New Orleans würde noch immer den Geruch des Wassers verströmen. Zusammen mit dem Duft frisch gemähten Rasens und erhitzten Holzes erschien es mir diesmal jedoch nicht negativ. Vielmehr erinnerte es mich an meine Kindheitstage, als ich gemeinsam mit meiner Familie in die Berge zum Kanufahren gereist war.
»Gabriel, schön, dass du endlich da bist«, begrüßte mich Angelique, ehe sie mir entgegenlief.
»Angelique!« Die gedrungene, kurvige Frau schien sich kaum verändert zu haben. Sie trug ein dunkelblaues Blümchenkleid, das sie auch bei meiner Abreise letztes Jahr getragen hatte. Ich überbrückte die wenigen Meter zwischen uns und schloss sie in eine herzliche Umarmung. Ihre braunen, krausen Locken kitzelten meine Nase, und der Geruch von Plätzchenteig füllte sie. Ich lächelte, umarmte sie noch fester. Ich war ihr dankbar, dass sie sich die Zeit nahm, mich zu begrüßen. Da es schon fast zehn war, sollte sie eigentlich längst zu Hause sein.
»Es tut gut, dich zu sehen«, sagte ich und meinte es auch so. Angelique und ich hatten uns kennengelernt, als ich ganz zu Beginn meines Aufenthalts wegen Katrina Bilder vom Waisenhaus gemacht hatte, und als mein Hotel überflutet worden war, hatte sie mir einen Platz im Stockbett angeboten. Nur selten war ich einem Menschen wie ihr begegnet. Mit ihren beinahe 55 Jahren hatte sie schon viel von der Welt gesehen und vor allem viel bewirkt. Ihr Herz schien beinahe grenzenlos zu sein, und ihre Liebe zu den Menschen und dieser Stadt war unerschütterlich. In all der Zeit, die ich sie und ihre Arbeit begleitet hatte, hatte es keinen Tag gegeben, an dem sie nicht wenigstens einem Menschen etwas Gutes getan hatte. Wenn man mich fragen würde, ob es Engel gäbe, wäre meine Antwort immer Ja. Sie erschienen uns vielleicht nicht mit Flügeln und Heiligenschein, aber dafür in Menschen wie Angelique.
»Wie geht es dir, mein Lieber?«, fragte sie, als sie sich von mir löste und sich zum Taxi umdrehte. Sie öffnete den Kofferraum und griff nach einem meiner zwei Koffer.
»Gut! Sehr gut!«, erklärte ich, bevor ich neben sie trat und den zweiten Koffer heraus hievte. Anschließend schmiss ich die Klappe zu und klopfte einmal drauf. Die Bremslichter leuchteten auf, dann fuhr das Taxi davon und hinterließ nichts als eine unangenehme Abgaswolke.
»Das freut mich zu hören! Toll siehst du aus.« Sie rieb mir über den Oberarm, wobei sie sich auf die Zehenspitzen stellen musste.
»Das kann ich nur zurückgeben.« Die letzten Jahre zeigten sich in ihrem Gesicht. Falten umrahmten ihre Augen mittlerweile wie ein Fächer, und die Zornesfalte schien sich mit jedem Jahr tiefer in ihre Stirn zu graben, doch von ihrer Ausstrahlung war nichts der Zeit gewichen. Noch immer waren da diese Herzlichkeit und Freude, die sie ausstrahlte. Eine Offenheit, die sie durch ihre Augen nach außen trug und die ihr scheinbar nichts nehmen konnte.
»Na los, komm, genug des Geplänkels. Du musst doch erschöpft sein!«
Ich machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich wünschte, ich müsste es nicht sagen, aber mittlerweile gehört der Jetlag zu mir wie der Sand zum Meer.«
Ihr Lächeln wurde breiter. »Aber ist das nicht das, was du immer wolltest? Reisen? Auf die Orte aufmerksam machen, die wir Menschen lieber vergessen würden?«
Ich senkte die Lider, zog den Handgriff des Koffers heraus.
»Ja, war es. Und ich will mich auch gar nicht beschweren, aber jeder Beruf verlangt seine Opfer.«
Ihr Lächeln erstarb. »Vielleicht kannst du jetzt etwas zur Ruhe kommen. Fangen wir damit an, dass ich dir deine Bleibe zeige.«
Ich nickte und folgte ihr. Die Straßen New Orleans hatten unter den Wassermassen ebenso gelitten wie ihre Bewohner. Der Asphalt war teilweise aufgesprungen, tiefe Furchen durchzogen die ganze Stadt. Das Wasser und die vergangenen Jahre hatten sich in den Boden gegraben wie die Falten in einen alternden Menschen.
»Da sind wir schon«, verkündete Angelique, nachdem wir die Straße überquert hatten und einen schwarzen Zaun erreichten.
»Wenn ich daran zurückdenke, wie es hier aussah, als ich vor zehn Jahren da war, kann ich nicht glauben, wie ihr es geschafft habt, alles wiederaufzubauen«, sagte ich, während ich die Eindrücke und Veränderungen förmlich in mich aufsaugte. Vor mir erstreckte sich eine bunte Häuserfront in kreolischem Stil, wie es für New Orleans typisch war.
»Das sagst du jedes Jahr, wenn du zu Besuch kommst«, stellte sie fest und entlockte mir damit ein verlegenes Lächeln. »Das wird deine Unterkunft sein.« Angelique deutete auf das weiße Haus vor uns. Es war einstöckig und verfügte über eine breite Veranda, mit bodentiefen, abgerundeten Fenstern. Wie auch alle angrenzenden Häuser war es mit Holz verkleidet und verfügte über dunkelgrüne Fensterläden und eine weiße Holzfriese entlang der Dachkante.
»Das ist meine Unterkunft? Ich dachte, ich bekomme einen Platz im Stockbett«, erklärte ich ehrlich erstaunt. Obwohl die Häuser in der Eight Street schmal und klein wirkten, konnten sie an Pracht mit den Villen im Garden District mithalten, woran wohl nicht zuletzt auch der gepflegte Vorgarten schuld war.
Angelique lachte. »Nach Katrina hat ein bekannter Geschäftsmann viel Geld in den Wiederaufbau dieses Bezirks gesteckt, daran erinnerst du dich vielleicht. Letztes Jahr hat er dieses Gebäude für uns renoviert und mir gegen einen kleinen Obolus zur Verfügung gestellt. Zusammen mit einem alten Chevrolet. Seither können wir Gäste oder Mitarbeiter auf Zeit hier unterbringen. Es wird dir gefallen.«
Sie drückte die Klinke der kleinen Gartentür herunter und führte mich durch den Vorgarten zur Eingangstür. Ich blieb am Fuße der Veranda stehen und wartete, bis Angelique einen großen Schlüsselbund aus ihrer Tasche gezogen und die Tür geöffnet hatte. Drinnen drehte sie sich um, offenbar suchte sie nach dem Lichtschalter. Ich folgte ihr bis auf die Veranda. Dunkelrotes Gartenmobiliar versprach gemütliche Sommerabende. Auf dem Tisch stand ein Aschenbecher, der übervoll mit Zigarettenstummeln war.
»Bin ich alleine?«, fragte ich, bevor ich eintrat.
»Nein, derzeit sind noch zwei Mädels hier untergebracht. Nachdem Nadja gekündigt hat, hat uns meine Schwester eine Mitarbeiterin aus Boston zur Verfügung gestellt, und diese hat spontan noch ihre beste Freundin mitgebracht.«
»Wunderbar! Und wie machen sie sich?« Während meiner Zeit hier hatte ich erfahren müssen, dass nicht alle Betreuer ihre Arbeit wirklich machten, weil sie es liebten.
Angelique lächelte, wobei ihre Augen noch mehr zu funkeln schienen als sonst. »Amanda arbeitet nicht bei uns. Und Evelyn …« Sie seufzte, lächelte gedankenverloren. »Ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der diesen Beruf so sehr liebt. Sie geht richtig darin auf, und bei dem Gedanken, dass sie uns irgendwann wieder verlassen muss, wird mir schon ganz mulmig.«
Ich lächelte. »Genieß einfach die Zeit, in der sie hier ist.«
Sie nickte. »Das mache ich.«
»Wissen sie, dass ich komme?«, fragte ich, ehe ich meinen Rucksack an eine schmale Kommode im Flur sinken ließ.
»Noch nicht. Du hast mir ja gestern Abend erst Bescheid gegeben. Aber ich werde ihnen ein Zettel da lassen.«
Ich lachte. »Hoffentlich sehen sie den, bevor sie mich sehen. Nicht, dass sie noch einen Herzinfarkt kriegen.« Sie stimmte in mein Lachen mit ein, und als sie den Lichtschalter endlich fand, wurde es hell in dem kleinen Flur. Unter meinen Füßen knarzte dunkles Parkett, auf dem ein roter Fransenteppich lag.
»So, da wären wir. Ich wünschte, ich könnte selbst hier leben.« Sie lachte verschmitzt, bevor sie die Hände in die Hüfte stemmte und mir dabei zusah, wie ich mich meiner Schuhe entledigte.
»Also, hier ist der Jackenständer, der, wie ich grade sehe, ziemlich voll gehängt ist … Diese Weiber! Und dort …« Sie deutete auf die gegenüberliegende Seite. »… ist der Schuhschrank. Ich schätze, die Mädels haben alles belegt, also schaff dir einfach ein wenig Platz.« Auf der Ablage des Schuhschranks stand eine goldene Schüssel, aus der ein bunter Schlüsselbund ragte. Er war mit Nagellack bemalt. Angelique drehte den Hausschlüssel von ihrem massiven Bund und legte ihn neben den anderen, bevor sie sich kurz im Spiegel betrachtete und sich hastig über ihre braunen Locken fuhr, als könnte sie sie mit dieser simplen Bewegung bändigen.
Dann sah sie mich erwartungsvoll an. Eilig zog ich mir die Jacke aus und hängte sie über den Ständer. Sie ging in den nächsten Raum, knipste das Licht an.
»Hier ist das Wohnzimmer. Sofa, Fernseher, dort Küche, Esstisch und …« Sie stockte kurz und lachte dann. »Stoffe.« Ich betrat hinter ihr den Raum und sah mich einen Moment um. Auf der linken Seite befand sich eine offene Küche. Sie schien modern. Auf der rechten Seite des Raumes befand sich das Wohnzimmer. Die Sofas waren etwas durchgesessen, doch man konnte sich nicht wirklich beklagen. Bunte abstrakte Bilder zierten die Wände, und auch sonst hatte man nicht an Farbe gespart. Über der Küchenzeile hingen in roten Lettern die Worte New Orleans, die Wände waren in Zitronenfaltergelb, und der Kamin neben dem Sofa war limettengrün gestrichen. Dieses Haus hatte eingefangen, was New Orleans auszeichnete: Vielfältigkeit, Farbe und Lebendigkeit. Hinzu kam der milde Geruch von Lavendel und Minze. Ein Blick in die Küche verriet mir, woher der Geruch rührte – das Fensterbrett war mit allen möglichen Kräutertöpfen zugestellt.
»Es ist wunderschön hier!«, sagte ich und streifte mit dem Blick einige gigantische Rollen Stoff. Scheinbar nähte eine meiner Mitbewohnerinnen.
»Was habe ich gesagt? Wenn du um die Ecke schaust, steht dort der Esstisch.« Ich lief an ihr vorbei, weiter in den Raum hinein, und beugte mich an einer Trennwand vorbei. Dort entdeckte ich einen runden massiven Esstisch, auf dem ein großer Blumenstrauß stand. Im Hintergrund war eine gekorkte Wand zu sehen, an der allerhand Notizen hingen. Allerdings konnte ich sie auf die Entfernung nicht entziffern. Ich sah zurück zu Angelique.
»Na komm, ich zeige dir dein Zimmer.« Ich folgte ihr durch eine verglaste Flügeltür in einen gedrängten, fensterlosen Flur, von dem vier Türen abgingen. Pflanzen standen an den Wänden und beengten den kleinen Korridor noch mehr.
»Auf der linken Seite sind die Zimmer der Mädels, und auf der rechten Seite ist deins.« Sie lief den schmalen Gang entlang und öffnete die Tür.
»Das Bett ist frisch bezogen, und ich habe dir ein paar Handtücher hingelegt.«
»Du bist ein Schatz!« Ich ging zu ihr und drückte ihr einen aufrichtigen Kuss auf die Wange. Angelique hatte dieselbe herzliche Art wie meine Mutter, und ich wünschte, es würde mehr Menschen wie sie geben.
»Für dich doch immer, Gabriel.« Sie machte das Licht an, dann ging sie einen Schritt zur Seite. Das Zimmer erstrahlte ihn einem dunklen Grünton, der zu grell für Oliv, aber zu dunkel für Limette war. Ansonsten wirkte es mit dem gigantischen Bett aus Messing und dem restlichen Mobiliar, das definitiv zu reichlich für den kleinen Raum war, etwas eng. Aber ich mochte es, denn es erinnerte mich an mein erstes Zimmer nach dem Auszug aus meinem Elternhaus. Wenig Fläche, dafür aber alles, was man brauchte – Schreibtisch, Kommode und ein Schrank. Das absolut Nötigste und doch zu viel für 15 Quadratmeter, woran auch die zahlreichen Pflanzen Schuld trugen, die überall verteilt waren.
»Am besten machst du die Fensterläden nachts zu. Die Vorhänge halten das Licht nicht wirklich ab.« Noch während sie das sagte, ging sie zu den Fenstern und zog die dunkelgrauen Vorhänge zu. »Aber immerhin schützen sie dich vor neugierigen Blicken.« Sie zwinkerte mir kurz zu, dann deutete sie auf den Kamin. Er war hinter einer großen buschigen Pflanze versteckt, die ich mit meinen mageren Botanik-Kenntnissen nicht einordnen konnte – fest stand nur, dass sie dabei war zu sterben.
»Holz findest du in der Abstellkammer am Ende des Flurs, auch wenn ich bezweifle, dass du das jemals brauchen wirst.« Sie drehte sich kurz im Kreis, als wolle sie sichergehen, dass sie nichts vergessen hatte.
»Ach so, der Schreibtisch wackelt etwas.«
Ich sah zu dem breiten Schreibtisch, über dem auf einem schmalen Regalbrett zahlreiche Pflanzen vor sich hinvegetierten und sichtlich nach Wasser dürsteten.
»Ich habe versucht, es mit Papier zu fixen, schau mal, ob du damit zurechtkommst. Ansonsten habe ich gehört, dass es sich am Esstisch auch sehr gut arbeiten lässt.« Sie stemmte die Hände in die Hüften und schaute sich erneut um, als würde sie nach Antworten auf eine Frage suchen, die sie sich noch gar nicht gestellt hatte.
»Mir ist so, als hätte ich irgendwas vergessen.« Sie sah mich mit gerunzelter Stirn an. »Ach ja! Die Kommode dort habe ich dir ebenfalls frei geräumt, schau am besten mal, ob du deine Sachen alle reinbekommst, ansonsten habe ich drüben noch einen Kleiderständer, den wir derzeit nicht brauchen. Hast du irgendwas, das hängen muss?«
Ich schüttelte den Kopf, dann ging ich zu ihr und legte ihr die Hände auf die Schultern.
»Angelique. Es ist alles wunderbar. Ich danke dir vielmals. Das ist viel mehr, als ich erwartet habe. Und jetzt bitte … Es ist schon fast halb elf. Geh nach Hause und ruh dich aus. Ich komme schon zurecht.«
Sie nickte. »Wenn irgendwas sein sollte, weißt du ja, wie du mich erreichen kannst, richtig?«
»Ja, Angelique.« Ich lachte, dann schob ich sie regelrecht zur Tür.
»Okay, dann bis morgen! Und sag den Mädels, sie sollen nett zu dir sein! Sonst bekommen sie es mit mir zu tun.« Sie fuchtelte mit dem Zeigefinger hin und her, dann verschwand sie aus dem Zimmer.
»Schlaf gut!«
»Du auch. Ich hänge noch kurz einen Zettel ans Korkbrett, dann bin ich weg! «, erwiderte sie. Einen Moment blieb ich noch stehen, ehe ich aufs Bett sank. Es quietschte.
Ich schloss lächelnd die Augen. Auf diesen Trip freute ich mich nun schon seit Monaten, und jetzt war ich endlich hier. Es war an der Zeit gewesen rauszukommen. Und auch wenn ich mich noch in den Staaten befand, tat es mir gut, für ein halbes Jahr mal fernab von allem zu sein, was mich sonst so begleitete. Es war eine Weile her, dass ich mir Zeit für eine Fotostrecke genommen hatte. Je bekannter und renommierter meine Bilder geworden waren, desto weniger Zeit hatte ich. Mein Leben bestand nur noch aus Tankstellenbrötchen, Jetlag und Reisetabletten. Doch für diese Fotostrecke wollte ich mir Zeit nehmen. Die Stadt und die Menschen hier verdienten es. Ich verdiente es. New Orleans sollte nicht nur Arbeit für mich sein, sondern allem voran auch eine Auszeit. Eine Auszeit von all den Dingen, von denen ich mir und meiner Familie vormachte, sie würden mich nicht belasten.
Einen Moment blieb ich noch liegen und starrte an die Holzvertäfelung der Decke, dann rappelte ich mich noch einmal auf und ging zurück in die Küche. Angelique war bereits fort. Im Abwaschbecken stapelten sich Tassen und Müslischüsseln, und ich konnte mir nicht helfen, aber ich musste grinsen. All das erinnerte mich an meine Studienzeit. Fünf Jahre hatte ich in einer WG gelebt, und manchmal vermisste ich die Zeit.
Es war nicht so, dass ich mich dagegen sträubte, älter zu werden – ganz im Gegenteil. Doch mit zunehmendem Alter musste ich auch erkennen, dass sich nicht alle Pläne so verwirklichten, wie man es plante. Mich noch einmal kurz so zu fühlen wie mit Anfang zwanzig tat erstaunlich gut. Vor allem, da mich nur noch ein Jahr von der 30 trennte. Ich ging zum Kühlschrank und öffnete ihn. Mir entfuhr ein leises Lachen. Im obersten Regalfach stapelten sich die Süßigkeiten regelrecht. Gummibärchen, Kinderschokolade, Fertigkuchen. Alles, was das Herz begehrte, war derart aufgereiht, dass es das Licht des Kühlschranks blockierte. Ich ließ den Blick nach unten schweifen und lachte erneut. In schönstem Kontrast zum Süßigkeitenfach war das Fach darunter voller Karotten, Salat, Gurken, Tomaten und Rotkohl. Scheinbar waren meine Mitbewohnerinnen sehr unterschiedlich.