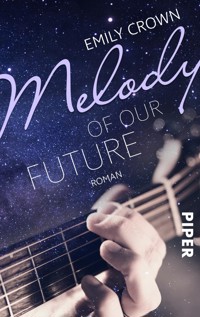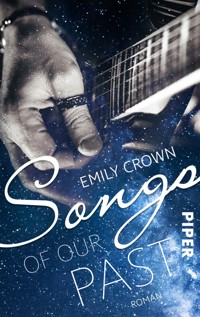9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Evelyn und Gabriel - wieviel Schmerz erträgt die Liebe?
Die Erinnerung an Evelyn schmerzt immer noch. Zu groß waren Gabriels Gefühle für sie. Doch da ist auch Grace, die mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem Verständnis einen festen Platz in Gabriels Herzen hat. Nach und nach wachsen sie zu einer Einheit zusammen und Gabriel versucht alles, um neu anzufangen. Dann jedoch holt ihn die Vergangenheit wieder ein und Gabriel muss schließlich die schwerste Entscheidung seines Lebens treffen …
"Emily Crown zaubert mit Worten und verwebt die Zeilen mit so viel Gefühl, dass ich mich mit den Charakteren verliebt und mit ihnen gelitten, jede Emotion bis tief in mein Herz gespürt habe." Maren Vivien Haase.
Dritter Band der großen „Zwischen uns das Leben“-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Evelyn und Gabriel – wieviel Schmerz erträgt die Liebe?
Die Erinnerung an Evelyn schmerzt immer noch. Zu groß waren Gabriels Gefühle für sie. Doch da ist auch Grace, die mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem Verständnis einen festen Platz in Gabriels Herzen hat. Nach und nach wachsen sie zu einer Einheit zusammen und Gabriel versucht alles, um neu anzufangen. Dann jedoch holt ihn die Vergangenheit wieder ein und Gabriel muss schließlich die schwerste Entscheidung seines Lebens treffen …
Dritter Band der großen »Zwischen uns das Leben« Trilogie.
Über Emily Crown
Emily Crown, geboren 1998, lebt als freie Autorin und Sprecherin am Bodensee. Schon als Kind liebte sie es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich in ferne Welten zu träumen. Nicht verwunderlich also, dass sie ihre erste große Liebe in der Literatur fand. Es folgten einige Jahre als begeisterte Leserin, ehe sie im Alter von 12 Jahren begann, eigene Geschichten zu Papier zu bringen. Heute schreibt sie über die Höhen und Tiefen der Liebe und all die Gefühle dazwischen.
Auf ihrem Instagram-Kanal @autorin_emilycrown tauscht sie sich mit ihren Leser:innen aus.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Emily Crown
Zwischen uns das Meer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Nachwort
Danksagung
Impressum
Playlist
Lord Huron –
The Night We Met
A Great Big World, Christina Aguilera –
Say Something
Arch Leaves, Randy Coleman –
Nowhere to Go
Red Hot Chili Peppers –
Wet Sand
Marvin Gaye, Tammi Terrell –
Ain’t No Mountain High Enough
Mumford & Sons –
White Blank Page
Taylor Swift, Bon Iver –
exile (feat. Bon Iver)
Ben E. King –
This Magic Moment
Derik Fein –
Retrograde
Lana Del Rey –
Happiness is a butterfly
Edward Sharpe & The Magnetic Zeros –
Home
Kapitel 1
Evelyn
Ich war ein Mädchen, das davonrannte. Damals wie heute.
Ich rannte, ohne den Weg zu kennen. Flüchtete, ohne zu wissen, wohin. Meine Füße gruben sich in den nassen Sand unter mir, Wasser umspülte erst meine Waden, schlug gegen mein Becken, spritzte gegen mein ertrinkendes Herz und verschlang irgendwann meinen ganzen Körper. Ich steuerte unaufhörlich auf ein Meer aus Flammen zu, doch bevor ich verbrennen konnte, schnappte ich nach Luft und ließ mich fallen. Ich schwebte, trieb tiefer und tiefer, in eine alles umfassende Stille, in der lediglich mein pulsierender Herzschlag widerhallte, wo weder Raum noch Zeit existierten. In der es nur mich gab. Ein Tropfen auf offenem Meer.
Ich hatte die Augen geschlossen, weinte, obwohl um mich herum nichts als Wasser war, trieb in der Stille umher, weil ich wusste, sobald ich auch nur einen einzigen Gedanken zuließ, würde ich explodieren – vor Schmerz, Wut, Trauer, vor diesem unerträglichen Gefühl eines gebrochenen Herzens, das zwar irgendwie noch schlug, aber eigentlich auch nicht mehr, das nur noch ein Organ war, dem die Seele entflohen war.
Eine Hand berührte mich am Arm, zog mich nach oben. Haut an Haut, Stoff an Stoff, Schmerz an Schmerz. Zwischen uns nichts als das Wasser und die Last ungesagter Worte. Er schlang die Arme um mich, zwang mich in eine Umarmung, die so fest, so innig war, dass ich seinen Herzschlag spüren konnte. Er bohrte sich in meine Brust, schnell und heftig – im Einklang mit meinem. Es waren die Herzen zweier Menschen, die einst im Takt der Liebe pulsiert und nun nur noch durch Schmerz miteinander verbunden waren. Zwei Herzen, die nur noch schlugen, um zu überleben.
»Nicht«, flehte er, mit dieser tiefen Stimme, die mir die Welt bedeutete. »Lauf nicht davon.« Drei Worte, gewispert im Wind, drei Worte, die alles sagten, was ich hören wollte, und doch nicht genug.
Ich rang um Atem, hustete, und mit jedem Atemzug schienen die Bilder in meinem Kopf klarer zu werden. Blonde Löckchen, meine Hand am Geländer der Treppe, hektische Schritte, die durchs Treppenhaus hallten, das Kreischen der Bremsen, ein dumpfer Aufprall, der dem gleichkam, wie ich mich gefühlt hatte, als ich das Wort Papa hörte.
Kraftlos sank ich in Gabriels Arme. Die Arme, die mich schon einmal aufgefangen hatten.
»Du lebst«, wisperte er. »Du lebst!«, rief er noch einmal aus. Ungläubig diesmal. »Du lebst, du lebst, du lebst!« Er löste sich von mir, nahm mein Gesicht zwischen seine Hände, sah mich an. Da waren sie wieder. Die tiefblauen Augen, in denen ein ganz eigener Ozean seine Wellen schlug. »Du lebst«, flüsterte er noch einmal, dann schlang er erneut die Arme um mich, hob mich hoch und schwang mich durchs Wasser, fast so, als wäre ich schwerelos. Als meine Füße erneut im Sand versanken, sah er mich ein weiteres Mal an, fuhr mir über die Haare, die Arme. Er berührte mich, als wollte er sich vergewissern, dass ich keine Fata Morgana war. Und ich?
Ich stand einfach nur da. Wie gelähmt vor Schmerz und Fassungslosigkeit. Seine Augen unter den dichten, dunklen Brauen funkelten heftiger als das kristallklare Wasser, seine Zähne blitzten im Morgenlicht, als er mich anstrahlte, und seine Tränen vermischten sich mit den salzigen Tropfen des Meeres.
»Du lebst«, wiederholte er noch einmal, und als er mit seinen rauen Händen meine Wangen berührte, verschwand die anfängliche Euphorie aus seinen Augen. An die Stelle von Freude und Erleichterung trat eine Erkenntnis, die mich beinahe zu Boden zu werfen drohte. Ich schluckte, weil ich das Gefühl hatte, zu ersticken, und noch während ich in seine Augen sah, begann die Trauer mich zu durchfluten, als würde das Wasser durch meine Haut in meinen Körper sinken. Mich beschweren und mir die Last der Vergangenheit auferlegen. Meine Lungen brannten, Tränen drückten mir hinter den Lidern.
»Ja«, wisperte ich. »Ich lebe.« Jedes einzelne Wort hing in der Luft wie eine Gewitterwolke, die einen rauen Sturm ankündigte. Und obwohl es niemand laut auszusprechen wagte, vibrierte die Luft von der Spannung des Ungesagten.
Ich lebe, und du warst nicht da, als ich aufgewacht bin.
Wir schauten einander an und konnten die stummen Worte in den Augen des anderen lesen: der Vorwurf in meinen, die Erkenntnis in seinen. Er kam auf mich zu, schloss die Arme erneut um mich, als befürchtete er, das Meer könnte mich sonst davonspülen.
Keiner von uns gab auch nur einen Ton von sich. Stattdessen legte Gabriel seinen Kopf in meine Schulterbeuge, und obwohl mein Körper nass vom Wasser war, spürte ich die Tränen, die heiß auf meine Schulter tropften.
Ich wollte ihn wegstoßen und ihn zugleich noch fester an mich ziehen. Wollte, dass er mich losließ, jedoch weiterhin seine Arme spüren. Konnte nicht mit ihm, aber auch nicht ohne ihn. Ich wollte zu viel. Es war die Erkenntnis, dass ich nichts mehr von ihm verlangen durfte, dass ich kein Teil mehr seines Lebens war, die mich zu Boden drückte. Meine Knie wurden weich, gaben der Schwere meiner Emotionen nach. Gabriel hielt mich fester, krallte sich beinahe in meine Seiten. Sein dunkelblonder Bart pikste meine Haut wie kleine Nadelstiche, und er war im Begriff, mich mit seinen starken Armen zu erdrücken.
»Es tut mir so leid«, wisperte er erneut, doch seine Worte trieben mit dem Wind davon, waren kurz darauf nur noch eine Erinnerung. So wie die Worte in seinen Briefen. Nichts als Erinnerungen.
»Wieso?«, fragte ich, bebend vor Schmerz.
»Wieso?«, schrie ich, während ich mich noch fester an ihn drückte, nur um ihn im selben Moment von mir stoßen zu wollen. Wieso hatte er mir nicht gesagt, dass er einen Sohn hatte? Wieso hatte er mir das all die Monate verheimlicht? Wieso war er gegangen? Was machte diese Frau hier? Was war passiert?
Er löste sich von mir, packte mich sanft, aber bestimmt an den Oberarmen. Seine blauen Augen waren so nah, dass ich mich darin zu verlieren drohte. Im Sturm, der darin zu wüten schien. Weitere Tränen drängten unter meinen Augen hervor.
»Wieso nur, Gabriel, wieso?« Ich begann mit den Fäusten gegen seine Brust zu hämmern, wusste nicht, wohin mit all der Wut und dem Schmerz, der mich schier aufzufressen, zu verschlingen drohte.
»Wieso hast du uns aufgegeben?«
Gabriel weinte ebenfalls. Nicht laut und rasend wie ich. Nicht vor Wut. Seine Tränen waren still und schmerzerfüllt. Sie standen für all das, was zwischen uns geschehen und nun vorbei war. Sie standen für das »Wir« der Vergangenheit, das es in Zukunft nicht mehr geben würde.
»Evelyn«, flehte er und nahm sanft meine Fäuste. »Es tut mir so leid, hörst du?« Ich stieß seine Hände weg, nur um im nächsten Moment doch zuzulassen, dass er mich zurück in seine Arme zog.
»Wieso?«, fragte ich erneut, während ich einfach nur weinte, dem Schlagen seines Herzens lauschte, die Trauer zuließ, die jeden Zentimeter meines Körpers auszufüllen begann. Doch plötzlich fanden die Worte von allein zu mir. Seine Worte. Die Briefe setzten sich vor meinem inneren Auge wieder zusammen. Die Entschuldigungen, der Schmerz, die Sehnsucht. Wo sich zuvor Wut mit Trauer vermischt hatte, Schock mich elektrisierte, stellte sich nun eine alles überwiegende Erkenntnis ein. Während ich beinahe taub vor Schmerz in seinen Armen lag, dem Rauschen der Wellen lauschte, als könnten sie all meine Gefühle wegspülen, sagte Gabriel immer und immer wieder: »Es tut mir so leid«, während sein Körper unter mir bebte und er leise schluchzte.
Ich lehnte mich etwas zurück, um sein Gesicht sehen zu können. Lange, blonde Strähnen fielen ihm in die Stirn. In seinen Augen standen Tränen, und alles an ihm schien verkrampft. Die tiefen Falten auf seiner Stirn, der angespannte Kiefermuskel. Da war diese Starre in seinem Gesicht, und doch war nicht zu verkennen, welcher Schmerz in jeder einzelnen Zelle seines Körpers wütete. Welche Schuld.
Gabriels Hand glitt liebevoll über meine Wange. Langsam schloss ich die Lider und ließ mich in seine Berührung sinken.
»Es tut mir so leid«, sagte er noch einmal, und als ich die Augen wieder öffnete, prallte mir der Sturm in seinen Augen entgegen. All die Fragen, all die ungesagten Worte. Doch obwohl ich zornig auf ihn sein wollte, konnte ich es nicht. Ich hasste ihn für das, was er mir angetan hatte, für die Lügen. Aber ihn an der Seite einer anderen Frau – das war nichts, was ich nicht schon einmal gesehen hatte. Denn wenn ich während der letzten Nächte im Bett gelegen hatte und die Anstrengungen des Reisens von mir abgefallen waren, hatte sich mir dieses Bild mehr als einmal aufgedrängt. Immer und immer wieder. Allerdings mit dem Unterschied, dass ich es hatte verdrängen können, was mir mit der Wahrheit wohl nicht so leicht gelingen würde.
Sanft legte ich meine Hand an seine Wange, sog alles an ihm in mich auf. Die plötzlich schulterlangen blonden Haare. Die sonnengebräunte Haut. Seine altertümliche Hornbrille, die über und über mit Wassertropfen besprenkelt war. Die blonden Bartstoppeln, die unter meinen Fingerkuppen kratzten. Diese vollen Lippen, die er so oft auf meine gepresst hatte oder die sanft mein Ohr berührten, wenn er mir leise Versprechen hinein geflüstert hatte. Er sah aus wie eine Mischung aus glücklich und todtraurig. Neu entdeckt und immer noch der Alte.
Er schloss die Augen, und seine Wimpern warfen einen dunklen Schatten auf seine Wangen. Sehnsüchtig schmiegte er sein Gesicht in meine Hand, legte seine Finger um meine. Diese simple Berührung reichte aus, und alles in mir zog sich zusammen. Mir wurde ganz warm, und trotz allem schien für einen Moment mein Herz im gewohnten Rhythmus zu schlagen, als wäre seine Berührung ein Pflaster, das sich um mein geschundenes Herz legte und alles zusammenhielt. Ich konnte ihn riechen, dieses salzige Aroma mit einem Hauch von Minze. Es war der Duft von Heimat und Geborgenheit.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass du hier bist«, murmelte er leise, bevor er die Augen öffnete. Diese verfluchten Augen.
»Ich auch nicht«, erwiderte ich, wich seinem Blick aus und sah stattdessen an ihm vorbei in Richtung des Strandes. Er war leer. Die Frau und Gabriels Sohn waren verschwunden.
»Evelyn?«
»Hm?« Ich drehte mich wieder zu ihm. Er lächelte schwach, wobei er in das klare Wasser starrte, das uns ebenso zu verschlucken schien, wie unsere Gefühle es taten.
»Wir sollten reden«, erklärte er. »Ich meine … Können wir reden?« Sein Blick wurde flehend. Ich biss mir auf die Lippe, sah auf meine Finger, ehe ich schließlich nickte. Natürlich würde ich mit ihm reden. Deswegen war ich ja hier, auch wenn ich mich vor diesem Gespräch fürchtete. Auch wenn mir der bloße Gedanke eine Gänsehaut bescherte. Für einen kurzen Moment überlegte ich, einfach weiter ins Wasser zu waten, vor ihm zu fliehen und mir die Möglichkeit zu geben, all das hier für immer zu vergessen. Ihn zu vergessen. So zu tun, als wäre dies nie geschehen. Als hätte es uns nie gegeben. Doch obwohl ich ein Mädchen war, das gern fortrannte, war ich auch eins, das wusste, dass es nichts brachte. Dass das Leben einen einholte, die Erinnerungen sowieso. Also griff ich nach der Hand, die er mir zittrig entgegenhielt, und wir liefen gemeinsam dem Strand entgegen – und in eine ungewisse Zukunft.
Als wir das Ufer erreichten, liefen wir durch kleine Wasserpfützen, die die Ebbe hinterlassen hatte, ehe er meine Hand losließ. Augenblicklich stach etwas in meinem Inneren. Während ich ihn beobachtete, nur wenige Schritte vor mir, die Waden voller Sand und die Haare an seinem Körper dunkel und nass, da stieg in mir eine furchtbare Sehnsucht nach ihm auf. Nach den Armen, in denen ich viel zu lang nicht mehr hatte liegen dürfen, den Augen, die in meiner Erinnerung nicht annähernd so schön gewesen waren wie jetzt, dem Bart, der sanft meine Schulter gekitzelt hatte, die langen Haare, die sonst kurz waren. Ich sehnte mich nach der Art, wie er seine Brille hochschob, mir sanft Küsse auf die Stirn hauchte, die Art, wie er meinen Namen aussprach. Aber zugleich sehnte ich mich auch nach dem Mann, der er jetzt war. Gebrochen und glücklich zugleich. Ich sehnte mich nach dem Mann aus der Vergangenheit und wollte den Mann, der er jetzt war. Das war wohl auch das ganze Dilemma, denn ich konnte ihn nicht haben. Weder heute noch morgen. Obwohl wir nach all den Monaten endlich beieinander waren, war es doch so, dass wir nicht weiter voneinander entfernt sein konnten. Uns mochten nur wenige Meter trennen, aber die Mauer, die zwischen uns in den Himmel ragte, bestehend aus allem, was in den letzten Monaten geschehen war – sie war so hoch wie nie zuvor, ragte zwischen uns empor wie die Gesteinsformationen, von denen wir umgeben waren.
In stummer Übereinkunft führte Gabriel mich durch den Sand ans Ende der Insel, zu einem kleineren, versteckt liegenden Strandabschnitt. Hinter uns sang ein Vogel, und das Rauschen des Meeres war laut und gleichmäßig. Doch so beruhigend es auch war, mein Körper war kurz davor zu explodieren.
Ich suchte Ablenkung in der Ferne. Es war grotesk, all das Grün, das uns umhüllte, als wären wir im Innern einer Blume. All das Grün, das sich im Wasser spiegelte. Grün – die Farbe der Hoffnung, inmitten einer absolut hoffnungslosen Situation. Gabriel sank zu Boden wie ein nasser Sack. Ich setzte mich neben ihn, schlug die Beine über Kreuz und sah auf das Meer – dem Grün entgegen. In der Ferne trieben einige Segelboote im Wasser, verschmolzen mit der Idylle diesen Ortes. Insekten zirpten und sangen ihr frühmorgendliches Lied, das beinahe im Rauschen des Meeres unterzugehen drohte. Dieser Ort lebte, sang und sprach förmlich zu uns. Aber wir gaben ihm keine Antwort, waren ganz leise.
Es war eine dieser Situationen, in denen es zu viel zu sagen gab, als dass man sofort wüsste, wo und wie man anfangen sollte.
Gabriel hatte die Hände im Sand vergraben, legte eine Muschel frei, und dann, als hätte er mit ihr auch die Worte freigelegt, begann er zu sprechen.
»Evelyn, ich …« Er brach ab und ließ seinen Blick zu mir wandern. Tränen glänzten in seinen Augen. »Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll«, gestand er, die Stimme zittrig.
»Fang einfach ganz vorn an«, erwiderte ich langsam, obwohl mir diese wenigen Worte alles abverlangten. Die Wahrheit war: Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt hören wollte, was er zu sagen hatte. Für mich war die Situation eindeutig. Mehr als das. Wozu mich diesem Gespräch aussetzen? Doch als mein Blick erneut auf ihn fiel, auf seine hängenden Schultern, das Beben seiner Lippen … Es ging nicht um mich. Vielleicht mochte ich nicht hören wollen, was er zu sagen hatte, aber ich wusste, dass er diesen Abschluss brauchte. Und nach allem, was er für mich getan hatte, war ich es ihm schuldig, ihm wenigstens die Gelegenheit zu geben, sich zu erklären.
Eine einzelne Träne tropfte auf seine Wange, kullerte sein Gesicht entlang, bis sie sich in seinem Bart verfing. Eilig wischte er sich über die Augen und presste die Handballen dagegen. Mein Blick blieb an seinen Händen hängen. Diese Hände, die ich so oft gehalten hatte, die mich so oft berührt hatten, deren feine Adern ich heimlich betrachtet hatte. Die Hände, die mein Herz hielten.
»Du musst total verwirrt sein, also … bitte, lass es mich dir erklären«, murmelte er, und ich kam nicht umhin, zu bemerken, dass er um einiges verwirrter war als ich selbst.
Er wandte den Blick wieder dem Himmel zu und schien sich in dessen Endlosigkeit zu verlieren.
»Okay«, sagte er dann. »Ganz von vorn …« Sein Körper bebte, seine Stimme war brüchig. Jeder einzelne Muskel war zum Zerreißen gespannt, strahlte den Schmerz aus, den er in seinem Inneren bekämpfte.
Gabriel atmete zittrig ein, dann sah ich, wie seine Lippen sich zu bewegen begannen.
»Es war ungefähr ein Jahr, bevor ich nach New Orleans kam … Da begann alles. Ich traf Grace. Die Frau, die du vorhin gesehen hast. Die Frau, der wir damals im Park begegnet sind.« Er machte eine kurze Pause, fast so, als wollte er warten, bis ich mich an jenen Tag erinnerte. Und tatsächlich tat ich das. Nur zu gut erinnerte ich mich an die Frau mit den kurzen blonden Haaren und dem hübschen Gesicht.
»Wir liefen uns rein zufällig über den Weg«, fuhr er fort. »Aber das war nicht das erste Mal. Ich hatte sie vier Jahre zuvor schon einmal getroffen.« Er fuhr sich durch die ungewohnt langen Haare, ehe er nervös einen Zopfgummi von seinem Handgelenk fummelte und sich einen Man Bun band. »Es gibt einen Gabriel, von dem du nichts weißt …«
Es überraschte mich nicht einmal. Gabriel hatte hin und wieder angedeutet, wie intensiv und wild seine Studienzeit gewesen war, aber ich hatte mich stets davor gedrückt, nachzufragen. »Damals war ich mit Scott und Phil unterwegs gewesen. Es war der Beginn der Semesterferien, und wir waren jede Nacht auf einer anderen Semesterabschlussparty. Es war eine wilde Zeit, in der ich es so richtig krachen ließ. Mit Alkohol und Frauen. Es ist nicht unbedingt der Teil meines Lebens, auf den ich stolz bin, aber er gehört eben zu mir.« Er stockte, rieb sich über das Gesicht, als könnte er so die Dämonen vertreiben, die ihn plagten. Jedes Wort schien ihm Unmögliches abzuverlangen.
»Es war einer dieser Abende, als ich Grace kennenlernte. Ich hatte zu viel getrunken. Viel zu viel. Auf einer der Partys war dieses Mädchen, das ich so toll fand, das jedoch mit einem Typen namens Denver zusammen war. Das Ende vom Lied war, dass Denver und ich uns gegenseitig die Seele aus dem Leib prügelten und ins Krankenhaus kamen. Ich hatte ein paar Prellungen und eine Platzwunde am Kopf. Nichts Wildes also. Die Schwester, die sich um mich kümmerte, war Grace. Irgendwie – es mochte wohl am Alkohol liegen – schaffte ich es, sie dazu zu überreden, nach ihrer Schicht etwas mit mir bei In-N-Out-Burger essen zu gehen. Es führte eins zum anderen, und schließlich landete ich in ihrem Bett …« Er presste die Zähne aufeinander, und sein Kiefermuskel zuckte angespannt. Ich beobachtete ihn wie aus der Ferne. Obwohl ich neben ihm saß, war seine Stimme furchtbar leise, und das, was er sagte, ließ sich nicht in Einklang bringen mit dem Mann, den ich in New Orleans kennengelernt hatte. Ich führte eine Hand zu der Kette um meinen Hals, die Kette, die er mir zu meinem Geburtstag geschenkt hatte. Behutsam legte ich zwei Finger auf den Anhänger, als könnte mir das helfen, ihm weiter zuzuhören. Jedes seiner Worte war wie ein kleiner Messerstich in mein Herz.
»Noch bevor sie aufwachte, stand ich auf und stahl mich aus ihrer Wohnung. Ich konnte mich weder an ihren Namen erinnern noch hatten wir Nummern ausgetauscht oder Ähnliches.« Er schüttelte den Kopf, ehe er schwer seufzte, so, als trüge er die Last der ganzen Welt auf seinen Schultern.
»Vier Jahre später traf ich sie wieder. Es war im Starbucks nahe dem Macy’s. Sie war nicht allein, Noah war bei ihr.« Mein Magen zog sich schmerzvoll zusammen, als ich an den kleinen Jungen mit den wunderschönen blonden Löckchen dachte. Ich löste meine Hand von der Kette, ließ sie stattdessen zu meinem Herzen wandern, das unentwegt zu bluten schien. Noah.
»Als sie mich sah … kam sie auf mich zugestürmt, fragte direkt, ob ich mich an sie erinnern könnte … Na ja, immerhin das konnte ich.« Er lachte, aber es klang, als würde er sich vor sich selbst ekeln. »Sie sagte, wir sollten einen Spaziergang machen.« Er zog die Brauen zusammen. »Ich war so überfordert und vor allem so überrumpelt gewesen, dass ich gar nicht anders konnte, als einzuwilligen. Während wir durch den Park liefen, sagte sie mir, dass Noah mein Sohn sei. Nie in meinem Leben habe ich mich so verloren und betrogen gefühlt. Ich sollte einen Sohn haben und nichts davon wissen? Wir einigten uns darauf, einen Test machen zu lassen, auch wenn es ihrer Meinung nach unnötig war. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon in seinen Augen gesehen, dass er mein Sohn ist, aber ich wollte es nicht wahrhaben, es erschien mir leichter, ihre Worte infrage zu stellen. Der Test war jedoch positiv. Es kam einen Alptraum gleich … zu wissen, dass ich all die Jahre einen Sohn gehabt hatte, der mich nicht kannte und den ich unwissentlich im Stich gelassen hatte … Es brach mir das Herz und stellte meine Welt völlig auf den Kopf.«
Seine Worte sickerten nur langsam zu mir durch, aber ich verstand jedes einzelne davon, spürte, wie mein Herz immer schwerer schlug, als die Worte sich zu meiner neuen Wahrheit formten.
»Ich hätte wohl davonlaufen können, aber so ein Mensch bin ich nicht. Ich wollte Verantwortung übernehmen. Also begannen wir uns regelmäßig zu treffen. Ich sollte Noah langsam kennenlernen, wir konnten ihm schließlich nicht einfach so sagen, dass ich sein Vater war.« Ich hörte ihm zu, und doch kam es mir vor, als spräche er von einem anderen Menschen. Ich konnte das Bild meines Gabriels einfach nicht mit dem Mann übereinbringen, der er angeblich einmal gewesen war. Blinzelnd sah ich auf meine Finger, dann zu ihm. All die Anrufe und Telefonate kamen mir wieder in den Sinn. Er hatte eine Hand auf mein Knie gelegt, sah mich mit tiefen Falten auf der Stirn an.
»Alles okay?«
Ich nickte bloß, ehe ich mich fragen hörte: »Wieso hat Grace dich nicht eher kontaktiert?« Meine Stimme klang leise, weit entfernt.
»Sie meinte, sie hätte mich gesucht. Aber Boston ist keine kleine Stadt, ich war viel und oft unterwegs. Hinzu kam, dass sie weder meinen Nachnamen wusste noch was ich beruflich machte. Sie versuchte es mehrere Monate lang, danach gab sie auf, was blieb ihr auch anderes übrig? Am Ende wusste sie ja nicht einmal, ob es die Suche wert wäre, ich hätte sie ebenso von mir stoßen und allein lassen können. Nachdem ich mich früh morgens aus ihrem Schlafzimmer gestohlen hatte, hatte sie wohl auch einfach nicht das beste Bild von mir.«
Ich nickte bloß, weil ich einfach nicht wusste, was ich dazu sagen sollte. Ich hatte keine Worte, etwas, was ich zu einem anderen Zeitpunkt meines Lebens wohl für unmöglich gehalten hätte. Ich begann, mit dem Finger Kreise in den Sand zu malen.
»Dennoch wirkte sie …« Er zuckte mit den Schultern. »Ich will nicht sagen erleichtert, aber sie sagte mir später, dass es ihr immer ein Anliegen war, mir zu sagen, dass ich einen Sohn hatte. Dass sie es endlich konnte, schien sie irgendwie zu erleichtern. Von da an begann ich mich um Noah zu kümmern. Besuchte sie regelmäßig, soweit meine Arbeit es zuließ ... So lange, bis ich schließlich nach New Orleans musste. Wir haben beinahe täglich telefoniert – das waren all die Anrufe, die du mitbekommen hast –, ich sprach mit Noah, aber auch mit Grace. Wenn man ein Kind hat, gibt es schließlich immer Dinge, die man zu besprechen hat.«
»Und ihr wart nicht …?«
Er schüttelte den Kopf, noch bevor ich den Satz zu Ende sprechen konnte. »Wir waren nicht zusammen, nein. Ich habe dich nicht betrogen. Alles, was uns zu diesem Zeitpunkt verband, war Noah. Er war alles, worum es uns ging. Klar, wir lernten uns auch kennen, aber nach allem, was geschehen war, kam es uns gar nicht in den Sinn …« Er schaute auf seine Zehen, die er nervös in den Sand grub, als suchte er so nach mehr Halt, nach irgendeinem Anker, der ihn am Boden hielt. Seine Worte ertönten noch einmal in meinem Kopf, und ich hängte mich an drei Worten auf. Zu diesem Zeitpunkt.
»Es kam uns nicht in den Sinn, einander anders als die Eltern eines gemeinsamen Sohnes kennenzulernen. Da war nichts Romantisches zwischen uns.« Sein Blick brannte auf meiner Haut, und er schien auf eine Reaktion meinerseits zu warten. Doch mein Kopf sang noch immer die drei Worte, die mir die Endgültigkeit dieser Situation klarmachten.
Zu diesem Zeitpunkt.
»Wann änderte sich das?«, fragte ich verspätet und zwang mich, ihn anzusehen – den Menschen, der mir so vertraut und so fremd zugleich war.
»Vor gar nicht allzu langer Zeit«, hauchte er, und ich fragte mich, was das wohl bedeutete, wenn man bedachte, dass ich erst vor gut sieben Monaten ins Koma gefallen war – eine für mein Empfinden doch recht kurze Zeit. Auf der anderen Seite musste ich wohl still sein – schließlich hatte ich ebenfalls Gefallen an einem anderen Mann gefunden. Ich runzelte die Stirn über die Widersprüchlichkeit meiner Gedanken, doch es war leichter, in Gabriels Verhalten etwas Böses zu finden, als in der Trauer zu versinken, die sich mit jedem Wort, das er sprach, etwas mehr in mir auszubreiten schien und die ich beständig versucht hatte, zu verdrängen.
»Grace ist Krankenschwester, und nach deinem Unfall fiel es mir unsagbar schwer, dich fremden Menschen zu überlassen. Aber ihr vertraute ich. Also verlegten wir dich ins Boston Medical Center, in dem sie arbeitet. Sie kam regelmäßig vorbei, kümmerte sich etwas um mich, sorgte dafür, dass du die besten Ärzte bekamst, die in Boston zu finden waren … So erfuhren wir mehr übereinander, aber es war noch immer nicht romantisch …«
Im Kopf zog ich gut drei Monate ab.
»Nachdem mein Dad gestorben war …« Er schluckte und rang um die nächsten Worte. »… wollte ich nur noch weg. Zunächst beschloss ich, für zwei Wochen zu verreisen. Dann waren es drei Wochen. Aber ich machte mir Sorgen wegen Noah. Ich ging also zu einem Münztelefon am Flughafen, um alles mit Grace zu besprechen. Sie bot an, dass sie und Noah nachkommen könnten. Sie erklärte, dass sie schon immer ein Sabbatical habe machen wollen, und da Noah nächstes Jahr in die Vorschule kommen soll, sei dies der einzige passende Zeitpunkt. Eigentlich sollte die Reise dazu dienen, mich selbst zu finden, aber …« Er zuckte unbeholfen mit den Schultern, wie ein Junge, der die Rechenaufgabe nicht lösen konnte. »Ich wollte nicht noch mehr bereuen. Ich bereute bereits so viel. Dass ich die Kindheit meines Sohnes verpasst habe, sollte nicht dazugehören. Später sagte Grace mir, dass ihr nicht wohl dabei war, wenn ich so allein unterwegs wäre. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, dass sie sich so um mich sorgt, aber sie tat etwas für mich, wofür ich ihr dankbar bin – sie brachte mir meinen Sohn zurück.« Er senkte den Blick, um seine Hände zu sehen. Adern traten hervor, und ich betrachtete einen Moment die blauen Linien unter der gebräunten Haut. Der Gedanke, dass er sich wenigstens nicht schon in Boston in eine andere verliebt hatte, tröstete mich.
»Zu Beginn war da nichts«, erklärte er leise. »Aber irgendwann merkte ich, wie es mir besser ging. Wie ihre Führsorge und ihr Lächeln etwas in mir auslösten. Also bat ich sie schließlich um ein richtiges Date. Noah zuliebe, und irgendwie auch dir zuliebe.« Mein Hals fühlte sich staubtrocken an. »Ich meine, alles, was du mir immer gepredigt hast, war, wie wichtig eine herzliche Familie ist. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich wäre es Noah und dir schuldig, wenigstens zu versuchen, Grace wirklich kennenzulernen. Nicht nur oberflächlich. So führte eins zum anderen. Das war vor ungefähr zweieinhalb Monaten.« Er sah betreten zu Boden, und meine Wut wurde unter einer Welle der Trauer begraben. Mein ganzer Körper schmerzte, pulsierte und schien sich auflösen zu wollen. Ich wusste, dass ich objektiv betrachtet kein Recht hatte, so zu reagieren – dass auch ich einen winzigen Teil meines Herzens an William verschenkt hatte. Doch er besaß es nicht mehr. Ich hatte es ihm wieder entrissen, weil ich auf das kleine Fünkchen Hoffnung, diesen winzigen Schimmer vertraut hatte, dem ich wie durch eine dunkle Nacht gefolgt war. Und nun? Nun war das Glühwürmchen verschwunden, und wo zuvor noch ein kleiner Funke gewesen war, war nur noch Finsternis.
Auf seine Worte folgte eine lange Stille. Aber nur äußerlich, denn innerlich schrien meine Gedanken sich lautstark an. So viele Fragen. So viele Wortfetzen aus seinen Briefen. Wie hatte er mir all das schreiben und es wenige Wochen danach wieder vergessen können? Ich ertappte mich bei der Frage, ob es möglicherweise besser gewesen wäre, wenn ich ihn nicht gefunden hätte. Irgendeine Stimme in meinem Inneren hatte mir zugeflüstert, ich wäre stark genug – egal, was käme. Doch hier saß ich nun, taub vor Trauer. Gelähmt vor Schmerz. Am Horizont tauchte ein kleines Boot auf, das schnell größer wurde, das nahezu bedrohlich ankündigte, dass bald die ersten Touristen den Strand mit wildem Geschrei und dem nervösen Klicken ihrer Kamera fluten würden.
»Wieso hast du es mir bloß nicht gesagt? Wieso hast du mir Noah verheimlicht? Grace als deine Cousine bezeichnet?«, hauchte ich in die Stille, so leise, dass ich schon befürchtete, dass das gleichmäßige Rauschen des Meeres meine Worte verschluckt hätte, doch Gabriel seufzte. In meinem Kopf waren noch viele weitere Fragen, doch sie schienen zu unkonkret.
Er fuhr sich über den Kopf. »Ich weiß es nicht, Evelyn. Ich hätte es direkt am ersten Tag sagen sollen, als wir essen waren. Kurz und schmerzlos. Wem hätte es schon wehgetan?« Nun sah er mich an, lächelte entschuldigend, und ich machte innerlich einen Schnappschuss von diesem Lächeln. Diesem Gesicht, nach dem ich mich so lange gesehnt hatte.
»Aber ich habe es nicht getan. Ich kann dir nicht sagen, wieso ich mich dagegen entschied. Es war keine Entscheidung, die ich bewusst traf. Vielmehr war damals noch alles frisch. Ich wusste gerade mal seit einem Jahr, dass ich Vater war, mein Sohn begann mir nur langsam zu vertrauen und …« Er zuckte mit den Schultern. »Ich hatte das Gefühl, dass Noah etwas sei, das ich beschützen müsse, das ich für mich allein behalten wollte. Zumal ich ihn aufgrund meiner vielen jobbedingten Reisen weniger gesehen habe, als ich mir wünschte. Selbst nach einem Jahr fühlte es sich einfach noch nicht wirklich real an. Auf der anderen Seite war da natürlich auch Angst … Angst davor, zugeben zu müssen, dass ich seit vier Jahren einen Sohn hatte und ihn erst seit einem Jahr kannte. Also wartete ich auf einen Moment, der mir richtig erschien, den es jedoch nicht geben sollte. Den es nie gibt. Für niemanden. Aber das habe ich zu spät begriffen. Tja, und ganz plötzlich war der Zeitraum des Kennenlernens vorbei. Einfach so. Nachdem du mir gesagt hattest, du willst nicht mit mir ausgehen, sah ich auch keinen Grund mehr, es dir zu erzählen. Doch dann wolltest du plötzlich doch, und da schien es mir dann schon zu spät. Irgendwann reichte eine Lüge eben nicht mehr aus, um geheim zu halten, was ich nicht wagte, laut auszusprechen …« Seine Unterlippe bebte, und aus dem Augenwinkel bekam ich mit, wie seine Finger nervös zuckten.
»Es war ja nicht einmal so, als hätte ich es nicht versucht … Aber du warst gerade erst aufgetaut, schienst mir nur langsam zu vertrauen. Dieses Vertrauen wollte ich nicht verlieren. Und dann …« Er senkte die Lider. »… saßen wir irgendwann gemeinsam auf der Terrasse. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Du sagtest, du könntest nicht verstehen, dass Väter sich ihrer Verantwortung entziehen, nur weil das Kind in einem One-Night-Stand entstanden sei. Du hast so wütend darüber gesprochen, da wusste ich, dass ich es dir nicht einfach sagen konnte. Von da an war jeder Tag ein Tag, an dem ich mit mir selbst kämpfte, versuchte, eine Lösung für ein Problem zu finden, das ich selbst geschaffen hatte. Aber ich scheiterte immer und immer wieder. Und irgendwann gab ich uns auf.« Seine Worte drängten mir blitzartig die Tränen in die Augen. »Du hättest es mir nicht verziehen. Ich begann, mir einzureden, ich würde es dir sagen, wenn du mich erst richtig lieben würdest …« Ich erinnerte mich noch sehr genau an diese Zeilen in einem seiner Briefe. Doch so absurd es klingen mochte – er hatte nicht einmal Unrecht damit. Wäre er sofort bei unserem Kennenlernen damit herausgeplatzt, bei unserem ersten Date oder irgendwann zwischen ›Wollen wir ausgehen‹ und ›Ich liebe dich‹, hätte ich mich dann weiter auf ihn eingelassen?
»Ein Teil von mir dachte wohl, dass es dir leichter fiele, mir zu verzeihen, wenn du mich erst lieben würdest, aber …«, sprach er weiter. »Aber als es dann so weit war, liebte ich dich selbst zu sehr, als dass ich das Risiko eingegangen wäre, dich zu verlieren. Irgendwann wusste ich, dass ich nie die Kraft haben würde, es dir zu gestehen. Ich kannte dich so gut. Sobald ich auch nur daran dachte, es dir zu sagen, sah ich den Schmerz in deinen Augen vor mir. Wie du mich ansehen würdest. Nicht einmal den Gedanken konnte ich ertragen. Von da an lebte ich nur noch von Tag zu Tag. Hoffte immer, dich noch einen Tag länger bei mir behalten zu dürfen. Irgendwann erschien es mir sogar besser, wenn du denken würdest, ich würde dich betrügen. Ich dachte, es fiele dir leichter, mich zu vergessen, wenn du mich für einen Arsch halten würdest …«
»Gabriel«, flüsterte ich. »Ich kann einfach nicht verstehen, wie du uns nur so aufgeben konntest?«
Er lachte verzweifelt, und eine Träne fiel ihm auf die Wange. »Ich war der festen Überzeugung, du würdest mir niemals verzeihen können, dass ich einen Sohn habe und seine Mutter nicht liebe. Dass ich mich gewissermaßen meiner Verantwortung entzog. Es stand für mich außer Frage, wie du reagieren würdest.«
In meinem Kopf rotierten die Gedanken. Sie schienen einander zu bekriegen, doch irgendwie war ich nicht in der Lage, sie zu sortieren. Klar zu denken. Hätte ich ihm verziehen? Hätte ich mich in ihn verliebt, wenn ich von alldem gewusst hätte? Alles in mir schien in Widersprüchlichkeit aufzugehen.
»Wegen dieses einen Satzes?«, flüsterte ich schließlich, weil mir nichts Besseres einfiel, mein Kopf zu voll und zu leer gleichzeitig war.
»Ja.«
»Aber hast du deinen Sohn denn im Stich gelassen?«, hörte ich mich fragen, auch wenn ich wusste, wie merkwürdig es ihm erscheinen musste. Es stimmte, dass ich Dinge gesagt hatte, doch hatte ich sie wirklich so gemeint? Oder hatte ich mich nicht viel mehr in Rage geredet, weil ich mit dem Leid eben jener Kinder tagtäglich konfrontiert war?
Er schüttelte den Kopf. »Nein, habe ich nicht. Aber ich war in New Orleans und er in Boston. Wie hätte das denn für dich ausgesehen?«
Ich öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Auch wenn es mir schwerfiel, es mir einzugestehen, bemerkte ich, dass er recht hatte. Als ich Gabriel nahekam, hatte ich quasi nur nach einem Grund gesucht, dass sich bewahrheitete, was meine Großmutter mir immer über Männer gepredigt hatte.
»Siehst du«, schlussfolgerte er ruhig. »Du wärst davongelaufen.«
Richtig. Ich hatte es an jenem folgenschweren Tag getan, als ich es erfahren hatte, und ich hätte es an jedem anderen Tag getan. Denn so war ich.
Ich hob eine Hand an meine Lippen, spürte die aufgeraute Haut unter meinen sandigen Fingerkuppen. Nun verstand ich auch, wieso er in all den Briefen so oft auf diesem Thema herumgeritten war, versucht hatte, sich zu erklären. Er hatte es getan, weil er ganz genau gewusst hatte, dass es der einzige Weg war, mich zum Zuhören zu zwingen. Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitzschlag. Unerwartet und heftig.
Er hatte mir die Briefe nicht nur geschrieben, um mich an all das zwischen uns zu erinnern, sondern auch, um mir seine Beweggründe näherzubringen, auch wenn er dabei niemals aussprach, was genau sein Geheimnis war. Er hatte einen Weg gefunden, mit mir zu sprechen, ohne dass ich fortrannte.
»Evelyn?«
Ich löste die Finger von meinen Lippen und sah ihn gedankenverloren an.
»Entschuldige, ich war in Gedanken«, murmelte ich.
Seine Lippen verzogen sich zu einem kleinen Lächeln. »Manche Dinge ändern sich wohl nie.«
Ich nickte nur. Es kehrte Stille ein, lediglich durchbrochen vom Rauschen des Meeres, einem Äffchen, das in der Ferne schrie, und den ersten Touristen, die einander etwas zuriefen, doch zwischen uns, da herrschte die Stille zweier Menschen, die einander nichts mehr zu sagen hatten.
Dennoch schienen die Worte, die Frage nach dem »Und jetzt?« unausgesprochen über uns zu schweben wie ein dunkles Omen.
Plötzlich schüttelte Gabriel den Kopf und rieb sich die Stirn. »Ich kann es noch immer nicht glauben …« Noch einmal schüttelte er den Kopf. »Wie kannst du hier sein? Wie kannst du überhaupt am Leben sein und wohlauf? Ich meine, ich bin unfassbar dankbar dafür, aber … Wenn ich an den Gesichtsausdruck der Ärzte denke, wann immer sie in dein Zimmer kamen, dann … « Er brach ab und rieb sich die Nasenwurzel.
Nun war ich es, die den Blick in die Ferne richtete, der Sonne entgegenschaute, dann begann ich zu erzählen. Von dem Tag, als ich aufwachte, der Reha und meinem Besuch bei Mia und seiner Mom, erzählte von all den Postkarten, die Mia mir zeigte, und wie ich den nächsten Flug buchte.
»Wann genau bist du aufgewacht?«
»Ende März …«
Er nickte. »Da war ich schon ein paar Wochen weg«, murmelte er.
»Und du bist mir alleine hinterhergereist?«, fragte er ungläubig, während er Sand zwischen zwei Händen jonglierte und sich ein vertrautes Lächeln auf seine Lippen stahl.
»Na ja, ich war nicht wirklich lange allein«, gestand ich. »Eigentlich war ich nie allein. Ich habe direkt an meinem ersten Tag in Jakarta jemanden aus Washington kennengelernt. Er hat mir geholfen, mich zurechtzufinden. Irgendwann trafen wir dann ein Pärchen, das William und mich begleitete. Gemeinsam suchten wir dich«, erzählte ich, wagte es jedoch nicht, ihn dabei anzusehen. Es war das erste Mal, dass ich Williams Namen vor ihm ausgesprochen hatte, und obwohl er in Gabriels Nähe in Vergessenheit geraten sollte, war da noch immer dieses stumme Stechen irgendwo in meinem Herzen. Zwar nur ein winziges Stechen, aber deutlich spürbar.
Gabriel legte seine Hand auf meine und drückte sie. Ich schloss die Augen, genoss die Wärme seiner Finger, den Sand zwischen uns, das Kribbeln überall, das die Härchen auf meinen Armen augenblicklich zu Berge stehen ließ. Der Wasserstand war mittlerweile angestiegen und schwappte mir über die nackten Füße.
»Es tut gut zu wissen, dass du nicht ganz alleine warst.« Er sagte das in einem liebevollen Ton, doch ich bemerkte auch den Vorwurf in seinen Augen – wem auch immer er galt.
»Ich kann gar nicht fassen, dass so viele Menschen versucht haben, mit dir gemeinsam mich zu finden. Absurd …« Er lachte leise. Nickend lächelte ich, ehe ich mit den Schultern zuckte, auf die die Sonne heiß herunterbrannte.
»Ich sah wohl hilfsbedürftig aus«, gestand ich.
Gabriel lachte. »Du und hilfsbedürftig? Niemals!« Wir lachten, wir beide, und plötzlich fühlte es sich an, als hätte sich nichts geändert – dabei hatte sich alles geändert. Nichts war wie zuvor, und trotzdem wirkte es, als sollte es genauso sein. Es war dieser Moment, wenn man eine gefühlte Ewigkeit einem Traum hinterherjagte und ihn plötzlich erreichte. Es war ein Moment des kompletten Stillstands, wo es niemanden gab außer einem selbst. Wo man gar nicht wusste, wie man begreifen sollte, dass man endlich angekommen war – erreicht hatte, wonach man so lange gestrebt hatte. So war es, hier neben Gabriel zu sitzen. Unwirklich. Überwältigend. Nun … Zumindest, wenn man von der Tatsache absah, dass sich einige Dinge grundlegend verändert hatten. Dass der Traum, die Erfüllung meines Traums, verpufft war.
»Evelyn?«
Ich sah auf und begegnete dem Ozeanblau von Gabriels Augen.
»Da ist noch etwas, was ich wissen muss …«, flüsterte er. Mein Herz begann zu rasen, schnürte mir die Luft zum Atmen ab, als hielte ich sie an. Was musste er wissen?
Irgendwie schaffte ich es zu nicken.
»Hättest du mir vergeben?«, flüsterte er. Ich wandte den Blick ab, und richtete ihn in die Ferne, als käme die Antwort mit einem der unzähligen Touristenboote, die auf die Insel zuhielten. Doch auf dem offenem Meer warteten keine Antworten. Die konnte nur ich selbst mir geben.
»Ich weiß es nicht«, gestand ich schließlich. »Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer kann das schon wissen? Aber das was ich dir sagen kann, ist, dass ...« Ich drehte mich zu ihm, fing seinen Blick auf.
»... ich dir nicht die Schuld an dem Unfall gebe. Und du solltest das auch nicht tun. Ich weiß, dass du mich in all der Zeit nur hast glücklich machen wollen. Ich verstehe, wovor du Angst hattest, und ich bin dir nicht böse, Gabriel. Keine Ahnung, wie ich damals reagiert hätte, aber heute bin ich dir nicht böse. Ich glaube, wir haben alle genug gelitten.«
Gabriel zog ein gequältes Gesicht, so, als hätte ich ihm eine Ohrfeige gegeben, dann raufte er sich die Haare, bis sein Zopfgummi in den Sand fiel, und vergrub das Gesicht in seinen Handflächen.
»Alles okay?«, flüsterte ich und legte behutsam eine Hand auf seine Schulter. Sie glühte förmlich.
»Ich habe dich und deinen Segen nicht verdient. Und ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, was ich mir dabei gedacht habe, als ich dich in Boston zurückließ.« Als er aufsah, pulsierte eine Ader an seiner Schläfe. »Ich hätte bei dir bleiben sollen … Ich hätte für dich da sein sollen, als du aufgewacht bist …« Tränen stiegen ihm in die Augen und lösten sich von seinen dichten, dunklen Wimpern, doch er wischte sie nur wütend fort. »Ich wollte immer alles richtig machen, wenn es um dich ging. Nun sieh mich an, wie ich alles zerstört habe.«
Ich überbrückte die Distanz zwischen uns, ging vor ihm auf die Knie und ließ mich auf meine Fersen sinken. Das Wasser schlug mir in regelmäßigen Abständen erst gegen die Füße, bäumte sich dann meinen Rücken empor.
»Gabriel, sieh mich an!« Als sein Blick den meinen fand, war das Blau getrübt. Seine Augen waren gerötet, und in ihnen standen so viel Schuld und Selbsthass, dass es mich innerlich beinahe zerriss. Er hatte Fehler gemacht … Doch wer nicht? Ihn traf keine Schuld. Ich mochte mir sonst über nichts im Klaren sein, doch darüber schon. Ich war nicht wütend, weil er sich neu verliebt hatte – ich war nur wütend, dass er mit seinen Lügen unsere Beziehung zerstört hatte, statt ehrlich zu mir zu sein.
»Gabriel, bitte … Ich weiß, ich war vorhin wütend, und ich will dich nicht anlügen – es schmerzt. Ja. Aber so ist das Leben, manchmal ist es Zeit, zu gehen. Du musstest tun, was du tun musstest, um über den Tod deines Vaters hinwegzukommen. Und vielleicht auch über mich. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, dass ich lebe. Sind wir also mal ehrlich … Wer hätte auf ein Wunder vertraut? Nichts von dem, was du getan hast, war falsch.« Weitere Tränen quollen aus seinen Augen, und ich konnte nur Vermutungen darüber anstellen, was er sich vorwarf. Dabei hatte ich mich ebenfalls neu verliebt – und das, obwohl ich wusste, dass er noch am Leben war.
»Wenn ich das Richtige getan habe, wieso tut es dann so weh? Wieso droht es mich innerlich zu zerreißen, wenn ich jetzt in deine Augen sehe und den Schmerz darin erkenne?«, fragte er leise, hielt sich den Kopf, als befürchtete er, er würde zerspringen, sobald er den Druck verringerte.
»Wenn es leicht wäre, das Richtige zu tun, würde es jeder machen, Gabriel. Du hast nur auf deine Seele und dein Herz gehört, nichts daran ist falsch. Du sollst wissen, dass es okay ist, dass du weitergegangen bist, dich neu verliebt hast.« Es war eine Halbwahrheit, doch so wie er da vor mir saß … Wie konnte ich ihm da Vorwürfe für etwas machen, was ich selbst getan hatte? War ich nicht ebenso weitergegangen? Es war offensichtlich, dass Gabriel hier glücklich war. Mit Noah und Grace. Egal, wie sehr es mich schmerzte und was auch immer ich mir von diesem Tag erhofft hatte – wenn es nun meine Aufgabe war, ihm das Gefühl zu geben, dass es genau das war, was ich für ihn wollte, dann würde ich das tun. Denn am Ende des Tages hatte sich die Welt nun einmal weitergedreht – egal, wie sehr ich Gabriels Lippen auf meinen spüren wollte, ich würde nicht zerstören, was er sich in den letzten Monaten so verzweifelt aufgebaut hatte. Ich würde ihn nicht vor eine Wahl stellen, die vielleicht nur in meinem Kopf existierte – auch wenn mir die Zärtlichkeit in seinem Blick etwas anderes verriet. Alles, was ich gewollt hatte, war, ihm zu sagen, dass ich noch am Leben war. Und ja, vielleicht war ich diesem Glühwürmchen der Hoffnung nachgejagt, aber ich war schon einmal geheilt … Ich würde es wieder tun.
Ich schluckte die Tränen herunter, die in mir aufstiegen, dann beugte ich mich zu ihm, hauchte ihm einen Kuss auf die Wange, schloss für einige Sekunden die Augen, um ihn zu riechen, zu fühlen. Als ich mich wieder von ihm löste, atmete ich tief ein, sammelte alle Kräfte, die ich besaß.
»Ich wünsche euch nur das Beste. Das Beste und noch so viel mehr. Du hast mir gezeigt, wie Liebe sich anfühlt, und das werde ich dir nie vergessen. Aber du bist mir deine Liebe nicht schuldig. Ich verzeihe dir, dass du gegangen bist. Versprich mir einfach, dass du glücklich wirst, ja?« Ich hielt sein Gesicht in meinen Händen, musste mich zu jedem Wort zwingen, obwohl ich es aufrichtig meinte – nur dass mein Herz, was das betraf, einfach nicht auf meiner Seite war. Es arbeitete gegen mich, so wie immer. So wie damals, als ich mich so gegen die Anziehung zwischen uns gewehrt hatte.
»Du kannst nicht wieder gehen«, flüsterte er und hielt meine Hand so fest, dass ich befürchtete, er würde sie brechen. »Bitte, ich kann dich nicht noch einmal gehen lassen. Können wir nicht Freunde bleiben?« Sanft sank seine Stirn gegen meine. Eine so intime Berührung, dass mir augenblicklich die Tränen in die Augen stiegen.
»Du weißt jetzt, dass ich am Leben bin, und alles andere wird sich finden, versprochen«, murmelte ich mit zittriger Stimme. Es war schon merkwürdig, das Leben. Wie einer von zwei Menschen immer stark sein musste, wenn er den anderen retten wollte, weil wir es alleine nicht immer konnten. Weil mancher Schmerz zu groß war für das Herz eines Einzelnen.
»Es ist okay, hörst du?«
Er hob die Hand, strich mit dem Daumen liebevoll meine Wange entlang, seine Lippen jedoch blieben stumm … und das, obwohl in seinen Augen so viel unausgesprochene Worte standen.
Aber manchmal war es einfacher, die Dinge nicht auszusprechen. Manchmal machte es Momente leichter, die ohnehin schon schwer genug waren. Situationen wie diese.
»Ich kann dich noch nicht gehen lassen«, flüsterte er.
»Dann bleibe ich noch.«
So saßen wir da. Zwei verlorene Seelen, unwiderruflich aneinander gekettet und doch viel zu weit voneinander entfernt. Vom Schicksal betrogen, am schönsten Ort der Welt, dessen Sand von nun an mit den Tränen unserer Herzen getränkt war.
Kapitel 2
Gabriel
Man sagt, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Aber so langsam begann ich das zu bezweifeln, ich fühlte mich eher der Willkür des Lebens ausgeliefert. Hier war ich nun – an einem der schönsten Orte der Welt, im Paradies. Einem Ort, an dem sich die Füße angenehm warm in den weißen Sand gruben, das Meer gleichmäßig rauschte und die Insekten leise zirpend in den Lianen hockten. Doch trotz dieser Idylle war Evelyn Campbell über mich hinweggefegt wie ein Sturm. Sie hatte mein Leben erschüttert, war eingeschlagen wie ein Blitz, und nun, da sie fort war, entblößte sich das tatsächliche Chaos, das sie verursacht hatte. Das Chaos in meinem Herzen. Meinem Kopf. Meiner Seele.
Mein Herz raste, schlug mir bis in den Hals und machte mir das Atmen schwer, wetteiferte mit dem Adrenalin, das meine Glieder zittern ließ, eine Schwäche in mir auslöste, der ich mich nicht gewachsen fühlte. Ich gab ihr nach, und sank auf die Knie. Diese Reise sollte ein Neuanfang werden. Gewissermaßen erzwungen – aber was spielte das schon für eine Rolle? Nach dem Tod meines Vaters hatte ich einfach nicht die Kraft gehabt, weiter in meinem eigenen Schmerz umherzutreiben, als sei ich bereits tot. Obwohl mich das schlechte Gewissen meiner Mutter und Mia gegenüber selbst bis ans andere Ende der Welt verfolgt hatte, war es für mich der einzige Ausweg gewesen, denn sonst hätte ich mich wohl für immer in meiner Trauer verloren. Schließlich hatte ich mich damit getröstet, dass mein Vater es gewollt hätte, ebenso wie Evelyn. Niemand von ihnen hätte es mir zum Vorwurf gemacht, dass ich ging, dass ich das Leben, in dem sie eine Rolle gespielt hatten, hinter mir zu lassen versuchte – wenn auch nur für eine gewisse Zeit.
Ich wollte Evelyn stolz machen, endlich richtig Verantwortung für meinen Sohn übernehmen – das Richtige tun –, auch wenn sie es niemals erfahren würde. Aber ich wusste, dass es ihr Wunsch gewesen wäre. Und jetzt, da sie plötzlich wieder hier war, nicht tot wie von all den unfähigen Kittelträgern prognostiziert, wusste ich plötzlich nicht mehr, was das Richtige war.
Alles, was ich für den Moment wusste, war, dass Evelyn wieder fort war. Alles, was mir von ihr geblieben war, war ihre Silhouette, die sich gegen die Sonne abhob, in ihrem Longtail-Boot, das abfuhr. Sie wurde buchstäblich wieder zu dem Geist, für den ich sie gehalten hatte.
Ich hatte versucht, den Abschied hinauszuzögern, so lange, dass die Sonne sich dem Horizont entgegenneigte und die Insel von verliebten Pärchen belagert wurde. Doch ich stand hier allein, ein verlorenes Kind in der endlos weiten Welt. Alles, wonach ich mich sehnte, war eine Umarmung und jemand, der mir versicherte, dass alles wieder gut werden würde. Dass dieses Gefühl des Sich-verloren-Fühlens nicht ewig andauern würde.
Was war bloß geschehen? Ich fuhr mir mit den Händen durch die Haare, hätte sie mir am liebsten ausgerissen. Als ich Evelyn vorhin gesehen hatte, war es, als wäre ich in meinen schönsten Traum und schlimmsten Alptraum zugleich gestolpert. Es war eine Kollision meiner Vergangenheit und meiner Zukunft gewesen, eine Supernova. Nur dass sich statt Sternenstaub Schmerz in mir entladen hatte. Da war so viel unerträglicher Schmerz in mir. Wegen allem. Wegen nichts. Wegen der Dinge, die ich getan und nicht getan hatte. Wegen all der falschen Entscheidungen, die ich getroffen hatte. Manchmal glaubt man, nichts anderes tun zu können, als aufzugeben. Man ergibt sich dem Schicksal und beugt sich dem Leben. So, wie ich es getan hatte. Aber hier stand ich nun, überfordert vom Leben, erschöpft von Schmerz, gelähmt von Erinnerungen.
Es war, als hätte mir Evelyns Erscheinen eine mächtige Last von den Schultern genommen, nur um mir eine noch viel schwerere aufzuerlegen. So oft hatte ich mir unser Wiedersehen ausgemalt. Bei ihr im Krankenhaus. So oft hatte ich davon geträumt, wie sie die Augen aufschlug und mich ansah. Monatelang hatte ich diese Vorstellung in meinem Inneren gehütet wie meinen größten Schatz. Und nun war sie endlich und tatsächlich aufgewacht – und alles war anders gekommen.
Noch einmal durchlebte ich diesen Moment. Den, der alles ändern sollte. Zunächst hatte ich gedacht, ich würde träumen. Die Sonne hatte sie angestrahlt wie einen Engel. Ich hatte ihr entgegengeblinzelt. Das Erste, was ich gesehen hatte, waren die braunen, schulterlangen Haare, die sich um ihr zartes Gesicht wellten, ihr schmaler Körper, der stocksteif wirkte. Das Nächste war der unendliche Schmerz in ihren Augen, der Brief in ihren Händen, den sie zusammenknüllte, das Auge des Kettenanhängers, den ich ihr zum Geburtstag geschenkt hatte.
Für den Bruchteil eines halben Herzschlags hatte ich Schwerelosigkeit verspürt. Aber binnen einer flüchtigen Umarmung entfloh dieses Gefühl, und an seine Stelle trat so viel mehr. Ich wünschte, die Zeit rückgängig machen zu können und empfand zugleich ein schlechtes Gewissen wegen all der schönen Momente, die ich in den letzten Monaten verpasst hatte. Die Uhr meines Lebens hatte schlichtweg weitergetickt, und mit dem kontinuierlichen Ticken der Zeiger hatte auch ich mich einem neuen Leben zugewandt.
Was für eine Ironie des Schicksals, dachte ich bitter. Leise stöhnend ließ ich mich auf die Fersen sinken und starrte in die Ferne, versuchte, meine Gedanken neu zu sortieren.
Eine salzige Brise umspielte meine Nasenspitze, und fuhr mir sanft durch die Haare. Das Meer rauschte beständig und schlug hohe Wellen, die mir Gischt entgegenspritzten, die Sonne brannte heiß auf mich herab – und das, obwohl ich doch bereits in Flammen aus Traurigkeit stand. Krampfhaft versuchte ich zu atmen, mich ganz und gar darauf zu konzentrieren, weil Atmen manchmal das Einzige war, das mir half, zu mir zurückzufinden – etwas, was Grace mir beigebracht hatte.
Plötzlich spürte ich eine sanfte Berührung an der Schulter. Ich blinzelte und sah mich träge um. Als Grace mein Gesicht sah, huschte ein Ausdruck des Schmerzes über ihres. Sie ging neben mir auf die Knie, strich mir sanft über die Wange, wobei ihre eisblauen Augen meine fanden und darin nach einer Wahrheit suchten, die sie wahrscheinlich gar nicht wirklich finden wollte.
»Hey, alles okay?« Ihre Stimme war leise und voller Mitgefühl.
»Wo ist Noah?«, fragte ich irritiert.
»Ich habe ihn zur Kinderbetreuung gebracht und bin dann zurückgekommen«, erklärte sie. Ich sah sie einen Moment an, wollte ihr so viel sagen, so viel versprechen. Sie sollte wissen, dass alles gut werden würde. Aber so sehr ich es auch versuchte, meine Lippen bewegten sich keinen Millimeter.
»Es tut mir so leid, Gabriel«, wisperte sie. Unsere Blicke trafen sich, und ich sah die Sorge in ihrem, die Angst, den Schmerz. Ich hatte nicht nur Evelyn enttäuscht … Ich brach auch noch Grace das Herz. Ich brannte lichterloh, und alle um mich herum gingen ebenfalls in Flammen auf.
»Es wird alles wieder gut«, flüsterte sie und sah mich liebevoll an. Es war einer dieser Momente, in denen schon wenige Worte ausreichten, um alles zum Einstürzen zu bringen.
Sie zog mich in ihre Arme, ließ zu, dass ich an ihre Brust sank und erneut zu weinen begann.
»Alles wird gut«, flüsterte sie immer und immer wieder, bis ich es zu glauben begann. Ich war ihr so unendlich dankbar, dass sie mich daran erinnerte, dass nichts von Dauer war. Auch Schmerz nicht.
Ich weiß nicht, wie lange wir dort saßen, doch irgendwann schlug mein Herz wieder gleichmäßig, und alles, was mir blieb, war, stumm zu beten, dass Evelyn ebenfalls jemanden hatte, der sie festhielt und ihr versprach, alles würde wieder gut werden.
»Lass uns gehen«, murmelte ich schließlich, ehe ich mich auf die Füße kämpfte und wir gemeinsam zu dem Longtail-Boot liefen, mit dem Evelyn zurückgekommen war. Während ich durch das kristallklare Wasser ging, sprangen kleine Fischschwärme auseinander. Mein Blick wanderte zu Grace, deren Gesicht angestrengt auf das Boot gerichtet war. Grace. Die Frau, die mir nach Evelyns Unfall und dem Tod meines Vaters beigestanden hatte. Grace, die es mit einer unglaublichen Sanftmut ertragen hatte, wenn ich von Evelyn sprach, nicht eifersüchtig oder bösartig wurde, sondern mir einfach nur zuhörte, wann immer ich es brauchte. Grace, die Frau, die mich gerettet hatte. Die Mutter meines Sohnes. Die Frau, der seit zwei Monaten mein Herz gehörte.
Die nächsten Stunden schien das Leben um mich herum zu fließen, als wäre ich ein Stein inmitten eines Flusses. Wir holten Noah von der Kinderbetreuung ab, unterhielten uns, ohne dass ich wusste, worüber, gingen zu unserem Bungalow, um uns fürs Abendessen zurecht zu machen … doch ich bekam all das nur vage mit, während ich Gedanken nachhing, die keine Rolle mehr spielten.
Grace bemerkte es, und als wir zurück im Bungalow waren, erklärte sie nur, sie gehe jetzt ins Bett. Dann hauchte sie mir einen sanften Kuss auf die Wange, und kurz darauf lagen sie und Noah in ihren Betten. Ich hingegen setzte mich auf die Terrasse und wartete, bis sie eingeschlafen waren, ehe ich mich auf Zehenspitzen zur Tür schlich und unseren Bungalow verließ. Gedankenverloren lief ich über Trampelpfade unter großen Palmen und anderen gigantischen Blätterdächern entlang zum Strand. Ich hatte das Gefühl, der Bungalow würde mir die Lunge abschnüren. Als ich endlich am Wasser ankam, fühlte ich mich fast augenblicklich besser. Es mochten zwar keines meiner Probleme gelöst sein, aber wann immer ich vor den Weiten des Ozeans stand, erschien es mir, als war ich mit meinen Problemen furchtbar klein im Vergleich zum Rest der Welt. Ich lief durch den weichen Sand, während der Mond hell auf mich niederschien. Es dauerte einige Minuten, dann begann sich der Sturm in mir langsam zu entladen. Zuerst gaben meine Beine nach, dann sackte ich in mir zusammen und schluchzte, weil die Emotionen in meinem Inneren einfach nicht anders zu ertragen waren. Und irgendwann fühlte ich sie endlich – innere Ruhe. Nach einer Weile erhob ich mich wieder, streifte am Meer entlang und noch bevor ich wusste, wonach ich überhaupt gesucht hatte, kam ich vor einem altertümlichen Münztelefon zum Stehen. Es stand in einer Sanddüne vor dem Kempinski-Hotel und wirkte mit seiner dunkelgrün abblätternden Farbe und den verschlissenen Tasten wie ein Relikt aus alten Zeiten. Über mir zirpten Mücken und andere Insekten, und das Licht einer Außenlampe schien schräg auf mich nieder. Mit zitternden Fingern warf ich ein paar Münzen ein und wählte die Nummer meiner Mutter, während ich beobachtete, wie sich die Mücken um das Licht der Laterne sammelten, heiß zischten, als sie sich am Glas verbrannten und schließlich zu Boden fielen.
»Malone, Sie sprechen mit Betty.« Ich musste ein Lachen unterdrücken, nur um kurz darauf von einer tiefen Welle der Erleichterung erfasst zu werden. Wie hatte ich ihre Stimme vermisst …
»Mom, ich bin’s«, sagte ich, hörte, wie meine eigene Stimme brach. Es blieb einige verbrennende Mückenkadaver lang still, dann sagte meine Mom: »Gabriel?« Ihre Stimme war dünn und leise.