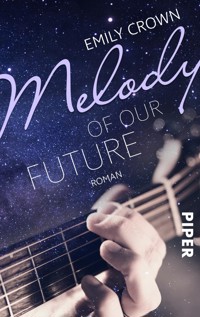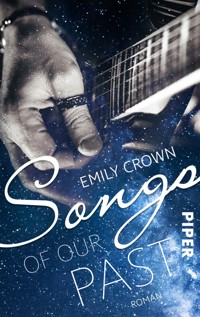Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zwischen uns das Leben
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Evelyn und Gabriel - eine Liebe, die niemals sein sollte?
Für Gabriel ist eine Welt zusammengebrochen. Evelyn bedeutete ihm alles und niemals wollte er, dass sein Geheimnis ihre Beziehung zerstört. Gabriel möchte nur noch eines: weg aus Boston und von den Erinnerungen. Zurück lässt er nur eine Schachtel mit Briefen an Evelyn, in denen er ihr endlich alles erklärt und von seinen wahren Gefühlen erzählt. Doch Gabriel weiß: Diese Briefe schrieb er zu spät …
"Eine Geschichte, die mich auf jeder Ebene berührt, mein Herz zerrissen und Stück für Stück wieder zusammengesetzt hat. Tiefgründig, mitreißend, dramatisch und süchtigmachend bis zur letzten Seite." Maren Vivien Haase.
Zweiter Band der großen „Zwischen uns das Leben“-Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Evelyn und Gabriel – eine Liebe, die niemals sein sollte?
Für Gabriel ist eine Welt zusammengebrochen. Evelyn bedeutete ihm alles und niemals wollte er, dass sein Geheimnis ihre Beziehung zerstört. Gabriel möchte nur noch eines: weg aus Boston und von den Erinnerungen. Zurück lässt er nur eine Schachtel mit Briefen an Evelyn, in denen er ihr endlich alles erklärt und von seinen wahren Gefühlen erzählt. Doch Gabriel weiß: Diese Briefe schrieb er zu spät …
Zweiter Band der großen »Zwischen uns das Leben« Trilogie.
Über Emily Crown
Emily Crown, geboren 1998, lebt als freie Autorin und Sprecherin am Bodensee. Schon als Kind liebte sie es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich in ferne Welten zu träumen. Nicht verwunderlich also, dass sie ihre erste große Liebe in der Literatur fand. Es folgten einige Jahre als begeisterte Leserin, ehe sie im Alter von 12 Jahren begann, eigene Geschichten zu Papier zu bringen. Heute schreibt sie über die Höhen und Tiefen der Liebe und all die Gefühle dazwischen.
Auf ihrem Instagram-Kanal @autorin_emilycrown tauscht sie sich mit ihren Leser:innen aus.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Emily Crown
Zwischen uns der Himmel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Impressum
Playlist
Ron Pope – A Drop In The Ocean
Timbaland, OneRepublic – Apologize
Lenny Kravitz – I’ll Be Waiting
James Blunt – Goodbye My Lover
Fleurie, Tommee Profitt – Hurts Like Hell
Matt Meason – Tribulation – Stripped
Jeff Buckley – Hallelujah
SYML – Where’s My Love
Howie Day – Collide
Ed Prosek – Weak Heart
Marcus Alexander – Supernova
Frühjahr 2016
Kapitel 1
Evelyn
Stimmen. Über mir. Hinter mir. Weit entfernt. Ganz nah.
Worte. Leer. Ohne Inhalt. In einen Raum hineingerufen, in der Ferne verhallt.
Desinfektionsmittel. Lavendel. Frisch gemähtes Gras. Vertraut und trotzdem fremd.
Ein kleiner Funken, der sich durch dichte Schwaden Dunkelheit kämpfte, sich darin verlor und plötzlich zu explodieren schien. Ein Feuerwerk, das zu einem grellen Lichtstrahl mutierte, mich zwang, die Augen zu öffnen. Etwas in mir schien zu erwachen, als die Umgebung sich zunächst verschwommen, dann erstaunlich klar vor mir auftat. Licht, dass sich im Stethoskop spiegelte, mich blendete. Fremde in weißen Kitteln, die sich über mich beugten. Ihre Lippen, die sich langsam bewegten. Erfreute, zufrieden Blicke, die ausgetauscht wurden. Jemand zog meine Lider etwas weiter auf und leuchtete mir in die Augen. Offenbar war ich in einem Krankenhaus. Freudige Überraschung spiegelt sich in den Gesichtern der Anwesenden. Noch immer redeten sie unablässig, gaben einander Anweisungen. Ihre Worte prallten an mir ab, wurden von einem betäubenden Fiepen verschluckt. Ich blinzelte, sah irritiert an mir hinab. Ein dünner Körper unter weißen Laken. Eine Hand, aus der Schläuche ragten.
Auf einmal löst sich das Fiepen auf, wurde immer leiser, bis ein merkwürdiges Geräusch ertönte, so, als hätte man den Stöpsel aus dem Abfluss gezogen. Stimmen wurden laut, Worte drangen zu mir durch. Ich hörte ein gleichmäßiges Piep. Piep.
Noch einmal blinzelte ich, wollte den Kopf drehen, doch jede Bewegung fiel mir schwer. Das Piepen wurde schneller, der Herzschlag trommelte mir in der Brust, schien meinen Brustkorb zerfetzen zu wollen. Ich öffnete die Lippen, nur um festzustellen, dass sie offen waren, dass ich etwas im Mund hatte. Ich sah hinab, bemerkte einen großen Schlauch, reflexartig hob ich die Hände, wollte ihn herausziehen. Wollte alles aus mir herausziehen.
»Ganz ruhig! Sie müssen ruhig bleiben. Ich übernehme das für Sie, in Ordnung? Atmen Sie einfach ruhig weiter«, sagte eine junge Frau mit dunklen, langen Haaren. Sie rief etwas, beugte sich zu mir herunter und zog behutsam den Schlauch heraus. Ich würgte, und sie hielt mir eilig eine Nierenschale hin. Behutsam strich sie mir über den Rücken, während ich mich erbrach.
»Ganz ruhig, lassen Sie alles raus und atmen Sie.« Ich kniff die Augen zusammen, hustete noch einmal, dann lehnte ich mich wieder zurück. Mein Rachen schmerzte. Falsch. Er brannte. Irritiert sah ich mich um, wollte etwas sagen. Aber die Worte wollten sich nicht formen. Nur ein Stöhnen verließ meine Lippen. Wütend und verwirrt zugleich. Ein Geräusch, das von Verzweiflung zeugte.
»Miss, Ihre Stimmenbänder sind noch strapaziert von dem Beatmungsschlauch, möglichweise fällt Ihnen das Sprechen noch schwer, hören Sie mich?«
Ein älterer Mann trat ans Bett, beugte sich ebenfalls über mich. Er roch herb. Nach einer Mischung aus Zigaretten und Aftershave. Er beugte sich zu mir herunter, wohl, um mir noch einmal in die Augen zu leuchten, obwohl das die Schwester vorhin schon getan hatte.
»Folgen Sie dem Licht«, wies er mich ruhig an, und ich tat, was er sagte. Anschließend hob er die Hand, platzierte sie an meinem Kopf, drückte sanft. »Tut das weh?«
Ich wollte Nein sagen, doch nur ein Krächzen verließ meine Lippe.
»Schon okay, Miss Campbell, Ihre Stimme wird bald wieder da sein. Vielleicht probieren Sie es bis dahin mit Bewegungen Ihrer Augen? Bewegen Sie die Augen nach links und rechts für ein Nein. Nach oben und unten für ein Ja. Ihre motorischen Fähigkeiten werden Sie auch wieder erlangen. Sie sind gewissermaßen etwas eingerostet.« Fragend sah ich ihn an.
Er zögerte. »Sie lagen im künstlichen Koma, deswegen werden iIhnen Bewegungen im Moment noch schwerfallen.«
Heftig bewegte ich die Augen von oben nach unten.
Der Mann drehte sich um, ich konnte nicht sehen, wohin, dann wandte er sich wieder mir zu und lächelte. »Mein Name ist Doktor Phil Miller. Ich bin Ihr Arzt. Fühlen Sie sich dazu imstande, dass ich Ihnen einige Informationen dazu gebe, was passiert ist?« Erneut bewegte ich die Augen auf und ab.
Das Piepen neben mir beschleunigte sich, während ich versuchte zu verstehen, was hier los war. Ich schnappte nach Luft, röchelte förmlich.
»Miss Campbell, Sie müssen sich beruhigen!«, wies er mich an. Sein Ton war streng und ließ keinen Widerspruch zu. Er richtete seinen Blick auf eine der Maschinen, die ich aus dem Augenwinkel sehen konnte.
»Ganz ruhig. Versuchen Sie, gleichmäßig zu atmen. Es ist alles in Ordnung!« Verzweifelt atmete ich, ließ ihn dabei aber nicht aus den Augen. Das Piepen wurde etwas langsamer.
»Gut«, sagte er und sah mich wieder an.
»Miss Campbell, können Sie sich an den Unfall erinnern?« Einen Moment sah ich ihn nur an, versuchte, die Ereignisse zu rekonstruieren. Da war eine Straße, mildes Licht, das von Straßenlaternen auf mich nieder strahlte. Mein Finger, der einen Knopf in einem Fahrstuhl drückte. Mein Spiegelbild, das mich aus erschöpften Augen heraus ansah. Das war’s. Kein Unfall. Nicht das Bersten von Glas. Aufgeregtes Hupen. Schreie. Da war nur Finsternis, die sich wie eine Decke über meinen Verstand gelegt und mich eingehüllt hatte.
Ich schluckte, bewegte die Augen von links nach rechts, kämpfte gegen die flaue Wut in meinem Magen an. Warum wusste ich nicht, was mit mir geschehen war? Ich stemmte die Hände aufs Bett, wollte aufstehen, doch ich konnte kaum die Beine anwinkeln. Wieso konnte ich nicht reden? Mich nicht bewegen? Gott verdammt, was war hier los?! Tränen der Hilflosigkeit stiegen mir in die Augen, flossen unnachgiebig meine Wangen herunter.
Jemand nahm meine Hand. Die Berührung war warm und irgendwie vertraut, auch wenn ich die Frau mit den braunen Haaren noch nie zuvor gesehen hatte.
»Miss Campbell, was ich Ihnen nun sage, wird nicht leicht für Sie sein. Sie müssen mir versprechen, ruhig zu bleiben. Schaffen Sie das?«
Ich holte tief Luft und nickte.
»Miss Campbell, Sie hatten einen schweren Verkehrsunfall. Dabei haben Sie sich unterschiedliche Frakturen und ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Aufgrund der Scherkräfte kam es zudem zu einer Ruptur eines Blutgefäßes, wodurch Ihr Gehirn anschwoll. Wir mussten Sie deshalb in ein künstliches Koma versetzen. Aber Sie hatten großes Glück. Sie haben keine körperlichen oder geistigen Folgeschäden erlitten. Ich weiß, Sie fühlen sich, als würden Sie nie wieder die Alte werden, aber Sie lagen drei Monate im künstlichen Koma. Sie müssen ihre Muskeln erst wieder aufbauen.«
Die Worte begannen sich in meinem Kopf zu überschlagen. Drei. Monate. Koma. Verkehrsunfall. Weitere drängende Gedanken, die sich in meinem Kopf miteinander vermischten. Nana. Grandma. Meine Mutter. Niclas. New Orleans. Eine gelbe Tür. Der Fahrstuhl. Blaue Augen. Eine Hornbrille. Ich wollte schreien, doch kein einziger Laut verließ meine Lippen. Ich war stumm. Stumm wie die Bäume im Wald – dazu verdammt, zu schweigen. Aber die Welt um mich herum schien mir entgegenzubrüllen.
Das Piepen wurde lauter. Schneller. Die Stimme des Doktors beruhigender, doch sie vermischte sich mit dem erneuten Fiepen in meinen Ohren, bis sie schließlich ganz fort war. Tränen raubten mir die Sicht, und die Erkenntnisse brachen wie eine Welle über mich herein. Ich war drei Monate im Koma gelegen. Der Arzt zog die Stirn in Falten, sein Gesicht verriet mir, dass er noch immer sprach, aber er hätte ebenso schweigen können. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, wie Bewegung ins Zimmer kam. Einige Schwestern kamen herein. Anweisungen rasten durch die Luft wie Raketen.
Ich spürte eine merkwürdige Trägheit. Erst im Körper, dann im Kopf. Und während sich Gabriels Gesicht vor meinem inneren Auge zusammensetzte – das Blau seiner Augen, die blonden Bartstoppeln, die dunkle Hornbrille –, verschwand das Licht, und zurück blieb Finsternis.
»Evelyn?«, durchbrach eine zittrige Stimme die Stille. Ein Stückchen Heimat in einer Welt, in der alles fremd war. Benommen schlug ich die Augen auf, sah in ein Paar mir nur allzu vertrauter blauer Augen. Sie waren gerötet, und die Person, der sie gehörten, beobachtete mich aufmerksam. Als sich unsere Blicke begegneten, begann sie zu weinen. Tränen liefen über die zarten Wangen meiner besten Freundin. Sie hinterließen helle Spuren da, wo sie das Make-up mit sich nahmen, verfingen sich in ihren Mundwinkeln.
»O mein Gott, ich kann nicht fassen, dass sie dich tatsächlich wecken konnten …«, krächzte sie, bevor sie sich über mich beugte und mich in eine Umarmung zog. Ihr Körper zitterte, während ich nur bewegungslos in ihrem Armen hing. Noch einmal versuchte ich mich an einem Lächeln. Diesmal gelang es mir. Schwerfällig hob ich die Arme und legte sie um ihren zarten Körper. Ich versuchte mich an einem »Alles wird gut«, doch ich bekam erneut nichts als ein Krächzen hervor.
»Deine Grandma müsste auch jeden Moment kommen!«, erklärte sie und drückte mich fest an sich.
»O mein Gott«, schluchzte sie an meinem Hals. Tränen tropften mir heiß auf die Schulter, ihre Haare kitzelten mir die Nase. Der Geruch von Pfirsich und Zedernholz umarmte mich wie ein Mantel der Liebe, erschuf Heimat, wo ansonsten nur Fremde war, bewies, dass das hier wirklich geschah, ich nicht träumte, gar halluzinierte.
Ich bin wach.
Nana umarmte mich eine kleine Ewigkeit lang. Endlose Sekunden, in denen unsere gemeinsamen Jahre stumm an mir vorüberzogen, begleitet von ihren gleichmäßigen Schluchzern.
Als sie sich von mir löste, war ihre Mascara verschmiert, und Rotz lief ihr aus der Nase. Sie beugte sich zurück und kramte in ihrer Tasche nach einem Taschentuch. Erst putzte sie sich die Nase, dann schaute sie mich einen Moment an, die Augen gerötet, tiefe Furchen darunter. Das Ergebnis zahlreicher schlafloser Nächte. Meine Freundin sah gealtert aus. Ihre langen Locken waren blonder als sonst, und die Falten auf ihrer Stirn schienen noch etwas tiefer geworden zu sein. Eilig wischte sie sich mit dem Papiertuch über die Augen, doch die Tränen wollten nicht versiegen.
Sie lachte, klar und hell, schüttelte dann aber leise seufzend den Kopf.
»Ich kann einfach nicht fassen, dass du aufgewacht bist. Sie haben so oft versucht, dich zu wecken, doch deine Lungen schafften es nicht«, sagte sie mit einem Schluchzen. In diesem Moment wünschte ich, ich könnte etwas sagen. Irgendwas. Ich öffnete die Lippen, beobachtete, wie sie mich ansah. Doch erneut entfuhr mir nur ein unverständlicher Laut. Genervt senkte ich den Blick, sah auf meine Hände.
Amanda – Nana – beugte sich über mich, strich mir sanft über das Gesicht. Erst jetzt merkte ich, dass ich ebenfalls weinte.
»Keine Sorge, das wird wieder. Die Ärzte meinten, das sei völlig normal. Du lagst drei Monate im Koma. Danach wacht man nicht einfach auf und springt durch die Krankenhausflure. Du wirst eine Reha bekommen, und bald kannst du wieder laufen und sprechen und alles tun, was dein Körper vorher konnte.« Sie lächelte, auch wenn es nicht wirklich überzeugt wirkte. Sanft legte sie eine Hand auf meine, sah mir aufmerksam in die Augen.
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisst habe«, wisperte sie. »Als vorhin der Anruf des Krankenhauses kam, dachte ich, ich habe mich verhört.« Sie lachte, wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht, gab den Kampf mit ihrem Mascara endgültig auf.
»Ich wusste, du bist da noch irgendwo, aber die Ärzte …« Weitere Tränen drängten unter ihren Lidern hervor und tropften mir heiß auf die Hand. »Sie sagten uns nach zwei Monaten, dass wir uns langsam mit dem Gedanken auseinandersetzen müssten, die Maschinen abzustellen. Sie haben dreimal versucht, dich aufzuwecken, und jedes Mal …« Ihre Stimme versagte. Meine Augen weiteten sich. Sie bemerkte meinen Blick, rutschte näher.
»Gott, es tut mir leid. Ich will dich nicht die ganze Zeit darüber voll heulen, wie schwer es für mich war. Der Arzt meinte, du wüsstest nicht, was geschehen ist?« Sie schniefte.
Kurz zögerte ich, schüttelte den Kopf, wobei mich bereits diese kurze Bewegung übermenschliche Anstrengung zu kosten schien. Sie rieb sich die Nase, dann sah sie auf meinen schmalen Körper, und begann zu erzählen. Davon, wie ich zu Gabriel gefahren und davongerannt war – wie mich das Auto erfasst hatte. Doch weshalb ich fortgerannt war, ließ sie aus. Wusste sie es nicht? Oder wollte sie es mir schlichtweg nicht sagen?
Ich blinzelte den erneuten Anflug von Tränen weg, doch das Chaos in meinem Inneren konnte ich nicht einfach wegblinzeln. Bei der Vorstellung, dass irgendwas, was auch immer geschehen war, mich hatte davonrennen lassen, bebte ich innerlich. Zitterte, weil ich wusste, Gabriel gab sich die Schuld dafür.
»Also schätze ich, du willst vor allem wissen, was mit Gabriel ist. Ich konnte ihn vorhin nicht erreichen, aber …« Meine Augen weiteten sich noch weiter.
Amanda verstummte, sah an mir vorbei an die Wand. »Ich weiß, ihr habt euch gestritten … Und ich weiß, du wolltest zu ihm, denn der Unfall war ja bei ihm vor der Tür …« Sie ließ sich Zeit, während sie sprach, suchte nach den richtigen Worten.
»Er war jeden Tag da, weißt du … Jeden verdammten Tag. Zwei Monate lang. Aber die Ärzte, sie …« Nun sah sie mich wieder an, die Tränen flossen schneller. »Sie machten uns nicht gerade viel Hoffnung, und …« Sie verstummte, schnappte nach Luft, als stünde sie kurz davor zu ersticken. »Sein Dad ist gestorben. Seitdem …« Sie zuckte unbeholfen mit den Schultern und schwieg einen Moment. Noch einmal weitete ich die Augen, wollte wissen, was sie mir nicht sagen wollte.
»Seitdem war er nicht mehr hier. Ich weiß nicht, wo er ist …«
Nun spürte ich die Tränen doch, die ich vor wenigen Augenblicken noch versucht hatte fortzublinzeln. Heiß und dick rollten sie über meine Wangen. Sie schmeckten salzig.
»Aber davor … er war jeden Tag da.« Sie verteidigte ihn, obwohl sie es nicht musste. Er hatte nichts falsch gemacht.
»Willst du ihn sehen?«, fragte sie. Ihre Tränen waren versiegt. Ihre Unterlippe zitterte jedoch noch immer. Ich senkte den Blick, sah auf den leblosen Körper, der wohl meiner war.
Natürlich wollte ich ihn sehen. Ich wünschte mir nichts sehnlicher als seinen Geruch von Meer und Minze wieder einzuatmen, seine Arme um meinen Körper, während er mich ganz fest hielt, die weichen Lippen, mit denen er mir sanfte Küsse auf die Stirn hauchte und mir versprach, dass alles gut werden würde, wir das schafften. Doch wollte ich, dass er mich so sah? Dass er mich anschaute und sich für all das hier die Schuld gab? Erneut fiel mein Blick auf die Schläuche in meinen Armen, den dünnen Körper unter viel zu viel Stoff. Ich war ein Schatten meiner selbst, der nicht nur furchtbar aussah, sondern sich weder richtig ausdrücken noch wirklich bewegen konnte. Wollte ich ihm das antun? Wollte ich, dass er mich so sah?
Nein. Es war besser, ihm in den Glauben zu lassen, ich sei noch immer im Koma. Es war leichter für ihn, zu denken, alles sei unverändert, auch wenn mich die Vorstellung, ihn auf unbestimmte Zeit nicht zu sehen, schmerzte. Wie lange würde so eine Reha dauern? Wochen? Monate? Was stand mir bevor? Doch egal, wie lang es war, er hatte genug gelitten. Ich würde zu ihm gehen, wenn ich bereit war, wenn ich das Gefühl hatte, mein Anblick würde ihm nicht noch mehr Schuld auf die Schultern laden, als er wahrscheinlich ohnehin schon mit sich herumtrug. Egal, was zwischen uns geschehen war, er verdiente es nicht, das, was nun folgen würde, auch noch mit ansehen zu müssen. Nein. Lieber kämpfte ich allein. Stumm. In dem Wissen, dass meine beste Freundin und meine Grandma bei mir waren, mir halfen, wo es nur ging. Lieber sollte mein Herz vor Sehnsucht bluten, als dass ich dem Mann, den ich über alles liebte, dabei zusehen musste, wie er in Schuld ertrank, obwohl er doch immer nur versucht hatte, für mich da zu sein.
Ich schwenkte mit den Augen nach links und rechts. Sie verstand sofort.
»Er wird es dir übel nehmen.«
Ich zuckte mit den Schultern, weil ich ihr nichts antworten konnte, außer unverständlichen Lauten.
Nana nahm meine Hand und drückte sie an ihren Brustkorb. »Das wird ein langer Weg. Aber ich werde nicht von deiner Seite weichen.«
Kapitel 2
Evelyn
10 Wochen später
Mitte Juni 2016
Zeit. Ein Wort, das unser ständiger Begleiter ist. Doch wer versteht die Zeit schon wirklich? Zeiger, die ticken. Kalenderblätter, die abgerissen werden. Ein Planet, der sich dreht. Und während ich früher immer auf der Flucht vor der Zeit, hatte ich mittlerweile begriffen, dass es Konstanten gibt, die wir Menschen schlichtweg nicht kontrollieren können. Zeit ist eine davon. Sie vergeht einfach, rennt an uns vorbei. Und sosehr wir uns auch bemühen … am Ende können wir sie ja doch nicht aufhalten.
Eine Lektion, die ich lernen musste: Zeit vergeht. Egal, ob man sich darüber im Klaren war, egal, ob es mich gab oder nicht. Zeiger tickten weiter, Kalenderblätter wurden weiterhin abgerissen, unser Planet drehte sich.
Mittlerweile war es gut zehn Wochen her, seitdem ich aus dem künstlichen Koma aufgewacht war. Zehn Wochen der Tränen, des Schmerzes und eines unnachgiebigen Kampfes zwischen mir und meinem Körper. Aber ich hatte es geschafft. Angetrieben durch puren Lebenswillen und Liebe, hatte ich wieder die Kontrolle über mich erlangt. War wieder eins mit meinem Körper geworden. Ich hatte mich zurück in ein Leben gekämpft, das ich früher nicht einmal wirklich gelebt hatte. Ein Leben, das mehr unreflektierte Vergangenheit als wirklich lebenswert war. Aber hier stand ich nun. Auf zwei Beinen, die laufen konnten. Fingern, die greifen konnten. Einem Geist, der sich nicht länger über seine Kindheit definierte.
Als man mich damals ins Reha-Zentrum brachte, erklärte man mir, dass es schwer werden würde. Wie schwer tatsächlich, sollte ich noch herausfinden. Ich verbrachte täglich acht bis zehn Stunden mit einem Team von Fachärzten und Physiotherapeuten, die versuchten, mir das zurückzugeben, was ein gesunder Mensch eigentlich können sollte. Was ich immer gekonnt hatte. Es war eine furchtbar entwürdigende Sache, nichts alleine zu können. Immerhin war mein Sprachzentrum durch den Unfall nicht beschädigt worden, so dass ich schon bald wieder sprechen konnte. Doch es war ein Alptraum, nicht wirklich laufen zu können oder vom Gang zur Toilette so erschöpft zu sein, dass ich erst mal eine Verschnaufpause brauchte, sobald ich dort ankam.
Es war schwer gewesen, unter diesen Umständen zu akzeptieren, dass ich Glück gehabt hatte. Ich hörte das wahnsinnig oft. Von Ärzten. Von Therapeuten. Von meinem Psychologen. Von Nana. Von meiner Grandma. Ich hatte Glück, dass ich aufgewacht war. Dass ich keine nennenswerten Folgeschäden davongetragen hatte. Dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war, und ich auch sonst keinen wirklichen Schaden außer ein paar unschönen Narben davongetragen hatte. Lediglich meine Muskeln waren während des künstlichen Komas derart geschrumpft, dass ich sie wiederaufbauen musste. So auch meine Atemmuskulatur.
Ja, ich hatte so viel Glück gehabt. Und während ich mich zu Beginn noch fühlte, als sei ich mit einem Fluch belegt, hatte ich das mittlerweile verstanden. Es stimmte, was sie sagten, auch wenn ich das in der Anfangszeit der Reha nur zu gern vergaß. Mich lieber in meinem Leid suhlte wie Maden im Speckmantel.
Obwohl mir zu Beginn nicht klar gewesen war, was diese Reha für mich wirklich bedeuten sollte, bereute ich keinen einzigen Tag, dass ich mich dazu entschlossen hatte, Gabriel nicht anrufen zu lassen, denn ich wollte es selbst tun.
Gott sei Dank war ich auch nie wirklich alleine. Nana kam fast täglich vorbei. Sie hatte nach ihrer Rückkehr aus New Orleans und meinem Unfall ihr Business von Ebay und Etsy auf eine eigene Homepage verlegt – sie erklärte, das sei ihre Art von Ablenkung gewesen. Arbeit. Arbeit. Arbeit. Doch nun, da ich wach war, arbeitete sie die Aufträge vor allem abends ab, während sie tagsüber so oft wie möglich bei mir war. Das klappte natürlich nicht immer, weil sie manchmal zu Kunden fuhr, um Maß zu nehmen, aber sie versuchte es. Und wann immer sie kam, brachte sie auch meine Grandma mit.
Während meiner Reha hatte ich unzählige Kurzgeschichten verfasst. Es war eine Übung gewesen, um meine Finger zu trainieren. Zu Beginn hatte ich unfassbar viel geweint, weil ich die Tasten nicht traf, den Stift nicht halten konnte, aber mit jedem Tag, den ich es weiter versuchte, schaffte ich es, mir meine Feinmotorik wieder anzutrainieren. Und ganz nebenbei füllte ich Seiten über Seiten.
Ich tat das für mich, aber auch für Gabriel. Für den Tag, an dem ich die Reha beenden und die Taste für einen Anruf treffen konnte.
Aber um an diesen Punkt zu gelangen, musste ich viele Steine überwinden. Ich schlief wenig, um bis in die Nacht an meinem Fingerspitzengefühl zu arbeiten. Kämpfte mich durchs Wasser und später entlang des Barrens zurück auf meine Beine. Trotzte den Grenzen, die die Therapeuten mir setzten, und wuchs über mich hinaus. Minuten, Stunden und schließlich Tage quälte ich mich zurück ins Leben. Angetrieben von der Macht der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einer Zukunft, aber auch nach ihm.
Und jetzt war es so weit. Ich war wieder ich. Zwar mochte ich noch Probleme beim Treppensteigen haben und auch das Schließen kleiner Verschlüsse machte mir Schwierigkeiten – aber davon abgesehen, ging es mir hervorragend. Es war, als wäre ich neu geboren worden. Die Ärzte nannten das Restitutio ad integrum – die völlige Wiederherstellung der normalen Körperfunktionen.
»Wirf deine Sachen einfach erst mal ins Wohnzimmer, wir können sie nachher hochräumen. Ich nehme an, du wirst ihn gleich besuchen wollen?« Nana hatte mir zwar eine Frage gestellt, doch ihre Stimme hatte den Unterton einer Aussage. Grinsend warf sie die Tür ins Schloss, kam mit den restlichen meiner Sachen zu mir herüber. Sie ließ sie achtlos fallen und stemmte seufzend die Hände in die Hüfte.
»Tja, also hier hat sich nicht wirklich viel verändert. Alles beim Alten, wie man so schön sagt.« Dennoch sog ich jedes noch so kleine Detail in mich auf. Die heruntergebrannten Kerzen, das alte, durchgesessene Ledersofa, die grellen Wände. Wie lange hatte ich auf diesen Tag gewartet?
»Deine Blumen habe ich gegossen …«, erklärte sie beiläufig, während sie zum Kühlschrank ging und eine Flasche Wasser herausholte. Ich kniete mich zu meiner Forellenbegonie, strich sacht über die dunkelgrünen, breitschultrigen Blätter. Die lachsfarbenen Blüten strahlten mich an. Ich biss mir auf die Lippe und warf ihr einen schnellen Blick zu.
Erneut seufzte sie. »Mist. Was hat mich verraten?«
»Ich hätte dir geglaubt, dass sie überlebt … Aber nicht, dass sie blüht.«
Sie rieb sich lachend die Stirn. »Du hast dich zurück auf die Beine gekämpft und traust mir nicht zu, zu lernen, wie ich deine Pflanzen zu gießen habe?«
Grinsend zog ich eine Braue hoch. Niemand hatte so einen schwarzen Daumen wie Nana. Bei ihr gingen selbst Kakteen ein.
»Na schön«, gestand sie. »Hauptsache, sie sind da, oder?«
»Du hättest nicht extra eine neue kaufen müssen«, erklärte ich und nahm ihr das Glas Wasser ab, das sie mir entgegenhielt.
»Ich weiß«, sagte sie schulterzuckend. »Aber ich wollte es.«
Ich schenkte ihr ein Lächeln, erhob mich und umfasste den goldenen Anhänger meiner Kette, die Gabriel mir geschenkt hatte. »Ich glaube, ich bin soweit«, erklärte ich. Nana atmete noch einmal tief durch, dann kehrten wir zum Auto zurück und machten uns auf den Weg.
Reglos starrte ich auf die Nummer, die in metallenen Ziffern an der Tür prangte: 57. Ich wusste, dass ich nach unserem Streit noch einmal hier gewesen war. Schließlich hatte Nana mir detailliert erklärt, dass sich der Unfall vor diesem Haus ereignet hatte. Nur wieso ich fortgerannt war, wusste keiner. Außer vielleicht Gabriel.
Also tappte ich im Dunkeln, erinnerte mich nicht einmal mehr daran, dass ich überhaupt hier gewesen war – vor dieser Tür. Es war schon merkwürdig, dieses Gedächtnis. Man merkte sich so viel Unnötiges, doch kam es mal drauf an …
Ein Bing ertönte und riss mich aus meinen fortwährend rotierenden Gedanken. Sofort drehte ich mich um. Es war nicht Gabriel, der aus dem Fahrstuhl trat. Es war eine Dame, die sich an die Griffe ihres Rollators klammerte. Ihr Blick war starr auf ihre Füße gerichtet, und sie murmelte ein leises »Hallo«, wobei sie sich an mir vorbei schleppte. Sie sah dabei nicht auf, sondern versteckte sich unter ihren voluminösen, weißen Locken.
Ich holte noch einmal tief Luft, ehe ich den Knopf für die Klingel drückte. Die folgenden Sekunden erschienen mir wie eine Ewigkeit. Es war mir unmöglich zu sagen, wie lange ich dort stand. Wartete, dass er mir endlich aufmachte, obwohl er ganz offensichtlich nicht da war.
Ganze drei Mal legte ich den Finger auf die Klingel, wartete. Aber es war vergebens. Also beschloss ich mich an den einzigen Ort zu begeben, wo man mir sagen konnte, wo er war.
Als ich das Gebäude verließ, blieb ich kurz stehen, starrte auf die Stelle, wo der Unfall passiert war. Nichts erinnerte mehr daran, was hier vor gut sechs Monaten geschehen war. Irgendwie hatte ich erwartet, der Asphalt wäre verfärbt. Reifenabdrücke würden eine Spur zeigen. Aber nichts. Da war nur grauer Asphalt. Als hätte es den Tag meines Unglücks niemals gegeben.
Amanda hatte sich Sorgen gemacht, dass es mich triggern könnte, hierher zurückzukehren. Aber es löste nichts in mir aus. In Filmen war es meistens so, dass die Rückkehr an den Ort des Geschehens oder das Erblicken einer involvierten Person dazu führte, dass die Protagonistin sich ganz plötzlich erinnerte. Aber wie so vieles traf das eben nicht auf jeden zu. Stattdessen kam es mir so vor, als wäre ich nur ein einziges Mal hier gewesen – als ich mich von Gabriel getrennt hatte. Doch ansonsten? Ansonsten war da nur Finsternis.
Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich mich mit ihm hatte versöhnen wollen. Eine zweite Chance für eine Liebe, die bereits zerbrochen war. Doch in der Zwischenzeit hätte alles passiert sein können.
Jemand legte mir eine Hand auf die Schulter. Ich blinzelte die Gedanken fort und sah auf. Amanda musterte mich, die Stirn vor Sorge gerunzelt.
»Alles okay?«, fragte sie.
Kurz schloss ich die Augen. »Ja, alles in Ordnung.«
»Erinnerst du dich an irgendwas?«
Ein Kopfschütteln meinerseits. »An absolut gar nichts«, erklärte ich schließlich, bevor ich an ihr vorbei zum Wagen lief. Sie folgte mir, öffnete die Fahrertür.
»Ja, und jetzt?«, wollte sie wissen, während sie eine Sekunde zu lang in den Rückspiegel sah. Im Gegensatz zu mir schien sie sich an diesen Ort mehr als deutlich zu erinnern.
»Warst du da?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich war doch noch bei meinen Eltern in Connecticut.« Nachdenklich runzelte ich dir Stirn, ehe mir wieder einfiel, dass sie über Weihnachten zu ihnen gefahren war und noch einige Tage hatte bleiben wollen.
Ich nickte nur.
»Aber ich bin später noch einmal hergekommen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wonach ich gesucht habe … Aber ich war hier, stand auf diesem Gehweg und hab auf die Stelle gestarrt, an der es passiert ist …«, gestand sie schließlich, ehe sie die Nase hochzog und den Schlüssel ins Zündschloss steckte, wobei ihr blondes Haar ihr so über die Schulter fiel, dass es ihr Gesicht verbarg.
»Also?«, fragte sie, ehe sie mich aufmerksam ansah. Sie hatte die Tränen heruntergeschluckt, allerdings konnte ich das Schimmern in ihren Augen noch immer sehen.
»Wir müssen nach Marthas Vineyard«, erklärte ich. Denn wenn Gabriel nicht hier war, konnte er überall sein, was bedeutete, ich musste zu den Menschen, die ihm am nächsten standen.
»Okay.« Die zweieinhalbstündige Fahrt verbrachten wir schweigend, waren der Worte müde. Ich ganz besonders. Während der letzten zehn Wochen hatte sich alles um mich und meinen Unfall gedreht: Wann würde ich wieder laufen können? Wann würde ich das Krankenhaus verlassen können? Wann würde ich Gabriel sehen können? Ich hatte mich dahinter versteckt, für ihn zu kämpfen, während ich in meinem Inneren einen ganz anderen Kampf austrug – ich hatte ein knappes halbes Jahr meines Lebens verloren. Obwohl es nach nicht viel klang, war es merkwürdig zu wissen, was ich seitdem alles verpasst hatte. Meine Grandma war um knapp fünf Jahre gealtert. Zumindest ihre Seele. Sie hatte sich bei mir entschuldigt, für meine Kindheit, ihre Art, mich zu erziehen. Wir hatten viele ernste Gespräche geführt, mit Einsichten, die ich ihr nach all den Jahren gar nicht mehr zugetraut hatte. Doch ich war froh darum. Es mochte merkwürdig klingen, doch die Ereignisse der letzten Monate schienen uns auf undenkbare Weise zusammengeschweißt zu haben. Von meiner unterdrückten Wut ihr gegenüber war nichts mehr geblieben außer einer fadenscheinigen Erinnerung.
Ich ließ den Kopf an die Scheibe sinken, sah dabei zu, wie die Stadt an uns vorüberglitt.
»Warum fühle ich mich noch immer, als würde ich träumen?«
Amanda sah mich kurz an, richtete den Blick aber sofort zurück auf die Straße.
»Weil du noch nicht einmal richtig begriffen hast, dass du wieder wach bist. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es sein muss, so lang im Koma zu liegen. Ich weiß, es ist jetzt schon zehn Wochen her, seitdem du aufgewacht bist. Aber es war ja nur Reha. Du hast dir keinen Tag Pause gegönnt, kennst nur das Innere der Reha-Klinik. Du warst zwar wieder hier, aber trotzdem nicht wirklich da. Ein bisschen so, als hättest du die letzten Monate in einem Paralleluniversum verbracht. Ich bezweifle, dass sich das wirklich wie Leben anfühlt. Dein Gehirn kann wahrscheinlich gar nicht verarbeiten, dass das dein Leben war. Dass dir das passiert ist.« Amanda machte das in letzter Zeit häufiger: sich auf mögliche Fragen meinerseits vorzubereiten.
Sosehr sie sich auch bemühte, hinter meinem Rücken zu agieren, hatte ich früher oder später mitbekommen, wie oft sie mit den Ärzten sprach. Sie war die Mutter und Schwester zugleich, die ich nie gehabt hatte. Und nachdem sie jede Information und alle psychologischen Hintergründe aus den Ärzten herausgequetscht hatte, brachte sie diese hin und wieder in die Konversationen mit mir ein, um mir nicht nur Freundin, sondern auch Ärztin zu sein. Sie gab die perfekten Antworten auf all die Fragen, die mich umtrieben, und ich liebte sie dafür. Mehr noch als zuvor.
»Es ist beinahe wie damals …«, murmelte ich. »Es kommt mir vor, als wäre all das gar nicht passiert, weil alles aussieht wie noch vor einem halben Jahr«, flüsterte ich in die Stille des Wagens hinein.
Amanda legte ihre Hand auf meine. »Die Zeit stand eben nur für uns still. Für die Welt … änderte sich nichts. Zeit ist ein Konstrukt, das nur für uns Menschen von größerer Bedeutung ist. Nur wir haben Angst, etwas zu verpassen.«
»Ich weiß«, murmelte ich. Aber es waren nur leere Worte. Phrasen, die mir in letzter Zeit einfach über die Lippen kamen, weil Phrasen leichter waren, als meine Gedanken zu ordnen, in Sätze zu verpacken und auszusprechen. Natürlich wusste ich all das, und trotzdem … waren da diese Monate, die ich wortwörtlich verschlafen hatte. Das Schicksal hatte mich aus meinem Leben gerissen und mich buchstäblich eingefroren. Abgeschnitten von der Außenwelt, von meinen Kindern in der Arbeit, meinem Leben, wie ich es vorher kannte. Aber vor allem von den Menschen, die ich liebte. Die Menschen um mich herum hatten gelitten, und ich hatte ihnen nicht beistehen können, war sogar der Grund für ihr Leiden. Und Gabriel und mir hatte das Schicksal noch viel mehr genommen. Eine zweite Chance. Gabriel seinen Vater. Egal, was geschehen war, egal, was da zwischen uns stand … Ich war mir sicher, wir hätten es überwunden. Aber dieser Chance hatte man uns beraubt. Und nun war er wie vom Erdboden verschluckt. Hatte mich seit Monaten nicht mehr besucht. Lag das nur daran, weil er die Hoffnung verloren hatte? Dass er nicht mit ansehen konnte, wie gleich zwei Menschen aus seinem Leben gerissen wurden?
Oder gab es andere Gründe? Es war egoistisch, und ich schämte mich dafür, aber immer wieder war da diese eine Frage: Liebte er mich noch? Denn ich tat es. Nach all der Zeit liebte ich ihn noch immer. Und die Sehnsucht nach ihm schien mich langsam von innen aufzufressen.
Wir erreichten das Haus der Malones schließlich am frühen Abend. Es war beleuchtet, aber Gabriels Wagen war nirgends zu sehen. Ich beschloss, mir die Hoffnung nicht nehmen zu lassen. Vielleicht war er vorerst hergezogen, und der dunkle BMW parkte in der Garage?
Möglicherweise saß er im Haus seiner Eltern, mit seiner Schwester und deren Mann und hatte Olivia und Amber – seine beiden Nichten – auf dem Schoß. Vielleicht erzählte er ihnen eine Geschichte, oder sie aßen? Oder war er unterwegs? Auf der Suche nach dem perfekten Bild, so, wie es sich für einen Fotografen gehörte? Mein Herz raste, schien sich in meiner Brust zu überschlagen. Ich schnappte nach Luft, starrte auf den Vorgarten, die Schatten, die durch den Flur huschten, der durch die verglaste Tür vom Rest der Welt abgetrennt war. Kurz schloss ich die Augen, in dem kläglichen Versuch, mich zu beruhigen. Als ich die Augen wieder öffnete, sah Amanda mich geduldig an. Sie ließ mir meine Zeit, und dafür konnte ich ihr gar nicht genug danken. Einige Sekunden verharrte ich noch so, dann legte ich die Hand auf den Türgriff des Gartentors, atmete ein letztes Mal tief durch – mehr als bereit, in die Arme des Mannes zurückzukehren, den ich so sehr liebte.
»Okay«, murmelte ich schließlich. Als ich die Tür aufstieß, schlotterten meine Beine, als wären sie aus Wackelpudding. Amanda kam um den Wagen, hängte sich bei mir ein und stützte mich. In dieser Sekunde war ich mehr als dankbar, dass sie mitgekommen war.
Wir öffneten die quietschende Gartentür und durchquerten den Vorgarten. Auch hier hatte sich nichts verändert. Die Blüten der Magnolie erstrahlten im Licht der untergehenden Sonne, der Zaun leuchtete in derselben Farbe – das Einzige, was anders war, war das Unkraut, das nun zwischen den Steinplatten wuchs.
»Bereit, wenn du es bist«, sagte Nana, als wir vor der verglasten Eingangstür zum Stehen kamen. Ich holte noch einmal tief Luft, sog den Geruch frisch gemähten Rasens ein und klingelte schließlich.
Wie auch schon bei meinem ersten Besuchen schallte ein fröhliches Läuten durchs Haus. Leises Gemurmel drang zu uns nach draußen, Schritte.
Das Licht im Flur sprang an, die Tür öffnete sich – Stille.
Für den Bruchteil eines Wimpernschlags schien die Zeit erneut stillzustehen. Mia – Gabriels Schwester – stand vor mir. Das blonde Haar zu voluminösen Locken geföhnt, die grün-blauen Augen geweitet. Binnen weniger Sekunden schien sämtliche Farbe aus ihrem Gesicht zu weichen. Sie starrte mich einfach nur an. Endlos lange Sekunden, dann überbrückte sie die wenigen Schritte zwischen uns und zog mich in ihre Arme. Der Geruch von Flieder stieg mir in die Nase, und ich klammerte mich an sie, als würde ich sonst untergehen. Ich hörte ihr Schluchzen, spürte ihre warmen Hände, die immer wieder über meine Haare fuhren, als wollte sie sich vergewissern, dass ich auch wirklich da war – und keine Illusion war.
»Evelyn, bist du’s wirklich?«, flüsterte sie und lehnte sich zurück, um mir ins Gesicht zu schauen. »Ich kann es nicht glauben.« Sie drückte mich noch einmal fest an sich, so, als könnte ich sonst davonschweben, löste sich dann aber langsam von mir. Eilig wischte sie sich über die Augen, ehe sie einen merkwürdigen Laut von sich gab und mich noch einmal an sich zog. Weitere Schritte wurden laut. »Wer ist das, Mia?«
Die Schritte verklangen, jemand schnappte nach Luft. Mia löste sich von mir und trat einen Schritt zur Seite.
»Evelyn?« Ich sah auf. Betty, Mias und Gabriels Mutter, stand im Flur. Sie schien kleiner geworden zu sein, was aber auch daran liegen konnte, dass sie die übergroße Fleecejacke ihres toten Mannes eng vor der Brust zusammengezogen hatte.
»Du bist es wirklich«, stieß sie atemlos hervor und legte sich eine Hand auf die Brust, als wollte sie ihren Herzschlag beruhigen, dann eilte sie auf mich zu, schlang die Arme um mich, weinte und lachte gleichzeitig an meinem Hals.
»Ich kann es nicht fassen«, sagte sie mit einem Schluchzen und umarmte mich so fest, dass ich kurzzeitig keine Luft bekam. Sie überschüttete mich mit der Liebe, die mich einst überfordert hatte, aber nun konnte ich nicht genug davon bekommen.
»Hey«, murmelte ich und drückte sie so fest ich konnte. Als sie sich von mir löste, strahlte sie mich an, ehe ihr Blick hinter mich fiel.
»Hi, ich bin Nana. Die beste Freundin.«
»Hallo, Nana!«, sagte Betty, ging an mir vorbei und zog auch meine beste Freundin überschwänglich in die Arme. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie Mia Nana angrinste. Scheinbar hatten sie einander schon vorgestellt, während ich noch in Bettys Armen gelegen hatte.
»Okay, los, kommt rein, ihr zwei.« Betty wartete unsere Antwort nicht ab und zog mich stattdessen an der Hand ins Haus.
»Wollt ihr etwas trinken, wir haben alles da!«, erklärte sie schniefend und nahm sich ihr übergroßes Brillengestell von der Nase, um sich die Tränen wegzutupfen.
Ich schüttelte nur den Kopf, und Mia legte ihrer Mutter die Hände auf die Schultern, führte sie Richtung Wohnzimmer. Amanda und ich folgten ihnen. Es roch nach Lavendel, und alles, was ich vermisste, war der Geruch von Zimt. Der Duft, der mich daran erinnerte, wie Gabriel und ich hier Weihnachten gefeiert und eng umschlungen getanzt hatten.
Als ich das Wohnzimmer betrat, wurde mein Gedächtnis von derart schönen Erinnerungen überflutet, dass es mich schmerzte. Ich konnte Gabriels Anwesenheit förmlich spüren. Seine Hand auf meiner Schulter, seine Lippen an meinem Ohr.
»Setzt euch bitte«, sagte Mia, ehe sie neben ihrer Mutter Platz nahm und ihre Hand mit der ihren verschränkte. Noch immer sahen sie mich nur an, konnten den Blick kaum abwenden. Es war, als befürchteten sie, dass ich verschwinden könnte, sobald sie woanders hinsahen, die Blicke auch nur für eine Sekunde von mir abwandten.
»Wie ist das möglich?«, hauchte Betty nach einem kurzen Augenblick der Stille. Sie musterte mich, schien etwas zu suchen, das darauf hindeutete, dass ich die letzten Monate im künstlichen Koma gelegen hatte.
Ich räusperte mich, um den wachsenden Kloß in meiner Kehle loszuwerden. Die ganze Zeit hatte ich an nichts anderes gedacht, als endlich hierherzukommen. Und nun, da ich endlich hier war, wusste ich nicht, wie ich ihnen erklären sollte, dass ich seit zehn Wochen bei Bewusstsein war, mich aber dazu entschieden hatte, sie nicht zu informieren.
Was, wenn sie mich für egoistisch hielten? Meine Gründe nicht nachvollziehen konnten? Gabriel war offenbar nicht hier, was also wollte ich hier? Wie sollte ich mich vor ihnen erklären? War ich nicht nur eine seiner Exfreundinnen? Ein Mädchen, das sie einige Monate gekannt hatten? Plötzlich schnürte es mir regelrecht die Kehle zu.
»Ich, ähm …«, stotterte ich und rieb mir den Hals, als könnte das dabei helfen, meine Stimme zu stärken. Ich war es leid, mich selbst einzuengen, indem ich mir Gedanken um Dinge machte, die ich nicht ändern konnte. Ich hatte vor zehn Wochen eine Entscheidung getroffen, und nun würde ich zu dieser stehen müssen. Außerdem würde ich auch nicht erfahren, wie sie reagierten, wenn ich nicht endlich mit ihnen sprach – etwas, was ich bei der Therapie gelernt hatte: Nur wer fragt, erhält auch Antworten.
Also erzählte ich schließlich, berichtete davon, wie ich aufgewacht war, erklärte die Gründe, dass ich mich erst jetzt bei ihnen meldete. Sie hörten zu. Schwiegen und lauschten und weinten. Weinten, als würden wir einander schon ewig kennen. Als wäre ich trotz meiner wenigen Besuche vor gut einem halben Jahr bereits Teil ihrer Familie, und obwohl ich sie genau genommen schon lang nicht mehr gesehen hatte, fühlte ich mich auch so – wie Teil einer Familie.
Nachdem ich alles berichtet und gebeichtet hatte, löste ich den Blick von meinen Händen, sah zwischen den beiden hin und her. Sie sahen mich noch immer wortlos an. Es war Betty, die zuerst das Wort ergriff. Sie tupfte sich die Tränen aus den Augen, nur damit sie danach sofort weiterflossen.
»Ich kann dich so gut verstehen«, gestand sie leise. »Natürlich wünschte ich mir, ich hätte eher davon erfahren, dass du aufgewacht bist …« Sie schwieg einen Moment, schien auf dem dunklen Parkett nach den richtigen Worten zu suchen. »Immerhin haben wir oft an dich gedacht und, ja … auch um dich getrauert, aber ich kann es verstehen. Ich würde mir unter keinen Umständen anmaßen zu behaupten, dass ich anders entschieden hätte«, beendete sie ihren Satz. Mia nickte bekräftigend, ehe sie den Mund öffnete, nur um ihn sofort wieder zu schließen. Mein Blick verharrte einen Moment auf ihr, und mir entging nicht, wie sie nach Worten suchte. Sie räusperte sich.
»Aber Gabriel …« Sie knetete angestrengt ihre Hände. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Irgendwas stimmte nicht. Mir wurde übel. »Gabriel hat sehr gelitten.« Sie fuhr sich mit einer Hand durch die Haare und brach ab. Betty tätschelte ihr Knie. »Noch nie zuvor habe ich meinen Sohn so gebrochen gesehen. Es war, als zerfiel er vor uns in seine Bestandteile. Er war jeden Tag bei dir …« Betty senkte den Kopf, wischte sich weitere Tränen aus den Augen. »Er war absolut am Ende. Gab sich die Schuld für all das. Seit deinem Unfall ist er nicht mehr derselbe. Wir haben uns große Sorgen um ihn gemacht«, sprach sie weiter. Ihre Tochter legte behutsam die Hand auf die ihre und drückte sie leicht.
»Und dann …« Sie stockte, die Stimme rau und kehlig. »Starb auch noch sein Dad … Robert.« Kurz zögerte ich, dann stand ich auf und ging zu ihr. Obwohl Mia sie hielt, streckte sie die Hände nach mir aus, ließ sich von mir in die Arme nehmen.
»Es tut mir so leid. Mein Beileid«, flüsterte ich, umarmte sie, so fest ich konnte. Sie erwiderte die Umarmung, und als ich mich nach einer Weile von ihr löste, waren ihre Augen rot und geschwollen.
»Es war der endgültige Stoß für ihn. Es ging ihm nicht gut. Er konnte sein Leben nicht mehr ertragen«, flüsterte sie, weil ihre Stimme zu mehr nicht fähig war, die Tränen ihr die Kehle zuzuschnüren schienen. Mia schluchzte und strich ihrer Mutter sanft über den Oberarm. Ich sah zwischen den beiden hin und her, schüttelte ungläubig den Kopf.
»Was ist mit ihm?«, hauchte ich und drückte eine Hand auf mein Herz. »Hat er sich …« Die Welt um mich herum begann zu schwanken.
Mia beugte sich an ihrer Mutter vorbei, schüttelte schnell den Kopf. »Nein, nein. Das hat er nicht!« Sie stand auf und ging vor mir in die Hocke. Sanft legte sie mir die Hände auf die Schultern. Sie sah mir tief in die Augen, dann sagte sie: »Aber er ist fort … Er hat seine Sachen gepackt und ist davongelaufen. Wir haben keine Ahnung, wo er ist, wir können ihn erreichen. Er schickt uns hin und wieder ein paar Postkarten, aber das war’s. Gabriel ist nicht mehr hier, und nur Gott weiß, wann er zurück nach Boston kommt.«
Kapitel 3
Evelyn
Noch nie war mir die Standuhr im hinteren Eck des Wohnzimmers der Malones aufgefallen – bis jetzt. In zermürbender Ruhe tickten die Zeiger vor sich hin, schienen mich beinahe zu verhöhnen.
Tick.
Tack.
Noch immer war es still. Niemand sagte etwas. Mias Arme lagen um meinen Körper, und ihre Wärme ging auf mich über. Aber ich konnte mich nicht bewegen, war taub vor Schmerz. Irgendwann musste ich aufgestanden sein, denn ich stand einfach da, hörte dabei zu, wie Sekunde um Sekunde verstrich, unfähig, nur ein Wort zu sagen. Plötzlich war ich nur noch müde.
Als hätte man mir den Strom abgedreht. All die Monate der Reha, der Sehnsucht. Gabriel war nicht der Einzige, für den ich gekämpft hatte, und doch war er der Mensch, der mich während dieser Zeit auch ohne seine Anwesenheit jede Sekunde meines Tages begleitet hatte. Die Erinnerung an sein Lächeln, das Blau seiner Augen, die Zärtlichkeit seiner Berührung. Und nun, da ich endlich hier war, bereit, ihn in mein Leben zu lassen, da war er fort?
Noch einmal hallten Mias Worte durch meinen Kopf. Gabriel ist nicht mehr hier, und nur Gott weiß, wann er zurück nach Boston kommt.
»Er ist fort.« Eine Aussage, die auch eine Frage hätte sein können. Worte, deren Bedeutung mir durch den Kopf waberten, aber die ich nicht glauben konnte. Nicht glauben wollte.
Er durfte nicht weg sein. Obwohl Mia mir bereits gesagt hatte, dass sie selbst nicht wussten, wo er war, hörte ich mich fragen: »Und wo ist er?«
Mia nahm meine Hand und führte mich zurück zum Sofa. Sanft drückte sie mich an den Schultern auf die weichen Polster, kniete sich vor mich. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, wie sie ihre Mutter ansah, dann wandte sie sich wieder mir zu und lächelte traurig.
»Wir wissen nicht, wo er ist. Er meinte, er muss sich selbst finden. Er hat kein Handy bei sich, schreibt uns nur hin und wieder Postkarten in Kuverts, denen er ein paar Polaroid-Fotos beilegt, und berichtet uns, wo er war. Aber jetzt im Moment? Jetzt kann er überall sein.« Er war überall und doch nirgendwo. Meine Hand zitterte, als ich sie hob, um mir eine Strähne aus dem Gesicht zu streichen.
»Wann ist er aufgebrochen?«, flüsterte ich. Mia sah mich einen Moment an, nur um im nächsten Moment den Kopf zu senken. Sie legte die Stirn in Falten, holte tief Luft. »Direkt, nachdem unser Dad …« Sie konnte den Satz nicht beenden, schluckte, als wolle sie so den Schmerz hinunterwürgen, der ihr nur allzu deutlich ins Gesicht geschrieben stand. »Vor ungefähr drei Monaten. Da lagst du noch im künstlichen Koma. Es war eine Hals-über-Kopf-Aktion. Es hätte sich nichts geändert, wenn du ihm eher Bescheid gegeben hättest«, versicherte sie mir und strich mir liebevoll über den Oberschenkel. Ich nickte, aber ihre Worte waren nur ein schwacher Trost.
Mia sah auf. »Es mag eine taktlose Frage sein, aber … In jener Nacht … Kannst du dich noch daran erinnern, was geschehen ist?«
Kurz zögerte ich, dann schüttelte ich den Kopf. »Alles, was ich noch weiß, ist, dass ich in den Fahrstuhl stieg. Danach ist alles schwarz«, murmelte ich gedankenverloren. Immer, wenn mich jemand danach fragte, ging ich in mich, suchte nach Erinnerungsfetzen. Aber jedes Mal war es dasselbe Ergebnis – nichts. Und doch so viel. Da waren so viele Erinnerungen, Momente und Gedanken in meinem Kopf. Aber wenn es um jene Nacht ging … blieb mein Kopf leer.
»Verstehe«, murmelte Mia und sah zu ihrer Mutter. »Komm, ich will dir etwas zeigen«, sagte sie plötzlich und hielt mir ihre Hand hin. Kurz zögerte ich, dann ergriff ich sie schließlich. Wozu sollte ich mich ihr auch widersetzen? Was auch immer sie mir zeigen wollte, sie hoffte wohl, dass es mich aufheiterte.
Kurz sah ich zu Amanda, aber diese nickte nur bekräftigend. Während wir durch den Korridor gingen, fielen mir einmal mehr die vielen Bilder an den Wänden auf, und es war, als konnte ich Gabriels Anwesenheit förmlich spüren, als würde sein Geist neben mir schweben. Sein Gesicht tauchte vor meinem inneren Auge auf, wie er gegrinst hatte, während er mir die Fotos an der Wand erklärte. Ein Ereignis, das in meiner Wirklichkeit vor nicht allzu langer Zeit geschehen war. In seiner Wirklichkeit aber war das gut sieben Monate her. Es war unser erster Besuch bei den Malones gewesen … Thanksgiving. Ich wusste es noch ganz genau.
Als ich zu Mia sah und bemerkte, dass ihre Hand auf der Klinke zu Gabriels altem Kinderzimmer lag, zog sich etwas in mir zusammen.
»Alles okay?«, fragte sie, die Stimme ganz leise vor Sorge. Schnell nickte ich und zwang mich zu einem Lächeln.
»Alles prima«, log ich.
»Okay …« Sie drückte die Klinke herunter, und obwohl Gabriels letzter Aufenthalt in diesem Raum Ewigkeiten her sein musste, prallte sein Geruch mir augenblicklich entgegen. Ich sog die Luft ein, schloss kurz die Augen. Minze mit einer Brise Meerwasser. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass all das hier ein abgekartetes Spiel war. Gabriel war gar nicht wirklich fort, sondern saß oben auf seinem Bett und wartete, dass ich ihm in die Arme sank. Dass Amanda und seine Familie mich nur in eine Falle gelockt hatten, so wie an meinem Geburtstag. Ein Teil von mir erwartete, dass er gleich die Leiter herunterkommen und mich mit diesem verschmitzten Grinsen ansehen würde, das ich so liebte. Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen lief Mia zielstrebig zu seinem Schreibtisch und hob eine schwarze Box hoch. Als ihr Blick auf die Polaroids an der Pinnwand fiel, hielt sie einen Moment inne, als würden Erinnerungen sie in Besitz nehmen, doch sie lächelte, zog eines der Fotos ab und drückte es mir in die Hand. Es war ein Foto von Gabriel und mir. Aufgenommen auf unserem Segelausflug, ich wusste nicht, wie er es in das Format eines alten Polaroids bekommen hatte, aber was spielte das auch für eine Rolle? Gabriel saß hinter mir, drückte mir einen liebevollen Kuss auf die Wange. Ich hatte die Augen geschlossen, lächelte zufrieden ins Nichts. Der Wind spielte in unseren Haaren, fuhr uns unter die Kleidung.
Langsam strich ich mit dem Daumen über sein Gesicht. An jenen Tag im Sommer konnte ich mich ganz genau erinnern. Ich hob das Foto an und drückte es mir behutsam an die Brust, um die Erinnerung und Liebe ganz nah dort zu spüren, wo nur Schmerz und Sehnsucht mich ausfüllten.
»Du solltest dich setzten«, sagte Mia und deutete auf den Platz neben sich auf dem alten, dunklen Sofa. Ich setzte mich zu ihr, sah auf ihre Hände, die noch immer auf der Kiste ruhten.
»Was ist da drin?«, fragte ich vorsichtig, als befürchtete ich, es könnte eine Bombe sein. Und wahrscheinlich war es genau das. Eine Bombe voller Erinnerungen. Eine Bombe, die mein Herz zum Explodieren brachte.
Mia lächelte, schob sich eine helle Strähne hinters Ohr und hob schließlich langsam den Deckel ab. Irritiert blickte ich in die Box. Darin lagen dicke Briefumschläge. Nicht verschlossen. Vergilbt und mit Kaffeeflecken beschmutzt. Ein Relikt aus einer vergangenen Zeit.
Mia nahm einen Umschlag heraus und betrachtete ihn seufzend. Ich beobachtete, wie sie sich in Erinnerungen zu verlieren schien, und gab ihr die Zeit, die sie brauchte, auch wenn ich meine Neugier kaum bändigen konnte. Was für Briefe waren das? Nach einer Weile senkte Mia den Blick, und ich bemerkte eine einzelne Träne auf ihrer Wange.
»Ich habe dir ja gesagt, dass Gabriel jeden Tag bei dir war«, murmelte sie. Zaghaft nickte ich.
»Tag für Tag habe ich ihn leiden sehen. Er sprach nicht viel in dieser Zeit. Weder mit dir noch mit uns. Er war verschlossen wie ein Buch, und egal, was wir versuchten, er wollte sich einfach nicht öffnen … Außer …« Sie hielt mir einen Umschlag hin. »Damit«, sagte sie. Vorsichtig, als könnte ich mich daran verbrennen, nahm ich ihn ihr ab.
»Er hat dir Briefe geschrieben«, erklärte sie schließlich. »Ich weiß nicht, was darinsteht. Aber er hat dir sehr viele Briefe geschrieben. Bestimmt sieben. Mit unendlich vielen Seiten. Und als er ging, gab er sie uns.«
Und da war sie. Die Bombe.
Kapitel 4
Gabriel
Erster Brief
Liebe Evelyn,
du liegst hier direkt vor mir, eine Armeslänge von mir entfernt. Dabei könnten es ebenso gut Lichtjahre sein. Der Graben zwischen uns hat sich bereits vor einiger Zeit aufgetan, aber wie nah du mir damals tatsächlich noch warst, habe ich wohl erst jetzt richtig bemerkt.
Ich weiß nicht, was ich zu dir sagen soll. Wie ich dich berühren soll. Das, was einst vertraut war, scheint plötzlich fremd. Als würde ich dich nicht mehr kennen. Als wärst du eine Unbekannte für mich. Es ist merkwürdig, dass man so empfinden kann, obwohl man im selben Augenblick nur Liebe empfindet. Ich sitze hier schon eine ganze Weile. Tag ein, Tag aus kauere ich auf diesem unbequemen Stuhl und warte, dass sie dich aufwecken. Sie dich zu mir zurückholen. Aber sie tun es nicht. Also kann ich nichts tun, außer dich anzusehen. Die Ärzte sagen, ich soll mit dir reden. Dass man sich uneinig darüber ist, ob Koma-Patienten bestimmte Dinge mitbekommen oder nicht. Aber ich glaube, das sagen sie nur, damit ich mich nicht so furchtbar fühle. Sie wollen mir einen kleinen Trost geben in einer Zeit, in der es keinen Trost gibt. Zu Beginn habe ich es versucht. Ja, wirklich. Ich habe auf dich eingeredet. Aber nach einer Weile wusste ich nicht mehr, was ich noch sagen soll. Es kann furchtbar einsam sein, einen Monolog zu führen, obwohl man sich in Wahrheit einen Dialog herbeisehnt. Aber wie einsam ich mich tatsächlich fühle, habe ich erst jetzt bemerkt.
Du fehlst mir. Alles an dir. Dein Lachen. Das Zimtbraun deiner Augen. Die Art, wie du dir auf die Lippe beißt, kurz bevor ich dich küsse. Die Geschichten, die du mit so viel Herz erzählst. Alles an dir fehlt mir.
Ich schätze, diese Situation ist eines unserer Firsts. Du erinnerst dich? Eins der Dinge, die wir gemeinsam zum ersten Mal erleben. Ein makabrer Zusammenhang, das ist mir schon klar. Aber dennoch … Es hilft mir, deinen »Zustand« mit unserem normalen Leben zu verweben. Es hilft mir dabei, weil all das dann nicht so hoffnungslos wirkt.
Ich schaue dich den ganzen Tag an und beobachte die Schläuche. Sie ragen überall aus dir heraus. Aus deinem Mund, deiner Hand … Es ist grauenhaft. Aber noch viel grausamer ist die Tatsache, dass ich der Grund dafür bin. Dass du all das nur wegen mir durchmachen musst. Ich hatte dir ein Versprechen gegeben – dass du bei mir sicher bist, dass ich dir nicht wehtun würde. Stattdessen habe ich dich fast ins Grab gebracht. Ironischerweise wird meine Familie nicht müde, mir ausreden zu wollen, dass es meine Schuld ist. Aber ich weiß es besser. Ich bin nicht naiv. Natürlich bin ich dafür verantwortlich. Du bist zu mir gekommen, weil ich ein Geheimnis vor dir hatte. Weil du Klarheit wolltest. Und als du es kanntest, bist du davongerannt. Ich mag zwar nicht derjenige gewesen sein, der hinter dem Lenkrad saß, aber dennoch … Ich bin der Grund, dass du an jenem Abend zu dieser Zeit an diesem Ort warst. Wegen mir bist du davongerannt – direkt vor dieses verfluchte Auto.
Ich kann dir nicht sagen, wieso ich dir all das erzähle, meine Gedanken sind in letzter Zeit sehr sprunghaft. Als würden sie sich überschlagen. Jetzt weiß ich, wie es dir all die Wochen und Monate erging. In meiner Verzweiflung habe ich sogar deinen Trick ausprobiert. Habe die Luft angehalten und bin einfach in der Wanne untergetaucht, um Stille unter Wasser zu erleben. Und in der absurdesten Situation habe ich dich plötzlich verstanden. Konnte nachvollziehen, wieso du es fortwährend gemacht hast. Da ist diese Stille. Als würden die Gedanken vom Wasser verdrängt. Es ist himmlisch. Aber du hast mir nicht gesagt, wie ernüchternd es ist, wenn man wieder auftaucht und die Gedanken in doppelter Intensität auf einen einströmen. Es ist ein Teufelskreis. Möglicherweise ist das auch der Grund dafür, dass ich nicht mehr schlafen kann. Das sollte ich wohl auch nicht, wenn man bedenkt, was ich verschuldet habe. Trotzdem verlangen es alle von mir. Schlafen, essen, duschen, zur Ruhe kommen …
Wie aber soll das gehen, wenn der Mensch, den ich liebe, im künstlichen Koma liegt? Und all das wegen mir? Wegen einer falschen Entscheidung, die ich traf?
Wenn du jetzt hier wärst, würdest du wahrscheinlich sagen, dass ich nicht so negativ denken soll. Aber du liegst nun schon seit zwei Wochen im künstlichen Koma und deine Gehirnschwellung geht noch immer nicht zurück. Die Ärzte sagen, dass dies noch geschehen kann, zwei Wochen noch nicht so lange sind. Aber das, was angeblich zwei Wochen sein sollen, erscheint mir wie Monate. Die Zeit verläuft anders hier drin. Eine Sekunde draußen, in der echten Welt, bedeutet Stunden hier drin.
Deine Großmutter und Nana kommen jeden Tag vorbei. Sie bringen mir Süßigkeiten. Und deine Grandma alte Kinderfotos von dir. Ja, sogar dein Lieblingsplüschtier Tommy lugte eines Tages aus ihrer Tasche. Du hast mir nie von dem kleinen Eisbären erzählt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn eigentlich für dich mitgebracht hat, aber ich habe ihn mit nach Hause genommen. Vielleicht erhoffte ich mir, doch schlafen zu können, wenn ich wüsste, ein Teil von dir ist bei mir. Aber stattdessen hat es das nur schlimmer gemacht. In jener Nacht bin ich durch die Wohnung getrottet auf der Suche nach dem Ungewissen. Das tue ich häufiger. Etwas suchen, obwohl ich nicht einmal weiß, wonach. Als ich am Kühlschrank ankam, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich war auf der Suche nach Dingen, die mich an New Orleans erinnern. Wann immer eine Situation einer aus unserem früheren Leben gleicht, ist es, als könnte ich dich spüren. Als wärst du ein Geist, der auf meiner Schulter sitzt. Mir auf Schritt und Tritt folgt. Mich beobachtet.
Also bin ich zum Kühlschrank gegangen, habe ihn geöffnet, und prompt überfiel mich eine Erinnerung an dich. In letzter Zeit verschwimmen die Erinnerungen manchmal mit der Realität, scheinen sich noch einmal zu wiederholen. Dein Gesicht war von breiten Schlaffalten gezeichnet, die Augen klein und müde.
»Na, auf der Suche nach einem Mitternachtssnack?«, fragtest du. Ich sah auf. Das bläuliche Licht strahlte dich direkt an, und aus irgendeinem Grund erschienst du mir an jenem Tag wie ein Engel. Du trugst eines meiner Shirts, es war dir viel zu groß, ragte dir bis über den Hintern und verbarg alles, was ich nur zu gerne gesehen hätte. An jenem Abend sahst du wunderschön aus. Es war, als wären die Mauern um dich herum eingerissen, und alles, was ich sah, war dein wirkliches ich. Nackt und verletzlich. Ich erkannte die starke Frau, die tief in dir schlummert, auch wenn du sie oft hinter den Schatten deiner Vergangenheit versteckst.
»Seitdem ich vegetarisch lebe, bekomme ich hin und wieder Heißhungerattacken auf Süßigkeiten«, erwiderte ich. Du hast gelacht, bis dir auffiel, dass Amanda schlief, und du dir eilig eine Hand vor den Mund gehalten hast.
»Und du meinst, in unserem Kühlschrank, der nur so vor Gemüse und Fleischersatzprodukten überquillt, wirst du etwas finden?«, hast du gefragt und mich dabei derart unverschämt angegrinst, dass ich dich am liebsten direkt auf der Küchentheke genommen hätte.
»Na ja, ich dachte, einen Versuch wäre es wert.« Diesmal lachtest du nicht. Stattdessen hast du dir auf die Lippe gebissen, ehe du dich umgedreht hast und in deinem Zimmer verschwunden bist.