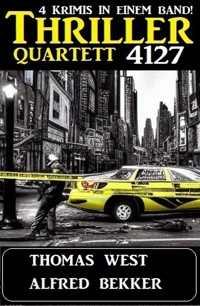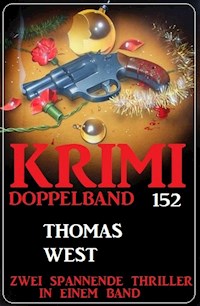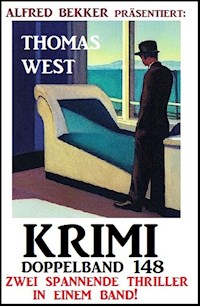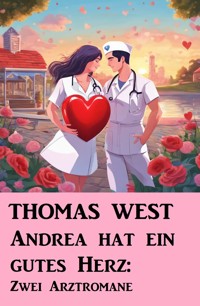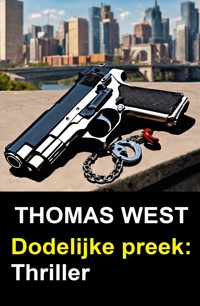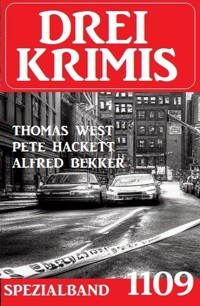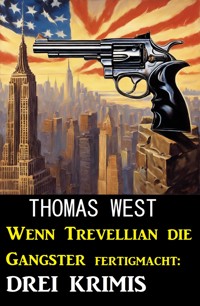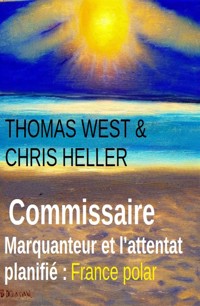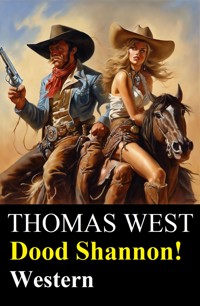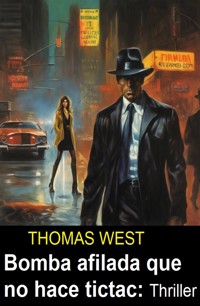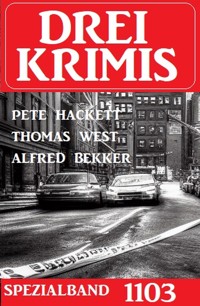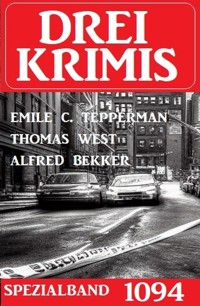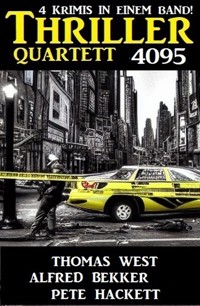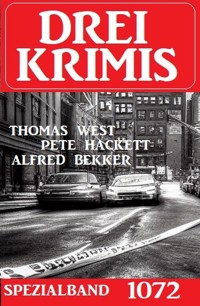Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dieser Band enthält folgende Romane: (349) Schicksalssprung Die falsche Ärztin Frau Dr. Alexandra Heinze hat verschlafen. Eilig macht sie sich auf zum Marien-Krankenhaus. Prompt schnappt ihr eine junge, ihr unbekannte Frau den Parkplatz weg, was sie ziemlich wütend werden lässt. Aber ihre Wut verraucht bald, und sie freundet sich mit der neuen Ärztin an. Alexandra spürt jedoch, dass sie ein Geheimnis mit sich herumträgt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West
2 Bezaubernde Romane um Dr. Alexandra Heinze Februar 2024
Inhaltsverzeichnis
2 Bezaubernde Romane um Dr. Alexandra Heinze Februar 2024
Schicksalssprung: Ärztin Alexandra Heinze: Arztroman
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Die falsche Ärztin
2 Bezaubernde Romane um Dr. Alexandra Heinze Februar 2024
Thomas West
Dieser Band enthält folgende Romane:
Schicksalssprung
Die falsche Ärztin
Frau Dr. Alexandra Heinze hat verschlafen. Eilig macht sie sich auf zum Marien-Krankenhaus. Prompt schnappt ihr eine junge, ihr unbekannte Frau den Parkplatz weg, was sie ziemlich wütend werden lässt. Aber ihre Wut verraucht bald, und sie freundet sich mit der neuen Ärztin an. Alexandra spürt jedoch, dass sie ein Geheimnis mit sich herumträgt …
Schicksalssprung: Ärztin Alexandra Heinze: Arztroman
von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 134 Taschenbuchseiten.
Als Konstantin Lorenz überraschend Knall auf Fall aus der Firma gedrängt wird, macht sich in ihm eine heftige Depression breit. Die Welt ist dunkel, und er will sich das Leben nehmen. Doktor Alexandra Heinze steigt zu ihm aufs Dach, um ihn vor dem Sprung zu bewahren, aber es scheint vergeblich.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Es war ein Riesenköter – schwarz, zottig, und mit gefletschten Zähnen stand er vor Charlotte. Sie mochte Hunde nicht besonders und kannte sich mit Hunderassen nicht gut aus. Aber dieses angriffslustige Vieh musste wohl ein Riesenschnauzer sein – jedenfalls sah es genauso aus, wie der Hund in dem Krimi am vergangenen Sonntag. Der Hund des ermordeten Geschäftsmann. Und das war ein Riesenschnauzer.
Charlotte wusste, dass sie ziemlich schlechte Karten hatte: Weit und breit keine Spur von Herrchen oder Frauchen der Bestie – auf dem Feldweg nicht, und am Waldrand nicht. Auch kein anderer Jogger, der ihr zur Hilfe hätte kommen können.
Der Hund stand wie festgewachsen und knurrte. Charlotte hatte ihn plötzlich zwischen den Laubbäumen des Stadtwaldes auftauchen sehen. „Einfach weiterrennen und so tun, als würdest du ihn gar nicht sehen“, hatte sie sich gesagt.
Sie lief diese Strecke fast jeden zweiten Morgen zwischen sechs und sieben. Seit etwa drei Jahren. Seitdem sie die Mitte vierzig hinter sich und eingesehen hatte, dass Fitness und eine gute Figur nicht einfach so vom Himmel fallen.
Natürlich begegnete sie bei ihren Waldläufen öfter Spaziergängern mit Hunden. Aber bis jetzt war ihr ein schmerzhafter Zusammenstoß mit einem Vierbeiner erspart geblieben. Nur einmal, im letzten Sommer, hatte sich einer von diesen kleinen Kläffern an ihre Fersen gehängt und nach ihrer Jogginghose geschnappt. Seitdem trug sie immer eine kleine Spraydose mit sich.
Der Hund, der jetzt vor ihr stand, war kein kleiner Kläffer, der seine lächerliche Winzigkeit durch ohrenbetäubendes Gebell ausgleichen musste. Der schwarze Bursche bellte nicht, noch nicht. Er stand nur da und knurrte. Charlotte spürte, wie ihre Nackenhaare sich aufrichteten.
„Ist ja gut, ist ja gut“, murmelte sie. Sie hatte ihre Vogel-Strauss-Taktik aufgegeben und war stehen geblieben. Nur alles vermeiden, was den Jagdinstinkt des Köters reizen könnte. „Bin nur eine harmlose Frau, die ein bisschen durch den Wald joggt.“
Sie sah sich um. Immer noch kein Mensch weit und breit. Ihr Herz schlug jetzt nicht mehr nur von dem dreißigminütigen Dauerlauf, der schon hinter ihr lag.
„Bitte verschwinde und lass mich in Ruhe!“ Sie wurde lauter, und das Zittern in ihrer Stimme machte ihr die Angst bewusst, die in ihre Glieder kroch. „Lass mich in Ruhe, hörst du?“
Der Schwarze hörte keineswegs. Er begann heiser zu bellen. Nicht laut, aber bösartig. Charlotte tastete nach der Tasche in ihrer Jogginghose. „Verschwinde!“, rief sie.
Schau einem angriffslustigen Hund nie in die Augen, sonst wird er erst recht aggressiv, hatte Stefan manchmal gesagt. Charlotte war da anderer Ansicht als ihr verstorbener Mann. Nur keine Angst zeigen – das schien ihr in diesem Fall die bessere Devise zu sein. Also fixierte sie das schwarze Biest mit ihrem Blick.
„Lass mich jetzt in Ruhe!“, schrie sie. Sie zog den Reißverschluss ihrer Hosentasche auf. Der Hund knurrte und bellte, stemmte seine Vorderläufe ins taunasse Gras und wirkte von Sekunde zu Sekunde bedrohlicher.
Charlotte zog die kleine Spraydose mit dem Reizgas heraus. „So – ich will pünktlich im Büro sein.“ Ohne den Hund aus den Augen zu lassen wandte sie ihm die Seite zu und machte ein paar vorsichtige Schritte. „Und deswegen werde ich jetzt weitergehen, verstanden?“
Der Hund bellte immer lauter und schwenkte dabei seinen Vorderkörper hin und her. Charlotte machte sich nichts vor – der zottige Riese würde sich nicht damit begnügen, nur nach ihrem Hosenbein zu schnappen.
Plötzlich machte er einen Satz und sprang auf sie zu. Sie riss die Dose hoch und drückte ab. Das Biest jaulte und heulte laut auf. Es schoss wie blind in die Wiese hinein, drehte sich ein paar Mal um die eigene Achse und rieb seinen Kopf im Gras.
Charlotte spurtete los. Der Waldparkplatz war fast vierhundert Meter entfernt. Doch sie rannte ohne Unterbrechung. Schwer atmend und schweißnass ließ sie sich knapp vier Minuten später in ihren Wagen fallen und schlug die Tür zu. „Mist!“, schimpfte sie und schlug aufs Lenkrad. Dann schloss sie die Augen und zwang sich ruhig und tief durchzuatmen.
Lange saß sie so da. Die Anspannung löste sich allmählich, und Tränen liefen ihr über das schmale Gesicht. Tränen der Wut. Dieser blöde Köter hatte ihr den Tagesbeginn versaut!
Ihr Blick fiel aufs Armaturenbrett. 6.59 Uhr zeigte die Digitaluhr. „O Gott! Schon so spät!“, rief sie erschrocken. „Susanne wollte geweckt werden!“ Sie drehte den Zündschlüssel um und startete den Wagen.
Charlottes achtundzwanzigjährige Tochter wohnte noch bei ihr im Haus. Seit Stefans Tod vor sieben Jahren war ihr Verhältnis noch inniger geworden. Susanne und sie waren wie gute Freundinnen.
Gestern, am Sonntagabend, war Susanne ziemlich angeheitert und sehr spät nach Hause gekommen. Weil Charlotte Frühaufsteherin war, hatte es sich eingebürgert, dass sie Frühstück machte und ihre Tochter weckte.
Als sie mit dem Wagen zurückstieß, sah sie ein Pärchen aus dem Wald auf den Parkplatz laufen. Einige Augenblicke länger als nötig beobachtete sie die beiden. Zehn Jahre jünger als sie mochten die beiden sein. Bei einem Wagen blieben sie stehen, und der Mann legte den Arm um die Frau.
Seufzend wandte Charlotte sich ab. Die wunde Stelle in ihrer Brust meldete sich mit einem leisen Brennen. Sie hatte lernen müssen, mit dieser Stelle zu leben. Sieben Jahre lang. Am Anfang schmerzte sie Tag und Nacht, wie eine entzündete Wunde. Seit zwei, drei Jahren kribbelte und brannte sie nur noch ab und zu. Wie große Narben es tun.
Ja – Charlotte hatte gelernt, mit dieser Narbe zu leben. Doch manchmal meldete sich die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und menschlicher Nähe. In letzter Zeit immer öfter.
Sie bog in die Straße ein und fuhr zurück in die Stadt. Um die trüben Gedanken zu verscheuchen, schaltete sie das Autoradio ein. Das Zeitzeichen ertönte – sieben Uhr. Der Nachrichtensprecher nannte das Datum: „Freitag, der dreizehnte Mai …“
„Natürlich!“, rief Charlotte. „Das passt ja wie die Faust aufs Auge!“ Wieder schlug sie mit der Hand auf das Lenkrad. „Blöder Köter!“
Später würde sie manchmal sagen: „Der schwarze Hund damals, am Freitag dem Dreizehnten – der war wie ein Vorbote des Unglücks.“ Aber noch ahnte sie nichts von den schlimmen Tagen, die ihr bevorstanden.
2
Alexandra hatte nichts dagegen, wenn eine Woche ruhig ausklang. Und diese Woche schien sehr ruhig auszuklingen. Die ersten zwei Stunden des Tages jedenfalls waren ohne Notruf verstrichen. Kurz vor acht saß sie mit ihren Kollegen von der Chirurgie in der Röntgenbesprechung. Lore Keller, die Oberärztin der Internen, stellte Röntgenbilder eines Patienten mit einem großen Dickdarmtumor vor.
„Der Tumor sitzt hier am aufsteigenden Colon, wie Sie sehen“, sie deutete auf das Röntgenbild. „Schön abgegrenzt und vermutlich leicht zu entfernen. Die Frau ist erst Anfang fünfzig – vielleicht können wir ihr einen Anus preater ersparen.“
„Die histologische Untersuchung ist eindeutig.“ Professor Walter Streithuber studierte den Bericht des Labors. In den Gewebeproben hatten sich bösartige Zellen gefunden.
„Metastasen?“, fragte Alexandra.
Lore schüttelte den Kopf. „Jedenfalls konnten wir keine Tochtergeschwüre finden. Ich werde heute mit der Patientin über die Diagnose sprechen.“ Sie wandte sich an Rudolph Benrath, den Stationsarzt der Chirurgie. „Haben Sie ein Frauenbett frei auf ihrer Station?“
Alexandras Piepser schlug Alarm. Auf dem Display erschien die Nummer des Bereitschaftszimmers. Sie griff zum Telefon auf der Konsole unter dem Wandschirm, an dem das Röntgenbild hing und wählte die Nummer.
„Notfall, Frau Doktor!“ Ewald Zühlkes raue Stimme. „Wir warten im Wagen auf Sie!“
„Ich werd’ gebraucht!“, entschuldigte sich die Notärztin und lief aus dem Besprechungszimmer. Sie spurtete an den Röntgenräumen vorbei zum Treppenhaus, eilte die Treppe hinunter ins Erdgeschoss, und rannte an der Ambulanz vorbei in die Zufahrtshalle für die Krankenwagen.
Das hydraulische Tor stand schon offen, und der Dieselmotor des Notarztwagens brummte rasselnd. Ewald Zühlke hielt ihr die Tür auf. Alexandra rutschte neben ihren Fahrer, Jupp Friederichs, und Zühlke sprang in das Fahrzeug und schlug die Tür zu. Wenige Sekunden später jagten sie mit Martinshorn und Blaulicht über die Rheinpromenade.
„Was ist passiert?“ Alexandra schnallte sich an.
„Kind aus dem Fenster gefallen“, antwortete Zühlke knapp.
Alexandra erschrak. „Gott – wie furchtbar!“ Sie machte diese Arbeit nun schon so lange – aber an den Anblick verletzter oder schwer kranker Kinder würde sie sich nie gewöhnen können. Es ging ihr jedes Mal unter die Haut, wenn sie ein verunglücktes Kind versorgen musste.
„Passt zu dem Tag, so ein Scheißunfall!“ So tarnte Friederichs seinen Schrecken.
„Wieso?“ An Alexandra vorbei schaute Zühlke seinen Kollegen fragend an.
„Na, Freitag, der dreizehnte!“
„Quatsch!“, brummte Zühlke. „Da passiert auch nicht mehr als sonst.“
Sie brauchten sechs Minuten bis zu der Wohnblocksiedlung am Stadtrand, wo der Unfall passiert war. Schon als sie in die Sackgasse einbogen, sahen sie die Menschenansammlung auf dem Wäscheplatz hinter einem der großen Mietshäuser. Friederichs stoppte, und Zühlke und die Ärztin sprangen aus dem Wagen.
Während Zühlke den Notfallkoffer aus dem Heck des Notarztwagens riss, lief Alexandra auf die Versammlung zu. Fast zwei Dutzend Menschen standen auf der Wiese unter den Fenstern des Hauses. Überwiegend Frauen.
Die Menge teilte sich. Eine weinende Frau hockte auf dem Kiesweg, der an der Hauswand entlangführte. Sie hielt ein etwa dreijähriges Mädchen im Arm. „Aus dem zweiten Stock“, erklärte eine ältere Frau, die neben ihr stand, mit belegter Stimme.
Alexandra schaute nach oben. Im zweiten Stock stand ein Fenster auf. „Ich bin nur schnell an die Wohnungstür, um den Großen zur Schule zu schicken“, schluchzte die Frau mit dem Kind.
Neben ihr hockte ein Junge mit Schulranzen auf dem Rücken. Er machte ein betretenes Gesicht und streichelte das kleine Mädchen. „Und in den paar Minuten klettert der Balg aufs Fensterbrett …“ Tränen erstickten die Stimme der noch jungen Frau.
Alexandra kniete sich ins Gras und widmete sich ihrer kleinen Patientin. Das Mädchen guckte mit großen Augen zu den Umstehenden hoch. Alexandra runzelte die Stirn. Dafür, dass sie aus einem Fenster im zweiten Stock gefallen war, wirkte die Kleine reichlich lebendig.
„Platz machen, bitte!“ Zühlke knallte den Koffer ins Gras und sah sich suchend um. „Ist das unser Patient?“ Verwundert musterte er das Kind.
Alexandra ließ es auf dem Arm seiner Mutter und untersuchte Glied für Glied. Das Kind kicherte, als würde man es kitzeln. „Legen Sie Ihre Tochter bitte auf den Rücken“, bat Alexandra die Frau. Sie tastete den kleinen Bauch und die zarten Rippen ab, drehte das Kind dann auf den Bauch und untersuchte die Wirbelsäule. Nichts. Das Mädchen quengelte nicht einmal.
Alexandra erhob sich und schaute sich unter den Leuten um. „Ist das Kind wirklich aus dem Fenster gefallen?“
Einige der Umstehenden nickte. Die Mutter des Kindes riss Augen und Mund auf. Die Frage der Notärztin schien ihr die Sprache zu verschlagen. „Ja, was glauben denn Sie?“, jammerte sie mit vorwurfsvollem Unterton. „Ich hör’ meine Jessi schreien, schau’ zum Fenster hinaus, und da liegt sie unten auf dem Kies.“
Die Frau begann hysterisch zu weinen. Skeptisch betrachtete Alexandra die Kleine. Sie hatte nicht einmal Schürfwunden.
„Stimmt“, sagte ein älterer Mann. Er trug ein weißes Unterhemd über einer grauen Hose. Getrockneter Rasierschaum bedeckte sein Gesicht. „Wohn’ nebendran und hab’s vom Bad aus gehört.“ Er deutete hinauf auf eines der Fenster. „Ich hab’ das Fenster aufgerissen, und da liegt der Zwerg unten auf dem Weg und plärrt.“
Friederichs drängte sich durch die Gruppe hindurch zur Hauswand. „Wo genau lag sie?“
Der Mann mit dem Rasierschaum im Gesicht folgte ihm und deutete auf eine Stelle vor einem Haufen Sperrmüll. „Hier.“
Alexandra und Zühlke betrachteten das Gerümpel: Pappkisten mit Kleiderbügeln, und ausrangierten Küchengeräten stapelten sich neben einem Tisch und zwei Bettgestellen. Dazwischen, säuberlich aufeinandergeschichtet, ein halbes Dutzend Matratzenteile.
Alexandras Blick wanderte von den Matratzen an der Hauswand entlang zum zweiten Stock hinauf. Das offene Fenster lag direkt über dem Matratzenstapel.
Die Notärztin und Zühlke sahen sich an. Beiden hatte es die Sprache verschlagen. Der Sanitäter schüttelte den Kopf und stapfte zu seinem Notfallkoffer zurück. „Von wegen Freitag, der Dreizehnte“, knurrte er seinen Kollegen an. „Die Kleine ist auf die Matratzen geknallt.“
Die Leute begannen aufgeregt zu palavern, und die Mutter des Kindes brach erneut in lautes Geheul aus. Alle waren fassungslos. Nur der Bruder des Mädchens strahlte über sein ganzes Lausbubengesicht. Er drehte sich um und rannte davon. Vermutlich will er die Story so schnell wie möglich seinen Klassenkameraden erzählen, dachte Alexandra.
„Nehmen wir sie trotzdem mit?“, wollte Friederichs wissen.
Alexandra überlegte. „Ja“, entschied sie schließlich. „Messen Sie bitte den Bauchumfang, Herr Zühlke.“ Sie zog ihr Arztlämpchen aus der Tasche. „Und ich schau mir die Pupillen noch einmal genau an.“
Dann wandte sie sich noch einmal an die schluchzende Mutter. „Danken Sie dem Himmel – Ihre Tochter muss einen tüchtigen Schutzengel haben. Aber vorsichtshalber will ich sie bis heute Abend auf unsere Kinderstation legen und beobachten lassen. Wenn wir restlos sicher sein können, dass sie keine inneren Blutungen hat, können Sie das Kind heute Abend wieder mit nach Hause nehmen.“
„Freitag, der dreizehnte“, höhnte Zühlke, während sie Mutter und Kind zum Notarztwagen begleiteten. „So einen Glücksfall habe ich selten gesehen!“
„Glücksfall nennst du das, wenn jemand aus dem Fenster fällt?“ Friederichs hielt der Frau die Heckklappe auf und half ihr beim Einsteigen. Alexandra reichte ihr das Mädchen hinein.
Zühlke verdrehte die Augen. „Haben Sie das gehört, Frau Doktor? Diese abergläubischen Leute finden doch immer ein Haar in der Suppe!“
3
Charlotte hatte ihre Tochter geweckt und in aller Eile das Frühstück zubereitet. Sie selbst hatte keine Eile. Seitdem die große Aluminiumfirma, in der sie Sekretärin eines der Geschäftsführer war, die gleitende Arbeitszeit eingeführt hatte, saß sie manchmal erst um halb neun an ihrem Schreibtisch. Dafür arbeitete sie häufig bis abends um sechs. Außerdem genoss sie als Chefsekretärin gewisse Privilegien.
Susanne blickte auf die Wanduhr über der Küchentür. „O Mist!“, schimpfte sie. „Schon zehn vor acht!“ Um acht Uhr begann ihr Dienst als Krankenschwester in der Ambulanz des Marien-Krankenhauses.
„Tja, Mäuschen – vielleicht schaffst du dir doch mal einen Wecker an“, schlug Charlotte vor und schenkte ihrer Tochter einen Kaffee ein. „Und vor allem bleibt man nicht bis in die Puppen op Jück, wenn man am nächsten Morgen arbeiten muss.“
„Nenn mich nicht Mäuschen, verdammt! Wie oft soll ich dir das noch sagen?“ Sie biss von ihrem Honigbrot ab und stand auf. „Und wie lange ich abends unterwegs bin, ist allein meine Sache.“ Kauend ging sie auf den Flur, wo das Telefontischchen stand.
Charlotte runzelte die Stirn und verkniff sich eine Antwort.
Susanne nahm den Hörer ab und wählte die Nummer ihrer Arbeitsstelle. „Wolters“, meldete sie sich. „Ja, ich bin’s, Susanne. Hab verschlafen. Komm ein paar Minuten zu spät.“
Wieder am Frühstückstisch pellte sie ihr Ei. Sie dachte nicht daran, mit leerem Magen in die Klinik zu fahren. Besser eine unpünktliche Schwester als ein ungenießbare, pflegte sie zu sagen. „Hast du die Inserate durchgesehen?“, fragte sie ihre Mutter mit vollem Mund.
„Ach, Susanne!“ Das Thema war Charlotte sichtlich peinlich. „Ich kann das nicht!“
„Wieso nicht?“, ereiferte sich Susanne mit einem Seitenblick auf die Uhr. „Viele machen das! Vor allem Leute, die so beschäftigt sind wie du!“ Sie spülte den Bissen herunter und hielt ihrer Mutter die leere Kaffeetasse hin. „Du hast einfach keine Zeit, Kontakte zu knüpfen. Und bist noch zu jung und viel zu attraktiv, um noch länger ohne Mann zu sein!“
Charlotte stützte ihren Kopf in die Hände und sah aus ihren braunen Augen in irgendeine Ferne. „Meinst du wirklich? Ich frage mich immer, was …“
„Jetzt fang bloß nicht wieder damit an! Ich kann dir sagen, was Vati dazu sagen würde. Er würde sagen: Hör’ auf deine Tochter, Lotte, und: Ich freu’ mich, wenn du glücklich bist.“
Susanne betrachtete das schmale Gesicht ihrer Mutter. Die feinen Züge wirkten weich und sanft und spiegelten nichts von der Hartnäckigkeit wider, mit der sie sich an ihrem stressigen Arbeitsplatz behaupten konnte. Sie trug ihr dichtes, schwarzes Haar kurz. Vereinzelte, silbrige Fäden durchzogen es am Scheitel.
Susanne war stolz auf ihre Mutter. „Ich habe eine schöne Mutti“, hatte sie schon im Kindergarten verkündet. Und das fand sie auch heute noch, fast fünfundzwanzig Jahre später.
Und sie war stolz darauf, ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein: Dieselben feinen Züge, dieselbe kleine Nase, derselbe große Mund. Nur trug Susanne ihre langen, schwarzen Haare zu einem dicken Zopf geflochten. Und die graugrünen Augen hatte sie von ihrem Vater geerbt.
„Also gut“, seufzte Charlotte, „ich werde noch einmal darüber nachdenken.“
„Denk nicht soviel darüber nach – tu es einfach.“ Susanne stellte ihre Tasse ab und stand auf. „Antworte auf ein Inserat, oder gib selbst eine Kontaktanzeige auf. Tu’s einfach.“ Sie strich ihrer Mutter zum Abschied kräftig über das kurze Haar. „Ich muss – schon fünf vor acht!“
Charlotte grinste ihrer Tochter hinterher. „Fahr vorsichtig! Und leg dich nicht wieder mit dem Oberarzt an!“ Die burschikose Art ihrer Tochter gefiel ihr. Sie wünschte, sie hätte auch ein bisschen mehr davon. Andrerseits stieß sie auf diese Weise immer wieder ihre zahlreichen Verehrer vor den Kopf. Die wenigsten waren der jungen Frau an Willensstärke und Dickköpfigkeit gewachsen.
Charlotte war sich ziemlich sicher, dass Susanne insgeheim einen Mann suchte, der stärker war als sie. Und an den sie sich anlehnen konnte. Natürlich würde sie das niemals zugeben. Und wehe, Charlotte machte entsprechende Bemerkungen! Dann konnte ihre Tochter einen lauten Streit vom Zaun brechen.
Charlotte ging ans Fenster und sah auf die Straße. Ihren roten Lederbeutel über der Schulter rannte Susanne auf den blauen Golf zu, den sie sich voriges Jahr gekauft hatte. Mit quietschenden Reifen fuhr sie an.
Charlotte ging zurück zum Frühstückstisch. Auf der Eckbank lag die Zeitung von gestern. Natürlich hatte sie die Kontaktanzeigen gelesen. Und es waren auch Inserate dabei, die sie spontan angesprochen hatten. Aber bis jetzt hatte sie sich noch nicht überwinden können, auf eine derartige Anzeige zu antworten. Doch immer mehr dämmerte ihr, dass Susanne recht hatte. Warum sollen vielbeschäftigte Menschen nicht diesen Weg wählen, um einen Partner kennenzulernen?
Sie faltete die Zeitung zusammen und steckte sie in ihre Handtasche. In der Mittagspause wollte sie sich die Anzeigen noch einmal genauer ansehen.
4
Er parkte seinen metallic-blauen Mercedes neben dem großen BMW des Chefarztes. Ein Schild wies diesen Parkplatz als seinen aus – Verwaltungsdirektor.
Er stieg aus und betrachtete die schöne Jugendstilfassade der Kurklinik, deren Finanzen und Personal er seit knapp fünf Jahren managte. Stolz erfüllte ihn. Noch vor vier Jahren war die psychosomatische Klinik am Rheinufer wirtschaftlich auf der Kippe gestanden. Dass sie immer noch arbeiten konnte, und inzwischen wieder mit Gewinn arbeiten konnte, war einzig und allein sein Verdienst.
„Guten Morgen, Herr Lorenz“, grüßte der Leiter der physiotherapeutischen Abteilung. Er trabte mit zwei Dutzend Patienten über den Parkplatz auf den Waldrand zu. Morgendliches Jogging stand auf dem Programm.
Lorenz winkte grüßend zurück. Er genoss bei allen Mitarbeitern uneingeschränkte Anerkennung. Bei fast allen.
Pfeifend schlenderte Konstantin Lorenz auf den Haupteingang der Klinik zu. Zur Arbeit gehen war für ihn wie für andere Leute nach Hause zu kommen. Ja – die Klinik war ihm ein Stück Heimat geworden. Und Lorenz hatte fünf lange Jahre kein zu Hause gehabt. Seit ihn seine Frau mit den Kindern verlassen hatte. Fast zehn Jahre war das jetzt her.
Sein lässiger Gang hatte nichts Steifes oder Schleppendes. Seiner Haltung und seiner lockeren Art sich zu bewegen nach, hätte er leicht für vierzig durchgehen können. Nur seine weißen Haare und die Geheimratsecken über seiner hohen Stirn deuteten an, dass dieser Mann wohl schon auf die Fünfzig zugehen musste.
Tatsächlich war Konstantin Lorenz vierundfünfzig an dem Tag, an dem sich am Horizont seines Lebens nach etlichen ruhigen Jahren wieder eine Krise zusammenbraute.
Seinen guten Gesundheitszustand und sein fast jugendliches Auftreten verdankte er der eisernen Disziplin, mit der er kontinuierlich Sport trieb: Radfahren, Joggen, Tennis, Schwimmen.
Das war nicht immer so gewesen. Die ersten drei Jahre nach der Trennung von seiner Frau war er total auf den Hund gekommen. Wirtschaftlich, gesundheitlich, psychisch. Er hatte geraucht wie ein Schlot, getrunken und sich gehen lassen.
Depressionen hatten ihn damals an den Rand des Selbstmords getrieben. Lange Zeit hatte er die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch nehmen müssen.
Aber irgendwann hatte er sich wieder aus dem Nullpunkt nach oben retten können. Und als er dann vor fünf Jahren Verwaltungschef dieser Klinik geworden war, hatte er sein Leben längst wieder im Griff gehabt.
Er zog die Tür zum Foyer auf und begrüßte die beiden Damen an der Rezeption. Auch hier freundliche Gesichter. Sein Büro lag im Durchgang zu einem großzügigen Veranstaltungssaal, in dem regelmäßig Konzerte oder Ausstellungen durchgeführt wurden.
Auch das ging auf seine Initiative zurück. Er hatte alles getan, um der Klinik eine gute Reputation zu verschaffen – hatte enge Kontakte mit der Presse geknüpft, besuchte regelmäßig die Kontaktleute in den Krankenkassen, und pflegte ausgedehnte Reisen im ganzen Bundesgebiet zu unternehmen, um in Arztpraxen und Beratungseinrichtungen für die Klinik zu werben.
Und das Haus war gut belegt. Mehr als fünfundneunzig Prozent Auslastung in den letzten drei Jahren. Ein Kunststück in Zeiten, in denen die sogenannte Gesundheitsreform Arztpraxen und Privatkliniken reihenweise sterben ließ.
Er öffnete die Tür zu seinem Büro. Hinter dem schwarz lackierten Schreibtisch hing die riesige Panoramaaufnahme einer wilden Berglandschaft – die Rocky Mountains von Montana. Konstantin Lorenz’ Traum war es, den amerikanischen Kontinent von den kanadischen Rocky Mountains bis hinunter zu den Anden zu durchqueren. Mit dem Mountainbike. In etwa sechs Jahren wollte er sich auf den Weg machen. Nach seiner Pensionierung.
Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte. „Lorenz?“
Der Chefarzt war am Apparat. Einer der wenigen Mitarbeiter in diesem Haus, auf den er gern verzichtet hätte. „Herr Lorenz, können Sie heute zehn Minuten früher zu unserer Besprechung kommen? Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen.“
„Kein Problem.“ Er legte auf. In aller Ruhe suchte er Aktenordner, Kalender und Schreibkladde zusammen und machte sich auf den Weg ins Chefarzt-Büro. Mit dem ärztlichen Direktor der Klinik, der leider auch Mit-Eigentümer war, traf er sich jeden Morgen zu einem organisatorischen Check-up.
„Guten Morgen, Herr Lorenz.“ Die Chefsekretärin strahlte über das ganze Gesicht, als sie ihn begrüßte. Die Frau flirtete seit gut zwei Jahren mit ihm. Sie war knapp zwanzig Jahre jünger als er, und er konnte sich manchmal nichts Schöneres vorstellen, als sich von ihr verführen zu lassen.
Ihr einziger Nachteil: Sie war verheiratet. Und seit seiner Trennung hatte Lorenz es sich zum Grundsatz gemacht, nie in eine fremde Beziehung einzudringen.
„Dr. Grüner erwartet Sie schon“, säuselte die Sekretärin. Und dann leiser: „Ist das eine neue Psychologin?“ Sie deutete auf die verschlossenen Tür zum Sprechzimmer. „Die sitzt schon eine geschlagene Stunde bei ihm drin.“
Lorenz zuckte mit den Schultern. „Lassen wir uns überraschen.“ Das war schon eine stehende Redewendung in der Kurklinik. Der Chefarzt hielt seine Mitarbeiter nämlich gern mit irgendwelchen Überraschungen in Atem.
Der Verwaltungsleiter klopfte und trat ein. Lorenz sah die junge Frau, und sofort ging rotes Licht unter seiner Schädeldecke an. Sie war relativ klein und zierlich. Eine Modelfigur eben, wie der Chefarzt es liebte. Er schätzte sie Anfang bis Mitte dreißig. Ein blonder Pagenschnitt umrahmte ihr kantiges Gesicht, in dem die braunen Augen dominierten – sie musterten ihn kühl.
Lorenz hatte einen sehr guten Instinkt für Menschen und Situationen. Er wusste sofort, dass die Anwesenheit der Frau bei Dr. Grüner auch private Gründe hatte. Sehr private Gründe. Und er spürte, dass die Frau gefährlich für ihn war. Darüber konnte auch die übertriebene Freundlichkeit des Chefarztes nicht hinwegtäuschen, mit der er Lorenz und die Frau bekannt machte.
„Das ist Frau Marten, Herr Lorenz“, lächelte er. „Sie ist Betriebswirtin … und … äh … wird bei uns ein bisschen hereinschauen.“
Es gab im ganzen Haus nur eine Stelle für einen Betriebswirt. Und das war seine, Lorenz’ Stelle!
5
Fast jeden Morgen dieselbe Hektik! Susanne gab Gas. Ungeduldig drängelte sie sich auf den linken Fahrstreifen, um an einen Bus zu überholen. Der Fahrer des roten Honda Civic, den sie dabei schnitt, hupte aufgebracht. „Leck mich!“, fauchte Susanne. Im Rückspiegel sah sie den Mann schimpfen und mit den Armen fuchteln.
Sie fuhr grundsätzlich immer erst auf den letzten Drücker los. Auch wenn sie nicht verschlief. Die Kolleginnen in der Klinik hatten sich schon daran gewöhnt, dass Susanne selten auf die Minute genau um acht auf der Matte stand.
Die Ampel sprang auf gelb. Doch der Wagen vor ihr dachte nicht daran, noch über die Kreuzung zu huschen. Seine Bremslichter leuchteten auf. „Lahmarsch!“ Susanne stieg auf die Bremse.
Nervös trommelte sie auf dem Lenkrad herum. „Werd endlich grün, du blödes Ding!“ Sie sah auf die Borduhr – drei nach acht. Hoffentlich war in der Ambulanz noch nicht allzu viel los!
Die Ampel sprang auf gelb. Der Wagen vor ihr ließ sich alle Zeit der Welt. „Nun mach’ schon!“, schimpfte Susanne und drückte auf die Hupe. „Pennst du noch, oder wie?“
Endlich fuhr ihr Vordermann an. Susanne gab Gas – und würgte den Motor ab. „Mist – elender!“ Hinter ihr hupte einer. Sie fummelte am Zündschlüssel herum, doch bevor sie weiterfahren konnte, leuchtete die Ampel schon wieder rot auf.
Der Typ hinter ihr hupte wie ein Verrückter. „Idiot!“, fauchte sie in den Rückspiegel. Es war der Kerl in dem roten Honda, vor dessen Kühler sie sich vorhin auf die linke Fahrspur gedrängelt hatte.
„Ist ja gut, ist ja gut!“, rief sie und machte eine abwehrende Geste in den Rückspiegel. Der rote Wagen rollte auf ihr Heck zu, ganz langsam zwar, aber er rollte. „He – spinnst du?“ Susanne löste hastig die Handbremse und legte den ersten Gang ein.
Zu spät: Ein Ruck ging durch ihren Golf. Der Hondafahrer hatte sie touchiert! „Das gibt’s doch nicht!“ Susanne riss die Handbremse hoch und stieß die Tür auf. „Dieser Mistkerl!“
Sie sprang aus dem Wagen. Mit zwei Schritten war sie am Kühler des Hondas. Ein Blick auf ihre Stoßstange – nichts. Der Typ hatte das doch absichtlich gemacht, oder?
Die Ampel war inzwischen wieder rot und würde jeden Moment auf grün springen. Ein ohrenbetäubendes Hupkonzert hatte eingesetzt. Susanne kümmerte sich nicht darum. „Na warte!“ Sie stemmte die Fäuste in die Hüften und pflanzte sich breitbeinig vor der Fahrertür des roten Hondas auf. „Sind Sie eigentlich von allen guten Geistern verlassen?“
Der Fahrer lehnte sich aus dem Beifahrerfenster und machte ein grimmiges Gesicht. Schwarzer Bürstenhaarschnitt, dunkler Teint, einen glitzernden Stein im linken Ohr, Anfang dreißig. Schwarzenegger-Verschnitt.
„Verdammt noch mal!“, schimpfte sie. „Ja, ich hab’ den Wagen abgewürgt – na und?“ Susanne konnte unheimlich wütend werden, und der Fahrer des Hondas bekam eine volle Breitseite ihrer Wut ab. Sein ärgerlich verkniffenes Gesicht glättete sich, und er zog überrascht die Brauen nach oben.
„Das ist kein Grund, mir gegen die Stoßstange zu knallen!“, rief Susanne. „Was fällt Ihnen eigentlich ein?“ Hinter dem Honda scherten die Wagen aus und fuhren hinter Susanne vorbei, um über die inzwischen wieder grüne Ampel zu fahren.
„Ich wollte nur …“ Der Mann versuchte, sie zu beschwichtigen.
„Sie gehören wohl auch zu den Idioten, für die ein Auto in erster Linie aus Hupe und Gaspedal besteht!“
Das Gesicht des Mannes verzog sich zu einem verlegenen Grinsen. „Sorry …“
Wie ein kleiner Junge, den man beim Kirschenklauen erwischt hat, dachte Susanne. Und ihre Wut verrauchte. Leider. Demonstrativ wandte sie sich ab und lief hinter den Honda, um sich wenigstens noch sein Kennzeichen zu notieren. Er blickte halb grinsend, halb bedauernd aus dem Seitenfenster zu ihr.
Ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen, setzte sie sich wieder hinter ihr Steuer. Die Ampel leuchtete grün. Sie ließ den Motor an, wartete ein paar Sekunden, bis die Ampel auf Gelb sprang und fuhr dann mit quietschenden Reifen an.
Befriedigt schaute sie in den Rückspiegel: Der Honda wartete brav am Haltestreifen. Sie grinste. Die kleine Rache befriedigte sie.
Fast zehn Minuten kam sie zu spät. Ihre Kollegin, Grit Mindermann, bedachte sie mit einem vorwurfsvollen Blick.
„Tut mir leid, Grit“, Susanne zuckte bedauernd mit den Schulter. „Verkehrsunfall.“
Grit legte erschrocken die Hand auf den Mund. „Ist jemand verletzt worden?“ Susanne schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Lust, über den unverschämten Autofahrer zu reden. Aber Grit bohrte weiter. „Großer Schaden?“
Susanne winkte kopfschüttelnd ab. „So ein Möchtegern-Rambo ist mir gegen die Stoßstange gefahren.“
„Mit so etwas muss man an einem Tag wie heute rechnen“, sagte Grit.
„Wieso?“
Grit deutete mit dem Kopf auf den Abreißkalender neben dem Schreibtisch. „Freitag, der dreizehnte!“
6
Alexandra verzichtete auf das Mittagessen. Ihr war heute nicht nach Forelle Blau. Außerdem würde sie heute Abend im Gasthof Kühn im Westerwald essen. Gleich, um drei Uhr, wenn Werner seine Sprechstunde beendet hatte, wollten sie in ihr Wochenendhaus fahren.
Statt ins Ärztekasino ging sie zur Kinderstation, um nach der kleinen Jessica zu sehen. Das Mädchen war quietschfidel. Neben ihrem Bett saß die Mutter und betrachtete mit ihrer Tochter ein Bilderbuch.
„Wie geht’s unserer kleinen Patientin?“, fragte Alexandra.
„Ich bin ja so froh, Frau Doktor“, seufzte die junge Frau. „Schauen Sie doch“, sie wies auf ihr Töchterchen. „Jessica ist putzmunter. Ich kann es nicht fassen!“
„Danken Sie dem Himmel.“ Alexandra strich der Kleinen über das Blondhaar. „Und streichen Sie sich den Tag rot in Ihrem Kalender an. Es hätte nicht viel gefehlt, und …“
„Ich weiß, ich weiß“, unterbrach die Frau. Ihre Augen wurden feucht. „Ich bin noch ganz geschockt.“
Alexandra verabschiedete sich. Im Stationszimmer erfuhr sie von Dr. Baumgärtner, dem jungen Kinderarzt, dass Jessica noch am Nachmittag entlassen werden sollte. Fast beschwingt verließ sie die Station. Als Ärztin musste sie viel Unglück und Leid sehen. Es tat gut, auch einmal ein Wunder zu erleben.
Im Bereitschaftszimmer telefonierte sie mit Werner. „Du rufst an, weil du überraschend Wochenenddienst machen musst, stimmt’s?“ Seine grimmige Stimme verriet Alexandra, dass er das nicht nur scherzhaft meinte.
„Mein kleiner, pessimistischer Schatz“, unkte Alexandra, „ich rufe an, weil ich wissen will, ob du noch schnell ein Dutzend Hausbesuche oder gar einen kleinen Ärztekongress in Hamburg für das Wochenende eingeschoben hast.“
„Nein, hab’ ich nicht.“ Sie konnte sich sein erleichtertes Grinsen lebhaft vorstellen. „Punkt drei Uhr schließe ich die Praxis, und dann werde ich mir mit Frau Dr. Heinze ein schönes Wochenende machen.“
Sie lachte. „Ich ruf’ dich an, weil ich ein Wunder erlebt habe.“
„Lass hören.“ Sie erzählte ihm von dem kleinen Mädchen und ihrem glimpflichen Fenstersturz.
„Kaum zu glauben“, staunte Werner. „Das ist ein gutes Omen für unser Wochenende. Die Maisonne lacht, und die Schutzengel sind unterwegs – was wollen wir mehr.“
Zur Abwechslung meldete sich mal wieder Alexandras Piepser. „Bis bald, mein Schatz“, flötete sie und legte auf.
Die Nummer der Ambulanz flimmerte auf dem Display. Offenbar wurde sie dort gebraucht.
Schon auf dem Gang von der Pforte zur Ambulanz hörte Alexandra eine jammernde Männerstimme. Sie beschleunigte ihren Schritt und öffnete die große Tür zum Hauptbehandlungsraum.
Auf dem Behandlungstisch unter der OP-Lampe lag ein Mann in einem blauen Overall.
„Arbeitsunfall“, sagte Schwester Susanne Wolters. Sie hatte dem Mann gerade die schweren und schmutzigen Arbeitsschuhe ausgezogen. Der Mann jammerte in höchsten Tönen. „Herr Bugül ist in einen Nagel getreten und dann vom Gerüst gefallen.“
Der türkische Bauarbeiter griff nach Alexandras Hand. „Schmerzen, Frau Doktor, Schmerzen!“ Er sah die Ärztin flehend an.
„Wer hat ihn gebracht?“, wunderte sich Alexandra. Solche Arbeitsunfälle waren normalerweise Anlass genug, den Notarztwagen anzufordern.
„Kollegen, Kollegen“, jammerte der Mann.
Die kleine Wunde in der Fußsohle war schmutzig und tief. Susanne reichte der Ärztin Kompressen und ein Desinfektionsmittel. Vorsichtig reinigte Alexandra das blutende Loch. Der Mann stöhnte.
Die Tür öffnete sich. Mit einem Stapel Röntgenbilder kam der Oberarzt Helmut Höper herein. „Was haben wir denn da?“ Er stellte sich neben Alexandra und betrachtete die Wunde. Susanne berichtete. „Ist doch nicht schlimm“, raunzte Höper den Mann an. „Jetzt reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen!“
Der Ton gefiel Alexandra nicht. „Ich kümmere mich schon um ihn.“ Sie wollte den Oberarzt schnell wieder loswerden. „Wo tut es Ihnen noch weh, Herr Bugül?“ Mit schmerzverzerrtem Gesicht deutete der Bauarbeiter auf seine Rippen.
Gemeinsam mit Höper und Susanne zogen sie dem Mann seinen Overall aus. Über seine linke Brustseite zog sich eine leicht blutende Schürfwunde. Er stöhnte laut und gestikulierte theatralisch.
„Sie benehmen sich wie ein altes Weib!“, fuhr Höper ihn an.
„Der Mann ist Südländer, Herr Dr. Höper!“, zischte Susanne. „Die äußern ihre Schmerzen nun mal etwas leidenschaftlicher als unsereins – bitte!“ Sie sah ihn streng an.
Verdutzt runzelte der Oberarzt die Stirn. Er lief rot an, und Alexandra erwartete, dass ihm der Kragen platzen würde. „Wir reinigen die Wunde und machen eine Thoraxaufnahme“, sagte sie schnell. „Vielleicht ist eine Rippe gebrochen.“ Sie wandte sich an Höper. Wütend fixierte der immer noch die Schwester. „Wollen Sie die Wunde ausschneiden?“
Er holte zischend Luft. Dann wandte er sich abrupt ab, warf die Röntgenbilder auf die Arbeitsfläche unter den weißen Hängeschränken und stapfte aus dem Raum.
Alexandra sah die Schwester an. Nicht die geringste Spur von Verlegenheit zeigte sich in ihren Gesichtszügen. Sie schätzte die direkte Art der jungen Frau, die vor etwa einem Jahr von der Städtischen Klinik ins Marien-Krankenhaus gewechselt hatte. Ihr Vater war vor sieben Jahren auf der Inneren gestorben. An Krebs. Alexandra konnte sich gut erinnern.
„Geben Sie mir bitte ein paar sterile Handschuhe, Skalpell und chirurgische Pinzette.“ Sie setzte dem jammernden Bauarbeiter eine lokale Betäubung. „Diplomatie ist nicht Ihre Stärke, hab’ ich recht, Susanne?“, sagte sie, während sie die durch den Nagel verdreckten Wundränder ausschnitt.
„Stimmt“, seufzte Susanne. „Aber dafür versteht jeder, was ich sagen will.“
„Da haben Sie recht“, grinste Alexandra.
7
In der Nachbarschaft des Bürohauses gab es einen kleinen Park. Hier verbrachte Charlotte häufig ihre Mittagspausen. Selten zog es sie zum Essen in die Mitarbeiterkantine. Der Vormittag war in aller Regel so stressig, dass sie froh war, mal eine halbe Stunde lang keinen Menschen zu sehen und zu hören.
Außerdem hatte sie sich angewöhnt, mittags weiter nichts als ein Glas Joghurt und ein Stück Obst zu sich zu nehmen. Warm gegessen wurde bei den beiden Wolters-Frauen abends. Und das auch nur jeden zweiten Tag.
Sie ließ sich auf ihrer Lieblingsbank vor dem barocken Springbrunnen nieder und öffnete das Joghurtglas. Im Vorzimmer des Chefs war es wie meistens heiß her gegangen: Telefonate, Terminabsprachen, Buchungen für Dienstreisen, Koordinierung von Sitzungen und Tagungen, Korrektur wichtiger Briefe und Protokolle. Wochenendstimmung würde sich frühestens um vier oder fünf Uhr einstellen.
Charlotte kannte das seit fast sechs Jahren – seitdem sie nach Stefans Tod wieder ganztags zu arbeiten angefangen hatte. Und sie beklagte sich nicht über die hohen Anforderungen, die ihr Job als Chefsekretärin an sie stellte. Im Gegenteil – ihre Arbeit füllte sie aus. Und sie erntete viel Anerkennung und Achtung von der ganzen Abteilung. Jeder wusste, dass sie die graue Eminenz im Hintergrund war, ohne die der Laden nicht lief. Auch ihr Chef wusste das. Und er schätzte sie dafür. Was wollte sie mehr?
Etwas gab es, was sie über ihren beruflichen Erfolg noch wollte. Etwas, das sie nach Stefans Tod abgeschrieben und zu den Akten gelegt hatte. Von dem sie aber in den letzten zwei Jahren immer häufiger träumte: Einen Lebenspartner. Zärtlichkeit. Einen Mann, mit dem sie irgendwann alt werden konnte.
Und Susanne hatte recht: Wenn man zu beschäftigt war, um auf Tanzveranstaltungen oder in Vereine zu gehen, musste man eben andere Wege beschreiten, um jemanden kennenzulernen.
Während sie einen Apfel aß, holte sie die Zeitung aus der Handtasche und entfaltete sie. Hinter dem Veranstaltungskalender für das Wochenende standen die Kontaktanzeigen.
Charlotte hatte die Anzeige angekreuzt, die sie gestern so spontan angesprochen hatte: Arzt, Mitte 50, verw., seriöse Erscheinung, sportlich, sucht treue Sie für gemeinsamen Lebensabend. Dann eine Chiffre, unter der man einen Antwortbrief an die Zeitung schicken konnte.
Sie holte ihren Notizblock heraus und entwarf einen Brief. Sehr geehrter Herr Unbekannt, ich könnte mir vorstellen, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ich bin achtundvierzig Jahre alt, seit sieben Jahren verwitwet … und so weiter.
Obwohl es zu ihrem alltäglichen Geschäft gehörte, Briefe zu schreiben – diese Zeilen fielen ihr nicht leicht. Die Mittagspause war zu kurz, um damit fertig zu werden.
Gegen fünf Uhr, als ihr Chef nach Hause gegangen war und Charlotte ihren Schreibtisch für das Wochenende aufgeräumt hatte, packte sie das Notizbuch aus und schrieb den Brief zu Ende. Als sie mit dem Ergebnis zufrieden war, tippte sie ihn mit dem Computer ab.
Auf dem Nachhauseweg steckte sie ihn in den Briefkasten. Morgen würde er den Adressaten erreichen. Mit einem warmen Prickeln im Bauch ging sie nach Hause.
8
Niedergeschlagen verließ Konstantin Lorenz am Abend die Kurklinik. Der Chef hatte sich heute merkwürdig distanziert verhalten. Und die junge Frau – Lisa Marten hieß sie – hatte er ihm als Praktikantin vorgestellt.