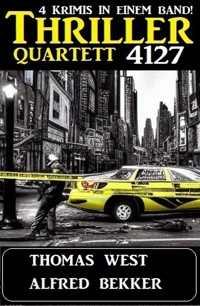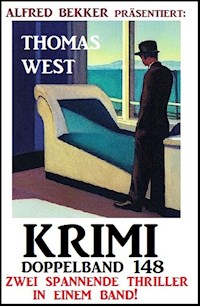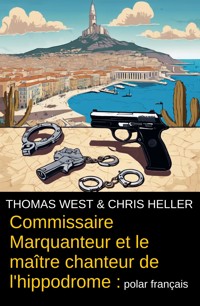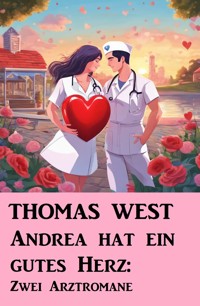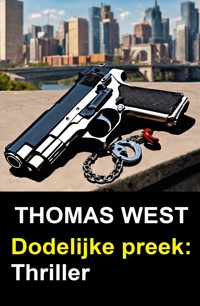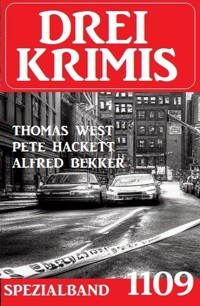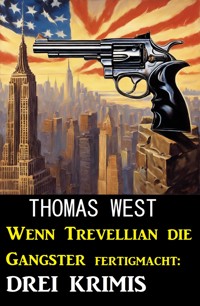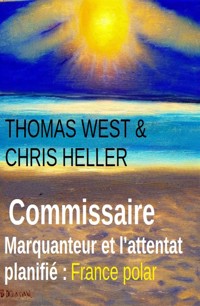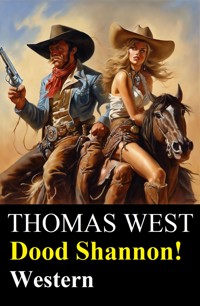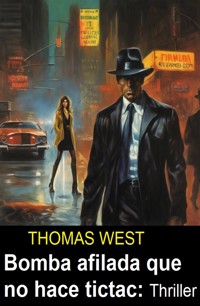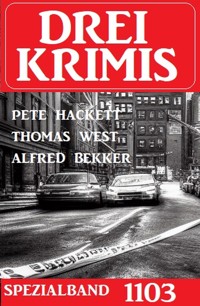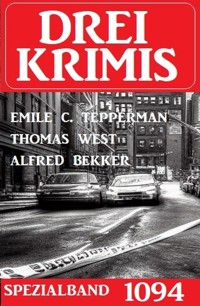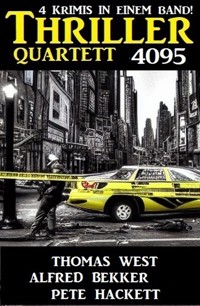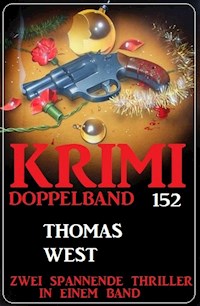
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis (349XE) von Thomas West: Jesse Trevellian - vom Geheimdienst gehetzt Rächer ohne Namen Irgend jemand zündete ein paar Kerzen an und schaltete das Licht hinter der Theke aus. Talita ging zum Plattenspieler und legte Meat Loaf auf. Und Jane huschte mit Marty in eines der Nebenzimmer. Nervös drehte Marc DaCol die Bierdose zwischen den Fingern. Natürlich wollten sie, dass er sich endlich verpisste! Die meisten waren ja schon gegangen. Fast der ganze Abschlussjahrgang. Nur die acht vom harten Kern noch nicht. Die Bacon-Clique. Und eben er. Er hatte einen Kloß im Hals, er rutschte nervös auf der Matratze hin und her, er zündete eine Zigarette nach der anderen an und eine ängstliche Stimme in ihm jammerte: "Jetzt geh, Marc, die wollen dich hier nicht..." Die andere Stimme in ihm aber - die trotzige, wütende Stimme - beharrte darauf: "Du bleibst!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West
Inhaltsverzeichnis
Krimi Doppelband 152 - Zwei spannende Thriller in einem Band
Copyright
Jesse Trevellian – vom Geheimdienst gehetzt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Rächer ohne Namen
Krimi Doppelband 152 - Zwei spannende Thriller in einem Band
Thomas West
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Thomas West:
Jesse Trevellian - vom Geheimdienst gehetzt
Rächer ohne Namen
Irgend jemand zündete ein paar Kerzen an und schaltete das Licht hinter der Theke aus. Talita ging zum Plattenspieler und legte Meat Loaf auf. Und Jane huschte mit Marty in eines der Nebenzimmer.
Nervös drehte Marc DaCol die Bierdose zwischen den Fingern. Natürlich wollten sie, dass er sich endlich verpisste! Die meisten waren ja schon gegangen. Fast der ganze Abschlussjahrgang. Nur die acht vom harten Kern noch nicht. Die Bacon-Clique. Und eben er.
Er hatte einen Kloß im Hals, er rutschte nervös auf der Matratze hin und her, er zündete eine Zigarette nach der anderen an und eine ängstliche Stimme in ihm jammerte: "Jetzt geh, Marc, die wollen dich hier nicht..."
Die andere Stimme in ihm aber - die trotzige, wütende Stimme - beharrte darauf: "Du bleibst!"
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER TONY MASERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Jesse Trevellian – vom Geheimdienst gehetzt
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 117 Taschenbuchseiten.
Dr. Yoshkun Erdan ist Kurde und Präsidiumsmitglied der PKK, er hat sich aus seiner Heimat abgesetzt, weil er aus dem sinnlosen Krieg aussteigen wollte. Von Geheimdiensten verfolgt, gelingt ihm im letzten Moment die Flucht nach New York. Die türkische Regierung bittet die USA, Erdan dort aufzuspüren und an die Türkei auszuliefern, deshalb soll das FBI ermitteln. Aber auch die Iraker wollen Erdan beseitigen lassen und haben einen Killer auf ihn angesetzt. Jesse Trevellian und seine FBI-Kollegen arbeiten fieberhaft daran, den Flüchtigen zu finden. Als Erdan entdeckt wird, taucht er unter - dann überschlagen sich die Ereignisse: Bevor der Kurde von seinen Verfolgern geschnappt wird, rückt das FBI an – und nach einer wilden Schießerei am Hudson River ist Jesse Trevellian spurlos verschwunden ...
1
Er steuerte den alten Toyota auf den Frauenparkplatz. Seine Augen flogen über die Parkreihen, die Rampe hinauf zur zweiten Ebene, in den Rückspiegel, durch die Windschutzscheibe hin zu der düsteren Fassade des Abflugterminals. Dann erst stieg er aus.
Eine Umhängetasche, einen kleinen Trolley - mehr Gepäck holte er nicht aus dem Kofferraum. Seine Schritte hallten durch das Parkhaus des Düsseldorfer Flughafens. Das Geräusch machte ihn genauso nervös, wie die Scheinwerferkegel der ein- und ausfahrenden Wagen. Ihr wechselndes Licht verkürzte und dehnte seinen Schatten, warf ihn von links nach rechts, oder ließ ihn zeitweise ganz verblassen.
Er überquerte die Taxizufahrt und hastete an der Außenwand der Flughalle entlang. Fast im Sekundentakt sah er sich um. Die von hinten heranrollenden Taxen, der Mann, der ihn im Dauerlauf überholte, die ihm entgegenkommende Frau, die plötzlich stehen blieb und hektisch ihre Handtasche durchwühlte - kaum ein Geräusch, kaum eine Bewegung, kaum eine Geste, die sein Hirn nicht als potentielle Gefahr registrierte.
Dann der erste der vier doppeltürigen Eingänge. Er drückte die Glastür auf und spürte die Nähe des Todes, noch bevor er einen seiner Jäger entdeckte.
Wie von selbst bewegten sich seine Beine plötzlich. Weg von seinem ursprünglichen Ziel, dem Schalter von British Airways, hin zum Zeitungskiosk kurz vor dem zweiten Eingang. Sein Blick flog über die vielen Menschen in der Flughalle. Und blieb für den Bruchteil einer Sekunde an zwei aufgeschlagenen Zeitungen hängen. Von den Männern dahinter sah er nur die Hosenbeine.
Es hatte Zeiten in Yoshkun Erdans Leben gegeben, in denen konnte er über Marktplätze, durch Bahnhofshallen oder Parkhäuser gehen, ohne sich auch nur einmal umzusehen. Zeiten, in denen sein Blick beim Betreten einer Bank, eines Supermarktes oder einer überfüllten Flughalle zuallererst und zwangsläufig an der erstbesten schönen Frau hängen geblieben war. Vorbei.
Er lehnte sich seitlich gegen den Verkaufstresen des Kiosk, warf einen Blick auf die türkischsprachigen Zeitungen und verlangte die > Özgür Politika<. Aus den Augenwinkeln beobachtete er die beiden Männer. Sie standen etwa fünfzig Meter von ihm entfernt an der Rolltreppe zur S-Bahn.
Einer von ihnen hatte sich die Zeitung inzwischen unter den Arm geklemmt und drückte sich ein Handy gegen das Ohr. Sonnenbrille, schwarzhaarig, dunkler Teint, buschiger Schnurrbart - Yoshkun Erdan registrierte den südländischen Habitus. Die beiden waren vermutlich Landsleute. Oder Irakis?
Wie von selbst schlugen seine Hände den Sportteil auf. Mit seinen Gedanken war er ganz woanders. Während er so tat, als würde er die aktuelle Tabelle der türkischen Meisterschaftsspiele studieren, checkte er in Wirklichkeit seine Chancen durch.
Entweder würden die beiden sich damit begnügen sein Reiseziel und seine Ankunftszeit auszuspionieren. Schlussfolgerung: In London, auf dem internationalen Flughafen von Heathrow, würden Sicherheitskräfte der türkischen Botschaft ihn in Empfang nehmen.
Vielleicht käme er in London auch noch bis zum Taxistand. Spätestens dort aber würden Männer des irakischen Geheimdienstes zuschlagen. Und zwar nicht mit Handschellen.
Oder aber sie riefen gerade ihre Leute zusammen, die sich an anderen Stellen des Flughafens postiert hatten. Schlussfolgerung: Sie würden in den nächsten Minuten zugreifen. Verhaftung oder Hinrichtung - je nachdem, zu welchem Lager die beiden an der Rolltreppe gehörten.
Yoshkun hatte nur eine Chance. Sie war lächerlich gering. Aber er war schon durch engere Maschen geschlüpft.
Er legte die Zeitung zusammen und steckte sie in die Tasche seines abgewetzten Jacketts. Dann die obligatorische Schachtel Marlboro. Auch so eine Bewegung, die ohne Zutun seines Bewusstseins funktionierte: Schachtel aus der Hemdtasche, Zigarette aus der Schachtel und zwischen die schmalen Lippen. Vierzig bis fünfzig Mal am Tag.
Den Trolley hinter sich herziehend schlenderte er zum Ausgang. Er hatte seine Waffe im Auto gelassen. Selbstverständlich. Das Risiko der Entdeckung bei der Gepäckkontrolle war noch größer als das Risiko auf dem Flughafen seinen Häschern in die Hände zu laufen. Aber genau das war jetzt geschehen.
Sein Pulsschlag trommelte in seinem Schädelinneren gegen die Schläfen. Äußerlich wirkte er ruhig, fast gelangweilt.
Fast hüfthohe, spindelartige Eternitaschenbecher flankierten die Glasfront. In der Flughalle herrschte Rauchverbot. Yoshkun zündete sich also die Zigarette draußen an und trat auf den Gehsteig. Ein Wartender wie viele. Scheinbar. Unablässig aber flogen seine Augen über Taxen, Menschen, Parkhausdecks und zurück in die Flughalle.
Die beiden Männer durchquerten jetzt die Halle und näherten sich ihm von hinten. Links, etwa hundert Meter entfernt, öffneten sich die hinteren Türen eines Taxis. Zwei Männer stiegen aus. Südländischen Typs. Rechts, ebenfalls gut hundert Meter entfernt, lösten sich zwei Männer aus dem letzten Eingang zur Flughalle.
Yoshkun packte seinen Trolley, ließ die Zigarette fallen und spurtete los.
Über die Zufahrt, die niedrige Begrenzungsmauer des ersten Parkhausdecks, und dann zwischen die parkenden Wagen. Er stieß sein Gepäck unter ein Fahrzeug und schlich geduckt in Richtung Frauenparkplatz.
Schon hörte er die Schritte seiner Verfolger hinter sich auf den Asphalt knallen. Gefährlich waren die beiden, die aus dem Taxi gestiegen waren. Sie würden versuchen, ihm den Weg abzuschneiden. Männerstimmen hallten durchs Parkhaus.
Unentdeckt erreichte er seinen Toyota. Durch die Fenster des daneben geparkten Wagens sah er wie seine Verfolger in einer Sechserkette das Parkhaus durchkämmten. Die Art wie sie Zeitungen oder Jacken vor ihren Bäuchen hielten, ließ an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig: Alle sechs waren bewaffnet.
Yoshkun schlüpfte in das Fahrzeug, zog eine Beretta unter dem Beifahrersitz heraus und ließ sich auf der Beifahrerseite wieder zum Wagen herausfallen.
Von Auto zu Auto huschte er zurück zu seinem Gepäck. Als er sich aufrichtete, um zurück zur Flughalle zu laufen, entdeckten sie ihn. Er schoss ohne zu zögern. Zwei der Männer gingen schreiend zu Boden, die anderen suchten Deckung zwischen den Parkreihen.
Yoshkun spurtete los. Am Eingang rannte er einen Raucher um, in der Flughalle sprangen die Leute beiseite, um ihm Platz zu machen, auf der Rolltreppe wurden ihm erbitterte Flüche hinterhergeschickt, als er sich durch die Menge nach unten drängte.
Der Bahnsteig war wie leer gefegt - die letzten Fahrgäste drängten sich eben in eine wartende S-Bahn. Yoshkun hechtete ins Innere des Zuges kurz bevor die Tür sich schloss.
Wieder einmal war das Schicksal gnädig mit ihm.
Schwer atmend ließ er sich in einen freien Sitz fallen. Die Bahn fuhr an. Yoshkun sah sich um. Zwei seiner Verfolger arbeiteten sich eben durch die vielen Menschen auf der Rolltreppe. Seufzend schloss er die Augen. Entkommen! Wieder einmal entkommen ...
In Düsseldorf Hauptbahnhof stieg er aus. Er nahm den nächstbesten Intercity Express nach Hamburg. Und von dort ging es über Kopenhagen nach Stockholm. Die Freunde dort würden ihm helfen.
Er musste raus aus Europa, kostete was es wollte ...
2
Die Frau konnte sich keine zwei Minuten auf den Monitor ihres Computers konzentrieren. Ständig schickte sie ihre Blicke auf Reisen an den Nachbarschreibtisch. Zu mir.
Dabei waren wir nur essen am Abend zuvor. Ich wollte, dass sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte - das Betriebsklima in der Bank interessierte mich, wer es mit wem konnte und wer nicht, wie der Chef ist, und so weiter. Sie redete fast ununterbrochen.
Anschließend hatte ich sie hinüber nach Brooklyn zu ihrem Apartment gefahren. Und zum Abschied ein Küsschen auf die Wange. Sonst nichts. Wirklich wahr.
Und heute Morgen verschlang sie mich mit ihren Blicken, als hätten wir die ganze Nacht in ihrem Bett herumgetobt.
Nicht dass Lydia Cellar hässlich gewesen wäre. Im Gegenteil: Kurze schwarze Locken, große braune Augen, schmales niedliches Gesicht mit einem köstlichen Stupsnäschen, höchst appetitliche Figur - schon auf der Schwelle zum Schalterraum der Bank war mir die knapp fünfundzwanzigjährige Frau vor zwei Tagen aufgefallen.
"Na wunderbar", dachte ich, "Arbeit und Vergnügen - so eng beieinander kann das liegen ..."
Lydia war auch ein nettes Mädchen. Durchaus. Aber ich merkte schnell, dass sie redete wie ein Wasserfall. Und dass sie zu der Sorte Frau gehörte, die möglichst schnell geheiratet werden will. Ich hab' eine Antenne für so was ...
Beruflich stehe ich auf redselige Frauen. Seit gestern Abend wusste ich zum Beispiel, dass der Kassierer der Bankfiliale schon zwei Entziehungskuren hinter sich hatte. Und laut Lydia immer noch soff.
Und dass der Filialleiter sich vor zwei Jahren ein Wochenendhaus mit Privatstrand auf Staten Island gekauft hatte. Lydia konnte sich nicht genug darüber wundern, woher der Mann das Geld nahm, um die Immobilie abzustottern.
Und dass der neue Anlageberater keine Gelegenheit ausließ, um am Stuhl des Filialleiters zu sägen, hatte ich auch erfahren.
Keine langweiligen Informationen, wenn man bedachte, dass im letzten halben Jahr fünf Filialen des > International Merchant Institutes< überfallen worden waren und wir von einem internen Komplizen der Bankräuber ausgingen.
Wie gesagt: Beruflich stehe ich auf redselige Frauen, und der Abend mit Lydia war vom beruflichen Standpunkt aus auch sicher ein Erfolg gewesen. Dass sie mich jetzt aber mit ihren Blicken befummelte, machte mich weiter nichts als nervös.
Ich lächelte zwei-, dreimal zurück. Dann tat ich so, als würde ich in meiner Arbeit versinken.
In der Filiale hielt man mich für einen McKinsey-Mitarbeiter. Diese Unternehmensberatung entwickelte seit einiger Zeit ein Marketingkonzept für das > Merchant International Institute<. Es ging um die Erforschung von Kundenbedürfnissen, Schichtzugehörigkeit der Kunden, kundenorientiertes Verhalten der Mitarbeiter und so weiter. Kurz: Die Unternehmensberatung sollte für die Bank herausfinden, wie man noch mehr Kunden dazu bringt, noch mehr Geld dem > International Merchant Institut< anzuvertrauen.
Nur zwei, drei Häuptlinge aus der Chefetage der Bankzentrale in der Wall Street kannten meine wahre Identität.
Wir arbeiteten mal wieder mit der > Bank Robbery Task Force< zusammen. Die Spezialtruppe aus Beamten der City Police und des FBI hatte mir eine Vita als Diplompsychologe aufgebaut. Ich hatte sogar einen entsprechenden Kurs absolviert. Jeder Mitarbeiter in der Bankfiliale glaubte, ich würde Kunden und Mitarbeiter beobachten, Betriebsabläufe dokumentieren, und mich ansonsten mit Kundenbefragung und Kundendateien befassen.
Weit gefehlt. Auf meinem linken Monitor flimmerten zwar lange Tabellen mit Kundendaten, mich aber interessierte fast ausschließlich der rechte. Über ihn konnte ich via Videokamera den Eingang der Bank beobachten. Und im linken Bügel meiner Fensterglasbrille war ein Lautsprecher eingebaut, aus dem hin und wieder Milos oder Orrys Stimmen zu hören waren.
Die beiden Kollegen wechselten sich am Fenster eines Hotelzimmers gegenüber der Bank ab und machten mich auf jeden Kunden aufmerksam, der ihnen verdächtig vorkam. Verdächtig hieß im schlimmsten Fall: Zu zweit oder dritt aus einem Wagen steigen und die Bank betreten, während ein Chauffeur im Auto zurückblieb und den Motor laufen ließ.
Die Bankfilialen waren ausnahmslos an Tagen überfallen worden, an denen extrem viel Geld im Banktresor gelagert war. Wir glaubten nicht an einen Zufall. Außerdem schienen die Täter sich in den Räumlichkeiten der Bankfilialen so gut auszukennen, als hätten sie Häuser selbst gebaut. Unsere Theorie: Sie erhielten Tipps von einem Insider. Was lag näher?
Also gehörte es auch zu meinem Job, die Mitarbeiter der Filiale genau unter die Lupe zu nehmen.
In zwölf der dreiundzwanzig Filialen, die das > International Merchant Institute< in New York City betrieb, hatten wir Special-Agents eingeschleust. Der fünfte Überfall lag vier Wochen zurück. Der sechste würde in den nächsten Tagen stattfinden. Daran zweifelte niemand im FBI-District und in der > Bank Robbery Task Force<. Wir waren vorbereitet.
3
Zwischen den Säulen des United States Courthouse der unvermeidliche Pulk der Presseleute. Emma O'Fancy verdrehte die Augen. Sie verriegelte ihren roten Ford Mustang und stieg die Vortreppe zu dem tempelartigen Unterbau des Gerichtsgebäudes hinauf.
Und schon ging ein Gewitter von Blitzlichtern und Fragen auf sie nieder. "Glauben Sie, die Geschworenen werden sich ihrem Strafmaß anschließen?" - "Warum gleich die Todesstrafe, Mrs. O'Fancy?" - "Was ist mit Baxters Alibi?" und so weiter und so weiter.
"Kein Kommentar!" Emma drängte sich durch die Kohorte der Medienleute. "Fragen sie mich heute Abend nach der Urteilsverkündung wieder." Sie drückte einen der großen Türflügel auf und rettete sich ins Foyer des Gebäudes.
Der Prozess gegen Timothy Baxter hatte viel Aufsehen erregt. Nicht nur in New York City. Der Weiße hatte eine schwarze Frau vergewaltigt und anschließend erdrosselt. Davon jedenfalls war Emma O'Fancy überzeugt.
Die Verteidigung hatte versucht, dem Opfer eine Teilschuld zuzuschieben. Keine Kunst - die Frau war nicht nur tot, sondern auch eine Prostituierte gewesen. > Totschlag im Affekt< - sie habe Baxter solange gedemütigt, bis der durchgedreht sei.
Emma holte den Aufzug und drückte auf den Knopf für das sechzehnte Stockwerk. Ein Blick auf die Uhr: kurz vor acht. Wie immer würde sie pünktlich in ihrem Büro erscheinen. Pünktlichkeit war nur eines ihrer Prinzipien.
Hartnäckigkeit ein anderes. Sie hatte gearbeitet wie ein Pferd - jedes Beweisstück geprüft, sich in jeden Ermittlungsschritt eingeschaltet, jedem Verhör beigewohnt und den ermittelnden Beamten Dampf gemacht. Sie war nicht mehr besonders beliebt bei der Mordkommission des Neunten Reviers. Nicht alle ermittelnden Beamten konnten ihren Eifer nachvollziehen - ein junger Weißer, eine schwarze Hure: Dumm gelaufen, aber deswegen gleich eine Mordanklage konstruieren?
Die Lifttüren schoben sich auseinander. Emmas Pumps knallten über den Boden der Zimmerflucht. Der energische, schnelle Gang war eines ihrer Markenzeichen. Die Tür des Chefzimmers ging auf, der silberhaarige, akkurat frisierte Aristokratenschädel Ralph Millards erschien im Türrahmen. Ihr Chef.
"Dein Plädoyer gestern war hervorragend, Emma." Er kam heraus und drückte ihr die Hand. "Gratuliere. Wir kriegen den Kerl. Wenn nicht auf den elektrischen Stuhl, dann wenigstens lebenslang hinter Gitter. Weiter so."
"Danke." Emma konnte ihre Genugtuung kaum verbergen. Sie war mit dreiunddreißig die jüngste Staatsanwältin im Team von Millard. Und es war ihr erster Mordprozess. Die Kollegen munkelten hinter vorgehaltener Hand, dass der Chefankläger Emma O'Fancy nicht nur wegen ihrer juristischen Qualitäten mit dem Fall betraut hatte. Jeder wusste, dass Millard versuchte, seiner jungen Assistentin sein Hobby schmackhaft zu machen. Jeder wusste, dass der geschiedene Mann scharf auf die Frau war. Und jeder wusste, dass Emma ihn seit über einem Jahr hinhielt.
Millard zog die Tür hinter sich zu und senkte die Stimme. "Wie wäre es, wenn wir heute Abend nach dem Prozess zusammen essen gehen?" Er setzte sein weltmännisches Lächeln auf. Manchmal schien er sich für unwiderstehlich zu halten. Nicht der einzige Zug an ihm, der Emma nervte. "Wir müssen doch unseren Sieg feiern."
"Warten wir es erst einmal ab, ob es überhaupt etwas zu feiern gibt."
"Daran zweifle ich nicht. Aber zum Drachenfliegen morgen Nachmittag kann ich dich abholen?"
"Versprochen ist versprochen." Sie ließ ihn stehen und steuerte ihr Büro an. Eigentlich war sie überzeugt davon, den Prozess zu gewinnen. Sie hatte hinter den Kulissen mit dafür gesorgt, dass die Geschworenenjury zur Hälfte aus Afroamerikanern bestand. Bis heute Abend würde ihr etwas einfallen, um Millards Einladung abzuwimmeln.
Die Fahrt in die Catskill Mountains stand schon seit Wochen in ihrem Terminkalender. Emma wusste selbst nicht, welcher Teufel sie geritten hatte, als sie ihrem Chef vorschlug, ihr das Drachenfliegen beizubringen.
"Guten Morgen!", flötete ihre Sekretärin im Vorzimmer. "Sie werden bereits erwartet."
Emma runzelte die Stirn. "In meinem Kalender steht kein Termin für heute Morgen." Sie zog den grünen Hut vom Kopf. Ihr rotblondes Haar hatte sie im Nacken zu einem Dutt zusammengebunden. Das verlieh ihrem sommersprossigen, eher lieblich wirkenden Gesicht einen strengen, fast prüden Zug.
Verblüffung zog die Miene der Sekretärin lang. "Aber Mr. Duxbury schwor Stein und Bein, dass er mit Ihnen verabredet wäre ..."
Emma verdrehte die Augen. "Ach du Schande!" Roger Duxbury war der hartnäckigste aller Mediengeier, die sie in New York City kennengelernt hatte. Er schrieb für die New York Post, verschiedene bunte Blätter und verkaufte seine Blut-und-Tränen-Geschichten an diverse Agenturen.
"Hören Sie, Mrs. Brown!", fuhr sie ihre Sekretärin an. "Ich verbiete Ihnen, in Zukunft jemals wieder einen Pressefritzen in mein Büro zu lassen! Ist das klar?!"
Die Frau senkte den Kopf und nickte schuldbewusst. "Er tat, als wäre das schon lange klar ...", jammerte sie.
"Schon gut." Duxbury konnte so überzeugend auftreten, dass er wahrscheinlich sogar einen Interviewtermin mit der First Lady bekommen würde, während sie in der Badewanne saß. Die Boulevardpresse riss sich um seine Stories.
Sie stieß die Tür ihres Arbeitszimmers auf. Der Journalist saß auf einem Stuhl vor ihrem Schreibtisch. Groß, breite Schultern und braun gebranntes, männliches Gesicht. Typ Tom Cruise. Die Sonnenbrille hing ihm auf dem dichten Haaransatz.
"Machen Sie, dass sie verschwinden, Duxbury!" Emma tat kühl und sprach mit gleichmütiger Stimmer. "Sie haben dreißig Sekunden Zeit. Dann rufe ich die Polizei und zeige Sie wegen Hausfriedensbruch an!"
Duxbury stand auf, lächelte und verneigte sich leicht. "Bitte nicht böse sein, Frau Staatsanwältin." Seine blauen, unverschämten Augen glitten über die schlanke, zierliche Gestalt der Frau. "Ganz Amerika will wissen, was eine Frau bewegt, die so leidenschaftlich für Gerechtigkeit plädiert. Haben Sie heute Nacht von Baxter geträumt?"
Emma funkelte ihn wütend an. Ihre grünen Augen wurden schmal. "Wenn Sie nicht sofort verschwinden, werden Sie heute Nacht von mir träumen!" Sie griff zum Telefon.
"Das ist nicht auszuschließen", grinste er. Ein Charmeur, wie er im Buche stand. "Sehen Sie, Mrs. O'Fancy - ich will von Ihnen nichts wissen, was nach Prozessende heute Abend sowieso in den Nachrichten zu hören ist. Meine Leser interessieren sich für die ganz menschlichen Seiten des Falles. Hat Baxter als kleiner Junge ins Bett gepinkelt oder Katzen gequält? Hat die Tote Kinder? Schreibt die Staatsanwältin Tagebuch, hat sie als kleines Mädchen mit Puppen gespielt, weint sie manchmal im Kino ..."
"Sie können mich mal." Emma griff sich den Hörer. "Verbinden sie mich mit dem ersten Polizeirevier!"
Duxbury hob beschwichtigend beide Hände. "Nur ein Satz, Frau Staatsanwältin. Oder zwei ..."
"Staatsanwaltschaft Manhattan, O'Fancy ", meldete Emma sich. "Schicken Sie mir sofort zwei Beamte. Ich werde hier in meinem Büro von einem Reporter belästigt ..."
"Schon gut." Duxbury eilte zur Tür. "Ich gehe. Schade." Er winkte ihr zu und verließ ihr Arbeitszimmer.
Emma legte auf. Sie ließ sich in ihren Schreibtischsessel fallen. Die Tür ging wieder auf, Duxbury kantiges Gesicht erschien. Die blauen Augen hinter seiner Brille heischten Frieden. "Ich hab' da eine Idee! Ich lade sie heute Abend zum Essen ein, und dann erzählen Sie mir ein bisschen was für unsere Mitbürger. Bitte!"
Er setzte ein um Liebe bettelndes Jungengesicht auf. Emma riss sich zusammen, um nicht grinsen zu müssen. Der Mann war ein gnadenloser Geschichtenjäger. Je blutrünstiger die Geschichten, desto hartnäckiger der Jäger. Aber Roger Duxbury war auch ein attraktiver Mann. Etwas in ihr begann unter seinem flehenden Blick zu schmelzen.
"Bitte!", wiederholte er.
Sie stülpte die Lippen aus und taxierte ihn von oben bis unten. Sicher war er nicht so ein Langweiler wie Ralph Millard. Und sie hatte lange keinen Sex mehr gehabt. Auch so ein Prinzip von ihr: Sie ging mit keinem ins Bett, in den sie nicht verliebt war. Millard wäre eine gute Partie. Und Emma wünschte sich nichts sehnlicher, als Kinder und Familie. Aber sie war nicht verliebt in den Chefankläger.
Und natürlich auch in diesen windigen Geschichtenerzähler nicht. Ihr Rücken straffte sich. Sie schüttelte den Anfall von weiblicher Sehnsucht ab, wie eine lästige Fliege. "Verschwinden Sie endlich!"
Duxbury, der schon anfing, Hoffnung zu schöpfen, machte ein enttäuschtes Gesicht und wollte die Tür zuziehen. "Sie können mich nächste Woche ja mal anrufen!", rief sie ihm nach und beschimpfte sich gleichzeitig für diesen Aussetzer ihrer Selbstbeherrschung.
Noch einmal sein schönes Gesicht im Türspalt. "Sie sind eine Perle!"
Emma machte sich an die Arbeit. Die Akten stapelten sich auf ihrem Schreibtisch. Wenn der Baxter-Prozess über der Bühne war, wartete schon die nächste Verhandlung auf sie.
Punkt zehn brachte ihre Sekretärin ihr eine Tasse Kaffee. Wie an jedem Arbeitstag. Alles hatte seinen festen Rhythmus in Emmas Leben.
Als sie am Nachmittag in ihre schwarze Robe gehüllt den bis auf den letzten Platz gefüllten Gerichtssaal betrat, setzte auf dem John F. Kennedy International Airport eine Boing 747 zur Landung an. Sie kam aus Stockholm.
Und während der Sprecher der Geschworenen das > Schuldig< begründete, trat ein Mann mit einem Trolley und einer Umhängetasche vor die Flughalle. Ein Türke kurdischer Abstammung. Er sah sich um und stieg in Taxi.
Es sollten noch fast achtundvierzig Stunden vergehen, bis Emmas Weg sich mit seinem kreuzen würde.
4
Isa Samara musterte den Mann mit gleichgültiger Miene. Er stand vor seinem Schreibtisch: Groß, glatt rasiert, braun gebrannt - ein Kubaner spanischer Abstammung. Fidelio Cortez hieß er. Ein viel versprechender Name für einen Killer.
Isa Samara wies auf den freien Stuhl vor seinem abgewetzten Schreibtisch. Der Kubaner setzte sich und griff nach der Zigarettenschachtel, die der Uniformierte ihm zuschob. Cortez zündete sich eine an und sog genüsslich den Rauch ein. "Was wollen Sie von mir, Commandante?"
Samara musterte ihn lauernd. Der Mann wich seinem Blick keinen Moment aus. Hinter Samara, an der Wand des kahlen Büros, lächelte das Konterfei eines der berüchtigsten Männer der Welt auf die beiden herab. Saddam Hussein. Die irakische Flagge hing schärpenartig um den Rahmens des Porträts.
"Ich habe mich bei den Kollegen des kubanischen Geheimdienstes umgehört. Sie haben gute Freunde dort."
Cortez nickte ungerührt. "Und gute Feinde. Ich habe lange genug dort gedient."
"Wir bräuchten ebenfalls Ihre Dienste." Es fiel Samara nicht leicht, den Auftrag von einem Fremden durchführen zu lassen. Der erfahrene Geheimdienstoffizier mit dem bulligen Körperbau, der Knollennase und dem buschigen Schnurrbart erledigte besonders die schwierigen Arbeiten lieber mit den eigenen Leuten.
"Ich höre." Cortez lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander.
"Ich brauche Ihnen sicher nicht erklären, warum jede Operation in den Vereinigten Staaten für uns mit unkalkulierbaren Risiken verbunden ist."
"Nein, das brauchen Sie wirklich nicht, Commandante." Nur die Mundpartie des Kubaners verzog sich zu einem flüchtigen Grinsen. Die Augen blieben eiskalt.
Samara zog die obere Schublade seines Schreibtisches auf. Er entnahm ihr ein Foto und reichte es Cortez. "Es geht um diesen Mann. Er muss weg."
Cortez betrachtete das Foto aufmerksam. "Wer ist das?"
"Sein richtiger Name lautet Yoshkun Erdan. Er ist Kurde. Mitglied der PKK."
"PKK?" Der Kubaner runzelte fragend die Stirn.
"Kurdische Arbeiterpartei."
"Meine Freunde beim kubanischen Geheimdienst werden nicht begeistert sein, wenn ich einen Marxisten liquidiere." Wieder das kalte Grinsen. "Eine aussterbende Gattung, wie Sie wissen, Commandante."
Samara winkte ab. "Marxisten, Kommunisten - erzählen Sie mir nichts, Cortez! Ein Räuberpack ist das, weiter nichts! Außerdem müssen ihre alten Kameraden nichts über ihren Auftrag zu erfahren."
"Sie unterschätzen den kubanischen Geheimdienst, Commandante!"
Der Offizier presste die Lippen zusammen. Umständlich holte er die Zigarettenschachtel von der anderen Seite des Schreibtisches. Cortez belauerte jede Geste des Irakis. Endlich brannte die Zigarette. "Dreißigtausend", sagte Samara.
"US-Dollar?" Die Miene des Kubaners hellte sich auf. Samara nickte. "Vierzigtausend!", verlangte Cortez.
"Einverstanden." Samaras Züge entspannten sich. Er hatte sich genau erkundigt und wusste längst, auf welchem Ohr der Killer besonders gut hörte. Er schob ihm einen Stapel Papiere über den Schreibtisch. "Hier steht alles Wissenswerte über Yoshkun Erdan drin - Familie, Tarnnamen, Gewohnheiten, alles, was Sie wissen müssen. Wir wissen aus sicherer Quelle, dass er sich nach New York City abgesetzt hat."
"Warum muss er weg?"
Samara Stirn legte sich in Falten. "Seit wann interessiert sich ein Henker für den Sinn seines Tuns?", knurrte er missmutig.
"Nennen Sie es Neugierde."
"Erdan wird als Nachfolger Öcalans gehandelt. Das könnten wir getrost den Türken überlassen. Nur - der Mann hat viele Anhänger unter den Kurden im Irak. Zwei seiner Brüder leben in unserem Land. Wenn er der neue PKK-Chef wird, sind Unruhen im Nordirak vorprogrammiert."
"Früher habt ihr so was mit Gas erledigt", sagte der andere kalt.
"Man lernt dazu." Die Zornesröte stieg dem Offizier ins Gesicht. Aber er beherrschte sich. "Wir neigen in letzter Zeit eher zu vorbeugenden Maßnahmen."
"Mir soll es recht sein." Der Kubaner schob die Unterlagen zusammen. "Zwanzigtausend Dollar sofort, zwanzigtausend nach Erledigung des Auftrages."
Samara drückte seine Zigarette aus. Dann griff er zum Telefon und wählte eine zweistellige Nummer. "Zwanzigtausend Anzahlung, Hassan. US-Dollar. Mach den Scheck fertig ..."
5
Sie kamen am späten Nachmittag, kurz vor Schalterschluss. Und sie waren so unverdächtig, dass Milos Warnung fast zu spät kam.
Als hätte sie jemand gewarnt, tauchten sie nacheinander auf. Im Abstand von fast einer halben Stunde. Er erste trug einen unauffälligen Anzug und hatte einen großen schwarzen Aktenkoffer bei sich. Nur sein Vollbart machte mich stutzig.
Mein Misstrauen legte sich erst, als Lydia sich mit ihm in eine der Beraterecken verzog. Ein paar Schritte hinter mir. Ab und zu schnappte ich einen Gesprächsbrocken auf: Es ging um Vermögensanlagen größeren Stils. Ein ganz normaler Kunde also. Dachte ich.
Und schließlich - ich hatte Lydia und den Mann schon fast vergessen - tauchte der Biker auf: Rotes eng anliegendes Dress, Schirmmütze, tief über die große Sonnenbrille gezogen. Warum nicht - die Oktobersonne hatte es in sich in diesem Jahr. Er trug einen riesigen Rucksack auf dem Rücken. Einer von diesen Fahrrad-Express-Boten eben. Er stellte sich an der Kasse an.
Kurz darauf dann Milos Stimme in meinem Ohr. "Achtung, Jesse - da parkt ein schwarzer Honda Akkord vor der Bank. Mit laufendem Motor. Ich kann mir keinen Reim darauf machen. Irgendwelche Verdächtige in der Bank?"
Ich registrierte plötzlich, dass Lydia Cellar verstummt war. Der Anlagenberater am Schreibtisch neben mir - ein junger kahlköpfiger Yuppie mit einem Brillanten in den Augenbrauen - sprang auf. Und plötzlich sah ich, wie der Biker eine Pumpgun aus seinem Rucksack zog. "Alarmstufe Rot, Milo - es geht los!"
Ich griff unter die Jacke und entsicherte meine SIG. "Überfall!", brüllte der Biker an der Kasse.
"Alle legen sich auf den Boden!" Der Kunde an Lydias Schreibtisch. Ich drehte mich zu ihm um - und sah in den Lauf einer Maschinenpistole. Sein linker Arm lag um Lydias Hals. Er presste sie an sich. Sie hatte eine Gesichtsfarbe wie kalte Holzasche. "Hinlegen!", wiederholte der Bursche seine Forderung. "Arme im Nacken verschränken!"
Fast gleichzeitig gingen Kunden und Bankangestellte zu Boden. Auch ich. Mein Auftrag für den Notfall war eindeutig - deeskalierend auf Mitarbeiter und Täter einwirken, dafür sorgen, dass es zu keiner Geiselnahme kam und die Täter mit dem Geld die Bank verlassen konnten. Dort würden die Kollegen sie greifen.
Der Biker kam hinter den Schaltertresen in den Geschäftsbereich. Ich sah nur seine roten Turnschuhe und seine starken, behaarten Waden. "Tresorraum aufschließen!", bellte er.
Jemand klirrte mit einem Schlüssel. Vermutlich der Filialleiter. Er und der Biker verschwanden Richtung Tresorraum. Der Mann mit dem Vollbart schleppte Lydia an mir vorbei. Die Gelegenheit wäre günstig gewesen. Aber ich hielt mich an den Einsatzplan und rührte mich nicht. "Wenn einer Faxen macht, stirbt die Frau!", brüllte er.
Elend lange Minuten verstrichen. Endlich kam der Biker mit dem Filialleiter aus dem Tresorraum zurück. "Und jetzt die Kasse!", schnarrte er.
Milos vertraute Stimme meldete sich. "Wir haben den Honda eingekreist, Jesse. Gib ein Zeichen, wenn wir zugreifen können."
"Okay." Durch die Schreibtische und Bürosessel hindurch sah ich die roten Turnschuhe des Bikers vorn am Eingang zum Kassenraum. Breitbeinig stand er da. Den raschelnden Geräuschen nach ließ er sich das Papiergeld aus der Kasse in seinen Rucksack leeren.
Die Sache wäre wohl genauso über die Bühne gegangen, wie wir es geplant hatten. Doch der neue Anlagenberater verlor die Nerven. Oder wollte den Helden spielen - weiß ich, was er wollte.
Aus den Augenwinkeln beobachtete ich, wie er sich unter den Nachbarschreibtisch schob und seine Rechte nach dem Alarmknopf unter der Schreibtischplatte ausstreckte. Ich hielt den Atem an. Der Vollbart zwei Schritte vor mir stieß Lydia zu Boden, riss seine MP herum und schoss auf den Mann.
Mir blieb keine Zeit zum Nachdenken. Ich sprang auf, drückte seinen Schussarm mit der tödlichen Waffe nach oben - fast gleichzeitig zog ich meine SIG und zielte auf den Biker. Der hatte seinen Rucksack fallen gelassen und legte seine Pumpgun auf mich an. Ich zog zweimal durch. Die Wucht der Schüsse schleuderte ihn in den Kassenraum hinein. Seine Pumpgun polterte auf den Boden.
Ich riss den Arm des Vollbarts nach hinten weg - ein hässliches Knirschen in seinem Schultergelenk, er schrie. Sekunden später lag er in Handschellen auf dem Boden.
Kunden und Bankangestellte rappelten sich in Zeitlupentempo auf. Als würden sie aus einer bleiernen Starre erwachen. Lydia sah mich aus großen Augen an - sie begriff nichts. Neben mir stöhnte der junge Kahlkopf. Ich beugte mich zu ihm herunter.
Es dauerte keine Minute, bis sich die Bank mit den Kollegen von der > Bank Robbery TaskForce< füllte. Ein Notarzt kümmerte sich um den verletzten Anlageberater. Die Schusssalve des Vollbarts hatte ihm das Kniegelenk zerschmettert. Er würde wohl bis an sein Lebensende an sein verhindertes Heldentum denken.
Milo und ich lehnten im Rahmen der Kassentür. Der Biker lag mit gebrochenen Augen in einer Blutlache. In seiner Stirn klaffte ein dunkles Loch. Ein feucht dunkler Fleck breitete sich über seiner Brust auf dem Bikerdress aus.
Unser Arzt zog sich eben die blutigen Latexhandschuhe aus. "Zweimal Steckschuss - Herz und Hirn. Er muss sofort tot gewesen sein", sagte er trocken.
Ich machte ein betretenes Gesicht und wandte mich ab. "Ich hatte keine Wahl, Milo."
"Und die, die du unbewusst getroffen hast, hat wohl ein paar Leuten hier das Leben gerettet." Er klopfte mir auf die Schulter. Das war nett von ihm - aber der Knoten in meinem Magen schien es nicht gemerkt zu haben.
"Jesse ...!" Lydia stand plötzlich vor uns. "Du bist ... du bist Polizist?"
Die Worte wollten ihr kaum von den Lippen. In dem Augenblick gefiel sie mir plötzlich. "Sicher ist mein Partner Polizist." Milo nahm mir die Antwort ab. "Genauer gesagt: Er ist FBI-Agent."
"Ich fass' es nicht ..."
Ich machte die beiden miteinander bekannt. Lydia war ganz aus dem Häuschen. Sie lud uns zum Essen ein. Der verhinderte Überfall müsse gefeiert werden. Ich dachte an Toten im Kassenraum, ich dachte an den angeschossenen Mitarbeiter - und winkte ab. "Mir ist nicht nach feiern ..."
"Quatsch!", mischte Milo sich ein. "Bis heute Abend ist ihm wieder nach feiern." Zu Lydia sagte er das, nicht etwa zu mir. Sie verabredeten ein Restaurant und eine Uhrzeit.
Ich hatte keine Chance es zu verhindern. Milo hätte sowieso nicht auf mich gehört. Beiläufig registrierte ich das vertraute Feuer in seinem Blick. Zu spät. Die Frau hatte es ihm angetan.
Selber schuld, dachte ich und verließ die Bank. Draußen auf der Straße sammelten sich schon die Nachrichtengeier. Kamerateams, Fernsehreporter, Journalisten der New Yorker Presse. Sie stürmten auf mich zu. "Haben Sie ein paar Informationen für uns?"
"Haben Sie eine Zigarette für mich?" Etwa ein halbes Dutzend Schachteln wurden mir entgegengestreckt. Ich entschied mich für eine Camel ohne Filter. Wenn schon, denn schon. Irgendjemand gab mir Feuer. Dann fragende Gesichter und ein Gestrüpp von Mikrofonen.
"Danke." Ich winkte und ließ sie stehen.
6
Yoshkun sprach leise und mit tonloser Stimme. Kemal, am Steuer des Cabbys nickte hin und wieder. Er stellte keine Fragen, er gab keine Ratschläge, er hörte einfach nur zu. Genau das war es, was Yoshkun an dem älteren Kurden schätzte.
Der Anatolier lebte mit seiner großen Familie schon seit mehr als zwanzig Jahren in New York City.
Yoshkun erzählte von der Schießerei auf dem deutschen Flughafen, von seiner Flucht nach Stockholm, von den Freunden dort, die ihm falsche Papiere, Visum und Flugticket nach New York City besorgt hatten.
An den noch glühenden Kippen zündete er sich die Zigaretten an. Kemal - er war Nichtraucher - beschwerte sich nicht.
Sie hatten die Brooklyn Bridge erreicht, als Yoshkun fertig war. Schweigend fuhren sie hinüber nach Manhattan. "Man sagt, du wolltest aussteigen", brummte Kemal.
"Ich bin ausgestiegen. Ich hab' genug von dem Wahnsinn. Die Waffen müssen endlich verstummen."
"Sie werden dir nicht glauben, dass du ausgestiegen bist", sagte Kemal. "Am allerwenigsten unsere Leute werden es dir glauben. Sie zählen auf dich."
"Die Zeit der PKK ist vorbei. Öcalan hat versagt. Wir müssen den vernünftigen Leuten unseres Volkes die Chance geben, etwas für die kurdische Sache zu erreichen."
Kemal schwieg ein Zeit lang. Dann: "Und was willst du nun tun?"
"Kontakt mit dem türkischen UNO-Botschafter aufnehmen. Ich will mit der Regierung verhandeln."
Wieder schwieg der Alte. Er ging vom Gas und schaltete herunter. Abendliche Rushhour. In der Canal Street ging nichts mehr. Mit einer Kopfbewegung deutete er auf das Handschuhfach. Yoshkun öffnete die Klappe. Zwei Waffen lagen im Fach. Eine Uzzi und ein Army-Revolver – ein .38 Smith & Wesson. Yoshkun schlug das Fach zu.
"Nimm, du Hohlkopf!", herrschte Kemal ihn an. "Wenn die Irakis dich erwischen, machen sie kurzen Prozess!" Yoshkun öffnete das Handschuhfach. Waffen und Munition verschwanden in seiner Umhängetasche.
Eine halbe Stunde später kroch das Cabby durch die Straßen von Chinatown. Kemal stoppte vor einem schmuddeligen Hotel in der Pell Street. > Shanghai< stand auf einem Holzschild an der grauen Fassade. In chinesischer und amerikanischer Schrift. Der alte Taxifahrer hatte dort ein Zimmer für Yoshkun gebucht. "Ruf mich nicht mehr an." Yoshkun fixierte ihn überrascht. "Ich kann nichts mehr für dich tun."
"Warum das?" Yoshkuns Stimme klang heiser.
"Sie haben bei mir angerufen und mir gedroht."
"Wer?"
Kemal hob müde die Schultern. "Wenn ich das wüsste ..." Er sah den Jüngeren traurig an. "Sie haben gesagt, sie werden meinen jüngsten Sohn töten, wenn ich dir helfe."
"Irgendjemand weiß also, dass ich in New York City bin ...", Yoshkun schloss die Augen. Schon wieder kämpfen, schon wieder flüchten, schon wieder einen sicheren Ort suchen ...
"Irgendjemand, der dein Feind ist", sagte Kemal. "Aber keine Sorge. Ich schweige, wie ein Grab." Sie umarmten sich. Kemal klopfte dem Jüngeren auf die Schulter. "Viel Glück."
Yoshkun schoss der Gedanke durch den Kopf, dass er Kemal töten müsste, um ganz sicher zu sein.
Yoshkun stieg aus. Er sah sich um, blickte Kemals Taxi hinterher, bis es in eine andere Straße abbog, sah sich wieder um.
Die Freundlichkeit der Asiaten im Hotel schien ihm gekünstelt. Später lag er in seinem Zimmer auf dem Bett und rauchte. Er fühlte sich unendlich einsam.
7
Die Nachmittagssonne stand noch hoch im Westen. Die Laubwälder der Catskill Mountains leuchteten in den rötlich-gelben Farben des Herbstes.
Von hier oben, vom Gipfel des Slide Mountains aus, hatte man eine prächtige Aussicht auf den Catskill Park und den Belle Ayr Mountain.
Emma hatte an diesem Nachmittag keinen Sinn für die Schönheit der Natur. Ihr Magen pulsierte, während sie sich in ihre gut isolierte Montur quälte - der erste Flug stand ihr bevor.
Neben der hölzernen Startrampe am Hang standen vier bunte Drachen. Männer in roten, blauen und gelben Schutzanzügen machten sich an ihren Geräten zu schaffen.
Ralph Millard wich nicht von ihrer Seite. Er trug bereits seine Kluft und den Helm. "Der Wind ist günstig", sagte er, "nicht zu schnell und nicht zu langsam. Wir werden dahingleiten, wie ein Seeadler." Er würde Emma begleiten bei ihrem ersten Flug.
Gemeinsam gingen sie zu Millards Drachen. Er machte das teure Gerät, das sich für den Flug zu zweit eignete, startklar. Sie hatten die Startvorbereitungen zigmal geübt. Theoretisch kannte Emma jeden Handgriff.
"Hey!" Millard legte seinen Arm um Emmas Schulter und zog sie an sich. "Du machst ja ein Gesicht, als hättest du einen Prozess verloren!"
"So ähnlich." Emma war speiübel.
"Denk an den Baxter-Prozess, denk an deinen Sieg!" Er klopfte ihr auf die Schulter. "Du bist ein Winner, Emma! Nach der Landung wirst du tanzen vor Freude!"
"Schon möglich."
Er drehte sich nach den anderen Piloten um. Sie standen am Hang, beobachteten die Wolken und maßen die Windgeschwindigkeit. "Siehst du den mit der blauen Montur?" Emma nickte. "Ein Rechtsanwalt aus Queens." Millard flüsterte. "Der hat sich bei seinem ersten Flug in die Hose gemacht." Emma betrachtete den großen, athletisch gebauten Mann - und musste plötzlich lachen. "Und heute unterrichten wir gemeinsam in der Drachenflugschule", sagte Millard.
Sorgfältig ging er mit ihr noch einmal das Gerät durch. "Du nimmst diesen Gurt. Wie nennt man den?"
"Schlafsackgurt mit integriertem Fallschirm", sagte Emma brav.
"Gut." Millard war zufrieden. "Und den hier?"
"Kniehängergurt."
"Genau. Den werde ich nehmen. Anlaufen wie geübt, dann in die Waagrechte. Ich übernehm' den Steuerbügel zunächst allein, und du tust weiter nichts, als mir auf die Finger zu schauen und so viele blöde Fragen zu stellen, wie dir einfallen. Klar?"
"Alles klar." Emmas Stimme klang heiser.
"Dann kann's ja losgehen." Millard führte den Vorflugcheck durch: Rohre, Kauschen, Verspannungen, Zentralgelenk, Aufhängung - er prüfte das Fluggerät noch einmal auf Herz und Nieren. Emma musste jeden Handgriff wiederholen. Das beruhigte sie ein wenig.
Schließlich klinkten sie sich ein und schoben den Drachen auf die Startrampe. Emmas Mund wurde trocken, während sie den Hang unter der Rampe betrachtete. Er war relativ flach, fiel aber nach etwa zweihundert Metern steil ab. Wieder rebellierte ihr Magen.
"Liegeprobe!", kommandierte Millard. Emma hängte sich in ihren Gurt. "Okay." Millard warf einen letzten Blick auf den Windgeschwindigkeitsmesser. Er reckte den Daumen hoch.
Sie schoben das Gerät bis zu der Stelle, an der die Rampe abfiel und der steilen Neigung des Hanges folgte. Millard justierte die Spitze des Drachens, bis sie in einem Winkel von etwa zwanzig Grad zum Hang stand. "Eins, zwei, los!" In einem oft geübten Gleichschritt spurteten sie die Rampe hinunter. Der Wind hob das Fluggerät hoch, und schon schwebten sie über dem Hang.
"Wahnsinn!", jubelte Emma. "Das ist ja toll! Das ist ja richtig gut!" Buschwerk und Unterholz glitt fünf, sechs Meter unter ihnen dahin. Der Drachen segelte auf die Baumwipfel zu. Gleich würden sie den Steilhang erreicht haben. "Ich fliege ...!", schrie Emma.
Plötzlich ging ein Ruck durch den Drachen. Emmas Jubelgeschrei blieb ihr im Hals stecken: Millard war seitlich weggekippt und aus seinem Bauchgurt gerutscht. "Ralph ...!" Mit weit aufgerissenen Augen sah Emma ihn durch das Gezweig einer jungen Birke brechen und im Buschwerk darunter verschwinden. Fassungslos starrte sie auf den leeren Gurt neben ihr. Sollte ihr Fluglehrer tatsächlich vergessen haben, sich anzuschnallen?
Und jäh fiel der Boden unter ihr in die Tiefe - sie hatte den Steilhang erreicht. Ein Aufwind blies unter die Segel und trug den Drachen in den Himmel.
Emma sah zurück - die anderen Piloten standen reglos am Hang und starrten ihr hinterher. Sekundenlang konnte sie sich nicht mehr bewegen - gelähmt vor Schreck registrierte sie, wie der Drachen sich von den Baumwipfeln entfernte und immer höher stieg.
"Emma!", brüllte eine ferne Stimme. "Emma!" Millards Stimme. Wenigstens hatte er den Sturz überstanden. Ihre Erstarrung löste sich, sie griff nach dem Steuerbügel. Minutenlang hielt sie ihn einfach nur umklammert. Bis ihr die Arme schmerzten.
Die Rodung mit der Abflugrampe im Hang des Slide Mountains war nur noch eine kleine Aussparung im rötlichen Leuchten des Waldes. Schon lag der Gipfel des Berges unter ihr. Und sie stieg immer höher. Unter ihr der Catskill Park. Der Atem stockte ihr, als sie sich klarmachte, dass sie irgendwo da unten landen musste. Oder mit dem Fallschirm abspringen ...
"Ich muss Kurven fliegen, sonst treibe ich ab", keuchte sie. Fieberhaft versuchte sie zu rekonstruieren, was sie aus den Büchern und von Millard gelernt hatte: Stationärer Kurvenflug - Steuerbügel drücken. "Lieber Gott, hilf mir!" Sie fasste nach dem Bügel. Wieder ging ein Ruck durch das Fluggerät. "Halt! Nicht so abrupt!" Sie schimpfte mit sich selbst.
Schnell fand sie heraus, wie viel Druck der Steuerbügel brauchte, um Vollkreise zu ziehen. Der Drachen schraubte sich spiralartig in die Höhe.
Emma war schweißgebadet - und fröstelte gleichzeitig. Ein Blick auf den Flughöhenmesser zeigte ihr, dass sie sich bereits in über dreizehnhundert Metern Höhe befand. "Oh Gott - ich muss doch runter!" Wieder spielte sie mit dem Gedanken, ihren Schlafsackgurt von den Verstrebungen des Drachens zu lösen und den Fallschirm zu benutzen.
Sie entschied sich dagegen. Weniger wegen des teuren Geräts - ihr Stolz ließ es einfach nicht zu. "Du hast dich darauf eingelassen, Emma!" Sie schrie sich regelrecht an. "Du dummes Weib hast dich auf so einen hirnverbrannten Flug eingelassen! Und jetzt bringst du es gefälligst zu Ende!"
Doch wie landete man so ein Gerät? Und wie zum Teufel brachte man es dazu mit der verdammten Steigung aufzuhören?
Emma zwang ihr leer gefegtes Hirn die ganze Theorie, die sie in den letzten Wochen inhaliert hatte, aus dem Langzeitgedächtnis zu kramen. Ihre Zähne klapperten. War es die Kälte hier oben, war es die Panik? Emma wusste es selbst nicht.
Sie ordnete die Flut von Informationen, die ihr Hirn plötzlich ausspuckte und zog endlich den Steuerbügel an. Gleichzeitig verlagerte sie ihr Gewicht zur äußeren Seite der Kurve und brachte den Steuerbügel dann wieder in Normalstellung.
Sie hielt den Atem an und blickte nach unten: Die Baumwipfel des Catskill Parks, ein Flusslauf und eine Straße, die tief unter ihr wie silbergraue Fäden den Park durchschnitten, glitten jetzt kerzengerade unter ihr vorbei. Der Drache flog keine Kurven mehr sondern hielt geradewegs auf den Belle Ayr Mountain auf der anderen Parkseite zu. "Lieber Gott, ich danke dir ..."
Und der Drachen sank. Emma blickte auf den Höhenmesser: Vierzehnhundert Meter. Ungefähr einen Meter verlor sie pro Sekunde, schätzte sie. Vierzehnhundert Sekunden - das waren ungefähr dreiundzwanzig Minuten.
"Sieh es positiv, Emma", murmelte sie. "Du hast noch mindestens dreiundzwanzig Minuten zu leben." Sie zwang sich ruhig durchzuatmen. Ein Psalm fiel ihr ein. "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln ..." Das alte Gebet entspannte sie. "… und ob ich schon wanderte im finstren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir ..."
Das Gesicht ihres Großvaters tauchte auf ihrer inneren Bühne auf. Nach dem Tod ihres Vaters waren sie und ihre Mutter zu dem Witwer gezogen. Emma war noch ein kleines Mädchen gewesen. Er hatte sie sehr religiös erzogen. "Es ist nicht schlimm zu sterben, Emma", hatte er manchmal gesagt. "Und was danach kommt, ist allemal schöner als dieses beschissene Leben ..."
Die tote Prostituierte verdrängte seine vertrauten Züge. Das schwarze Gesicht mit den gebrochenen Augen und der herausgequollenen Zunge schien sie hämisch anzugrinsen. Emma hatte ihre Leiche in der Pathologie gesehen.
Und plötzlich fiel ihr Timothy Baxter ein. Der Mann war nach der Urteilsverkündung auf der Anklagebank zusammengebrochen und hatte geheult wie ein kleines Kind ...
Und sie hatte sich voller Genugtuung zurückgelehnt und die Zufriedenheit in den Gesichtern der Prozessbesucher genossen.
Lächerlich kam ihr eigenes Leben ihr plötzlich vor. Lächerlich und bedeutungslos. Nichts als das mühsame Streben nach oben, schon in ihrer Jugend: Immer musste sie die Beste sein. Nichts als Karriere, kaum Zeit zum Leben. Mit Bitterkeit dachte sie plötzlich daran, dass es erst einen Mann in ihrem Leben gegeben hatte, einen Mann, mit dem sie Sex hatte ...
"Ich will nicht sterben!", schrie sie. "Ich will leben!" Die Tränen stürzten ihr aus den Augen. Das Visier ihres Helmes beschlug sich.
Eine Turbulenz packte den Drachen und drückte ihn nach unten. Emma wusste nicht wie ihr geschah. Sie wurde hin und her geworfen. Der Höhenmesser zeigte nur noch vierhundert Meter an. Noch knapp sechs Minuten. Der Wind wurde stärker, drückte auf die Segel und der Drachen verlor schneller an Höhe. Noch zweihundert Meter. Noch hundertfünfzig, hundert, achtzig Meter.
Sie sah die Baumwipfel des dichten Waldes unter sich, sie sah zwei, dreihundert Meter vor sich die Lichtung, und sie sah den schroffen Felshang des tief in die Lichtung eingekerbten Flusslaufes, und auch die plötzlich abbrechende Grasmatte der Lichtung sah sie. Noch dreißig Höhenmeter - der Drachen hielt genau auf die Schlucht zu.
Eisschauer rieselten über Emmas Hirnhäute. In Bruchteilen von Sekunden erfasste sie die Situation: In wenigen Minuten würde sie gegen die Felswand auf der anderen Flussseite prallen und wer weiß wie tief in die Schlucht stürzen. Die Kurve, mit der sie das verhindern konnte, würde so eng ausfallen, dass sie sofort abstürzen würde. Nur noch zwanzig Meter, aber hoch genug, um sich alle Knochen zu brechen.
Sie hatte nur eine Chance: Eine der drei Eichen wenige Meter vor dem Rand der Schlucht. "Eine Baumlandung ...", keuchte sie, "du hast gestern noch davon gelesen ... eine Baumlandung ... versuch's ..."
Sie verlagerte das Gewicht und es gelang ihr den Drachen so auf Kurs zu bringen, dass er direkt auf die mittlere Eiche zuhielt. Aber immer noch flog sie so hoch, dass sie mindestens fünf Meter über der Krone hinweg auf den Felsen zusteuern würde.
Gras, Geröll und Büsche der Lichtung rasten unter ihr hinweg. Kaum war es ihr bewusst, dass sie schrie - die Eichenkrone, das Tosen des unsichtbaren Flusses, die Schlucht und der Felsen: Für Sekunden bestand die Welt aus nichts anderem mehr.
Emma drückte den Steuerungsbügel heraus, schrie und drückte, schrie und drückte. Der Drachen sackte ab, sie ging aus der Hängestellung, ließ die Beine baumeln, dann die Wipfeläste der Eiche, ihre Schuhe verhakten sich, schmerzhaft zerrte die Schubkraft des Drachens an Hüften, Schultern und Knien - der Bug des Drachens senkte sich ruckartig, stieß fast senkrecht hinunter, und zog Emma kopfüber ins Geäst hinein ...
Sie brauchte Minuten, bis ihre flatternden Nerven sich beruhigten. Immer noch schluchzend löste sie sich aus dem Gurt. Fast eine halbe Stunde lang hing sie in den Ästen des Baumes, bis sie ihre zitternden und schmerzenden Beine endlich dazu brachte, sich nach unten zu tasten.
Endlich stand sie am Abgrund. Knapp fünfzehn Meter unter ihr tobte ein schäumender Gebirgsfluss durch enge Felsschneise. "Ich lebe", murmelte sie, "lieber Gott, ich lebe noch ..." Sie sank ins Gras.
In den kommenden Wochen würde sie oft an diese bangen Minuten zurückdenken. Und im Rückblick würden sie ihr vorkommen, wie das erste Anklopfen des Todes ...
8
"Hier." Der Chefredakteur reichte ihm die druckfrische Ausgabe der New York Post. "Deine Stories schießen mal wieder den Vogel ab."
Roger Duxbury hielt die Titelseite ein Stück von sich weg. Um seine Mundwinkel spielte ein zufriedenes Lächeln.
> Geistesgegenwärtiger FBI-Agent verhindert Blutbad in Bank<. Sie hatten sich für den Banküberfall als Titelstory entschieden. Das Titelfoto zeigte einen hageren, dunkelhaarigen Mann, der sich eine Zigarette zwischen die Lippen steckte. > Die Nerven flattern noch<, lautete die Bildunterschrift.
Duxbury hatte den Namen des Mannes recherchiert, den sein Fotograf abgelichtet hatte. Jesse Trevellian hieß er. Kein Unbekannter für den Journalisten. Der G-Man hatte einen Namen in Manhattan. Einen Namen, der sich hören ließ.
Die zweite Story drehte sich natürlich um den Baxter-Prozess. > Schuldig< prangte in hohen Lettern über dem Artikel. Ein Foto zeigte den Verurteilten mit gesenktem Kopf. Seine verzerrte Miene war gerade noch zu erahnen. Unter dem Bild ein Text des Chefredakteurs: > Auf dem langen Weg zum elektrischen Stuhl. Zu harte Strafe für den Familienvater?<
"Raffiniert", murmelte Duxbury. Natürlich würden viele Leser der New York Post empört sein über das Todesurteil für einen Mann, der die Nerven verlor und eine schwarze Prostituierte erdrosselte.
Im Text ein großer Abschnitt über die Staatsanwältin. Ihre irischen Vorfahren, ihre Karriere, ihr Arbeitsstil, ihre knallharte Art, ihre Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, ihr gefährliches Hobby, die Drachenfliegerei - Roger Duxbury hatte alles verwurstet und aufgebauscht, was er von Mitarbeitern und aus der Gerüchteküche der Staatsanwaltschaft aufgeschnappt hatte. Tenor der Story - > hart, aber gerecht<.
Er wollte es sich mit der Frau nicht verderben. Nächste Woche würde er versuchen, ein Date mit ihr zu bekommen. Vielleicht konnte er noch eine Story nachschieben.
"Da hat jemand für dich angerufen, Roger." Die Redaktionssekretärin reichte ihm einen Zettel. "Du sollst zurückrufen." Der Name > Chang < stand auf dem Zettel. Dahinter eine Nummer.
Marc Chang, einer von Duxburys vielen Informanten, war Arzt in Chinatown. Er kam viel in die Häuser, interessierte sich für alles und jeden, und wurde gern von der Unterwelt in Anspruch genommen, wenn > Krankheiten< zu behandeln waren, die andere Ärzte dem Staatsanwalt oder der Polizei meldeten: In erster Linie Schuss- und Stichwunden.
Duxbury verzog sich in sein Büro und hängte sich ans Telefon. "Was gibt's, Doc?"
"Etwas, was dich sehr interessieren könnte." Wie immer tat der Mann zunächst einmal geheimnisvoll. Schon mit dem ersten Satz pflegte er sich auf diese Weise eine günstige Ausgangsposition für die Honorarverhandlungen zu schaffen.
Duxbury hatte im Lauf der Zeit seine eigene Strategie dagegen entwickelt. "Ich hab' zurzeit soviel Interessantes, was eine gute Story hergibt - da musst du dich schon gewaltig anstrengen, um mich von meinem Schreibtisch wegzulocken. Gib mir ein Stichwort."
"Öcalan", sagte Chang.
"Der sitzt seit ein paar Wochen auf einer türkischen Gefängnisinsel. Solange sein Prozess nicht läuft, gibt er keine Story mehr her."
"Er nicht, aber seine Partei."
"Die PKK interessierte den Durchschnittsmanhattie nicht." Es war immer das Gleiche - Chang behielt seine Katze solange im Sack, bis Duxbury seine Neugierde kaum noch im Zaum halten konnte. Doch der Reporter tat so gelangweilt wie möglich. "Es sei denn, sie bewerfen den Wagen des türkischen UNO-Botschafters mit Farbbeuteln, Steinen oder Molotowcocktails."
"Vielleicht tun sie das ja demnächst." Chang senkte seine Stimme und klang plötzlich sehr verschwörerisch. "In letzter Zeit sind nämlich einige Kurden nach Lower Manhattan gekommen."
Fünf Minuten später saß Duxbury in seinem metallic blauen BMW Z 3 und fuhr Richtung Chinatown.
Marc Changs Praxis lag in der Canal Street. Nicht weit entfernt vom Harry Howard Square. Das Wartezimmer war überfüllt - zur Hälfte mit Amerikanern chinesischer Abstammung.
"Melden Sie mich bei Dr. Chang an." Duxbury nahm seine Sonnenbrille ab und schob der schlitzäugigen Arzthelferin seine Karte über den Tresen. Zehn Minuten später öffnete sich die Tür eines der Behandlungszimmer. Eine Mutter mit einem Kind auf dem Arm kam heraus. Chang winkte den Journalisten hinein.
Duxbury setzte sich auf die Liege neben dem EKG-Gerät. Am Fußende der Liege stand ein menschliches Skelett. Duxbury stellte sich vor, er würde in diesem Raum mit der Diagnose einer schweren Krankheit konfrontiert. Und dann vom Sessel vor dem Schreibtisch aufstehen und das Skelett sehen. Sehr ermutigend ...
"Also - was ist mit diesen Kurden?"