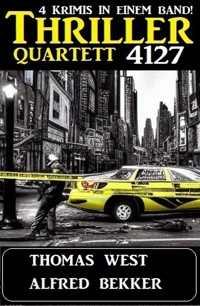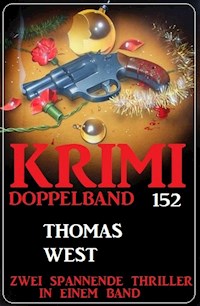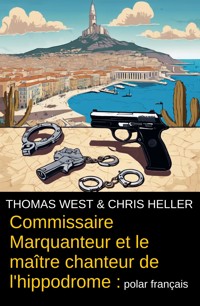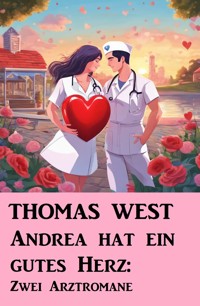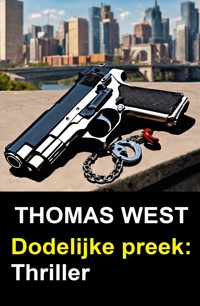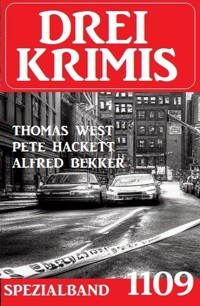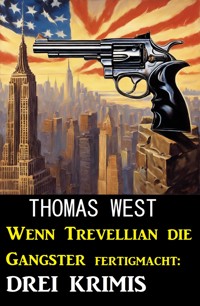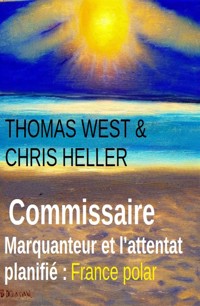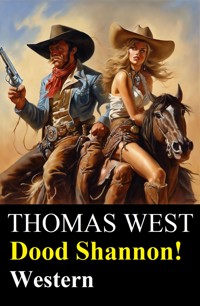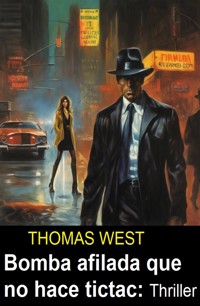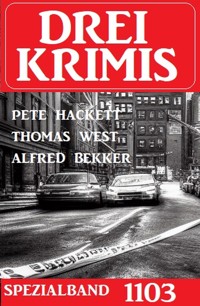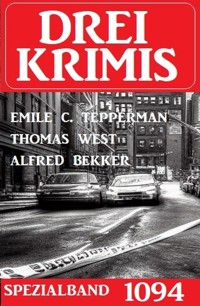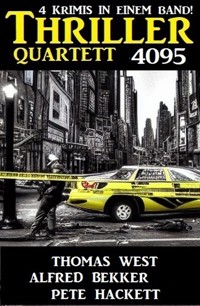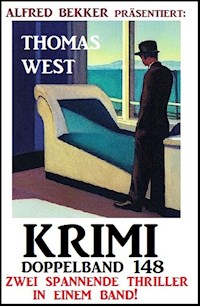
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis von Thomas West: Kein Verbrechen ohne Sühne Triebfeder Hass Eine Reporterin verschwindet, aber vorher konnte sie noch mitteilen, woran sie arbeitete. Eigentlich recherchierte sie über uneheliche Kinder, doch etwas anderes war herausgekommen: Ein geplantes Attentat im Basketballmilieu. Ein heißes Eisen! Das Verschwinden der Reporterin ruft das FBI auf den Plan. Jesse Trevellian, eigentlich schon im Urlaub, wird von einer alten Freundin um Hilfe gebeten und nimmt sich der Sache an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas West
Inhaltsverzeichnis
Krimi Doppelband 148 - Zwei spannende Thriller in einem Band
Copyright
Kein Verbrechen ohne Sühne
Triebfeder Hass
Krimi Doppelband 148 - Zwei spannende Thriller in einem Band
Thomas West
Dieser Band enthält folgende Krimis
von Thomas West:
Kein Verbrechen ohne Sühne
Triebfeder Hass
Eine Reporterin verschwindet, aber vorher konnte sie noch mitteilen, woran sie arbeitete. Eigentlich recherchierte sie über uneheliche Kinder, doch etwas anderes war herausgekommen: Ein geplantes Attentat im Basketballmilieu. Ein heißes Eisen! Das Verschwinden der Reporterin ruft das FBI auf den Plan. Jesse Trevellian, eigentlich schon im Urlaub, wird von einer alten Freundin um Hilfe gebeten und nimmt sich der Sache an.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Kein Verbrechen ohne Sühne
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 114 Taschenbuchseiten.
Der Prozess gegen drei Verbrecher aus der Belucci-Familie soll beginnen, doch vorher wird die kleine Tochter des zuständigen Richters entführt. Damit steht nicht nur der Prozess auf der Kippe, das FBI muss sich beeilen, um das Kind lebend zu befreien. Bronco Belucci schreckt auch vor einem der schrecklichsten Verbrechen nicht zurück, um seine Familie vor dem Gesetz zu bewahren. Aber in diesem Fall gibt es besondere Umstände.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Er zog die kleine Tür hinter sich zu und machte es sich auf dem einzigen Sitz bequem. Die halbdunkle Kabine nahm ihn in ihre Geborgenheit auf. Es roch nach Holz, Leder und Weihrauch. Alles, was ihm durch den Kopf ging, alles, was ihn bewegte und besorgt machte, fiel von ihm ab. Für die nächsten zwei Stunden würde er Priester sein. Priester, und weiter nichts als Priester.
Er zog das Schiebetürchen des buchdeckelgroßen Fensters an der Trennwand auf. Es war eher ein Lauschfenster als ein Sichtfenster, denn immer noch trennte ihn jetzt eine dunkelbraune, kunstvoll von zahllosen Löchern durchbrochene Holzplatte von der anderen Seite des Beichtstuhls. Im Halbdunkel, das dort herrschte, sah er faltige Gesichtshaut und das Glas einer Sonnenbrille. Mehr nicht.
„Was führt dich vor das Angesicht des HERRN, mein Sohn?“
„Meine Sünden, Vater.“ Die Stimme klang rau. Der Mann im anderen Teil des Beichtstuhls konnte nicht mehr ganz jung sein. „Ich habe getötet.“
Pater Paul Stahl erschrak. Nicht übermäßig, denn er war es gewohnt, abgründige Geschichten zu hören, wenn er seinen Priesterdienst im Beichtstuhl versah. Aber doch so sehr erschrocken, dass er sich aufs Neue sammeln musste, bevor er fortfahren konnte. Immerhin war es erst acht Uhr morgens, und die Glocken der Grace Church läuteten eben die Morgenmesse aus. Die arme Seele auf der anderen Seite der Trennwand war sein erstes Beichtkind an diesem Tag.
„Erleichtere dein Herz vor dem Allmächtigen und Dreieinigen, mein Sohn, sprich.“
„Heilige Jungfrau ...“ Der Mann jenseits der Trennwand seufzte. „Mein Herz erleichtern ...“ Pater Paul Stahl glaubte, die arme Seele würde jeden Moment in Tränen ausbrechen. „Wenn Sie wüssten, Pater, was mein Herz alles zu tragen hat. Es ist schon ganz mürbe von all der Last.“
„Sprich einfach.“
„Meine Söhne, meine armen Söhne ...“ Der Satz ging in unterdrücktem Schluchzen unter. Jetzt weinte der Fremde jenseits der Trennwand tatsächlich.
„Was ist mit deinen Söhnen.“
„Der Jüngste ist tot, erschossen. Der zweite liegt mit zerschossener Wirbelsäule in einem Gefängnishospital an der Westküste. Und der dritte sitzt im Gefängnis, genau wie mein Bruder.“
„Wen Gott liebt, den straft und züchtigt er“, sagte Pater Paul. „Bete für deine Söhne und für deinen Bruder.“
Was für eine unglückselige Familie, dachte er. Und er fragte sich, ob das anfängliche Bekenntnis getötet zu haben, sich vielleicht auf den jüngsten Sohn des Mannes bezog; oder ob der arme Kerl damit nur sein Schuldgefühl am Schicksal seiner Angehörigen umschreiben wollte. Dieser Gedanke erleichterte Pater Paul ein wenig. Fast begierig verfolgte er ihn weiter.
„Du bist nicht verantwortlich für die Taten deiner Söhne und deines Bruder. Jeder von ihnen steht für sich allein vor seinem Gott. Du kannst nur für sie beten.“
„Was glauben Sie, was ich tue, Pater? Tag und Nacht bete ich, ich kann einfach nicht glauben, dass sie so versagt haben. Trotzdem bete ich für sie, damit sie aus dem Gefängnis kommen. Ja, ich bete, dass sie freigesprochen werden. Diese verd ... diese ... ich meine, die Polizei, sie kann mir nicht alles nehmen, nicht auch noch meine Söhne.“
Pater Paul war nicht sicher, ob er alles hundertprozentig verstanden hatte. Auch irritierte ihn der zornige Unterton, der sich in die Stimme des Mannes geschlichen hatte.
„Lass uns nicht von anderen sprechen“, sagte er. „Du stehst jetzt vor Gott, du willst deine Schuld bekennen. Vor Gottes Angesicht höre ich dir zu. Bekenne deine Sünden. Was heißt das – ich habe getötet?“ Die Vorstellung, der Mann auf der anderen Seite der Trennwand könnte sein anfängliches Bekenntnis doch buchstäblich gemeint haben, machte den Jesuitenpater beklommen.
„Nun ja, nicht direkt getötet“, flüsterte der Mann, und Pater Paul atmete auf. „Aber andererseits wieder doch, ich habe durch Worte getötet, ich habe anderen den Befehl zum Töten gegeben. Glauben Sie, Gott wird mir verzeihen?“
„Wenn du bekennst und bereust, mein Sohn, dann wird er verzeihen. Warst du Soldat? Hast du als Offizier den Befehl zu töten gegeben?“ Auch mit derartigen Schuldbekenntnissen wurde Pater Paul hin und wieder konfrontiert.
„Meinen Sie, Gott würde meinen Söhnen beistehen, wenn ich ihm meine Sünden bekenne und sie bereue?“
„Lass uns nicht von anderen sprechen. Vor Gott steht jeder allein mit ...“
„Sie haben mein Lebenswerk zerstört, Pater, sie haben mir alles genommen, wirklich alles. Ist es auch eine Sünde, zu hassen?“
„Natürlich. Wer hat dein Lebenswerk zerstört, mein Sohn?“ Allmählich beschlich den Pater der Eindruck, nicht als Priester, sondern als Psychotherapeut gefragt zu sein.
„Ich hasse sie. Ja, ich bekenne: Ich hasse die Männer, die meine Söhne ins Gefängnis gebracht haben. Und ich kann nicht versprechen, dass ich nicht wieder töten werde.“
Pater Paul Stahl erschauerte. Meinte der Mann ernst, was er da sagte? Oder war er einfach nur verrückt?
„Bitterkeit und Hass haben dich in ihr Netz verstrickt, mein Sohn.“ Er räusperte sich. Nein, entschied er schließlich, dieses Gespräch gehörte nicht in einen Beichtstuhl. „Mir scheint, Sie bräuchten einen fachkundigen Gesprächspartner“, sagte er förmlich. „Kommen Sie in meine seelsorgerliche Sprechstunde. Ich gebe Ihnen meine Nummer, damit wir einen Termin ...“
„Beten Sie für mich, Pater“, unterbrach ihn der Fremde. „Beten Sie für mich und meine Söhne.“
Pater Paul schwieg. Was tun? Der Mann jenseits der Trennwand brauchte andere Hilfe als nur ein Gebet, das schien ihm ganz offensichtlich.
„Jetzt, Pater“, beharrte die raue Stimme. „Beten Sie jetzt für mich und meine Söhne.“
„Gut.“ Wieder räusperte sich der Pater. Er lehnte den Kopf gegen die Rückwand des Beichtstuhls, faltete die Hände und schloss die Augen. „Lass uns beten. Allmächtiger Gott, ich lege dir die Not dieses Bruders zu Füßen ...“
Ungefähr drei Minuten betete er für den Mann jenseits der Trennwand, für seine Söhne – auch für den toten – für seinen Bruder, und für die Menschen, die ihm seiner Ansicht nach Unrecht getan hatten. Irgendwann sagte er „Amen“ und lauschte. Doch er wartete vergeblich auf das „Amen“ des Verbitterten. Pater Paul Stahl spähte durch die Löcher der Trennscheibe. Niemand zu sehen. Er saß allein im Beichtstuhl.
Er drückte die Tür auf und beugte sich heraus. Es roch nach Hund. Die Grace Church war menschenleer. Ein Flügel ihres Eingangsportals schloss sich langsam.
2
„In drei Tagen ist es so weit.“ Jonathan McKee setzte sich zu uns an den Konferenztisch. Er breitete die „New York Post‟ zwischen seinen Fäusten aus und präsentierte uns die Schlagzeile des Tages: „Dr. Richard Donovan zum Vorsitzenden Richter im Belucci-Prozess bestellt. Prozessbeginn am kommenden Montag‟
„Ich habe gestern mit Mr. Donovan telefoniert. Es war nicht einfach, zwölf Geschworene zu finden. Viele Leute, die in Frage gekommen wären, wollten nichts mit diesem Prozess zu tun haben.“
„Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass der alte Belucci eine Todesliste führt“, sagte ich. Ich musste es wissen: Milo und ich standen auf dieser Liste. Schon zweimal hatte der Belucci-Clan versucht, uns das Lebenslicht auszublasen.
„Warum spricht sich nicht herum, dass er inzwischen ganz allein steht?“ Clive Caravaggio schnitt eine grimmige Miene. „So was macht mich zornig! Wo kommen wir hin, wenn Leute ihre öffentlichen Pflichten nicht mehr wahrnehmen wollen, weil sie sich von einem Verbrecher einschüchtern lassen?!“
„Tja, Gentlemen“, Jonathan McKee zuckte mit den Schultern, „die Legende vom unbesiegbaren Verbrecher wird eher geglaubt und in den Medien gepflegt als die Wirklichkeit. Wir von der Bundespolizei haben die kriminelle Organisation eines alten Mannes zerschlagen; wir von der Bundespolizei jagen diesen alten Mann überall in den Vereinigten Staaten; und der alte Mann muss sich vor uns verkriechen. Aber lässt sich daraus eine Geschichte machen? Eine Geschichte, die Einschaltquoten und Auflagen in die Höhe treibt?“ Unser Chef schüttelte den Kopf. Sein bitteres Lächeln überraschte mich. Jonathan McKee neigte normalerweise nicht zu Sarkasmus. „Solche Geschichten interessieren die Medien und die unterhaltungssüchtige Öffentlichkeit nicht besonders. So ist das leider.“
Widerwille beschlich mich. Belucci – schon wieder dieser Name! Wie lange beschäftigen der Mann und seine Räuberbande uns nun bereits? Ich wusste es schon nicht mehr. Belucci und Schutzgelderpressung, Belucci und Prostitution, Belucci und Drogenhandel, Belucci und eine lange Blutspur. Und nun: Belucci und der Prozess gegen die Köpfe seines Syndikats; gegen seinen Bruder und seine beiden Söhne. Ehrlich gesagt, ich hatte genug von diesem Fall.
„Stimmt schon“, sagte Milo. „Er steht allein, der Mann. Nach unserer Kenntnis jedenfalls. Aber ich trau ihm jede Teufelei zu.“
„Ich auch“, brummte Jay Kronburg. „Der Kerl hat sich genug Kohle zusammen geraubt, um jederzeit eine neue Killertruppe auf die Beine zu stellen. Und wenn ihr mich fragt: Genau das wird er tun.“
„Verlassen wir uns drauf!“, bekräftigte Milo. „Ich wundere mich, dass er uns noch keine Schweinerei serviert hat.“
„Ich hab da meine Zweifel“, sagte Zeerokah. „Dazu müsste er sich aus der Deckung wagen. Viel zu gefährlich für ihn. In jedem Bundesstaat wird nach ihm gefahndet. Und nicht zu vergessen die fünfhunderttausend Dollar, die auf seinen Kopf ausgesetzt sind. Leicht zu verdienendes Geld. Wenn er in der Unterwelt auftaucht, um Leute anzuheuern, ist er geliefert.“
„Mag sein“, sagte ich. „Mag sein, dass alle seine Leute tot sind oder hinter Gitter sitzen. Mag sein, dass seine beiden Söhne und sein Bruder in absehbarer Zeit lebenslänglich bekommen oder sogar auf den elektrischen Stuhl geschickt werden. Mag auch sein, dass er sich irgendwo auf der anderen Seite des Globus verkrochen hat. Aber eins steht für mich fest: Ein Mann wie Bronco Belucci gibt niemals auf.“
Die weißen Brauen des Chefs wanderten zusehends Richtung Stirn, während er unsere Diskussion verfolgte. „Verstehen Sie mich nicht falsch, Gentlemen.“ Er hob die zusammengerollte Zeitung wie einen verlängerten Zeigefinger. „Wenn ich von dem alten Mann und dessen zerschlagenem Syndikat spreche, will ich damit nicht sagen, dass ich den Indio inzwischen für ungefährlich halte. Im Gegenteil: Ein angeschossenes Raubtier ist gefährlich, lebensgefährlich. Vielleicht müssen wir uns Belucci nicht gerade als gebrochenen Mann vorstellen, aber doch als einen schwer verwundeten Mann. Ich meine das im übertragenen Sinn: Wir haben ihm praktisch alles genommen: Seine Organisation, seine Familie, seine Geschäftsbasis.“
Das war nicht übertrieben. Unser Chef übertreibt nie. Ich musste an die erste Begegnung mit dem Belucci-Clan denken. Hier bei uns in Manhattan war das gewesen, schon ein Weilchen her. Bronco Belucci – oder der Indio, wie er in Kreisen der Unterwelt genannt wurde – versuchte die finsteren Machenschaften seines Syndikats auf den Big Apple auszudehnen. Wir hatten ihm damals einen Strich durch die Rechnung gemacht, und sein jüngster Sohn Rosco wurde von einem seiner Opfer erschossen.
In Las Vegas legten wir Wochen später Beluccis ältestem Sohn Tibor das Handwerk, und ein paar Monate danach gelang es uns, das Syndikat in Cleveland zu zerschlagen und seinen Kopf, Rico Belucci zu verhaften.
Der vierte Akt der blutigen Tragödie lag noch gar nicht so lang zurück: Zeerokah hatte sich undercover in die kriminelle Organisation des zweiten Belucci-Sohns Roman in San Diego eingeschlichen. Milo und ich reisten nach San Diego. Zusammen mit den Kollegen dort hielten wir den Kontakt mit Orry. Fast wären wir zu spät gekommen: Die beiden verbliebenen Beluccis begannen gerade, ihr Personal zu beseitigen. Sie wussten, dass wir ihnen auf den Fersen waren und wollten San Diego aufgeben, ohne Spuren und Zeugen zu hinterlassen. Um ein Haar hätte es auch Orry erwischt.
„Denken Sie daran, wie er seine eigenen Leute in San Diego beseitigen wollte“, fuhr Jonathan McKee fort. „Nur, um potentielle Zeugen zum Schweigen zu bringen. Oder wie er aus seinen gewohnten Geschäften ausgestiegen ist, um mit Plutonium zu handeln.“ Der ausgestreckte Zeigefinger des Chefs deutete auf niemand Bestimmten. „Nein, unterschätzen wir den Indio nicht. Er hat alles getan, um seine Spuren zu verwischen, und er wird alles tun, um seine Söhne vor dem elektrischen Stuhl zu retten.“
„Ich würde mich nicht einmal wundern, wenn er sich schon in der Stadt aufhielte.“ Damit sprach ich meine geheimsten Befürchtungen aus.
Für Sekunden wurde es still um den Konferenztisch. Die meisten Kollegen musterten mich mit hochgezogenen Brauen, der Chef ziemlich ernst, und Clive mit einem müden Lächeln.
3
Herbert Ramsay goss sich einen doppelten Whisky ein, schraubte die Flasche zu, und legte sie zurück in das Schreibtischfach, in dem er die Briefbögen seiner Anwaltskanzlei aufbewahrte. Und, unter dem Stapel versteckt, seine Pornomagazine.
Er schob die Schublade zu, legte die Beine auf den Schreibtisch, und nippte an seinem Whisky. Danach zündete er sich eine Benson & Hedges an. Missmutig betrachtete er abwechselnd die verwahrlosten Fassaden der Bronxdale Avenue vor seinem Fenster und die Rechnungen, die sich im Posteingangskorb neben seinem Monitor stapelten.
Die Uhr über der Bürotür stand auf viertel nach zwei, die auf der Taskleiste des Monitors 10.19 Uhr. Die Uhr des Computers ging exakt. 10.19 Uhr, und schon der zweite Klient an diesem Vormittag hatte abgesagt; 10.19 Uhr, und Herbert Ramsay verabreichte sich seinen zweiten Whisky an diesem Tag. Den zweiten von durchschnittlich siebenundzwanzig an normalen Arbeitstagen.
Er schnippte die Asche in den Kübel des Gummibaums, der hinter seinem Schreibtischsessel stand. Die Pflanze füllte die Wand zwischen den beiden Fenstern aus. Viele ihrer Blätter hatten einen Gelbstich oder waren schon vollständig vergilbt. Ein Sonnenstrahl, der sich von der Bronxdale Avenue in sein Büro verirrte, enthüllte die Staubschicht auf einigen grünen Blättern.
„Wasser“, dachte Ramsay. „Er braucht Wasser. Warum muss man sich immer selbst um alles kümmern?“ Sein Blick streifte die verdammten Rechnungen, als er sich zum Telefon beugte. Er wollte Cindy auffordern, in der Mittagspause den Gummibaum zu gießen.
Cindy Dorham, seine Sekretärin seit siebzehn Jahren, war nach Ramsays Meinung nicht ganz unschuldig am Niedergang seiner Kanzlei. Vielleicht trug sie sogar die Hauptverantwortung dafür, diese alte Zicke.
Er drückte die Nummer des Vorzimmers, und fast im selben Moment hörte er Cindys Stimme. Ramsay konnte sich nicht erinnern, dass sie jemals so schnell am Apparat gewesen war.
„Ich wollte Sie gerade anrufen, Mr. Ramsay“, krähte sie mit ihrer von Tabak und Alkohol ruinierter Stimme. „Ein Klient hat eben geklingelt. Ich höre schon seine Schritte draußen im Treppenhaus.“
„Oh!“, sagte Ramsay. „Er soll einen Augenblick warten. Ich telefoniere gerade mit dem Bezirksgericht.“
„In Ordnung, Sir.“
„Und in der Mittagspause denken Sie bitte daran, den Gummibaum zu gießen.“
„In Ordnung, Sir.“
Ramsay legte auf. Er blies den Rauch gegen den ausgeschalteten Monitor und fragte sich, welcher Sozialhilfeempfänger jetzt schon wieder seine Dienste zum Freundschaftspreis in Anspruch nehmen wollte. Wahrscheinlich irgendein Strafentlassener, der ihm vor hundert Jahren mal einen Gefallen getan hatte.
Herbert Ramsay misstraute jedem, der den Weg in seine Kanzlei fand. Und er misstraute auch den kleinsten Anzeichen auf Besserung seiner wirtschaftlichen Lage. Mit anderen Worten: Ramsay war Pessimist.
Möglicherweise hatte er den Pessimismus schon mit der Muttermilch aufgesogen, oder mit den Genen seiner Vorfahren in diese fragwürdige Welt getragen. Wahrscheinlicher aber war, dass sein Pessimismus mit der Entwicklung seiner Anwaltskanzlei zusammenhing: Vor zwölf Jahren beschäftigte die Sozietät Ramsay & Partner noch sechs Anwälte und acht Sekretärinnen. Seit anderthalb Jahren bestritten Cindy Dorham und Herbert Ramsay die Kanzlei zu zweit. Und sie waren nicht gerade überfordert.
Im Vorzimmer knarrte die Eingangstür. Ramsay hörte Cindys Stimme einen frostigen Gruß ausstoßen. Danach eine fremde Männerstimme. Ramsay drückte die Zigarette aus und stemmte sich ächzend aus seinem Sessel.
Er schob das Fenster hoch und ließ Ascher und Glas in seinem Schreibtisch verschwinden. Vor dem Spiegel über dem Waschbecken knotete er seine Krawatte und zog den Scheitel in seinem schütteren, fettigen Grauhaar nach.
Herbert Ramsay war ein mittelgroßer Mann von ungefähr dreiundfünfzig Jahren. Sein rundes, aufgequollenes Gesicht wirkte teigig und ungesund, was die Hautfarbe betraf – ähnlich wie einige Blätter seines Gummibaums wies sie einen fahlen Gelbstich auf. Davon abgesehen handelte es sich eigentlich ein Allerweltsgesicht.
Überhaupt wäre Herbert Ramsay alles in allem eine unauffällige Erscheinung gewesen – wenn er nicht gut zweihundertfünfzig Pfund Körpergewicht mit sich herumgeschleppt hätte.
Er ging zum Schreibtisch und wählte die Nummer des Vorzimmers. „Ich bin dann soweit, schicken Sie den Mann herein, Cindy.“
„In Ordnung, Sir.“
Er saß noch nicht in seinem Sessel, da öffnete sich bereits die Tür. Ein deutscher Schäferhund drängte sich zwischen Rahmen und Türblatt in den Raum. Das Lederband seines Geschirrs straffte sich, als das Tier seinen Herrn aus dem Vorzimmer zog.
Ramsay sah erst einen weißen Stock, und dann einen hageren, eher zu kurz geratenen Mann in Tennisschuhen und einem grauen Anzug. Ein Blinder, gut zehn Jahre älter als Ramsay selbst. Er trug eine dunkle Sonnenbrille und eine schwarze Baseballkappe.
„Platz, Hoover“, sagte der Blinde, und die Stimme ließ Ramsay augenblicklich aufhorchen; es gibt Stimmen, die hört man einmal und vergisst sie nie wieder.
Der Hund ließ sich vor Ramsays Schreibtisch nieder. Mit einer Zielstrebigkeit, die Ramsay verwirrte, zog der Blinde sich einen Stuhl heran und nahm Platz. „Nett, dich mal wieder zu sehen, Herbie.“ Er nahm die Sonnenbrille ab und sah sich um. „Du hast schon bessere Zeiten erlebt, will mir scheinen.“
Erkennen dämmerte in Ramsay auf, sein Atem beschleunigte sich, und sein verfettetes Herz kam ins Stolpern. Er versank gleichsam in seinem Sessel.
Mit einer erschöpften Handbewegung streifte der Blinde sich die Baseballkappe vom Kopf. Weißes Haar wurde sichtbar, ein dünner Zopf fiel auf seine Schulter. „Nun, dann haben wir ja etwas gemeinsam. Meine Geschäfte liefen auch schon besser.“ Er lächelte müde. Tiefe Falten verliehen seinem Gesicht etwas Verwittertes und Würdevolles zugleich.
„Mr. Belucci!“, flüsterte Ramsay. „Sir ...“
Was hatte er neulich gelesen? Fünfhunderttausend Dollar Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung dieses Mannes führten?
„Tja, Herbie – wie sagte mein sizilianischer Großvater immer? Das Leben ist eines der Seltsamsten.“ Beluccis Stimme klang knorrig und matt. „Sie haben mir übel mitgespielt, wirst davon gehört haben.“
„Der Prozess gegen Ihre Söhne. In drei Tagen!“
„Es gab Zeiten, da haben wir uns mit Vornamen angesprochen. Lass uns daran anknüpfen, Herbie.“ Belucci schnupperte, warf einen Blick auf das offene Fenster, und zog dann einen Zigarillo aus der Brusttasche des Sakkos. „Hier riecht’s, als dürfte man.“ Herbert Ramsay beugte sich über den Schreibtisch und gab ihm Feuer.
„Du weißt, dass die Bundespolizei meine Firma zerschlagen hat; ich weiß, dass deine Firma auf den Hund gekommen ist.“ Er saugte an seinem Zigarillo und blies den Rauch an Ramsay vorbei gegen den Gummibaum. Wie Nebelschwaden waberte er durch das Geäst.
„Du weißt, dass die Feds hinter dem Indio her sind; ich weiß, dass zwei Dutzend Gläubiger hinter Herbert Ramsay her sind. Also reden wir nicht um den heißen Brei herum. Willst du für mich arbeiten?“
Bronco Belucci griff in die Innentasche seines Sakkos und zog einen Scheck heraus. „Ich biete dir achthunderttausend. Das sind dreihunderttausend mehr als das Kopfgeld.“ Sein kantiges Gesicht verzog sich zu einem spöttischen Lächeln. „Nimm diese Fünfhunderttausend als Anzahlung.“
Ramsays Hand langte nach dem Scheck. „Fünfhunderttausend!?!“ Ungläubig betrachtete er das Stück Papier. Seine Hände begannen zu zittern, Schweißperlen erschienen auf seiner Stirn.
Mit der Linken griff er unter sich und stellte den Whisky auf den Schreibtisch, und nach der Flasche zwei Gläser. Routinierte Griffe waren das, auch wenn die Zeiten, in denen Ramsay nicht allein trinken musste, längst vorbei waren.
Er schenkte ein, sie stießen an und tranken. Herbert Ramsay steckte sich eine Zigarette an. „Was kann ich für dich tun, Bronco?“
„So allerhand.“ Noch einmal verschwand Beluccis Hand in seiner Jacke. Diesmal zog sie ein großes, zusammengerolltes Kuvert heraus. „Als erstes muss dieser Umschlag zu seinem Empfänger. Du weißt, worauf man in unseren Kreisen bei solchen Gelegenheiten achten muss.“
Ramsay nahm das Kuvert und betrachtete es. „Dr. Richard Donovan“, las er murmelnd. „Was willst du erreichen, Bronco?“
„Der Prozess muss sich hinziehen. Rico und meine Söhne sollen möglichst lange im Untersuchungsgefängnis in der Centre Street bleiben. Von dort kann ich sie mit einer schlagkräftigen Truppe heraushauen. Aus Rikers Island nicht.“
„Es kostet Zeit und Geld, eine schlagkräftige Truppe aufzubauen, Bronco.“ Aus seinen kleinen, glitzernden Augen belauerte Ramsay den Indio.
„Richtig. Und Geld ist nicht das Problem. Außerdem suche ich jemanden, der mit den Anwälten meiner Söhne und meines Bruders Kontakt aufnimmt. Und dann würde ich mir gern deine Klientenkartei ansehen. Wie gesagt: Ich brauche ein paar gute Leute.“
4
„Belucci in der Stadt“, seufzte Orry. „Deute das einem Reporter von der New York Post an, dann sind die Schlagzeilen für die nächsten Tage gesichert.“
„Jetzt übertreibst du“, sagte Clive. „Seine Söhne mögen ihm wichtig sein, noch wichtiger ist ihm seine eigene Freiheit.“
„Das klingt unwahrscheinlich.“ Der Chef ergriff wieder das Wort. „Vielleicht ist es sogar unwahrscheinlich. Wir sollten dennoch von dieser Theorie ausgehen. Ich will mir keine Vorwürfe machen müssen, wenn vor und während des Prozesses Dinge geschehen, die wir durch einfache Sicherheitsmaßnahmen hätten verhindern können.“
„Also gut.“ Clive lehnte sich zurück. „Das schriftliche Belastungsmaterial halte ich nicht für gefährdet. Es liegt in mehreren Kopien bei uns, beim Bundesgericht und bei den Staatsanwaltschaften von Ohio und Kalifornien.“
Das Material, von dem Clive sprach, bestand im Wesentlichen aus einem umfangreichen Geständnis eines Aussteigers und aus den akkuraten Aufzeichnungen einer Autorin, die Orry in San Diego getroffen hatte. Genau wie er selbst arbeitete die Frau undercover für Roman Belucci. Allerdings nicht im Auftrag der Polizei, sondern in eigener Sache: Sie recherchierte für ein Buch. Ihr eigener Mann hatte sie erschossen. Aber das ist eine andere Geschichte.
„Richtig.“ Jonathan McKee stand auf. „Das Belastungsmaterial ist sicher. Im Wesentlichen geht es jetzt um drei Aufgaben.“ Der Chef ging zu einem Flipchart, dass er vor dem Konferenztisch aufgestellt hatte. Er schrieb mit einem schwarzen Edding. „Erstens. Organisation des Transportes von Rikers Island ins Criminal Courts Building.“
Der Prozess gegen die drei Beluccis sollte aus Sicherheitsgründen zu später Abendstunde stattfinden. Im Criminal Courts Building wird in der Regel zwischen fünf Uhr nachmittags und ein Uhr nachts verhandelt. Außerdem ist das Gebäude über eine Brücke mit dem Untersuchungsgefängnis auf der anderen Seite der Centre Street verbunden. Dort sollten die Beluccis für die Dauer des Prozesses untergebracht werden.
„Dazu gehört auch der Transport Roman Beluccis vom La Guardia Flughafen zum Gerichtsgebäude.“
Roman Belucci – in einschlägigen Kreisen nannte man ihn „Baba“ – war querschnittsgelähmt. Eine Kugel Orrys hatte ihn schwer verletzt. Er war erst seit kurzem transportfähig und sollte in den nächsten Tagen von San Diego nach New York City verlegt werden.
„Beide Transporte müssen unter den Kriterien der Sicherheitsstufe Eins organisiert werden. Vielleicht übernehmen Sie das, Jay und Leslie.“ Jonathan McKee wandte sich wieder zum Flipchart. „Zweitens: Personenschutz für George Forster. Jetzt, kurz vor dem Prozessbeginn, steigt sein Risiko ganz erheblich. Ebenfalls Sicherheitsstufe Eins. Nehmen Sie das bitte in die Hand, Clive und Zeerokah.“
George Forster hatte in Las Vegas eine Spielbank für Tibor Belucci geleitet. Und seine schmutzigen Geschäfte mehr als nur unterstützt. Der Manhattaner Bundesrichter und der Staatsanwalt hatten ihm eine neue Identität angeboten, wenn er als Kronzeuge gegen den Belucci-Clan aussagen würde. Ein Killerkommando des Indios hatte den Helikopter abgeschossen, der ihn aus dem Gefängnis abholte. Forster überlebte schwer verletzt. Er wartete in einem Sanatorium in Brooklyn auf den Prozess.
„Und drittens: Personenschutz für Richard Donovan. Das wüsste ich gern in Ihrer Verantwortung, Milo und Jesse.“
„Hat der Richter um Personenschutz gebeten?“ Milo war nicht der einzige, der sich wunderte.
„Ja“, sagte der Chef. „Aber nicht aus eigener Initiative. Dr. Donovan ist kein Mann, der sich vor irgendjemandem fürchtet. Aber seine Frau hat kein besonders stabiles Nervenkostüm. Sie hat versucht, ihren Mann dazu zu überreden, die Leitung des Prozesses abzulehnen. Kein Thema für Donovan. Jetzt verlangt sie wenigstens Personenschutz.“
„Wie viele Leute haben wir?“, wollte ich wissen.
„Das NYCPD hat vier Beamte für diese Aufgabe freigestellt. Sehen Sie selbst, wie viele Agenten von uns Sie noch brauchen.“
„Also gut.“ Jay klatschte in die Hände und rieb die Handflächen gegeneinander. „Eine Menge Arbeit. Packen wir sie an.“
„Und hoffen wir, das wir sie uns nur um eines Phantoms Willen aufhalsen“, sagte Milo.
5
Richard Donovan steuerte seinen schwarzen Volvo V 70 bis vor den Haupteingang des Hunter College. Er stieg aus und öffnete die hintere Tür auf der Fahrerseite. „Raus mit dir, Prinzessin.“
Ein kleines Mädchen schob sich aus dem Fahrzeug – blonde Zöpfe mit roten Zopfbändern, weißes Kleidchen, weiße Socken, rote Lackschuhe mit weißen Schnallen: Dr. Donovans sechsjährige Tochter. Sie zog einen Geigenkasten hinter sich her, halb so lang wie sie selbst.
Donovan ging vor ihr in die Hocke. „Viel Spaß, Prinzessin.“
Sie lachten sich eine Weile an. „Heute üben wir wieder We shall overcome“, sagte Prinzessin – mit bürgerlichem Namen hieß sie Sheila – und drückte ihren Geigenkasten an sich. „Ich freue mich schon.“
„Dann freue ich mich auch.“ Donovan umarmte seine Tochter und drückte sie an sich. Er persönlich hätte lieber gehört, wenn sie ihm erzählt hätte, sie würde „God bless America‟ üben, oder von ihm aus auch „John Brown’s Body‟. Aber Nancy Turner, Sheilas Geigenlehrerin, hatte da ihren eigenen Geschmack. Nun gut – Hauptsache das Kind verlor nicht den Spaß an seinem Instrument.
Er ließ sie los, und sie rannte die Treppe zum College-Eingang hinauf. Dort drehte sie sich noch einmal um und winkte. Himmel! Wie sehr sie ihrer Mutter glich!
„Miss Turner bringt dich dann nach Hause!“, rief Donovan. Das tat Nancy Turner hin und wieder. Und heute war es Donovan Recht: Kim, seine Frau, besuchte ihre Eltern in Florida, und das Kindermädchen hatte frei.
Er wartete, bis seine Prinzessin hinter der dunklen Glastür verschwunden war, danach setzte er sich wieder hinter das Steuer seines Volvos und fuhr die 68. Richtung Lexington Avenue hinunter.
Um sechzehn Uhr wollte er hinter seinem Schreibtisch im fünfundzwanzigsten Stockwerk des United States Courthouse sitzen. Die erste Verhandlung würde er um 18.30 Uhr im Criminal Courts Building leiten. Und danach ging es bis ein Uhr nachts wie am Fließband. Glücklicherweise war Freitag, und das Wochenende stand vor der Tür.
Dr. Richard Donovan schätzte die nächtlichen Verhandlungen nicht besonders. Glücklicherweise konnte er als leitender Richter des Bundesgerichts inzwischen viele dieser Prozesse an seine Untergebenen delegieren.
An das, was nach dem Wochenende, am Montag, auf seinem Programm stand, mochte der Richter lieber nicht denken. Die Vorbereitungen auf den Belucci-Prozess hatten ihm manche schlaflose Stunde bereitet. Er bog nach rechts in die Lexington Avenue ab. Der silbergraue Honda Civic, fünf Fahrzeuge hinter ihm, fiel ihm nicht auf.
Er dachte an Prinzessin, und sein Herz wurde warm. Er liebte das Mädchen mehr, als alles andere auf der Welt, sich selbst eingeschlossen. Ein Kind seines zweiten Lebensfrühlings gewissermaßen – Ende vierzig war er gewesen, als Sheila geboren wurde. Donovan hatte noch zwei, schon erwachsene, Söhne von seiner ersten Frau. Deren Tod lag schon über anderthalb Jahrzehnte zurück.
Der Verkehr kam ins Stocken, Donovan ging vom Gas. Die Ampel an der Kreuzung zur Sechzigsten sprang auf Rot. Der silbergraue Honda Civic – jetzt nur noch zwei Wagen hinter Donovan – wechselte auf die linke Fahrspur, und schob sich in der zweiten Reihe an Donovans Volvo heran. Der Bundesrichter hatte keinen Grund, das Fahrzeug auffälliger zu finden als Hunderte andere um ihn herum.
Der Verkehr stoppte, Donovan zog die Handbremse an. We shall overcome, dachte er, wäre eigentlich ein guter Choral für Autofahrer im Stau.
Verschiedene Demonstrationen, die er miterleben musste – als Adressat miterleben musste, nicht als Demonstrant natürlich – gingen ihm durch den Kopf. Und ein paar Gesichter von Leuten, die er wegen Landfriedensbruch und Störung der öffentlichen Ordnung verurteilt hatte. Kriegsgegner, Gegner der amerikanischen Umweltpolitik, Globalisierungsgegner – lauter Gegner von irgendwas eben. Donovan, dem überzeugten Republikaner, war diese ganze Friedensmasche zutiefst suspekt.
Im Geist sah er Nancy Turner, die junge Geigenlehrerin seiner Prinzessin vor sich. Vermutlich gehörte sie in die gleiche Ecke. Was sollte er tun – das Mädchen mochte sie.
Jemand hupte. Die Ampel stand längst wieder auf grün, aber es ging nicht voran. Wieder hupte es. Donovan sah nach links: Der silbergraue Honda Civic stand neben ihm auf dem linken Fahrstreifen. Jetzt konnte Donovan gar nicht mehr anders, als den Wagen auffällig zu finden. Erstens fuhr er nicht weiter, obwohl der Stau auf seinem Fahrstreifen sich längst auflöste, und zweitens fuchtelte der Fahrer mit einem Kuvert herum.
Das Fenster auf der Beifahrerseite des Hondas senkte sich. Donovan begriff, dass der Fahrer etwas von ihm wollte. Also drückte er einen Knopf in der Mittelkonsole – sein Seitenfenster versank in der Tür. Der Hondafahrer beugte sich weit über einen Beifahrersitz, streckte Arm und Hand mit dem zusammengerollten Kuvert heraus und warf es Donovan zielsicher an den Kopf.
„Hey!“ Donovan öffnete sein Gurtschloss. „Erlauben Sie mal!“
Der Honda fuhr mit quietschenden Reifen an. Mit einer scharfen Linkskurve überquerte er den Mittelstreifen und fädelte sich in den lange nicht so dichten Gegenverkehr ein. Donovan sprang aus dem Volvo. Er konnte nicht einmal mehr das Kennzeichen des rätselhaften Postboten entziffern.
Wieder ein Hupkonzert – die Fahrzeuge hinter ihm schlugen ihm lautstark vor, endlich weiter zu fahren. Zurück im Wagen warf er einen Blick auf das Kuvert. B.B. stand handschriftlich an der Stelle, an der sonst der Absender zu lesen ist. Initialen, mit denen der Richter nichts anfangen konnte. Ein einziger Gedanke füllte sein Gehirn aus: Anthrax!
6
Der Wind blies vom Atlantik her landeinwärts und trug den Verkehrslärm vom Belt Parkway zum Sanatorium herauf. Die Luft war selten klar an diesem Nachmittag. So klar, das George Forster die vielen Menschen am fast zwei Meilen entfernten Strand der Gravesend Bay von Sand und Büschen unterscheiden konnte.
Er hatte seinen Rollstuhl aus dem Speisesaal des Sanatoriums auf die Terrasse gerollt. Der Wind zerwühlte seine grauen Locken. Seine düsteren Gedanken konnte er nicht wegwehen.
Links, wo er ein Stück Straße hinter der Gartenanlage sehen konnte, rollte ein grauer Mercury heran und verschwand in der Einfahrt zum Sanatoriumsparkplatz. Besuch; und zwar Besuch für ihn. George hatte inzwischen einen Riecher für offizielle Fahrzeuge. Vielleicht wurden seine Beschützer abgelöst.
Er wusste schon nicht mehr, wie viele Wochen es her war, dass ihn ein Van des FBI hierher gebracht hatte. Das lag nicht allein an der Anzahl der Wochen, es lag auch an seinem Hirn – seit jenem Katastrophentag tat es sich schwer mit Zahlen. Und nicht nur mit Zahlen.
Ein Killer des alten Belucci hatte den Helikopter angegriffen, der ihn zum Bundesgericht hätte bringen sollen. Und als er nach dem Absturz, von einer Schwimmweste gehalten, im East River trieb, war er dem Rennboot und der Waffe des Killers hilflos ausgeliefert.
George Forster überlebte. Und empfand sein Leben als tägliche Strafe: Nach dem Schädelbasisbruch haperte es mit den einfachsten Rechenaufgaben; und mit seinem Kurzzeitgedächtnis. Anfangs sogar mit der Wortfindung, aber das hatten sie hier im Sanatorium wieder einigermaßen hingekriegt.
Der Angriff hatte ihn darüber hinaus das rechte Bein gekostet. Und das linke konnte er nicht mehr gebrauchen. Eine Maschinengewehrsalve hatte ihm die Wirbelsäule im Lendenbereich zertrümmert. Von der Hüfte abwärts war George Forster gelähmt. Fast jeden Tag wünschte er sich den Tod.