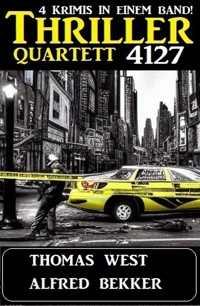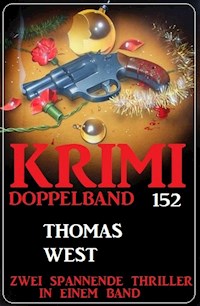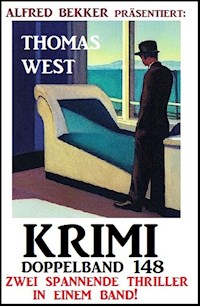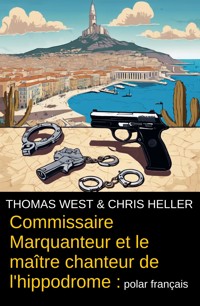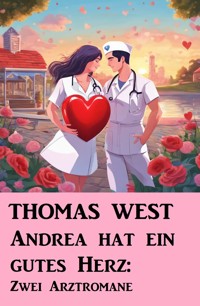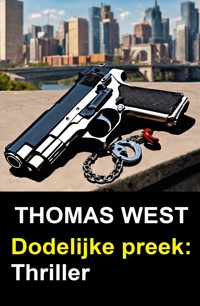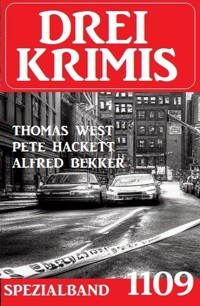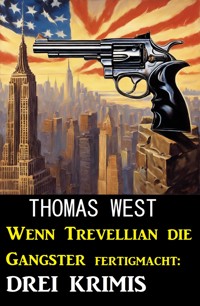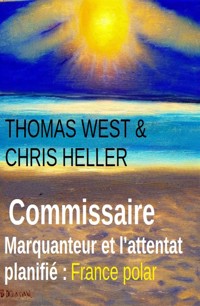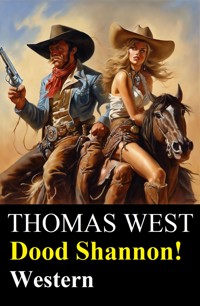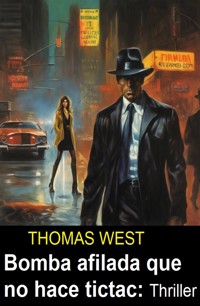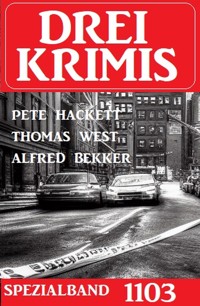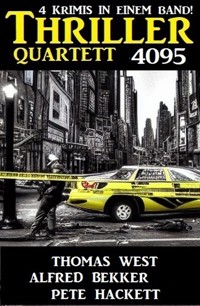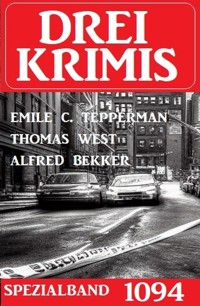
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Die zur Hölle fahren (Thomas West) Mörderlotterie für G-men (Emile C. Tepperman) Kommissar Jörgensen und der Killer von Altona (Alfred Bekker) Neulich, beim Friseur, blätterte ich in einem Boulevardblatt. War's die New York Post oder waren es die Daily News - ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls las ich von einem Mann, der mit seinem Dodge Pick-up gegen einen Baum gerast war. Irgendwo in Wyoming, in den Rocky Mountains. Nichts Besonderes an sich, oder? Wie viele Leute fahren nicht Tag für Tag gegen irgendwelche Bäume. In Russland, in Deutschland, in den USA, oder sonst wo. Weil ihnen ein Reifen platzt, weil sie zu schnell fahren, weil sie eine Kurve falsch eingeschätzt haben - weiß Gott warum. Der Mann in Wyoming war betrunken gewesen. Sie haben ihn aus dem zertrümmerten Wrack seines Wagens gezogen und zur nächstbesten Intensivstation gebracht. Hatte ihn ziemlich schwer erwischt, aber er hat überlebt. Immerhin. Warum erzähle ich diese banale Geschichte? Nun ja - wegen des Baumes, gegen den der Mann gefahren war. Eine Buche. Und zwar die einzige weit und breit. Auch das an sich nichts Besonders. Einsame Bäume an kurvenreichen Straßen - wer kennt das nicht? Nur - die Buche stand am Rand eines Steilhanges. Hinter ihr ging es in eine tiefe Schlucht. Vierzig Meter tief, wenn ich mich recht erinnere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emile C. Tepperman, Thomas West, Alfred Bekker
Drei Krimis Spezialband 1094
Inhaltsverzeichnis
Drei Krimis Spezialband 1094
Copyright
Die zur Hölle fahren
Mörderlotterie für G-men
Kommissar Jörgensen und der Killer von Altona
Drei Krimis Spezialband 1094
Emile C. Tepperman, Thomas West, Alfred Bekker
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Die zur Hölle fahren (Thomas West)
Mörderlotterie für G-men (Emile C. Tepperman)
Kommissar Jörgensen und der Killer von Altona (Alfred Bekker)
Neulich, beim Friseur, blätterte ich in einem Boulevardblatt. War's die New York Post oder waren es die Daily News - ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls las ich von einem Mann, der mit seinem Dodge Pick-up gegen einen Baum gerast war. Irgendwo in Wyoming, in den Rocky Mountains.
Nichts Besonderes an sich, oder? Wie viele Leute fahren nicht Tag für Tag gegen irgendwelche Bäume. In Russland, in Deutschland, in den USA, oder sonst wo. Weil ihnen ein Reifen platzt, weil sie zu schnell fahren, weil sie eine Kurve falsch eingeschätzt haben - weiß Gott warum.
Der Mann in Wyoming war betrunken gewesen. Sie haben ihn aus dem zertrümmerten Wrack seines Wagens gezogen und zur nächstbesten Intensivstation gebracht. Hatte ihn ziemlich schwer erwischt, aber er hat überlebt. Immerhin.
Warum erzähle ich diese banale Geschichte? Nun ja - wegen des Baumes, gegen den der Mann gefahren war. Eine Buche. Und zwar die einzige weit und breit. Auch das an sich nichts Besonders. Einsame Bäume an kurvenreichen Straßen - wer kennt das nicht? Nur - die Buche stand am Rand eines Steilhanges. Hinter ihr ging es in eine tiefe Schlucht. Vierzig Meter tief, wenn ich mich recht erinnere.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Die zur Hölle fahren
Thomas West
Ein Jesse Trevellian Roman
In der Serie „Jesse Trevellian“ erschienen bislang folgende Titel (ungeachtet ihrer jeweiligen Lieferbarkeit auf allen Portalen):
Alfred Bekker: Killer ohne Namen
Alfred Bekker: Killer ohne Skrupel
Alfred Bekker: Killer ohne Gnade
Alfred Bekker: Killer ohne Reue
Alfred Bekker: Killer in New York (Sammelband)
Thomas West: Rächer ohne Namen
Thomas West: Gangster Rapper
Thomas West: Richter und Rächer
Thomas West: Die zur Hölle fahren
Weitere Titel folgen
Ein CassiopeiaPress E-Book
© Serienrechte „Jesse Trevellian“ by Alfred Bekker
© 2000 des Romans by Author
© 2013 der Digitalausgabe by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Kairo
Sie schwebte förmlich über die kleine Bühne, bog ihren Körper im Rhythmus der Musik, ließ ihre Hüften kreisen, stieß ihren Bauch nach vorn, zog ihn ein, ließ ihn pulsieren, warf ihre schlanken Arme in die Luft und drehte sich um sich selbst - eine Schlange hätte sich nicht geschmeidiger gewunden.
Khaled Bin Assir vergaß sein Bier, vergaß die brennende Zigarette im Aschenbecher vor sich auf dem schwarzen, runden Tischchen, vergaß Raphael neben sich auf der Polsterbank, vergaß die vielen Männer um sich herum in der halbdunklen, verrauchten Bar. Seine Augen klebten an dem tanzenden Frauenkörper, an dem straffen, nackten Fleisch zwischen dem roten Oberteil und dem roten Seidentuch knapp unterhalb ihrer Hüfte.
Wie er pulsierte, dieser köstliche Bauch, wie er sich wandt und zuckte, wie er kreiste, wie er sich wölbte und einzog - als wäre er ein kleines exotisches Tier. Ein Wildtier, das seine Besitzerin vergeblich zu zähmen versuchte. Die Glöckchen an den Säumen ihres Seidenstoffes klimperten, Schleier und Schwarzhaar flatterten, wenn sie über die Bühne wirbelte, der lange Rock bauschte sich auf, teilte sich, enthüllte für Augenblicke ihre festen Schenkel, und Khaled hielt den Atem an.
Von der Seite spürte er Raphaels Blick. Er wandte den Kopf - der ältere Freund - ein Palästinenser aus Nablus – und lächelte ihn an. Ein verschwörerisches Lächeln, in dem ein wenig Spott lag - freundlicher Spott. Nur Raphael konnte so lächeln. Anders als Khaled besuchte er nicht zum ersten Mal eine dieser verruchten Bars im Stadtteil Zamalek. Aber zum ersten Mal hatte er Khaled überreden können, ihn zu begleiten. Er beugte sich zu ihm. "Und? Gefällt's dir?"
Khaled grinste und nickte. Raphael griff nach den Biergläsern, reichte Khaled seines und stieß mit ihm an. Das kühle Bier schmeckte etwas bitter. Es prickelte angenehm, während es durch Khaleds Kehle rann. Auch Bier und Wein trank er erst, seit er Raphael an der Universität von Kairo wiedergetroffen hatte.
Die Musik brach ab, die Bauchtänzerin verneigte sich, Applaus brandete durch das Halbdunkel der Bar. Khaled stellte sein Glas ab, um ebenfalls zu klatschen. Zuerst fiel ihm nur auf, dass Raphael sein Glas nicht wegstellte. Dann sah er ihn an - Raphael lächelte nicht mehr. Er hatte auch keinen Blick mehr für die Bauchtänzerin. An Khaled vorbei starrte er mit ausdruckslosem Gesicht nach oben.
Khaleds Kopf zuckte zur Seite, und dann erst sah er sie. Sie waren zu dritt.
Die beiden jüngeren Männer kannte Khaled. Den einen, kleineren, aus seiner Heimatstadt im Jemen, den anderen aus der Uni. Der Student hieß Hassan Zakaria. Während der Physikvorlesungen war Khaled der junge Bursche aufgefallen, weil er niemals westliche Kleidung trug und ihn hin und wieder mit stechendem Blick fixiert hatte. Beide waren ungefähr in Khaleds Alter: Ende zwanzig.
Den dritten Mann hatte Khaled noch nie zuvor gesehen. Er trug ein langes schwarzes Gewand und einen grünen Turban - ein Koranlehrer, ohne Zweifel. Sein rundes Gesicht war von einem grauen Vollbart eingerahmt. Zwei auffällige Falten zogen sich von den Flügeln der Knollennase zu den Mundwinkeln herab. Er mochte Anfang vierzig sein, vielleicht auch älter. Seine samtbraunen Augen ruhten vorwurfsvoll auf Khaled, wanderten dann zu Raphael und nahmen einen feindseligen Ausdruck an.
Die Bauchtänzerin auf der Bühne verbeugte sich noch immer, Stimmengewirr mischte sich in den nicht enden wollenden Applaus. Verstohlene Blicke trafen die drei neuen Gäste. Khaled bemerkte es nicht.
Doch die Nervosität der beiden jüngeren Begleiter des Koranlehrers fiel ihm auf. Sie wussten kaum wohin mit ihren Händen, ihre Blicke hetzten scheu durch die Bar, mieden aber die leichtbekleidete Frau auf der Bühne. Der schmächtige Bursche aus Al Hudaydah, Khaleds jemenitischer Heimatstadt, tänzelte nervös von einem Bein auf das andere. Sein Name fiel Khaled wieder ein - Achmed hieß er, Achmed Uthman. Khaleds Vater hatte ihn und seinen älteren Bruder damals für die Organisation angeworben.
Endlich ließen die feindseligen Augen des Turbanträgers Raphael los. Wie ein Sieger schaute er sich in der Bar um, als würde sie ihm gehören. Als würde ihm die ganze Stadt, die ganze Welt gehören. Die Bauchtänzerin zog sich zum Vorhang hinter der kleinen Bühne zurück, verbeugte sich ein letztes Mal und verschwand. Der Turbanträger sah ihr nach, seine Mundwinkel zogen sich verächtlich nach unten. Der Applaus legte sich.
Der Blick des Turbanträgers blieb schließlich an den Biergläsern auf dem Tisch vor Khaled und Raphael hängen. Er beugte sich hinunter und griff nach einem - nach Khaleds Glas. Er roch daran und rümpfte angewidert die Nase. "Dein Vater würde weinen, wenn er sehen müsste, wie du das Gesetz des Propheten mit Füßen trittst", murmelte er. Khaled fröstelte.
"Was soll das!", zischte Raphael. Er schüttelte sich, als würde er aus lähmender Erstarrung erwachen. "Was haben wir mit euch noch zu schaffen?! Wir sind hier und amüsieren uns wie jeder andere auch! Na und?"
Die Augen des Turbanträgers verengten sich zu Schlitzen. Kalt musterte er den jungen Mann. "Du kennst die Worte des Propheten: 'Der Gläubige sieht seine Sünde wie einen großen Berg, von dem er fürchtet begraben zu werden. Der Heuchler sieht seine Sünde wie eine Fliege, die vor seiner Nase herumfliegt, und die er verscheucht.'" Er knallte das Glas zurück auf den Tisch und richtete sich auf. "Kommt heraus aus dieser Lasterhöhle. Wir warten auf der Straße." Er drehte sich um und schritt an den Tischen vorbei zum Ausgang zurück. Seine beiden Begleiter folgten ihm.
Raphael fluchte. "Sie lassen dich nicht in Ruhe." Er leerte sein Glas. "Bis ans Ende der Welt verfolgen sie dich... glauben, du wärst ihr Eigentum... glauben, du müsstest wie dein Vater sein..."
Khaled hörte nicht mehr zu. Er starrte auf seine Hände. Ein Kloß schwoll in seinem Hals. Wut, Angst und Schuldgefühle zerrten an ihm. Wut auf die Organisation, Angst vor ihren Henkern, Schuldgefühle seinem toten Vater gegenüber.
"Männer der Organisation...?", krächzte er heiser. "Meinst du wirklich?" So unerwartet waren die Drei aufgetaucht, als hätte das Nichts sie ausgespuckt. Oder die Vergangenheit. Khaleds Verstand sträubte sich gegen die Wirklichkeit. Die Angst schnürte ihm die Kehle zu.
"Sei kein Dummkopf, Khaled!", zischte Raphael. "Natürlich waren das Männer von Al Quaidah - was glaubst du denn?" Khaled sah das Flackern in den Augen seines Freundes. Wie ein in die Enge getriebenes Beutetier beäugte er die Männer an den Tischen in ihrer Umgebung. Er hat Angst, schoss es Khaled durch den Kopf. Selbst mein tapferer Freund Raphael hat Angst...
Khaleds eigene Angst steigerte sich zur Panik. Er stand auf. Sein Blick flog zum Ausgang. Ein Schwarm junger Männer strömte polternd und lachend in die Bar. Von den drei Al-Qaida-Leuten keine Spur mehr. Wir warten auf der Straße... Auf Khaleds innerer Bühne die samtbraunen Augen des Koranlehrers. Augen, die keinen Widerspruch duldeten. Nur ein Wunsch beseelte Khaled plötzlich: Der Wunsch nie mehr in diese Augen sehen zu müssen.
An den vollbesetzten Tischen vorbei steuerte er die Toiletten an. "He, Khaled! Wohin willst du?" Raphael stemmte sich aus der niedrigen Polsterbank und lief seinem Freund hinterher.
Erinnerungen überfluteten Khaleds Sinne, Bilder aus den Jahren, als sein Vater noch lebte: Die geheimen Versammlungen in seinem Elternhaus in Al Hudaydah, die flammenden Reden des Scheichs, er Seite an Seite mit Raphael bei Schießübungen am Strand, sein Vater und sein Onkel am Tag der Abreise nach Riad. Die Bilder schoben sich zwischen ihn und die Wirklichkeit, wie ein Traum erschien ihm die Bar plötzlich, er nahm sie nicht mehr wahr, die plaudernden Männer an den Tischen.
Kein Mensch in der Toilette. Khaled stützte sich aufs Waschbecken und blickte in das Gesicht seines Spiegelbildes. Ein bronzefarbenes Gesicht, glattrasiert und von dunkelbraunen, mandelförmigen Augen dominiert. Die Nase wie gemeißelt, der Mund breit und schmallippig, die glattrasierte Kinnpartie scharfgeschnitten. Ein männliches, ein schönes Gesicht.
Jetzt aber stand die Angst in seinen Zügen. Khaled schloss die Augen. Hinter ihm drückte Raphael die Tür zu und lehnte mit dem Rücken dagegen. "Wir haben ihnen nichts getan", sagte er, "wir gehen jetzt aus der Bar, nehmen ein Taxi und fahren nach Hause. Sie werden uns in Ruhe lassen." Seine belegte Stimme verriet mehr als seine hastig hervorgestoßenen Worte: Raphael glaubte selbst nicht, was er sagte.
Khaled seufzte tief und fuhr sich mit beiden Händen durch seine langen, störrischen Locken. "Sie werden uns niemals in Ruhe lassen." Er drehte sich um und sah seinen Freund an. "Wir haben die Organisation verlassen. Für sie sind wir Verräter."
Als wäre es gestern gewesen, stand ihm plötzlich der kleine dunkle Raum im Bazar des Hafenviertels von Al Hudaydah vor Augen. Wochenlang hatten er und Raphael sich dort mit dem alten Imam der jemenitischen Küstenstadt getroffen, um über Glaubensfragen zu diskutieren. 1995 war es gewesen, in den Monaten nach dem Tod seines Vaters und der Verhaftung seines Onkels durch die Amerikaner. Khaled und Raphael wollten nach Afghanistan, um in einem Ausbildungslager der Organisation den Umgang mit Sprengstoff zu lernen.
"Wir können den Ausgang nicht benutzen." Khaled stieß sich vom Waschbecken ab und öffnete eines der Fenster über den Pissoirs. Es führte in einen dunklen Hinterhof.
Der Imam von Al Hudaydah wollte sie damals davon abhalten, Kämpfer der Organisation zu werden. An unzähligen Abenden las er ihnen die Worte des Propheten vor. In der Religion gibt es keinen Zwang, war ein Satz, der Khaled damals mitten ins Herz getroffen hatte. Und: Ruf die Menschen mit Weisheit und einer guten Ermahnung auf den Weg deines Herrn und streite mit ihnen auf eine möglichst gute Art.
Khaled schob sich durch das enge Fenster und sprang auf den Hof hinaus. Nur schummriges Licht aus ein paar Fenstern in der Hausfassade beleuchteten ihn. "Sie sind nicht hinter mir her", keuchte Raphael, während er durch die Fensteröffnung kroch. "Sie sind hinter dir her!"
Diese Koranverse hatten schließlich den Ausschlag gegeben: Khaled widerstand dem Druck seiner Familie den Vater zu rächen und ging nach London, um zu studieren. Raphael tauchte in Kairo unter.
Sie lauschten in die Nacht. Verkehrslärm und Stimmen drangen durch ein enges Portal in der Hausfassade. Es führte auf die Straße hinaus. "Wir klettern über die Mauer. Vielleicht finden wir einen Hof, der zu einer Seitengasse führt."
Khaled huschte zur Mauer. Raphael hinter her. "Ich hätte keinen Kontakt zu dir aufnehmen sollen", zischte er. "Sie verfolgen dich durch die ganze Welt. Sie können es nicht akzeptieren, dass der Sohn eines Märtyrers nicht in die Fußstapfen tritt..."
Khaled antwortete nicht. Er wusste, dass Raphael Recht hatte. Sie schwangen sich über die Mauer, schlichen durch den angrenzenden Hof und gelangten zum Hintereingang eines kleinen Restaurants. Durch das Restaurant hindurch erreichten sie eine Seitengasse. Und wenige Minuten später den Tahrir-Platz.
Ein Taxi näherte sich, ein alter Fiat Kleinbus. Der Wagen hielt. Ein graubärtiger Fahrer in schwarzem Jackett musterte sie neugierig. "El Muayyad." Dort, im Süden der Stadt hatte Khaled Freunde. Er hielt es für besser, nicht gleich zu seinem Zimmer im Studentenwohnheim zu fahren.
"Inscha'allah", brummte der Chauffeur gleichgültig. Khaled und Raphael kletterten auf die mittlere Sitzbank.
Und dann ging alles sehr schnell: Aus dem Halbdunkel der engen Seitengasse tauchten die Männer auf. Einer warf sich neben den Fahrer auf den Beifahrersitz, vier drängten sich in den Fahrgastraum des Kleinbusses. Khaled sah in die Mündungen von Pistolen. Der letzte der Männer zog die Tür zu. "Los!", blaffte der auf dem Beifahrersitz. "Fahr zu...!"
*
"Umsonst hat man euch die Worte des Korans gelehrt!" Der Turbanträger saß mit gekreuzten Beinen vor ihnen. "Umsonst hat man eure jungen Herzen für den Heiligen Krieg gewonnen!" Er sprach ruhig, fast leise, und ohne die Stimme zu heben - als würde er aus einem Buch vorlesen. Seine samtbraunen Augen musterten Khaled. Fast nie sah er Raphael an. "Abtrünnige seid ihr, Verräter." Er nickte langsam, wie um seine eigenen Worte vor sich selbst zu bekräftigen.
Eine nackte Glühbirne hing an der Decke des Stalls. Die jungen Männer, die um den Turbanträger herumstanden, waren allesamt bewaffnet. Sie sprachen ihn mit Mufti an. Khaled erkannte Hassan Zakaria, den Studenten aus den Physikvorlesungen. Und Achmed Uthman aus Al Hudaydah. Sie hatten als kleine Jungen miteinander am Hafen gespielt. Jetzt musterte der Altersgenosse ihn mit unverhohlener Verachtung.
Es roch nach Kamel. Und tatsächlich sah Khaled hinter einem Holzverschlag die Höcker und manchmal auch den Kopf eines Kamels. Die Männer hatten sie in ein Dorf nördlich von Kairo gebracht. Nicht in das Wohnhaus des Fellachenhofes, sondern in die Stallungen. Gefesselt kauerten sie an der Stallwand.
"Berauschende Getränke..." Der Mufti schnaubte verächtlich. "Unzüchtige Tänze und lose Weiber... als hättet ihr die Worte des Propheten nie gehört." Er beugte sich vor. "'Haltet euch von den Todsünden fern' - habt ihr vergessen, dass der Prophet so gesprochen hat? Sieben nennt er an einer Stelle der Hadith-Bücher. 'Andere Götter neben Allah stellen. Magie. Das Töten einer Seele, es sei denn, dass die Gerechtigkeit es erlaubt..."
Khaleds Herz klopfte. Er fühlte die Nähe des Todes. Natürlich kannte er Die Bücher derÜberlieferung - die Hadith-Bücher - Reden und Taten des Propheten Mohammeds, aufgezeichnet von seinen Gefährten. Khaleds Vater hatte oft daraus vorgelesen. Der Imam von Al Hudaydah aber wollte sie nie auf gleiche Stufe mit dem Koran stellen.
"...und Rückzug vom Kampf im gerechten Krieg.'" Der Mufti lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. "Rückzug vom Kampf im gerechten Krieg", wiederholte er leise.
Die ganze Welt schien erfüllt von der ruhigen Stimme des Muftis. Seine Worte bohrten sich in Khaleds Brust. Wie ein Todesurteil klangen sie. Neben sich spürte er die Wärme von Raphaels Körper. Sie werden uns doch nicht töten, dachte er, das werden sie doch nicht tun... Er stemmte seine Füße in den strohbedeckten Lehmboden und drängte sich näher an Raphael heran. Dessen Leib fühlte sich verkrampft und steif an, als wäre er schon tot.
Der Mufti stützte die Hände auf seine Knie und beugte sich wieder nach vorn. Als wollte er Khaled mit seinem Blick durchbohren, fixierte er ihn. Seine Augen wurden merkwürdig dunkel plötzlich. Nichts Samtenes hatten sie mehr. Jetzt fiel Khaled auch auf, dass die Skleren um die Iris gelblich verfärbt waren. Die Lider des Mannes verengten sich und seine Kaumuskeln traten hervor, bevor er weitersprach. "Und von einer weiteren Todsünde spricht er. Kannst du sie mir nennen, Khaled Bin Assir?"
Khaled schluckte. Wider Willen suchte er nach einer Antwort. Dutzende von Koranversen rauschten durch seinen Kopf. Er hörte die Stimme seines Vater die Heiligen Suren vorlesen, er sah sein ernstes, hartes Gesicht. Hastig schüttelte er den Kopf.
"Du kannst sie nicht nennen, Khaled Bin Assir?" Der Mufti verzog seine vollen Lippen, als wollte er lächeln. Aber das war kein Lächeln, was seine Miene verzerrte, es war der Blick eines Scharfrichters - ein bitterer Blick voller Verachtung. "Es wundert mich, dass du sie nicht nennen kannst, Khaled Bin Assir!" Seine Stimme wurde jetzt lauter und schärfer. "Kann doch jeder Wissende diese Todsünde aus deinem Leben ablesen! 'Widerspenstigkeit gegen die Eltern'!" Er lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. In der Pose eines Kalifen, der über Tod und Leben zu Gericht sitzt, betrachtete er Khaled. Nicht Raphael, wieder nur Khaled.
Er schwieg. Quälend lange Minuten schleppten sich zäh dahin. Khaleds Mund fühlte sich an wie ausgedörrter Kameldung. Raphael neben ihm begann unruhig hin und her zu rutschen.
Irgendwann hob der Turbanträger die rechte Hand. Hassan und Achmed traten vor. Der Jemenit packte Raphael, der Physikstudent Khaled. Sie zerrten die Gefesselten hoch.
"Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes", hob der Mufti an. "Als Gelehrter der Sharia und der Worte des Propheten, und als ein Führer von Al-Qaida steht es mir zu das Urteil über euch zu sprechen." Sehr langsam und laut sprach der Mufti plötzlich. "Und ich verurteile euch zu der einzigen Strafe, die Verrätern und Todsündern zukommt!" Er betonte jedes einzelne Wort. "Im Namen Allahs, der am Tage des Gerichts regiert, verurteile ich euch zum Tode!"
Khaled blieb der Atem weg. Er hatte längst geahnt, worauf alles hinauslaufen würde. Seitdem er vor Stunden zum ersten Mal in die Augen dieses Mannes blickte, hatte er es geahnt. Aber es jetzt zu hören, jetzt Raphael neben sich aufschreien zu hören, jetzt zu sehen, wie zwei der der Gefolgsleute des Muftis unter ihre Gewänder griffen, Schalldämpfer herausholten und sie auf die Läufe ihrer Pistolen schraubten - das raubte ihm schier die Sinne. "Nein", flüsterte er. "Nein, nein..."
Raphael und er wurden auseinander gerissen. Zwei weitere Männer eilten herbei und halfen, sie in eine leere Kamelbox zu zerren. Vor dem offenen Verschlag der Box blieben sie mit Khaled stehen. "Bitte nicht", flüsterte er. "Bitte nicht..."
Kaum vier Schritte vor ihm stießen sie Raphael in Stroh und Kameldung. Er wand sich, warf sich auf den Rücken, versuchte nach seinen Henkern zu treten. Die wichen zurück. Achmed, der kleine Jemenit aus Al Hudaydah, riss die schalldämpferbewehrte Waffe hoch und drückte ab - einmal, zweimal, dreimal. Raphaels Körper bäumte sich auf, sein Kopf knallte auf den harten Lehmboden, dann regte er sich nicht mehr.
Fassungslos starrte Khaled auf seinen toten Freund. Dessen weitaufgerissenen Augen starrten gebrochen an die mistverschmierte Bretterwand des Verschlags. Das schmutzige Stroh um seinen Kopf färbte sich rot. Ein Blutfleck auch auf seinem hellen T-Shirt über der Brust. Khaleds Unterlippe bebte.
Sie zerrten ihn neben Raphaels Leiche und drückten ihn in die Knie. Alle Kraft, alles Leben wich aus seinem Körper. Harndrang schnitt ihm in den Unterleib. Er gab ihm nach. Während das warme Wasser in seine Hosen sickerte, fing er zu beten an. "Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes..." Das kalte Metall des Schalldämpfers drückte sich in seinen Nacken. "...Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt..." Er zog die Schultern hoch und kniff die Lider zusammen. "...dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert..." Wie von selbst kamen die Worte der ersten Sure über seine zitternden Lippen. "...dir dienen wir..." Tränen strömten über seine Wangen. "...dich bitten wir um Hilfe..."
Er wartete auf das metallene Floppen des Schusses, er wartete auf das Feuer des Schmerzes, er wartete auf das Ende der unerträglichen Angst. Doch nichts geschah. "...führe und den geraden Weg..." Der Druck des Metalls in seinem Nacken ließ nach. "...den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast..." Schritte raschelten hinter ihm im Stroh. "...nicht den Weg derer, die deinem Zorn verfallen sind..."
Jemand ging hinter ihm in die Hocke. Eine Hand legte sich auf seine Schulter. "Vielleicht gibt es wirklich noch Hilfe für dich", raunte eine Stimme dicht an seinem Ohr. Die Stimme des Muftis. Khaled spürte seinen warmen Atem über seine Wange streichen. "Vielleicht ist die Pforte noch offen für dich, die Pforte auf den geraden Weg..."
Khaled öffnete die Augen. Der Geruch seines Angstschweißes und seines Urins stieg ihm in die Nase. Er wandte den Kopf. Die samtbraunen Augen direkt neben ihm. Nichts Hartes mehr in ihnen, nichts Erbittertes und Verächtliches. Väterlich blickte der Turbanträger ihn jetzt an, gütig und voller Mitleid. Khaled schluchzte hemmungslos.
"Die Organisation hat dich zum Tod verurteilt - schon lange, mein Sohn. Der Tod ist die gerechte Strafe für jeden Verräter." Khaled ließ seinen Oberkörper auf seine Schenkel fallen und legte die Stirn auf seine Knie. Das Metall der Waffe folgte ihm nicht. Er heulte wie ein kleiner Junge.
Der Mufti legte seine Hand auf den Rücken Khaleds und wartete bis sein Geheule und Gejammer nachließ. "Aber Allah ist gnädig und barmherzig!", verkündete er mit lauter Stimme. "Er sieht die Verdienste der Märtyrer des gerechten Kampfes! Und dein Vater ist ein Märtyrer des gerechten Kampfes!"
Er senkte die Stimme und beugte sich so tief zu Khaled herab, dass der den Bart des Muftis an seiner Ohrmuschel spürte. "Und ich habe Seite an Seite mit deinem Vater gekämpft." Der Turbanträger sprach mit gesenkter Stimme weiter. "Ich habe ihn gesehen am Tage seines Sieges in Riad. Wie er in den Wagen mit der Sprengladung stieg, um sie in die Basis der Soldaten des Großen Satans zu fahren. Glücklich war er..."
Khaled öffnete die Lider. Die leeren Augen Raphaels starrten ihn an. "Glücklich und stolz seine Tage als Märtyrer des gerechten Kampfes beenden zu dürfen. Und als Vater eines Sohnes, der ihm nachfolgen würde im Eifer für die Sache Allahs, des Allmächtigen."
Khaled richtete sich auf. Schluchzer schüttelten seinen Körper. Durch einen Tränenschleier hindurch sah er das Gesicht des Muftis. Wie ein gnädiger Richter erschien er ihm auf einmal. Die Hoffnung glimmte in seiner Brust auf - Licht am Ende eines finsteren Tunnels, in den er gestürzt war, in den er geglaubt hatte für immer versinken zu müssen.
"'Achte auf meinen Sohn', waren die letzten Worte gewesen, die er zu mir sprach. 'Achte darauf, dass er zu einem Streiter des gerechten Kampfes wird'. Ich habe es ihm versprochen, ich habe es bei Allah geschworen, als die Bombe ihn zerriss und Tod und Verderben über die Soldaten des Großen Satans brachte."
Der Mufti nahm die Hand von Khaleds Rücken. Khaled richtete sich auf. Sein Blick saugte sich förmlich fest an den vollen Lippen des Gelehrten. Sein Hirn war wie leergefegt, das Herz galoppierte ihm durch den Brustkasten wie ein junges Kamel. Jeder Stolz, jeder Würde war in ihm zerbrochen. Ein kleines Kind war er in diesen Augenblicken - ein kleines, ohnmächtiges Kind, das Hilfe und Rettung herbeisehnte.
"Glaub mir, Khaled", fuhr der Mufti fort. "Es hat uns allen das Herz zerrissen, als wir hörten, dass du die Reihen unserer Kämpfer verlassen hast." Seine dunkle Stimme schien in Khaled Blut widerzuhallen. "Glaub mir - ich kämpfte mit den Tränen, als ich dich und deinen Verführer in dieser Lasterhöhle sah..." Wieder legte er seine Hand auf Khaleds Schulter. "Kehre um, mein Sohn! Im Namen Allahs, im Namen deines Vaters und im Namen deines Onkels, der seit vier Jahren in den Kerkern des Großen Satans schmachtet, rufe ich dich dazu auf! Ich, Massud Al Turabi, fordere dich auf: Kehre zurück in die Reihen der Gerechten! Kehre zurück zu den Kriegern des gerechten Kampfes - und dein Leben sei dir gestundet..."
Khaled weinte laut. Er lehnte den Kopf gegen die Brust des Muftis. Der schloss ihn fest in seine Arme.
*
Quantico, Virginia, etwa vier Monate später
Neulich, beim Friseur, blätterte ich in einem Boulevardblatt. War's die New York Post oder waren es die Daily News - ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls las ich von einem Mann, der mit seinem Dodge Pick-up gegen einen Baum gerast war. Irgendwo in Wyoming, in den Rocky Mountains.
Nichts Besonderes an sich, oder? Wie viele Leute fahren nicht Tag für Tag gegen irgendwelche Bäume. In Russland, in Deutschland, in den USA, oder sonst wo. Weil ihnen ein Reifen platzt, weil sie zu schnell fahren, weil sie eine Kurve falsch eingeschätzt haben - weiß Gott warum.
Der Mann in Wyoming war betrunken gewesen. Sie haben ihn aus dem zertrümmerten Wrack seines Wagens gezogen und zur nächstbesten Intensivstation gebracht. Hatte ihn ziemlich schwer erwischt, aber er hat überlebt. Immerhin.
Warum erzähle ich diese banale Geschichte? Nun ja - wegen des Baumes, gegen den der Mann gefahren war. Eine Buche. Und zwar die einzige weit und breit. Auch das an sich nichts Besonders. Einsame Bäume an kurvenreichen Straßen - wer kennt das nicht? Nur - die Buche stand am Rand eines Steilhanges. Hinter ihr ging es in eine tiefe Schlucht. Vierzig Meter tief, wenn ich mich recht erinnere.
Sie verstehen - wäre der besoffene Glückspilz Bruchteile von Sekunden früher ins Schleudern gekommen oder Bruchteile von Sekunden später... Vierzig Meter, wie gesagt. Sie hätten ihn auf keine Intensivstation mehr bringen müssen.
Zufall? Oder Schicksal?
Ähnlich wie die schmerzhafte Begegnung jenes Mannes aus Wyoming mit der einsamen Buche, die Begegnung mit Menschen, die für unser Leben von Bedeutung sind. Eine rote Ampel mehr, ein Stau, der sich nicht rechtzeitig auflöst, ein überraschender Anruf, der unser geplantes Abendprogramm durcheinander bringt - und wir wären ihm nicht begegnet.
Die Frau zum Beispiel, die an jenem Vormittag in einem Hörsaal der University of Virginia in Quantico über islamischen Fundamentalismus referierte - ich muss immer zuerst an jenen kalten und verschneiten Vormittag denken, wenn mir dieser verfluchte Fall einfällt - diese Frau also: Wäre ich ihr je begegnet, wenn ich nicht zufällig während einer Kaffeepause den Prospekt mit dem Fortbildungsprogramm der FBI-Akademie auf Mandys Schreibtisch gesehen hätte?
Oder wenn Milo und ich den Polizistenmord in der Lower East Side nicht früher als erwartet gelöst hätten? Oder wenn nicht auf den letzten Drücker zwei Plätze frei geworden wären, weil Kollegen aus Washington buchstäblich in letzter Minute eine Vorladung zu einem Prozess vor dem Bundesgericht erhalten hätten, in dem sie als Zeugen aussagen mussten?
Zufall oder Schicksal? Keine Ahnung.
Jedenfalls schien uns die Gelegenheit günstig zu sein, und Milo und ich entschieden uns spontan nach Quantico zu fahren und unsere Kenntnisse über den islamischen Fundamentalismus aufzumöbeln.
Es war ein Wintertag, wie gesagt - Ende Januar oder Anfang Februar. Die Jalousien vor den großen Fenstern des Hörsaals senkten sich herab, sehr langsam und sehr geräuschvoll. Und ebenso langsam verengte sich der helle Tageslichtstreifen, durch den ich dicke Schneeflocken schweben sah. Auf dem Dach der gegenüberliegenden Sporthalle wölbte sich schon ein kleiner Schneehügel. Es schneite seit dem frühen Morgen.
Ich wandte den Blick von der Jalousie und sah nach links, wo Milo neben mir saß. Oder eigentlich saß er nicht - er lag halb in seinem Stuhl, hatte die Arme vor der Brust verschränkt und die Augen geschlossen.
Seine Atemgeräusche drohten in das überzugehen, was man allgemein als Schnarchen bezeichnet. Ein G-man sollte einfach einen besseren Eindruck machen, fand ich. Zumindest dann, wenn sechs Dutzend Kollegen aus dem ganzen Land in unmittelbarer Nähe waren.
Er schreckte auf, als ich ihm meinen Ellenbogen in die Rippen rammte. "Du wirst uns hier nicht blamieren, Partner", flüsterte ich. "Wer gut feiern kann, muss auch gut arbeiten können." Natürlich hatten wir eine Menge alte Bekannte aus den verschiedensten Bundesstaaten wiedergetroffen. Die Nacht war entsprechend lang geworden.
"...und damit Gewalt und Fanatismus ein Gesicht für Sie bekommen, Ladies und Gentlemen, nun einige Schlüsselfiguren des islamistischen Terrors." Die Frau dort unten vor dem Rednerpult - die Frau also, die ich durch eine Kette von Zufällen - oder durch Schicksal von mir aus - an jenem Vormittag zum ersten Mal in meinem Leben sah, diese Frau war ganz in schwarz gekleidet. Mehr fiel mir zunächst nicht an ihr auf.
Anfangs ging mir der Gedanke durch den Kopf, sie könnte um einen Angehörigen trauern, aber wahrscheinlich bevorzugte sie einfach nur Schwarz. Ihre Brille, die Mappe mit ihren Folien und Konzeptblättern, selbst der Lack ihrer Fingernägel - alles schwarz.
Selbstverständlich auch ihr Haar. Bisher kannte ich nur ihren Namen - sie hieß Judith Aboudh - und ihren Job beim FBI-District Baltimore: Sie war Spezialistin für islamistischen Fundamentalismus. Ich schätzte sie auf Mitte dreißig. Bald sollte ich mehr kennen, als nur ihren Namen und ihre Funktion.
Lady Black drückte auf einen Knopf an der Vorderseite des Dozentenpults, das Licht erlosch. Damals nannte ich sie nur in Gedanken so - Lady Black. Auf der großen Projektionsfläche an der Stirnseite des Hörsaales flammte ein Bild auf - das Porträt eines unscheinbaren Mannes mit dunklen Haaren, Stirnglatze und einer unverhältnismäßig großen Brille. Allenfalls der kurze, schwarze Bart ließ mich an einen Orientalen denken.
"Dieser Mann ist tot." Judith Aboudhs dunkle Stimme erfüllte den Hörsaal. "Er hieß Fathi Schakaki und war Führer des palästinensischen 'Islamischen Dschihad'. Ein Mossad-Kommando hat ihn im Oktober 1995 erschossen. Eine Aktion, die den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Rabin politisch teuer zu stehen kam. Ich erwähne Schakaki an dieser Stelle, um Ihnen Biographie, Karriere und Arbeitsweise eines typischen Terroristenführers im Nahen Osten zu veranschaulichen..."
Islamischer Terrorismus stand nicht erst seit den verheerenden Bombenattentaten auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania auf den Fortbildungsplänen der FBI Akademie in Quantico. Aber seitdem verstärkt - zugegeben. Es war die dritte Fortbildung dieser Art, die Milo und ich genossen. Eine Auffrischung sozusagen. Die Dozentin allerdings war neu für uns.
Stichwortartig referierte sie den Werdegang des Mannes, dessen Gesicht überlebensgroß die Stirnwand ausfüllte. Als Student hatte er den Verein für Heiligen Krieg in Kairo gegründet. Fünfzig Akademiker gehörten seinerzeit zum Gründungszirkel. Die Führer der militanten Fundamentalisten waren alles andere Analphabeten. Schakaki selbst arbeitete als Kinderarzt in Jerusalem und führte jahrelang ein bürgerliches Leben - jedenfalls nach außen hin.
Ein zweites Bild zeigte ihn mit geballten Fäusten und höhnisch lachend. "Vielleicht erinnern sie sich an dieses Foto, Ladies und Gentlemen", sagte Special Agent Aboudh. "Es ging seinerzeit durch die Presse - Schakaki bei einem Interview, in dem er sich mit einem von ihm organisierten Selbstmordkommando brüstete, bei dem zwei seiner sogenannten Märtyrer an der Bet-Lid-Kreuzung bei Netanja sich selbst und einundzwanzig Menschen in die Luft sprengten. Die meisten von ihnen waren junge, israelische Soldaten, die auf den Bus warteten..."
Lady Black skizzierte den fünf Jahre zurückliegenden Anschlag in allen Einzelheiten. Ich fragte mich, wie viele solcher Fakten sie unter ihrem kurzen, schwarzen Lockenschopf gespeichert hatte.
Dann das nächste Bild. Der Mann darauf riss den Mund weit auf, hielt den Zeigefinger drohend über dem Kopf und schien gerade irgendetwas in ein Mikrophon zu brüllen. Auch er bärtig und von orientalischer Physiognomie, jünger allerdings als Schakaki und mit Hornbrille.
"Das ist Abdallah Schallah, Schakakis Nachfolger, ebenfalls Angehöriger der palästinensischen Bildungsschicht. Prägen Sie sich das Gesicht ein. Man sieht ihm zwar an, dass er Prediger ist, aber nicht unbedingt, dass er bereits ein halbes Dutzend Selbstmordkommandos auf Höllenfahrt geschickt hat..."
Die stellenweise etwas harte Ausdrucksweise der Kollegin dort unten machte mich hellhörig. Ich fragte mich, ob der militante Islamismus etwas mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun haben könnte. 'Aboudh' - der Name klang nicht gerade amerikanisch. Auch äußerlich wirkte Lady Black ein wenig wie eine Schönheit aus Tausendundeiner Nacht. Jedenfalls von weitem. Allzu nah war ich ihr zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen.
"Auch dieser Mann hier wird uns noch einiges Kopfzerbrechen bereiten, wenn man den Dossiers unserer Kollegen vom CIA glauben darf." Das Porträt eines etwa fünfundvierzigjährigen Mannes mit schwarzem Turban erschien auf der Stirnwand des Hörsaals. Wieder der obligatorische Bart, und, wie sein Vorgänger, eine Hornbrille. Die Krieger Allahs liebten es schmucklos, wie es schien.
"Hassan Nasrallah, ein Korangelehrter - das also, was man sich unter einem Mullah vorstellen muss. Er ist Generalsekretär der Hizbullah, oder der Partei Gottes, wenn Ihnen das lieber ist." Täuschte ich mich, oder hörte ich einen leicht zynischen Unterton in der Altstimme Judith Aboudhs? "Ein besonders glühender Hasser des Großen Satans. Der Vereinigten Staaten also und seiner Bürger. Ich brauche ihnen die Bluttaten der Hizbullah nicht aufzuzählen."
Als wollte sie sich und uns quälen, tat sie es trotzdem. Angefangen von jenem schwarzen Tag in der neueren amerikanischen Geschichte, als 1983 zweihunderteinundvierzig GIs bei einem Autobombenattentat auf das US-Hauptquartier in Beirut getötet wurden, bis zu jenem Selbstmordanschlag auf einen Jerusalemer Schulbus vor wenigen Monaten. Eine breite Spur aus Blut und Tränen zog die Hizbullah seit achtzehn Jahren durch die Welt. Und nicht nur durch die Welt des Nahen Ostens.
Es waren keine besonders erquicklichen Stunden an jenem Vormittag. Judith Aboudh gab uns einen umfassenden Einblick in den Terror der islamischen Fundamentalisten und ihrer Köpfe.
Von so einer Fortbildung verspricht man sich ja auch immer ein wenig Abstand vom Alltagsgeschäft. Ein paar hundert Meilen entfernt vom Big Apple vergaßen wir zwar unsere Serienmörder, Drogendealer und Waffenhändler. Dafür rückte uns eine Dimension des Verbrechens auf die Haut, die jede Vorstellungskraft menschlicher Phantasie sprengte.
Je länger Judith Aboudh dozierte und je mehr Fotos von Fanatikern und ihrer Anhänger, Tatorte und Opfer sie uns vorführte, desto bleierner legte sich eine bedrückte Stimmung auf das Auditorium. Allerdings war jeder hellwach. Selbst Milo neben mir machte keine Anstalten mehr einzuschlafen.
"Und nun der aktuelle Gipfel islamistischen Terrorismus'", kündigte Aboudh das nächste Bild an. Es zeigte einen langen, mit weißem Tuch abgedeckten Konferenztisch. Flankiert von zwei bärtigen Hornbrillenträgern mit weißen Turbans hockte dort ein Mann mit hagerem, abgehärmtem Gesicht und langem Bart vor einem Mikrofon. Hinter ihm an der Wand ein schwarzer Teppich mit arabischen Schriftzeichen. Links und rechts daneben zwei Schwarzvermummte mit automatischen Gewehren.
"Die Medien nennen diesen Mann 'Weltfeind Nummer Eins der USA'", sagte Lady Black, "das klingt ziemlich reißerisch, ist aber vielleicht nicht einmal übertrieben."
Der Mann auf der Bildmitte war Osama Bin Laden - Milo und ich kannten ihn aus umfangreichen Aktenkopien des CIAs und unserer eigenen Firma. Nichts von dem, was Judith Aboudh berichtete, war uns wirklich neu. Seit seine Terrorgruppen im vorletzten Jahr die US-Botschaften in Daressalam und Nairobi angegriffen hatten, war sein Name in aller Munde. Und fest verknüpft mit fast dreihundert Toten und über fünftausend Verletzten.
"Die Terrorgruppe des Scheichs nennt sich wie Sie wissen Al-Qaida - die Basis. Vermutlich verbirgt Bin Laden sich noch immer afghanischen Hochgebirge", sagte unsere Dozentin. "Nicht einmal der CIA weiß wirklich, wo er steckt. Vielleicht haben Sie gehört, dass er seinerzeit den afghanischen Mujaheddin Straßen, Munitionsdepots, Bunker und Flugplätze baute und so den Sieg über die Rote Armee vorbereitete. Vermutlich hat er ihn sogar herbeigeführt als er ihnen die Stinger-Raketen besorgte."
Es war dunkel, und das Gesicht Judith Aboudhs war von den oberen Sitzreihen nicht zu erkennen - doch ihre Stimme klang ein wenig, als würde sie lächeln. Es musste ein zynisches Lächeln gewesen sein. "In diesem Sinne", sagte sie, "war unser größter Feind einst also unser Verbündeter."
Geraune erhob sich unter den etwa siebzig meist jüngeren Kollegen. Aber genau besehen hatte sie Recht.
Es folgte ein äußerst detaillierter Bericht über Bin Ladins Karriere folgte, über seine Aktionen, Ausbildungslager, Giftgasfabriken, Verbindungsleute, und so weiter, und so weiter. Vor allem natürlich über seinen legendären Reichtum. Ich hörte keine Papier rascheln, ich sah Judith Aboudh sich nicht über Konzeptpapier beugen. Sie schien alle Fakten im Kopf parat zu haben. Ich fragte mich, wie intensiv sich ein Mensch mit einem derart komplexen Thema befassen musste, bis er druckreife Vorträge ohne Konzept darüber halten konnte.
"Der Bankier des Terrors, Ladies und Gentlemen, hat viele rechte Hände. Oder soll ich sagen 'rechte Arme'? So lang sind seine Arme, dass sie schon bis in die Vereinigten Staaten reichen. Einer seiner Statthalter in Großbritannien hat erst vor kurzem die Fatwa über einige US-Bürger verhängt..."
Wir kannten den Fall - der radikale Scheich in London hatte das Todesurteil - 'Fatwa' nannten die Radikalen das - über drei New Yorker ausgerufen und prompt waren seine Handlanger in der Stadt aufgekreuzt und hatten uns gewaltig zugesetzt.
"Ich erinnere an diesen Vorfall, um etwaige Zweifel daran auszuräumen, uns hier in den Staaten ginge das Problem nur indirekt an." Die dunkle Stimme unserer Dozentin nahm einen schneidenden Unterton an. Ich muss gestehen: Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits die Nase voll blutigen Fakten über Fanatiker.
"Und folgender Satz von Bin Laden mag ihnen verdeutlichen, wie kompromisslos und gefährlich solche Leute sind. Von einer deutschen Zeitung auf das Kopfgeld angesprochen, das der CIA angeblich auf ihn ausgesetzt hat, sagte er folgendes: 'Daran können Sie ermessen, wie dumm diese Leute sind - für uns gibt es doch nichts Ehrenwerteres als das Martyrium. Mein Tod würde die Bewegung unsterblich machen...'"
Milo neben mir schüttelte fassungslos den Kopf. Ein kalter Schauer rieselte durch mich hindurch. Unvorstellbar für einen durchschnittlichen Menschen der westlichen Hemisphäre, so zu denken.
Mit ähnlich unerfreulichen Geschichten ging dann auch der Nachmittag dahin. Irgendwann schaltete ich ab. Man kann nicht pausenlos negative Informationen aufnehmen. Ich jedenfalls kann das nicht.
Eigentlich hatte ich mich auf einen lockeren Bowling-Abend mit Milo und einigen Kollegen aus Los Angeles und Chicago eingestellt. Mein Neffe Will war mit von der Partie und Rose Warrington aus San Francisco. Mit ihr als Undercover-Agenten hatten wir schon die wildesten Fälle gelöst.
Doch Milo schien andere Dinge im Kopf zu haben. Dinge, die typisch für ihn waren. Am frühen Abend kam ich aus der Mensa der University of Virginia - Fortbildungen eher wissenschaftlichen Charakters finden meist dort und nicht in der FBI-Akademie statt - und wer steht am Getränkeautomaten? Mein Partner und eine relativ kleine, schlanke Frau mit auffallend kurzen Locken: Lady Black. Er mit beiden Händen gestikulierend und weiß Gott welche Heldentaten zum Besten gebend, und sie lächelnd und schweigend.
"Das ist mein Partner!", rief er, als er mich entdeckte. "Meine bessere Hälfte sozusagen." Er machte uns miteinander bekannt. Zum ersten Mal sah ich sie von nahem. Ich hatte mir ihr Gesicht älter und herber vorgestellt. Vermutlich ihrer dunklen Stimme wegen. Doch Judith Aboudhs Gesichtszüge hatten nichts Hartes oder Dunkles - abgesehen vielleicht von der bronzefarbenen Haut.
Schmal war ihr Gesicht, weich ihr Kinn und ihre Nase, prägnant nur ihre hohen Wangenknochen. Nichts Bitteres und Zynisches auch um den großen Mund. Die schwarzbraunen Augen und das bläulich schimmernde, kurze Schwarzhaar vor allem gaben ihr jenen orientalischen Touch, den ich von der Hinterbank des Hörsaals wahrgenommen hatte. Auch ihr jugendliches Aussehen überraschte mich. Auge in Auge mit der Spezialistin schätzte ich sie auf höchstens Ende zwanzig.
"Will und Rose haben die Bowlingbahn in der Akademie reserviert", sagte ich zu Milo. "Wir treffen uns in einer Stunde." Ich wandte mich an Judith Aboudh. "Vielleicht haben Sie auch Lust auf einen sportlichen Abend?"
"Nennen Sie mich Jude, Jesse", lächelte sie. "Ihr Partner war so freundlich mich zum Essen einzuladen. Wollen Sie uns nicht Gesellschaft leisten? Man trifft nicht alle Tage zwei Kollegen aus New York City."
Ein Seitenblick auf Milo bestätigte mir, was ich schon ahnte: Mein Partner dachte an einen eher zweisamen Abend. Ich wollte schon zu einer Lobrede über das Bowling im Allgemeinen und das Wiedersehen mit alten Bekannten im Besonderen ausholen - doch irgend etwas war da in ihren dunklen Augen, das mich schneller überzeugte, als ich denken konnte. "Warum nicht?", sagte ich.
Wir landeten also in einem mexikanischen Restaurant am Stadtrand von Quantico, einem für meinen Geschmack etwas zu feinem Laden. Ziemlich teuer obendrein. Milo pflegte sich Bekanntschaften interessanter Frauen etwas kosten zu lassen.
Die Speisekarte las sich langweilig - Tortillas in ungefähr dreiundzwanzig Variationen. Jude - ich gewöhnte mich schnell daran, sie so zu nennen - trank kalifornischen Weißwein, Milo und ich mexikanisches Bier.
Ich glaube, der halbe Abend verging unter Milos Regie - er erzählte von New York City, von unserem FBI-Office und der Arbeit in Manhattan. Jude erwies sich als aufmerksame Zuhörerin, stellte kluge Fragen, und es zeigte sich, dass sie sich gut in der Manhattaner Musikszene auskannte. Wir hörten Namen von Musikkneipen und Jazzkellern, die selbst ich noch nicht kannte.
"Du scheinst nur nach Manhattan zu kommen, um Musik zu hören", sagte ich.
"Oder um Musik zu machen. Ein paar Freunde von mir haben eine Band in SoHo. Bei ihnen singe ich hin und wieder. Wenn ich zufällig im Big Apple bin."
Wir erfuhren, dass sie eine Gesangsausbildung genossen hatte. "Wie kommt man als Musikerin zu unserer prosaischen Firma?", wollte Milo wissen.
"Das Musikstudium in Philadelphia war reine Liebhaberei. Ich hab Chemie studiert und bin Spezialistin für Sprengstoff und biologische Kampfmittel."
Wir machten große Augen. "Musik und Sprengstoff - nicht gerade eine weit verbreitete Kombination", staunte Milo.
"Sag das nicht, Milo - gute Musik ist Sprengstoff." Sie lachte. "Außerdem habe ich noch Arabisch studiert."
"Ich hab deinen Namen zum ersten Mal auf dem Fortbildungsprospekt gelesen", sagte ich. "Wie lange arbeitest du schon als Sprengstoff- und Islamspezialistin für uns?"
"Erst seit Mitte letzten Jahres. Ich habe vorher fast sieben Jahre lang für den CIA gearbeitet."
Sieben Jahre, und davor noch ein Studium - ich korrigierte meine Vorstellung von ihrem Alter nach oben. Unwillkürlich sah ich auf ihre Hände. Feingliedrig, und schwarzlackierte Fingernägel wie gesagt - aber kein Ring, der sie als verheiratet oder verlobt verraten hätte. Mein Interesse verwirrte mich selbst. Ich schimpfte innerlich mit mir. Es war noch nicht lange her, dass ich mich von einer gescheiterten Beziehung erholt hatte.
Wir erfuhren, dass Judes Vater Ägypter und sie für den amerikanischen Geheimdienst in Ägypten und in Jordanien tätig gewesen war. In welcher Funktion verriet sie uns nicht.
"Du scheinst alle Fakten zu kennen, die man im Zusammenhang mit den islamischen Fundamentalisten überhaupt kennen kann", tastete ich mich vor.
"Mein Vater ist Jude. Meine Mutter übrigens auch. Ein paar Jahre meiner Jugend habe ich sogar in Tel Aviv verbracht. Meine Mutter war dort bei der US-Botschaft angestellt. Ich weiß, wie es ist, durch Straßen zu gehen und Angst vor Autobomben oder granatenwerfenden Fanatikern zu haben." Ihre Miene wurde sehr ernst plötzlich. Für Sekunden schien ein Schleier durch ihren Blick zu schweben - Trauer, vermutete ich.
"Und ich habe Opfer jener Gotteskrieger gesehen." Sie senkte die Stimme. "Einer von ihnen war mein Freund. Ein blutjunger, israelischer Rekrut. Ich musste ihn identifizieren. Das ist fast fünfzehn Jahre her..."
Mehr erzählte sie nicht. Sie wechselte das Thema und klapperte die bekanntesten Jazz-Interpreten ab. Kennst du diesen, kennst du jenen - nach dem Motto etwa. So verging der Abend.
Am nächsten Tag bekam ich sie nicht mehr zu Gesicht. Aber ich dachte an sie. Mehr als mir lieb war, dachte ich an sie. Ein Religionswissenschaftler führte uns von morgens bis abends in die Glaubenswelt des Islams und in die Denkweise der fanatischen Splittergruppen dieser jüngsten Weltreligion ein. Vermutlich könnte ich jetzt aus dem Effeff die wichtigsten Lebensdaten Mohammeds referieren, und den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten - wenn ich nicht am Abend zuvor Jude begegnet wäre.
Sie ging mir nicht aus dem Kopf.
Auch in den ersten Tagen zurück in Manhattan nicht. Bald überrollte uns die Arbeit und das Bild ihres schönen Gesichtes verblasste allmählich.
Später, als wir uns wiedersahen, stellte ich mir die alte Frage: War es Zufall, dass ich ausgerechnet das Fortbildungsseminar über islamischen Fundamentalismus gebucht hatte und so Jude begegnete? Oder war es Schicksal? Und wie immer, wenn ich mir diese Frage stellte - und ich stelle sie mir oft - fand ich nur eine Antwort: Keine Ahnung...
*
Florence, Colorado, zur selben Zeit
Auf dem Zufahrtsweg zum Parkplatz spürte Blake W. Stockman wieder jenes leise Kribbeln im Zwerchfell - Stolz. Stolz auf SuperMax. Wie ein Raumfahrtzentrum oder eine Raketenabschussbasis der US-Airforce lag es vor ihm, das modernste Gefängnis der Vereinigten Staaten.
Blake rangierte seinen Toyota in eine Parklücke, schloss den Wagen ab und marschierte quer über den Parkplatz zum Personaleingang. Es war ein Freitag.
Blakes Stiefel sanken in den Schneematsch. Fast knöchelhoch bedeckte er den Parkplatz. Von den weißen Gipfeln der Rocky Mountains wehte ein kalter, feuchter Wind. Milder als gestern, aber immer noch lausig kalt.
Drei mit einem mehr als fünf Meter hohen Stahlzaun verbundene Rundtürme standen an jeder Ecke des dreieckig angelegten Zuchthauskomplexes. Offiziell hieß dieser sicherste Betonklotz der Vereinigten Staaten United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, abgekürzt AMX. Doch keiner von Blakes tausendvierhundert Kollegen nannte das Zuchthaus so. Man würde sich ja die Zunge abbrechen. Das Wachpersonal - viele ehemalige Soldaten wie Blake - nannte es schlicht SuperMax.
Er presste seine Hand gegen die Sensorfläche neben den Metallschiebetüren. Der Rechner identifizierte ihn als zugangsberechtigte Person, die Türen schoben sich auseinander, Blake passierte die Sicherheitsschleusen und lief in die Personalräume.
Nicht unbedingt, dass er im modernsten Zuchthaus der Staaten arbeiten konnte, erfüllte Blake jedesmal mit Stolz, wenn er zum Dienst ging. Nicht einmal, dass er schon seit der Eröffnung 1994 in SuperMax arbeitete. SuperMax war in gewissem Sinn sein Werk - seines und das vieler anderer Bürger von Florence.
Vor zehn Jahren noch war Florence eine sterbende Bergarbeiterstadt gewesen. Blake und seine Mitbürger hatten hunderttausend Dollar gesammelt, ein Stück Ödland gekauft und es der Regierung geschenkt, die Bauplatz für ein Hochsicherheitszuchthaus suchte. Die Regierung baute SuperMax, und zwar in Rekordzeit.
Seitdem gab es eine Menge Arbeit und Florence blühte wieder wie in alten Zeiten.
Blake zog seine Uniform an und ging hinüber in den Ostflügel von SuperMax, in den Teil, den er und seine Kollegen Bomberwing nannten. Hier saß eine Hand voll Männer hinter Schloss und Riegel, die mit Bomben gemordet hatten.
Kaczynski zum Beispiel, der sogenannte Unabomber. Oder der verdrehte McVeigh, der in Oklahoma City einen Bürokomplex in die Luft gejagt und hundertachtundsechzig Menschen getötet hatte. Oder Muhammed Bin Assir, einer der Köpfe des Bombenattentats auf die US-Militärbasis in Riad vor fünf Jahren.
Die gefährlichsten Männer der Vereinigten Staaten zu bewachen, die Erzfeinde seines Landes sozusagen - auch das nährte Blakes Stolz.
Die Frühschicht hatte sich schon im Zentralbüro versammelt. "Wie geht's so?", rief er in die Runde. Die Männer grüßten zurück, verhalten und müde die einen, lautstark und frisch die anderen. Blake war der Chef des Wachpersonals im Bomberwing.
Überall an den Wänden flimmerten Monitore. Auf ihnen konnte man die Gefangenen rund um die Uhr beobachten. Blake warf einen flüchtigen Blick auf sie. McVeigh lag apathisch auf seiner Pritsche, Kaczynski hockte an seiner Schreibplatte und kritzelte irgendwelche Blätter voll, und Bin Assir lief mit einem Buch in der Hand in seiner kleinen Zelle auf und ab.
Blake ließ sich Bericht erstatten, überflog das Schichtprotokoll und das Protokoll der Gespräche zwischen den Häftlingen während des einstündigen Hofgangs. Nichts besonderes: Sie hatten mal wieder über ein Footballspiel diskutiert, das sie im Sportkanal gesehen hatten. Und der islamische Terrorist hatte Kaczynski die arabische Übersetzung einiger amerikanischer Begriffe aus der Elektronik beigebracht. Der Unabomber lernte tatsächlich Arabisch.
Blake schüttelte den Kopf und stieß einen Seufzer aus. "Vom Wahnsinn angefressen", sagte er. Das war einer seiner Lieblingssprüche. "Alle drei vom Wahnsinn angefressen, jeder auf seine Art."
Die Frühschicht verzog sich nach Hause. Blake und seine Leute gingen der Routinearbeit nach: Zellenüberprüfung, Rasierklingenzählung, visuelle Überwachung, Essensausgabe, und so weiter.
Am späten Nachmittag hingen die meisten Gefangenen vor der Glotze. McVeigh und Kaczynski schauten sich einen alten John-Wayne-Western, der auf TNT lief. Morgen, während des Hofgangs würden sie wieder darüber diskutieren, ob Wayne oder Gary Cooper der coolere Westernheld aller Zeiten gewesen ist.
Der jemenitische Terrorist, Muhammed Bin Assir, kniete mitten in seiner Zelle. Freitagsgebet. Zusammen mit dem islamischen Geistlichen auf der Mattscheibe betete der Terrorist ein arabisches Gebet. Blake beobachtete ihn auf dem Monitor im Zentralbüro. Jeder Häftling in SuperMax konnte sich religiöse Sendungen anschauen, wenn er wollte. Jüdische, katholische, islamische - alles, was es so gab.
Blake fand das übertrieben.
Vor allem was den Jemeniten betraf. Für ihn, Blake, war dieser Mann nicht einfach nur ein Terrorist, ein Bombenleger wie Kaczynski oder McVeigh - für ihn war er ein Feind der amerikanischen Nation. Ein Feind der Army.
Bin Assir hatte schließlich nicht irgendwen in die Luft gesprengt - Marines waren durch sein Attentat ums Leben gekommen. Blakes Kameraden.
Gegen Abend, nach dem Essen, lief Bin Assir wieder mit dem Buch in den Händen in seiner Zelle auf und ab. Diesmal beobachtete Blake W. Stockman ihn direkt von der Eisengitterwand aus, die Bin Assirs Zelle vom Gang trennte. "Was liest du da?"
Der Jemenit hob das Buch, so dass Blake die arabischen Schriftzeichen auf dem Einband erkennen konnte. "Den Koran."
Blake nickte und ging zurück ins Zentralbüro. Mit verschränkten Armen stand er vor den Monitoren. Der islamische Bombenleger blätterte in seinem Heiligen Buch hin und her. Manchmal bewegte er stumm die Lippen.
"Vom Wahnsinn angenagt..." Der Chef des Wachpersonals schüttelte den Kopf. Blake begriff nicht, dass Männer, die andere Menschen heimtückisch getötet hatten, beteten und ihre Heiligen Schriften studierten.
Er überlegte, ob Bin Assir schon in den ersten Wochen in SuperMax gebetet und den Koran studiert hatte. Genau konnte er sich nicht mehr erinnern. Er nahm sich vor die Dienstprotokolle jener Jahre herauszusuchen. Allerdings war er ziemlich sicher, den Terroristen in den letzten Monaten häufiger beim Gebet beobachtete zu haben, als noch im Sommer letzten Jahres. Er fragte sich, ob es im Islam auch so etwas wie Reue und Umkehr gab...
"Sag mal, Joey", wandte er sich an Joe Burger, einen seiner jüngeren Kollegen. "Seit wann liest Bin Assir dieses Buch?"
"Den Koran? Seit Ende letzten Jahres. Er hat einen Antrag gestellt. Und der Direktor hat die Schwarte genehmigt."
"Wieso hab ich das nicht mitgekriegt?"
Joe Burger zuckte mit den Schultern. "Muss in deinem Weihnachtsurlaub gewesen sein..."
*
London, wahrscheinlich im selben Monat
Fast jeder hätte Patricia McGovern als glückliche Frau bezeichnet. Abgesehen von Menschen, die in die Zukunft blicken können. Aber wer kann das schon?
Patricia McGovern konnte es nicht. Und so hielt sie selbst sich auch für eine glückliche Frau. Seit Monaten schon. Auch an diesem nasskalten Londoner Wintermorgen noch, als sie von der Peel Street im Londoner Stadtteil Kensington in den prachtvollen Altbau trat, in dessen drittem Obergeschoss sich ihre Wohnung befand.
Oder Hendrik Winters Wohnung, genauer gesagt. Vor etwas mehr als einem halben Jahr war Patricia zu ihrem fünfzehn Jahre älteren Lover nach Kensington gezogen. Auch das ein Mosaikstein ihres andauernden Glücks. Ein ziemlich großer sogar.
Sie schüttelte den Regenschirm über der Vortreppe aus, drückte die schwere Eichentür auf und steuerte die Briefkästen an. Den Regenschirm unter den Arm geklemmt und die Einkaufstasche zwischen den Knien - Patricia hatte Brötchen geholt - öffnete sie den Briefkasten. Wie jeden Morgen seit fast zwei Wochen. Und wie jeden Morgen klopfte ihr Herz dabei.
Richtig: Sie erwartete Post. Nicht irgendwelche Post.
Patricia stand zu jener Zeit gewissermaßen vor einer wichtigen Weichenstellung ihres weiteres Lebens. Die Frage war, ob sie sich nach abgeschlossenem Studium der deutschen Sprache eine Stelle als Lehrerin suchte - einen Job, den Patricia sich nicht anders als langweilig vorstellen konnte - oder sich ihr Lebenstraum vielleicht doch noch erfüllen sollte.
Ihr Lebenstraum war es, als Stewardess in der Weltgeschichte herumzufliegen.
Die beiden Briefe, die sie seit zwei Wochen herbeisehnte, würden die erst halboffene Tür zu diesem Traum entweder vollständig aufstoßen oder ein für allemal schließen. Wenigstens einer der beiden Briefe würde das tun. Patricia hoffte natürlich auf die weitoffene Tür zu ihrem Traum, möglichst noch mit rotem Teppich. Und sie hoffte das mit inbrünstiger Leidenschaft. Sie hatte sogar wieder angefangen zu beten, seit zwei Fluggesellschaften sie in die engere Auswahl gezogen hatten.
Ein halbes Dutzend Kuverts, die an Hendrik adressiert waren - von seinem Steuerberater, seinem Anwalt, seinem amerikanischem Verlag und von Fans. Patricias Liebhaber war Schriftsteller.
Ein Brief war handschriftlich an Hendriks Frau adressiert. Patricia runzelte verwundert die Stirn. Hendriks Frau wohnte schon seit fast einem Jahr nicht mehr hier in der Peel Street. Gleich nach der Trennung von Hendrik war sie nach Manchester gezogen.
Nacheinander zog sie die Briefe aus dem Postkasten. Und dann entfuhr ihr ein Schrei - ein Brief für sie! Von der British Midlands! Und noch einer! Von der British Airways!
"Ich glaub's nicht...", rief sie mit weinerlicher Stimme. "Ich glaub's einfach nicht...!"
Zwei Wochen wartete sie auf den Bescheid zweier Fluggesellschaften, und nun trudelten beide Briefe an ein und demselben Tag ein! Patricia atmete tief durch, stopfte Hendriks Post zu den Brötchen in die Einkaufstasche und wollte den ersten der beiden Briefe öffnen, den von der British Midlands.
Und wenn nun beide absagen...
Der Gedanke war ihr nie zuvor gekommen. Patricia war erfüllt von der Überzeugung, dass etwas, dass man von ganzem Herzen will, einem auch irgendwann in den Schoß fällt. Doch jetzt, vor dem offenen Briefkasten, die ersehnte Post in den Händen - jetzt kam ihr der Gedanke. Er fiel geradezu über sie her.
Wenn nun beide absagen...
"Das verkrafte ich nicht...", murmelte sie. "Das würde ich nicht verkraften..." Die Briefe in ihren Händen zitterten. Sie legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und atmete noch einmal tief durch. Und noch einmal, und noch einmal...
So, wie sie da in dem düsteren Treppenhaus stand - in ihrem langen, weißen Trenchcoat, mit ihrem blonden Pagenschnitt, ihrem blassen Teint und dem hübschen, weichen Gesicht - hätte ein phantasievoller Beobachter sie leicht für einen Engel halten können. Zumal sie, wie gesagt, mit geschlossenen Augen zur Decke des Treppenhauses hinaufblickte.
Ganz und gar nicht weit hergeholt dieser Eindruck - schon ihr Vater nannte sie liebevoll Angel, bis über ihre Pubertät hinaus. Und auch Hendrik pflegte Angel zu nennen. Und nicht nur in besonders zärtlichen Augenblicken nannte er sie so.
Patricia McGovern gehörte zu der Art Frauen, die bei bärbeißigen und starken Männern einen Beschützerinstinkt auslöste: Schmal, klein, zerbrechlich, ein wenig kindlich, ein wenig ätherisch - engelhaft eben.
Äußerlich jedenfalls machte Patricia diesen Eindruck. Natürlich hatte sie noch eine ganz andere Seite. Anders hätte sie sich nicht bei zwei Fluggesellschaften gemeinsam mit jeweils fünfzehn anderen Bewerberinnen gegen über vierhundert junge Frauen durchgesetzt, die genau wie sie davon träumten als Stewardessen durch die Welt zu jetten.
Mit diesen jeweils fünfzehn Konkurrentinnen hatte sie bei beiden Fluggesellschaften ein Accessment-Center absolviert, bei dem fünf zukünftige Stewardessen ausgesiebt werden sollten.
Was ein Accessment-Center war, begriff Patricia auch erst, als sie sich plötzlich in der ersten dieser eintägigen Marathonsitzungen wiederfand und gezwungen war, in Rollenspielen, Interviews, Intelligenztests und so weiter ihre Schokoladenseiten herauszukehren.
Das Ergebnis des Ausleseverfahrens hielt sie jetzt in ihren schmalen Händen. Das Ergebnis beider Auslesesitzungen.
Sie öffnete die Augen. Gefasst blickte sie auf den Brief von der British Midlands. "Ich bin durchgefallen", murmelte sie. "Ganz bestimmt bin ich durchgefallen. Weil ich zu klein bin... ich bin einfach zu klein, um Stewardess werden zu können..." Sie riss das Kuvert auf.
Die Gefühl zu klein für einen solchen Job zu sein, war keineswegs an den Haaren herbeigezogen. Patricia war genau hundertsechzig Zentimeter groß. Die absolute Untergrenze für eine Stewardess.
Die Fluggesellschaften legten diese Untergrenze nicht etwa deshalb fest, weil sie ein bestimmtes Schönheitsideal vertraten, nach dem Frauen besonders groß zu sein hatten. Nein - das Maß hundertsechzig Zentimeter hatte rein praktische Gründe: Die Sauerstoffmasken in einer Verkehrsmaschine sind unter der Decke des Passagierraums angebracht. Wer nicht mindestens hundertsechzig Zentimeter groß war, erreichte sie selbst dann nicht, wenn er sich auf die Zehenspitzen stellte.
Patricia entfaltete den Brief und las murmelnd. "Sehr geehrte Miss McGovern, wir freuen uns außerordentlich, Ihnen mitteilen zu können, dass..."
Patricia riss beide Arme hoch. Der Regenschirm knallte auf die Fliesen. "Yea!", brüllte sie. "Yea!" Sie drückte den Briefkasten zu, packte Tasche und Schirm und stürzte die Treppe hinauf. Schreiend vor Glück.
Hendrik stand an der offenen Apartmenttür - im Morgenmantel und die rechte Gesichtshälfte mit Rasierschaum bedeckt. Verwundert blickte er ihr entgegen.
"Yea!", schrie Patricia. "Ich hab's geschafft! Ich bin durch!" Sie ließ Tasche und Schirm fallen und warf sich an Hendriks breite Brust. "Ich wusste, dass ich es schaffen würde! Ich wusste es! Yea - ich wusste es...!"
Später saßen sie am runden Esszimmertisch. Hendrik Winter noch immer im Morgenmantel und halb eingeseift, und Patricia noch immer in ihrem hellen Trenchcoat. Hendrik las den Brief, wieder und wieder las er ihn. "Gratuliere, Angel, herzlichen Glückwunsch..."
Hendrik war ein großer Mann - fast zwei Köpfe größer als Patricia - von athletischem Körperbau, mit haariger Brust, breitem Schädel und angegrauten, störrischen Locken. Ein dichter Schnurrbart wucherte unter seiner Hakennase. In wenigen Wochen würde er seinen fünfundvierzigsten Geburtstag feiern. Aber seit er Patricia kannte, fühlte er sich wie fünfundzwanzig. Hendrik Winter, eigentlich US-Amerikaner, lebte seit neun Jahren in Großbritannien.
Er freute sich aufrichtig mit seiner kleinen Freundin, aber ganz ungetrübt war seine Freude nicht. Hendrik Winter hatte noch nie in seinem Leben eine Flugreise unternommen: Die Vorstellung, es je zu tun, veranlasste seinen Magen regelmäßig, sich zu einem zähen Klumpen zusammenzuziehen.
Außerdem hatte er sich an den Gedanken gewöhnt seine kleine Patricia um sich zu haben. Als Lehrerin würde die jeden Nachmittag nach Hause kommen...
"Ich bin eine Stewardess, ich fliege um die ganze Welt..." Patricia sang diese Worte zur Melodie der englischen Nationalhymne, während sie zum Kühlschrank ging. "...ich bin eine wunderbare, schöne, kleine Super-Stewardess, ich fliege von Paris nach Madrid, von Rom nach Kairo, von Damaskus nach Kalkutta..." Sie holte eine Flasche Sekt aus dem Türfach und kehrte zu Hendrik ins Esszimmer zurück.
"Die British Midlands fliegt meines Wissens nur Städte in Westeuropa an." Es klang, als wollte Hendrik sich selbst trösten. "Allenfalls noch Südost-Europa..."
"Ganz egal - ich werde Stewardess sein, ganz egal... hier, mach die Flasche auf!" Hendrik entkorkte den Sekt, während Patricia Gläser aus dem Schrank holte.
"Und der zweite Brief?" Der Korken entglitt Hendriks Pranken und knallte gegen die Stuckdecke. Hastig schenkte er ein. "Von wem ist der zweite Brief?"