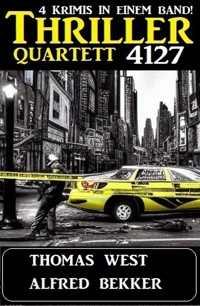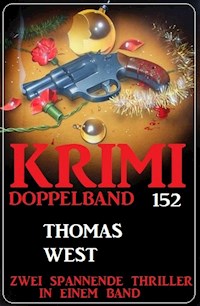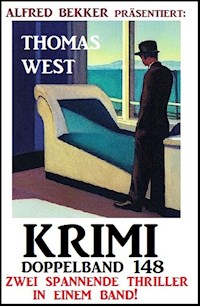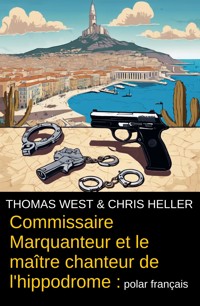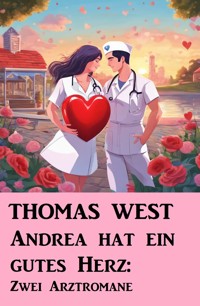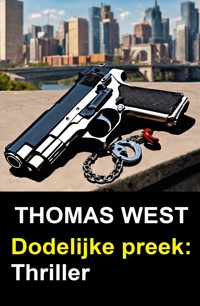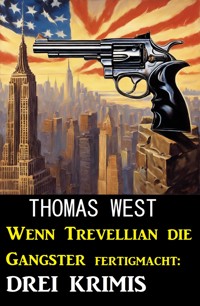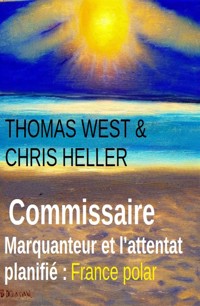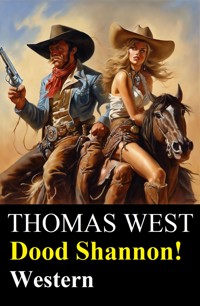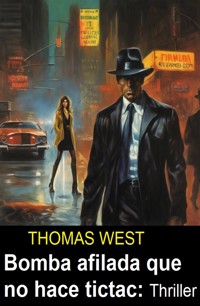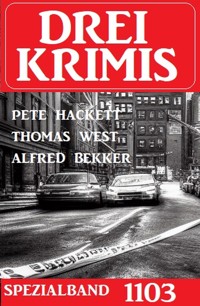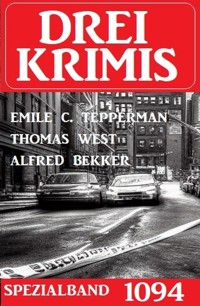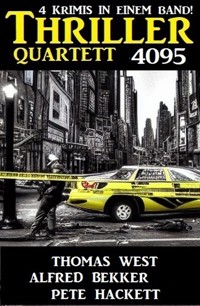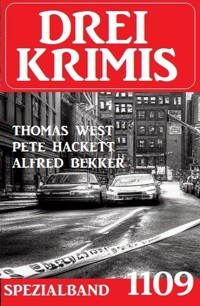
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
von Alfred Bekker, Thomas West, Pete Hackett (399) Über diesen Band: Dieser Band enthält folgende Krimis: Trevellian und die mörderische Schwester (Pete Hackett) Tödliche Zwickmühle (Thomas West) Kubinke und das Netz der Verschwörer (Alfred Bekker) image Als die Freundin des FBI-Agenten Trevellian entführt wird, muss er die Seiten wechseln, um ihr Leben zu retten. Ein Schwerverbrecher soll befreit werden, um weitere Straftaten begehen zu können. Trevellian muss bis an seine Grenzen gehen. Wird er seinen Diensteid gegenüber der Regierung brechen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Thomas West, Pete Hackett
Drei Krimis Spezialband 1109
Inhaltsverzeichnis
Drei Krimis Spezialband 1109
Copyright
Trevellian und die Mörderische Schwester: Action Krimi
Tödliche Zwickmühle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Kubinke und das Netz der Verschwörer: Kriminalroman
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Drei Krimis Spezialband 1109
von Alfred Bekker, Thomas West, Pete Hackett
von Alfred Bekker, Thomas West, Pete Hackett
Über diesen Band:
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Trevellian und die mörderische Schwester (Pete Hackett)
Tödliche Zwickmühle (Thomas West)
Kubinke und das Netz der Verschwörer (Alfred Bekker)
Als die Freundin des FBI-Agenten Trevellian entführt wird, muss er die Seiten wechseln, um ihr Leben zu retten. Ein Schwerverbrecher soll befreit werden, um weitere Straftaten begehen zu können. Trevellian muss bis an seine Grenzen gehen. Wird er seinen Diensteid gegenüber der Regierung brechen?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker (https://www.lovelybooks.de/autor/Alfred-Bekker/)
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian und die Mörderische Schwester: Action Krimi
Pete Hackett
Pete Hackett
Trevellian und die Mörderische Schwester: Action Krimi
––––––––
Trevellian und die Mörderische Schwester: Action Krimi
Krimi von Pete Hackett
––––––––
Der Umfang dieses Buchs entspricht 114 Taschenbuchseiten.
––––––––
Der Selbstmord von Robby Whitmore löst eine Lawine aus. Seine Schwester beginnt einen Rachefeldzug auf die Leute, die Robby in den Tod getrieben haben: Namhafte Personen, die Sexorgien feiern und die Rauschgiftabhängigkeit der Jugendlichen für ihre perversen Spiele ausnutzen. Das FBI bekommt es mit schmutzigen Triebtätern zu tun.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker (https://www.lovelybooks.de/autor/Alfred-Bekker/)
© Roman by Author /COVER FIRUZ ASKIN
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Robby Whitmore hockte neben den Gleisen der Staten Island Rapid Transit Railway. Über ihm spannte sich die Bayonne Bridge. Die Lichter der Häuser von Bergen Point spiegelten sich im Kill van Kull Strom. Wenn Robby den Blick nach Nordosten wandte, konnte er die hell erleuchtete Freiheitsstatue vor der glitzernden Kulisse Manhattans sehen.
Der 17-jährige nahm noch einmal alle Eindrücke in sich auf, die sich ihm boten. Dunkelheit umgab ihn. Er fragte sich, ob er wohl im Waisenhaus schon vermisst wurde. Würde ihn McRaney suchen lassen? Egal! Robby wollte nicht mehr.
Die Gleise vibrierten. Fernes Dröhnen drang an Robbys Gehör. Der Zug nahte. Sekundenlang umkrampfte grenzenlose Angst das Herz des Jungen. Er gab sich einen Ruck, erhob sich und trat entschlossen auf den Schienenstrang. Er verfluchte sie alle!
Die Lichter der Lokomotive durchbrachen die Finsternis. Das Dröhnen nahm zu. Dann sah Robby den Zug, der sich aus der Dunkelheit schälte. Er erinnerte an eine riesige Raupe, an ein alles verschlingendes Ungeheuer. Mit unverminderter Geschwindigkeit raste er heran. Der Lärm wurde ohrenbetäubend. Dann kam der fürchterliche Schlag, der alles auslöschte. Robby spürte keinen Schmerz. Die absolute Finsternis kam schlagartig und war endgültig. Der Körper des Jungen wirbelte durch die Luft. Ein junges Leben hatte ein brutales Ende gefunden!
Er hatte es nicht mehr ausgehalten. Man hatte ihn zum Liebes-, zum Sexsklaven degradiert. Er wollte den geilen Perverslingen mit den dicken Brieftaschen nicht mehr länger zu Willen sein. Lieber war er tot.
Der Lokführer war der Meinung, ein Stück Wild war ihm vor die Lokomotive gelaufen. Er gab eine entsprechende Meldung durch und raste mit unverminderter Geschwindigkeit weiter – seinem Ziel entgegen.
Am Morgen wurde die total verstümmelte Leiche Robby Whitmores neben dem Schienenstrang entdeckt. Ein Staatsanwalt verfügte die Überführung ins gerichtsmedizinische Institut. Bei der Polizeidienststelle von Port Richmond auf Staten Island war zwischenzeitlich eine Anzeige des Waisenhauses eingegangen, wonach ein 17-jähriger namens Rob Whitmore seit dem Abend vermisst werde. Der Junge wurde als mittelgroß, schlank und blondhaarig beschrieben. Als besonderes Kennzeichen war eine zwei Zoll lange Narbe am Kinn angegeben.
Die Polizei stellte sofort einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Jungen und der Leiche her.
Zwei Cops fuhren beim St.-Lukas-Waisenhaus in der Wilcox Street vor. Dem Hausmeister gegenüber erklärten sie, dass sie gerne Mr. McRaney gesprochen hätten. Sie wurden gebeten, in der Halle des alten Bauwerks zu warten. Es gab hier eine Polstermöbelgruppe und einen niedrigen Tisch, auf dem einige Zeitschriften und die New York Times vom aktuellen Tag lagen.
Der Leiter des Heimes, Jack McRaney, ließ nicht lange auf sich warten. Er schaute verunsichert, wie in der Erwartung einer unerfreulichen Nachricht.
„Es sieht so aus, Mr. McRaney“, begann einer der beiden Polizisten, „als wäre der von Ihnen als verschwunden gemeldete Rob Whitmore gefunden worden. Tot. Wahrscheinlich Selbstmord. Seine verstümmelte Leiche lag an den Gleisen der Staten Island Rapid Transit Railway, unter der Bayonne Bridge.“
Das Gesicht McRaneys hatte eine blasse Färbung angenommen. Jeder Blutstropfen schien daraus entwichen zu sein. In seinen Mundwinkeln zuckte es. Aus seinen Augen sprach Fassungslosigkeit.
„Er – er ist tot?“, brach es erschüttert aus seiner Kehle. Er schluckte krampfhaft. „Vom – vom Zug überfahren?“
Der Cop nickte. „Er wurde in die Pathologie verbracht. Wir sollen Sie ebenfalls dorthin bringen, Mr. McRaney, damit Sie den Jungen identifizieren. Haben Sie eine Ahnung, was ihn veranlasst haben könnte, sich vor den Zug zu werfen?“
McRaney schaute geistesabwesend. Sekundenlang schwieg er, und der Polizist wollte seine Frage schon wiederholen, als der Heimleiter leise sagte: „Vielleicht war er unglücklich. Nachdem vor einem Jahr seine Schwester das Waisenhaus verlassen durfte, weil sie volljährig wurde, ging es mit Robby immer mehr bergab. Seine Schulnoten wurden immer miserabler. Er tanzte aus der Reihe, war aufsässig und frech geworden.“
„Er hat eine Schwester?“
„Ja, Patricia. Die Eltern der beiden verunglückten, als sie vier und sechs Jahre alt waren. Niemand wollte sich der beiden Kinder annehmen, also landeten sie bei mir.“
McRaneys Miene wies einen schmerzlichen Ausdruck auf. Die beiden Polizisten mussten annehmen, dass ihn das Schicksal des jungen Rob Whitmore betroffen und fassungslos machte. Es war ein fast weinerlicher Gesichtsausdruck, den er zur Schau trug.
„Es – es waren gute Kinder“, fügte er hinzu und schniefte. Dann durchfuhr ihn ein Ruck. „Lediglich seit einem Jahr spielte Robby manchmal verrückt. Vielleicht lag es am Alter. Spätpubertäre Erscheinungen.“ Er zuckte mit den Achseln. „Weiß der Himmel, was sich in Robbys Psyche abspielte, nachdem seine Schwester das Heim verlassen hatte.“
„Wenn Sie jetzt so freundlich wären“, murmelte der Polizist, der bisher auch schon das Wort geführt hatte.
„Natürlich. Ich holte nur meine Jacke.“ McRaney hastete davon und verschwand in einem Raum im Erdgeschoss des Gebäudes, das fast 40 Waisenkindern Platz und Fürsorge bot.
„Der arme Junge“, murmelte Jameson Parker, der Hausmeister, der alles gehört hatte. „Nun ja, in letzter Zeit wirkte er schon etwas verstört. Aber dass er gleich Selbstmord begeht ...“ Ungläubig schüttelte der Mann den Kopf.
Jack McRaney kam zurück. Er trug jetzt eine altmodische Jacke mit Fischgrätenmuster und Schultern, die aussahen, als wären sie ausgepolstert. Er war überhaupt eine ziemlich farblose Erscheinung. Der 48-jährige war, was seine Kleidung betraf, ein erzkonservativer Typ.
„Kann ich mit Ihnen fahren? Bringen Sie mich wieder zurück?“, wollte er wissen. Ein angedeutetes, verlegen anmutendes Lächeln umspielte seine Lippen. „Oder soll ich selbst ...“
„Nein, wir bringen Sie zum gerichtsmedizinischen Institut und fahren Sie auch wieder hierher zurück, Mr. McRaney“, erklärte der Cop. „In Ihrem erregten Zustand wäre es vielleicht nicht gut, wenn Sie selber fahren würden.“
„Danke.“
Die Fahrt nach Manhattan dauerte eine halbe Stunde. Eine Viertelstunde später identifizierte Jack McRaney den toten Jungen als Rob Whitmore. „Ja, das ist Robby“, würgte er hervor und wandte sich ab. „Großer Gott.“
Das weiße Tuch wurde wieder über das entstellte Gesicht des Toten gezogen. McRaney wankte. Einer der Polizisten stützte ihn. „Es – es ist so furchtbar“, stammelte McRaney.
Der Cop nickte.
2
Patricia Whitmore hielt den Brief in der Hand. Am Morgen hatte sie in den Lokalnachrichten vernommen, dass an der Linie der Staten Island Rapid Transit Railway der Leichnam eines jungen Mannes aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen, so der Nachrichtensprecher, lag ein Selbstmord vor, schied Fremdverschulden also aus.
Pat hatte sich nichts Schlimmes gedacht, als sie es vernahm. Sie war zur Arbeit gefahren, wie jeden anderen Werktag auch. Aber nun ...
Die Augen der jungen, hübschen Frau schwammen in einem See von Tränen. Ihr Gesicht wies eine ungesunde, bleiche Farbe auf. Draußen begann es zu dämmern. Vor zehn Minuten etwa war sie von der Arbeit nach Hause gekommen. In ihrem Briefkasten hatte Robbys Brief gelegen.
Ja, es war Selbstmord.
Ja, Fremdverschulden schied aus.
Niemand wusste es genauer als Patricia.
Und dennoch war Robby nicht freiwillig in den Tod gegangen. Er war in den Selbstmord getrieben worden. In dem Brief stand es. Noch einmal las ihn Patricia. Die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen.
„McRaney!“, brach es schließlich über ihre bebenden Lippen. „Du Schwein! Du dreckiges, mieses Schwein.“
Der Hass kam bei Patricia in rasenden, giftigen Wogen. Er glomm in den blauen Augen des Girls und wütete in seinen Zügen. „Dafür wirst du büßen. Und jeder andere auch.“
Patricia schaute geistesabwesend den Rest der Post durch, die sie aus dem Briefkasten entnommen hatte. Zwei Umschläge samt Inhalt wanderten ansatzlos in den Abfalleimer, denn es handelte sich um die Reklamen eines Fitnessstudios und einer Lottogesellschaft. Dann las sie eine Mitteilung der Polizei, dass sie beim Revier in der 54. Straße anrufen sollte. Die Telefonnummer war vermerkt.
Nur nach und nach gelang es Patricia, den Aufruhr in ihrem Innersten unter Kontrolle zu bekommen. Sie zwang eine klare Linie in ihr Denken und ahnte, weshalb sie bei der Polizei anrufen sollte. Man wollte sie vom Tod Robbys in Kenntnis setzen. Einen anderen Grund gab es nicht.
Warum, Robby?, brüllte alles in dem Mädchen. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Warum hast du das alles in dich hineingefressen und dich schließlich vor den Zug geworfen? Robby! Warum?
Sie fand keine Antwort auf diese bohrenden Fragen. Zuletzt hatte sie Robby vor zwei Wochen im Waisenhaus besucht. Er wirkte etwas verstört, fahrig, abwesend. Warum hatte er nicht mit ihr darüber gesprochen?
Patricia wischte sich mit dem Handrücken die Augen trocken. „Du hast McRaney und die Schweine, die dir das angetan haben, in deinem Brief verflucht, Robby“, flüsterte sie mit belegter, heiserer Stimme. „Und ich werde dafür sorgen, dass sich dein Fluch erfüllt. Mein Wort drauf, Robby.“
Es klang wie ein Schwur, wie eine böse Prophezeiung.
Mit zitternder Hand griff Pat zum Telefonhörer. Sie tippte die Nummer, die auf der polizeilichen Mitteilung vermerkt war, und gleich drauf hatte sie eine Verbindung. Sie nannte ihren Namen. Der Polizist druckste ein wenig herum, es war, als suchte er nach den richtigen Worten.
„Miss Whitmore“, sagte er schließlich, „es ist – ich muss Ihnen leider eine unerfreuliche, eine traurige Mitteilung machen. Ich – ich hoffe, Sie sind stark genug.“
„Es ist wegen meines Bruders, nicht wahr?“, unterbrach ihn Patricia. „Er ist tot. Ich habe ...“ Sie brach ab, dachte kurz nach. „Es ist doch wegen Robby?“ Nach außen hin wirkte sie jetzt gefasst, nahezu kühl.
„So ist es, Miss Whitmore. Er hat sich vom Zug überfahren lassen. Jetzt befindet er sich im gerichtsmedizinischen Institut. Mr. McRaney, der Leiter des Heimes, in dem Ihr Bruder lebte, hat ihn identifiziert.“
Bei Nennung des Namens McRaney schienen Pats Augen zu Eis zu gefrieren.
„Woher wussten Sie, dass Ihr Bruder tot ist?“, hörte sie den Polizisten fragen. „Hat man Sie schon von Seiten des Waisenhauses unterrichtet?“
„Ja“, kam es versonnen von Pat. „Das Waisenhaus.“
„Es ist tragisch“, sagte der Polizist mit dem Ausdruck des tiefen Bedauerns. „Ich schätze, morgen wird der Leichnam freigegeben. Sie werden dann für die Beerdigung sorgen müssen. Ich möchte Ihnen mein Beileid ausdrücken, Miss.“
„Natürlich“, murmelte Sarah. „Vielen Dank.“ Sie legte auf. Mit erloschenem Blick ließ sie sich auf die Couch fallen. Düstere Gedanken zogen durch ihren Verstand. Ein Fluch war Robbys Vermächtnis. Er war tot. Robby hatte keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Er war unwiederbringlich von dieser Welt gegangen. Patricia konnte nichts anderes mehr denken. Und es trieb den Hass immer tiefer in ihr Gemüt – einen verzehrenden, grenzenlosen Hass, der keine Zugeständnisse und kein Entgegenkommen kannte.
In seinem Brief verfluchte er McRaney.
McRaney!, hämmerte es hinter Patricias Stirn. Immer wieder: McRaney!
Dann fasste Patricia einen Entschluss. Das Mädchen erhob sich abrupt, holte seine Handtasche und verließ das Apartment in der 52. Straße. Es lief ein Stück nach Osten und setzte sich in der Nähe des Rockefeller Centers in ein Taxi. „Wilcox Street, Staten Island, zum St.-Lukas-Waisenhaus“, wies sie den Cab Driver an.
Die Fahrt ging nach Süden, durch den Holland Tunnel gelangte das Yellow Cab nach New Jersey, und über die Bayonne Bridge schließlich nach Staten Island. Bei dem Waisenhaus bezahlte Pat den Cabby. Es war jetzt finster. Aus vielen Fenstern des großen Gebäudes fiel Licht. Es lag etwas zurückversetzt in einem großen Garten. Eine breite, geteerte Zufahrt führte zu den beiden Garagen, die angebaut worden waren.
Der Hausmeister ließ Patricia eintreten. Gleich darauf saß sie Jack McRaney gegenüber. Er schaute zerknirscht, ganz so, als wäre sein leiblicher Sohn vom Zug getötet worden.
Heuchler, niederträchtiger Heuchler!, durchfuhr es Patricia wie ein Blitzstrahl. Aber dir wird es vergehen!
3
Sarah Anderson und ich waren auf dem Weg ins New York University Medical Center, um James Steele, einen Mafiaboss, festzunehmen. Er war lebensgefährlich verletzt worden, nachdem auf sein Haus ein Überfall mit einer Boden-Luft-Rakete verübt worden war. Sarah und ich, die dem Gangster Personenschutz zu gewähren hatten, waren zufällig nicht im Haus gewesen, als der Anschlag geschah. Zwei Bodyguards des Mafioso waren ums Leben gekommen.
Nachdem uns Dave Fitzgerald den Drogenlieferanten Steeles verraten hatte, und dieser sich als sehr geständig erwies, war es uns ein inneres Bedürfnis, James Steele zu verhaften.
Er lag nicht mehr auf der Intensivstation, sondern in einem Einzelbettzimmer. Sein Kopf und seine Hände waren dick bandagiert. Steele hatte Verbrennungen ersten und zweiten Grades erlitten. In seinem rechten Arm steckte eine Kanüle, von der aus ein dünner Schlauch zu einem Tropf führte, von dem aus dem Gangster eine wasserklare Lösung intravenös verabreicht wurde.
Ein Arzt begleitete uns. Ehe wir das Krankenzimmer betraten, wies er uns darauf hin, dass wir den Patienten nicht allzu sehr beanspruchen sollten, da er der Ruhe bedürfe.
James Steele war bei Bewusstsein. Unter den Verbänden hervor, die sein Gesicht bedeckten, schaute er uns mit trübem Blick an. Erkennen blitzte in seinen Augen auf.
Ich sagte: „Von Ihrem Arzt weiß ich, dass Sie sich auf dem Weg der Genesung befinden, Steele. Den Anschlag haben Sie im Übrigen Dave Fitzgerald zu verdanken. Aber den haben wir zwischenzeitlich auf Nummer Sicher. Ebenso Ihren Drogenlieferanten, den Kolumbianer Fernando Valdez. Er hat gestanden, dass Sie einer seiner Hauptabnehmer harter Drogen wie Heroin und Marihuana waren. Wir verhaften Sie daher, Steele. Alles was Sie von nun an von sich geben, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Es steht Ihnen frei ...“
Ich leierte die Litanei herunter, die bei jeder Verhaftung vorgeschrieben war und die damit endete, dass ich den Gangster darauf hinwies, dass es ihm freigestellt sei, einen Anwalt seiner Wahl zu konsultieren.
Und während ich sprach, verspürte ich ein tiefes Gefühl des Triumphs in mir. Wer zuletzt lacht ...
Steele schwieg. Ich rief beim Police Department an und bat, zwei Polizisten zur Universitätsklinik abzuordnen, damit sie das Zimmer Steeles bewachten. Man sagte mir zu, die beiden Cops unverzüglich zu schicken.
Ich wandte mich, als mein Handy wieder in der Tasche steckte, erneut an Steele. „Wir werden Ihnen auch die illegale Prostitution nachweisen, Steele, und die Schutzgelderpressungen, die Sie in Südmanhattan bei Gastwirten und Geschäftsleuten in Szene gesetzt haben. Und in diesem Zusammenhang kommt sicher auch Licht in das Dunkel, in dem derzeit noch einige Morde liegen. Ich werde alles tun, Steele, um zu verhindern, dass Sie die Freiheit jemals wiedersehen.“
Der Mafioso knirschte mit den Zähnen. „Fahr zur Hölle, Trevellian!“
Sarah und ich verließen das Zimmer. Unten, in der Eingangshalle, warteten wir auf die Ankunft der beiden Police Officer. Sie ließen nicht lange auf sich warten. Wir wiesen sie in ihre Aufgabe ein, und die beiden traten ihren Dienst vor dem Krankenzimmer des Mafioso an. Sobald er haftfähig war, würde Steele ins City Prison überführt werden.
Während wir zur Federal Plaza zurückfuhren, brachte der Nachrichtensender die Geschichte vom Selbstmord eines 17-jährigen in Staten Island.
„Tragisch“, murmelte Sarah. „Was mag in einem solchen Menschen wohl vorgehen?“
Wir hatten in dieser Minute keine Ahnung, wie sehr uns das Schicksal Robby Whitmores noch beschäftigen sollte.
Ehe wir zu Steele gefahren waren, hatten wir beschlossen, die Clubs, die Steele in Südmanhattan betrieb, auf den Kopf zu stellen. Sicher gingen uns einige Dealer und illegale Huren ins Netz, die für Steele arbeiteten. Vielleicht plauderte auch der eine oder andere seiner Geschäftsführer und Vertrauten aus der Schule, wenn er sich in die Enge getrieben sah.
Mit Unterstützung des Police Department wurden gegen Mitternacht die fünf Barbetriebe, die James Steele sein Eigen nannte, umstellt. Sarah und ich befanden uns mit einer Gruppe von Leuten in der Barclay Street vor der „Silver Moon Bar“. Sie war im Erdgeschoss eines Hochhauses untergebracht. Auf dem Gehsteig davor lungerten zwei Kerle in Jeansanzügen herum. Hin und wieder wurden sie angequatscht. Sie unterhielten sich mit Leuten, die in die Bar gingen oder sie verließen, dann verschwanden sie mit einem Pärchen in einer Einfahrt.
Ich ahnte, dass ein Deal ablief.
Ich schaute auf meine Uhr. Es war eine Minute vor null Uhr. Von der Bar aus war ich im Schattenfeld einer Passage zwischen zwei Häusern nicht zu sehen. Polizei hatte die Bar umstellt. Punkt null Uhr wollten wir bei sämtlichen Etablissements gleichzeitig zuschlagen.
Die beiden Dealer und das Pärchen kamen auf den Gehsteig zurück. Das Pärchen wandte sich nach links. Ich wollte nicht länger warten. Ehe die beiden verschwanden, sagte ich in mein Walkie-Talkie: „Zugriff. Achtet auf das Pärchen und die beiden Dealer. Niemand darf entkommen.“
In den Schatten um das Gebäude herum und hinter geparkten Autos wurde es lebendig. Auch aus einigen Häusern auf beiden Straßenseiten kamen Polizisten. „O verdammt, die Bullen!“, brüllte jemand, dann trappelten Schritte auf dem Asphalt.
„Stehenbleiben! Police Department! Bleiben Sie stehen oder ich schieße!“
Einer der Kerle im Jeansanzug rannte in meine Richtung. Ich sah ihn unter seine Jacke greifen. Plötzlich blitzte es bei ihm auf. Er feuerte auf die Polizisten, die ihn verfolgten. Ich sah einen der Cops zu Boden gehen und sprang aus der Passage, in der mich die Finsternis gedeckt hatte wie ein schwarzer Vorhang.
Der Bursche sah mich und schlug auf mich an. Mein Bein zuckte hoch und traf seine Faust. Sein Arm wurde in die Höhe geschleudert, der Schuss peitschte, die Kugel pfiff über meinen Kopf hinweg. Und dann prallte ich gegen den Burschen. Ich packte ihn am Arm und drehte mich in ihn hinein. Im Hochrucken zog ich ihn über meine Schulter. Er schrie auf, seine Beine wirbelten durch die Luft, dann krachte er der Länge nach auf den Gehsteig. Seine Pistole schlitterte davon. Der Aufprall presste dem Kerl die Luft aus den Lungen, er japste erstickend nach Luft.
Dann waren auch schon zwei Cops heran, und ich überließ ihnen den Knaben.
Die meisten der Kollegen waren zwischenzeitlich in die Bar eingedrungen. Ehe sich das Personal und die Gäste versahen, waren Vorder- und Hinterausgang von Polizisten besetzt.
Ich sah zwei Kollegen bei dem Pärchen. Zwei andere rangen den anderen Dealer nieder. Ich vernahm aus der Kneipe Sarah Andersons Organ: „Keiner verlässt die Bar! Nehmen Sie Ihre Pässe heraus. Wir werden Sie einzeln überprüfen.“
Ich überzeugte mich, dass die beiden Dealer sowie das Pärchen festgenommen wurden, dann ging ich in die Bar. Von der ursprünglich sicher ausgesprochen schummrigen Atmosphäre war nichts mehr übrig. Überall brannten die Lampen. Es war taghell. Das Personal hatte sich am Ende des Tresens versammelt. Sarah und ein uniformierter Polizist prüften Ausweise. Wer sich ausweisen konnte und nicht verdächtig war, durfte die Bar verlassen.
Mein Handy dudelte. Es war Blackfeather, der mit seiner Gruppe die „Paradise Bar“ hops genommen hatte. Blacky sagte: „Wir haben hier alles unter Kontrolle, Jesse. Fünf Ladys und zwei Jünglinge sind in dem Laden der verbotenen Prostitution nachgegangen. Wir haben den Geschäftsführer und die Prostituierten verhaftet. Außerdem einen Dealer, der vor dem Lokal mit Ecstasy handelte.“
„Prima“, sagte ich, „auch bei uns scheint der Einsatz nicht umsonst gewesen zu sein, Blacky. Auf jeden Fall haben wir zwei Streetworker und zwei Aufkäufer geschnappt. Vielleicht werden wir im Lokal auch noch fündig. Wenn ich mich hier so umsehe, dann sehe ich Anhieb ein halbes Dutzend Girls, die sicher illegal anschaffen. Wir sehen uns im Building, Blacky.“
„Bis später“, sagte mein indianischer Kollege, dann unterbrach er die Verbindung.
Ich rief Jay Kronburg an. Er und seine Männer hatten das „Big Apple“ hochgenommen. Jay berichtete, dass er einige Kerle mit Heroin erwischt habe.
Auch Jennifer Johnson und Annie Francesco waren mit ihrer Gruppe erfolgreich gewesen. Ebenso Leslie Morell und George Maxwell, die das „Blue Shark“ hochgenommen hatten. Verbotenes Glücksspiel, illegale Prostitution, Drogenhandel und -konsum. Die Geschäftsführer der Betriebe wurden festgenommen. Die Girls und Jungs vom horizontalen Gewerbe, die ohne Genehmigung tätig waren, wurden zum Police Department befördert. Einige Dealer und Abnehmer wanderten in vorläufige Haft. Über ihr Schicksal musste der Haftrichter entscheiden.
Es war ein ziemlicher Erfolg gewesen.
Es war fast Morgen und der Tag graute schon im Osten, als wir im Federal Building eintrafen. Blackfeather sagte: „Die beiden Jünglinge, die in der Paradise Bar als Lustknaben tätig waren, sind erst sechzehn und siebzehn Jahre alt. Wenn ich dir sage, dass sie in einem Waisenhaus hier in New York leben, wirst du das kaum glauben. Man muss sich fragen, ob diese Halbwüchsigen in dem Waisenhaus denn keiner Kontrolle unterliegen, dass sie mitten in der Nacht in einer zwielichtigen Manhattaner Bar dem horizontalen Gewerbe nachgehen können.“
Diese Frage stellte ich mir in der Tat.
„Welches Waisenhaus?“, fragte ich.
„St. Lukas, in der Wilcox Street, Granitville, Staten Island.“
„Wo sind die Jungs jetzt?“
„Im Police Department zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Anschließend werden sie nach Hause gefahren.“
4
Drei Tage später wurde Robby beerdigt. Der einfache Sarg stand auf zwei Kanthölzern, die quer über das Grab gelegt waren. Nur wenige Trauergäste hatten sich eingefunden. Ein einfaches Blumengebinde lag auf dem Deckel des Sarges. Patricia Whitmore trug dunkle Trauerkleidung. Außer ihr gab es keine Angehörigen des Toten. An der Seite des Grabes standen Jack McRaney und einige Halbwüchsige aus dem Heim, die Robby nähergestanden hatten.
„... und zieh hin, du arme Seele, aus dieser Welt, im Namen des Allmächtigen ...“, hörte Patricia den Pfarrer sprechen.
Sie beobachtete McRaney. Der hatte die Finger vor dem Leib verschränkt und starrte auf den Sarg. In seinem Gesicht zuckte kein Muskel.
„... und erneuere in ihm, gütiger Vater, was durch des Satans Trug verdorben ist ...“, sickerte es wieder in Patricias Verstand.
Leise quietschte der Weihrauchkessel an den vier dünnen Ketten, den einer der Ministranten schwenkte. Der Geruch des Weihrauchs erfüllte intensiv die Luft.
Patricia war nur mit halbem Ohr bei der Sache. Die Stimme des Pfarrers erreichte die meiste Zeit nur den Rand ihres Bewusstseins. Ihre Gedanken waren bei Robby, der stumm und starr im Sarg lag.
„... und was er in seinem Erdenwandel aus menschlicher Schwäche gefehlt hat, Herr, das tilge durch deine verzeihende Barmherzigkeit und Liebe“, sickerte es wieder in Patricias Verstand. „Durch Christus, unseren Herrn.“
„Amen!“, sagten die beiden Ministranten.
Die vier Totengräbergehilfen zogen Stricke unter dem Sarg hindurch und hoben ihn an. Die beiden Querhölzer wurden hervorgezogen. Langsam wurde der Sarg in die Grube gesenkt. Patricia hatte das Gefühl, das Herz müsste ihr in der Brust zerspringen. Es überstieg ihr Begriffsvermögen.
Wieder folgte ein monotones Gebet, in das einige der Jugendlichen einstimmten.
„Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück, Robby“, setzte der Pfarrer hinzu. „Der Herr aber wird dich auferwecken am Jüngsten Tage.“
Der Pfarrer ließ eine Hand voll Erdreich in das Grab rieseln.
McRaney vermied es, Patricia anzusehen. Wenn sein Blick sie traf, irrte er sogleich wieder ab. Seine Wangenmuskeln vibrierten, wenn er die Zähne zusammenbiss. In der Tiefe seiner Augen wütete mörderische Wut auf dieses Mädchen, das ihn in der Hand hatte.
Sie war bei ihm gewesen und hatte ihm von dem Abschiedsbrief Robbys berichtet. Sie wollte Namen wissen, die Namen der Kerle, denen Robby zu Willen sein musste. Andernfalls wollte sie den Brief der Polizei zuspielen, und da sein Name als einziger in dem Brief erwähnt wurde, würde das eine Reihe unerfreulicher Fragen und Ermittlungen nach sich ziehen, an deren Ende für ihn, McRaney, das gnadenlose Aus stehen würde.
Da er das Vorhandensein des Briefes angezweifelt hatte, überließ Patricia ihm eine Kopie. Er trug sie bei sich.
Ja, er hatte Robby erpresst. Robby hatte im Heim mit Haschisch gedealt. In einem ganz kleinen Rahmen nur, aber wenn es der Polizei bekannt geworden wäre, würde es für die Erziehungsanstalt oder eine Gefängnisstrafe ausgereicht haben. Robby hatte es in seinem Brief zugegeben. „Daraufhin hatte McRaney mich in der Hand, Pat. Er schickte mich auf den Strich. Ich musste in der Paradise Bar und manchmal auch im Silver Moon anschaffen. Es gab einen gewissen Kundenstamm ...“
Das war die Anklage, die Robby in seinem Abschiedsbrief formuliert hatte.
Während der Pfarrer sprach, rieselte das alles durch den Kopf des Heimleiters. Er hatte mit James Steele, dem Mafioso, einen Pakt geschlossen. Es gab eben Kunden, die nicht auf Mädchen standen. Es gab andere Kunden, die sowohl Mädchen als auch Jungs wollten. Und James Steele wollte allen Wünschen seiner Kunden gerecht werden.
Die Polizei hatte Steeles Betriebe geschlossen, da Drogenhandel und illegale Prostitution nachgewiesen werden konnten. Tom Russel und Jim Wright waren in der „Paradise Bar“ bei der illegalen Prostitution erwischt worden. Die Polizei wusste, dass sie beiden 16- und 17-jährigen aus dem Heim kamen.
Er, McRaney, hatte den beiden Jungs gedroht. Er hatte sie eingeschüchtert. Sie würden ihn nicht belasten. Aber da war Patricia Whitmore. Ihr Bruder war tot. Sie war voll Hass auf ihn, McRaney, und auf die Männer, denen ihr Bruder zu Willen sein musste!
Sie muss sterben!, hämmerte es hinter der Stirn des verbrecherischen Heimleiters. Wie aus weiter Ferne hörte er die Stimme des Priesters. Nur unterbewusst nahm er wahr, dass die Burschen, die mit ihm gekommen waren, sich zu Patricia begaben, um ihr Mitgefühl auszudrücken.
Er bewegte sich wie in Trance. Dann stand er vor dem Mädchen. „Es tut mir leid um deinen Bruder, Pat“, murmelte er gepresst. „In unseren Herzen wird er ewig leben.“
Patricias Miene versteinerte. Der Blick, mit dem sie McRaney maß, ließ diesen frösteln. Sie entzog McRaney ihre Hand, bedankte sich knapp und wandte sich ab.
Die kleine Trauergemeinde löste sich auf.
McRaney ging zu seinem Auto. Es war ein Oldsmobile. Er konnte Patricia sehen, die langsam davon schritt. Das Mädchen hatte selbst kein Auto. Die Burschen aus dem Heim, die zur Beerdigung gekommen waren, begaben sich zur Omnibushaltestelle.
Der Oldsmobile holte Patricia ein. McRaney fuhr an den Gehsteig heran und ließ per Automatic das rechte Seitenfenster nach unten. „Willst du mitfahren?“
Patricia war stehengeblieben, bückte sich und schaute ins Wageninnere. Mit frostigem Tonfall sagte sie: „Nein, danke. Ich nehme mir ein Taxi.“
„Wir müssen noch einmal reden, Pat.“
„Ich wüsste nicht, was es zwischen uns noch zu bereden gäbe, McRaney. Ich habe Ihnen drei Tage Zeit gegeben, mir die Namen der Kerle zu nennen, die Robby missbraucht haben. Das Ultimatum läuft morgen ab. Habe ich morgen Abend die Namen nicht, bekommt die Polizei Robbys Abschiedsbrief.“
„Das ist Erpressung!“, knirschte McRaney.
Patricia verzog verächtlich den Mund. „Nennen Sie es, wie Sie wollen, McRaney. Im Übrigen machen Sie sich lächerlich. Erpressung!“ Patricia lachte klirrend auf. Dann schienen ihre Züge wieder zu gefrieren. „Entweder Sie nennen mir die Namen, oder die Polizei holt sie aus Ihnen heraus, McRaney. Dass Sie obendrein Ihren gut bezahlten Job los sein werden und hinter Gitter marschieren, dürfte Ihnen sicherlich klar sein.“
Das Mädchen ging hocherhobenen Hauptes weiter.
McRaney knirschte mit den Zähnen. Sie hatte ihn in der Hand – sie hatte sein ganzes zukünftiges Leben in der Hand. Sie konnte ihn fertig machen. Und wieder sagte er sich, dass Patricia sterben musste.
McRaney fuhr an. Er schaltete die Freisprechanlage an, wählte eine Nummer und ging auf Verbindung. Einige Male erklang das Freizeichen, dann sagte ein tiefer Bass: „Young.“
„Es gibt ein Problem, Walter“, erklärte McRaney. „Die Schwester Robbys hat einen Abschiedsbrief des Jungen in den Händen. Darin wird mein Name genannt. Die Schwester will nun die Namen der Männer wissen, die Robby vernascht haben. Andernfalls bekommt den Abschiedsbrief die Polizei. Ich stecke in einer ziemlichen Klemme.“
„Wo wohnt das Mädchen?“
„In der zweiundfünfzigsten Straße hat sie ein kleines Apartment.“
„Nummer?“
„Weiß ich nicht, dürfte aber nicht schwer sein, sie herauszufinden.“
„Finde sie heraus, McRaney. Ich kümmere mich um die Kleine. War wegen der Razzia in der Paradise Bar schon die Polizei im Heim?“
„Bis jetzt noch nicht. Das FBI hat Tommy Russel und Jimmy Wright einvernommen und dann laufen lassen. Sie haben meinen Namen nicht genannt. Den Bullen gegenüber haben sie angegeben, dass sie sich immer wieder heimlich aus dem Heim entfernt hatten, um sich einige Dollar zu verdienen.“
„Dennoch wirst du vom FBI Besuch kriegen, McRaney. Das Girl will die Namen bis morgen Abend, nicht wahr?“
„Ja. Ich werde Pat folgen, um das Haus herauszufinden, in dem sie wohnt. Dann sage ich dir Bescheid. Lass sie am Besten spurlos verschwinden, Walter. Ohne Leiche kein Mord. Jährlich verschwinden hunderte von Menschen spurlos.“
„Gib mir nur die Hausnummer, McRaney. Für den Rest wird gesorgt.“
Dann war die Leitung tot.
Patricia lief am Eingang des Friedhofes zu einem Taxi, setzte sich auf den Rücksitz und nannte das Ziel. McRaney, der das Mädchen in der Zwischenzeit überholt hatte, sah es im Rückspiegel. Er fuhr rechts ran und wartete, bis das Taxi an ihm vorbei gerollt war. Dann folgte er ihm.
5
Mr. McKee, der Special Agent in Charge des FBI New York, hatte Sarah Anderson und mich mit den Ermittlungen in dem Waisenhaus beauftragt. Die beiden Jugendlichen waren nach der Razzia nicht festgehalten worden, nachdem ihre Personalien sichergestellt waren.
Wir hatten den Geschäftsführer der „Paradise Bar“ verhört. Dass in seinem Betrieb illegale Prostitution betrieben worden war, wusste er nicht. Dass mit Drogen gehandelt wurde, ebenso wenig. Dass James Steele sein Boss war, war das einzige, was er zugab. Aber daran war ihm nichts vorzuwerfen. Dass die beiden Jugendlichen um Mitternacht in seinem Laden aufgegriffen worden waren, nötigte ihm lediglich ein Achselzucken ab. Er könnte nicht den Ausweis eines jeden Gastes kontrollieren, außerdem habe er zwei Türsteher beschäftigt, die darauf zu achten hatten, wer den Club betrat.
Kurz, aus dem Burschen war nichts herauszuholen.
Jetzt befanden wir uns in dem Waisenhaus. Der Hausmeister forderte uns auf, in der Halle zu warten, da Mr. Jack McRaney bei einer Beerdigung sei.
„Handelt es sich um den Jungen, der sich vom Zug überfahren ließ, der beerdigt wird?“, fragte Sarah.
Der Hausmeister nickte. „Armer Bursche. Hat nicht mal einen Abschiedsbrief hinterlassen. Nur Gott weiß, was ihn getrieben hat, als er seinem jungen Leben ein Ende setzte.“
„Sind Ihnen die beiden Burschen Tom Russell und Jim Wright bekannt?“, erkundigte sich Sarah.
Der Mann nickte, steckte die Hände in die Taschen des grauen Kittels, den er trug, und sagte: „Natürlich. Die beiden wurden doch bei einer Razzia in einer zwielichtigen Bar in Manhattan erwischt. Ich frage mich, welcher Teufel die beiden geritten hat.“
„Achtet niemand darauf, dass die Jungs und Mädchen am Abend zu einer gewissen Zeit in den Betten liegen?“, kam es wie aus der Pistole geschossen von Sarah.
„Doch, natürlich. Um zweiundzwanzig Uhr ist Bettruhe. Die Kinder unter zwölf haben um zwanzig Uhr in den Betten zu liegen. Aber das ist kein Gefängnis, Special Agents. Wenn die Halbwüchsigen nach der Kontrolle aus dem Fenster steigen und verschwinden, merken das weder ich noch Mr. McRaney, noch sonst jemand vom Personal, soweit es im Haus wohnt.“
„Wohnen Sie hier?“
„Ja. Im Anbau.“
„Und Mr. McRaney?“
„Auch er wohnt im Anbau. Ihm gehört dort das gesamte Untergeschoss. Ich lebe mit meiner Frau in der Mansarde.“
„Ist McRaney verheiratet?“, fragte ich.
„Geschieden.“
„Wann findet die Beerdigung statt?“, kam es von Sarah.
„Um vierzehn Uhr.“
Ich schaute auf meine Uhr. Es war zehn Minuten nach vier Uhr nachmittags. „Mr. McRaney müsste eigentlich längst zurück sein.“
„Nun, vielleicht hat er noch etwas zu erledigen.“ Der Hausmeister zeigte ein verlegenes Lächeln. „Entschuldigen Sie mich jetzt, Special Agents, aber ich kann Ihnen auch nichts sagen in der Sache mit beiden Burschen. Und ich hab ‘ne Menge Arbeit.“
„Schon gut“, murmelte ich. „Gehen Sie nur.“
Jameson Parker verschwand nach draußen.
Sarah und ich ließen uns auf den Polstermöbeln nieder. Hin und wieder sahen wir Kinder oder Jugendliche. Ein halbes Dutzend Mädchen und Jungs, die feierlich gekleidet waren, betraten die Halle. Ich vermutete, dass sie von der Beerdigung kamen und sprach sie an.
„Die Beerdigung war um drei zu Ende“, gab eines der Mädchen zu verstehen. „Bis wir dann einen Bus bekamen, verging einige Zeit. Dann mussten wir umsteigen.“
„Wir warten auf Mr. McRaney“, erklärte Sarah Anderson.
„Der ist mit seinem Oldsmobile weggefahren, als die Beerdigung zu Ende war“, sagte das Girl. „Er müsste längst hier sein, es sei denn, er hat noch irgendetwas zu erledigen.“
Das war natürlich nicht auszuschließen.
Einer der Jungs blieb stehen, während die anderen weitergingen und die Treppe emporstiegen. Er schaute von mir zu Sarah, dann kehrte sein Blick wieder zu mir zurück, und er ließ seine Stimme erklingen: „Sie kommen wegen Tommy und mir, nicht wahr?“
„Wenn Sie Jimmy Wright sind – ja“, versetzte ich.
„Ich bin Jim Wright“, murmelte der Junge und knetete nervös seine Hände. Mit gesenktem Kopf sagte er: „Mr. McRaney wird Ihnen zu der Angelegenheit kaum etwas sagen können. Tommy, Kenny, auch Robby und ich sind regelmäßig aus dem Fenster geklettert, nachdem McRaney täglich um zweiundzwanzig Uhr seinen Kontrollgang absolviert hatte. Wir sind dann hinüber nach Manhattan.“
„Robby, Kenny?“, echote ich.
Jim Wright nickte. „Ja, auch Robby, den wir heute beerdigt haben. Vielleicht war das der Grund, dass er sich vor den Zug warf. Er hat keinen Abschiedsbrief geschrieben, also wird es wohl nie jemand erfahren, was ihn bewogen hat, einen Schlussstrich zu ziehen.“
„Wer ist Kenny?“, wollte Sarah wissen.
„Ken Osborne. Er wohnt mit Tom und mir in einem Zimmer. In dem Zimmer wohnte auch Robby. McRaney weiß von nichts.“ Die letzten Worte des Jungen fielen mit Nachdruck, er starrte mich an, als wollte er mich hypnotisieren.
„Wenn ihr das Haus heimlich verlassen hattet“, sagte Sarah, „seid ihr dann zu Fuß nach Manhattan hinüber?“
Jimmy Wright lachte gequält. „Wir hatten feste Arbeitszeiten. Ein Taxi holte uns ab und brachte uns wieder.“
„Wer hat euch das Taxi geschickt?“
„Niemand. Wir haben das Taxiunternehmen beauftragt, uns an gewissen Tagen nach zehn Uhr abends ein Fahrzeug zu schicken.“
„An welchen Tagen?“
„Freitag, Samstag, Sonntag.“
„Wussten die Geschäftsführer der Bars, in denen ihr angeschafft habt, dass ihr minderjährig seid?“
„Keine Ahnung“, erwiderte Jimmy Wright. „Wir haben uns den Kerlen nicht vorgestellt.“
„Wer waren eure Kunden?“
„Reiche, geile Böcke, die recht großzügig waren. Ihre Namen weiß ich nicht. Es waren fast immer dieselben. Die einen waren echt schwul, die anderen bi.“
„Okay, Jimmy“, knurrte ich, „vielen Dank für diese Hinweise.“ Ich schaute Sarah an. „Ich denke, wir hinterlegen für Mr. McRaney eine förmliche Vorladung zum Field Office. Noch länger auf ihn zu warten dürfte sinnlos sein.“
In dem Moment, als wir das Waisenhaus verlassen wollten, fuhr ein Oldsmobile vor. Er hielt vor dem Haus an, schaukelte etwas in der Federung, dann entstieg ein hochgewachsener, hagerer Mann dem Wagen. Er sah uns bei der Tür, hielt in seiner Bewegung inne und starrte zu uns her.
Schon gleich aber kam Leben in seine Gestalt. Er umrundete das Auto und schritt näher. Erwartungsvoll und fordernd war der Blick, mit dem er uns musterte.
„Sind Sie Mr. McRaney?“, fragte ich, als er am Fuß der Treppe anhielt.
„Ja. Und wer sind Sie?“ Er blinzelte verunsichert.
„Special Agent Trevellian, FBI New York.“ Ich wies mit einer knappen Handbewegung auf meine Gefährtin. „Special Agent Sarah Anderson. Wir kommen wegen der Jungs, die bei der Prostitution in der Paradise Bar erwischt wurden. Können wir mit Ihnen sprechen, Mr. McRaney?“
Ich hatte das Empfinden, als würde der Heimleiter aufatmen, als hätte er einen anderen Grund für unser Erscheinen erwartet. Ja, er schien von einer schweren Last befreit zu sein. Geschäftig kam er die Treppe herauf.
„Das wird ein Nachspiel für diese Kerle haben“, versprach er mit grimmigem Unterton. „Sie bringen das Heim in Verruf, und das kann ich nicht dulden. Es handelt sich um eine kirchliche Einrichtung.“ Er wies in die Halle. „Nach Ihnen, Special Agents.“
Wir kehrten also in das Haus zurück. McRaney lotste uns in sein Büro. Er hatte zu seiner Sicherheit zurückgefunden. Er bot uns Plätze an und fragte sogar, ob wir was zu trinken wollten. Dankend lehnten wir ab. Als er hinter seinem Schreibtisch Platz genommen hatte, nahm ich das Wort.
„Wissen Sie, McRaney, dass nicht nur Tom Russel und Jim Wright in verschiedenen Nachtlokalen drüben in Manhattan auf dem Strich gegangen sind, sondern auch Ken Osborne und – Robby Whitmore?“
McRaney schaute mich an wie jemand, dem man soeben den Fußboden unter den Füßen weggezogen hatte. Unter seinem linken Augen begann ein Nerv zu zucken.
Als wir McRaney eine halbe Stunde später verließen, waren wir nicht schlauer als vorher. Er wusste von nichts. Hinweise darauf, dass er vielleicht seine Aufsichtspflicht vernachlässigt haben könnte, wies er weit von sich. Stellenweise wurde er regelrecht aggressiv.
6
Sarah und ich waren wieder zurück im Federal Building. Wir überlegten, ob wir noch etwas Schreibtischarbeit erledigen oder zum City Prison fahren sollten, um Wilson Howard, den Geschäftsführer der „Paradise Bar“, einzuvernehmen.
Wir entschieden uns für die Schreibtischarbeit, denn es ging auf Feierabend zu und in den vergangenen Tagen hatten wir kaum richtig Zeit gefunden, mal richtig durchzuatmen. Jeder von uns brauchte einfach mal einen Abend für sich.
„Mir geht dieser Junge, dieser Robby Whitmore, nicht aus dem Kopf“, meinte Sarah, als wir an unseren Schreibtischen saßen. „Warum nimmt sich ein siebzehnjähriger das Leben?“
Ich hob die Schultern, ließ sie wieder nach unten sinken, und erwiderte: „Er ist auf den Strich gegangen. Er wusste, dass er etwas Verbotenes tat und er mit nachhaltigen Sanktionen zu rechnen hatte, wenn ihn McRaney erwischte. Wahrscheinlich hat er es nicht mehr verkraftet.“
Sarah schüttelte den Kopf. „Daran will ich einfach nicht glauben. Dass er auf den Strich ging, kann nicht der Grund gewesen sein. Er hätte nur aufzuhören brauchen.“
„Weiß man denn, was im Kopf des Burschen vorgegangen ist?“, murmelte ich und klickte im Programm herum, das ich geöffnet hatte. Ich wollte im Zentralcomputer des FBI einen Abgleich mit den Namen der Leute herbeiführen, die wir bei den Razzien in Steeles Bars verhaftet hatten. Hinterher wollte ich den Zentralcomputer des Police Department bemühen.
Ich tippte den Namen Howard in den Suchlauf, eine ganze Liste wurde geöffnet, ein Wilson Howard war jedoch nicht darunter. Fehlanzeige!
„Es sei denn“, hörte ich Sarah weitersprechen, „der Junge wurde zur Prostitution gezwungen. Dann konnte er nicht einfach aufhören, und er sah für sich nur den Freitod als Ausweg.“
Ich nahm meinen Blick vom Bildschirm und begegnete dem meiner Teampartnerin. „Und wer sollte ihn gezwungen haben?“
„Es ist eine Hypothese, Jesse“, kam es zurück. „Ein Gedanke. Man sollte vielleicht doch einmal mit Wilson Howard sprechen. Und auch mit den Jungs, die in der Paradise Bar auf den Strich gegangen sind. Etwas stimmt da nicht. Ich kann dir aber nicht sagen, woher ich diese Vermutung habe. Es entzieht sich meinem Verstand.“
Irgendwie regten mich Sarahs Worte auch zum Nachdenken an. Es klang in mir nach: Es sei denn, der Junge wurde zur Prostitution gezwungen ...
„Also begeben wir uns ins City Prison“, sagte ich und fuhr mein Computerterminal herunter. Dann erhob ich mich.
Wir verließen unser Büro und ließen uns vom Lift in die Tiefgarage tragen. Gleich darauf rollten wir mit einem Dienstwagen – dieses Mal war es ein Van, der uns zur Verfügung gestellt wurde – die Ausfahrt hinauf. Ich fädelte mich in den fließenden Verkehr ein. Es war die Zeit der Rushhour und die Stadt stand dicht vor dem Kollaps. Nichts ging vorwärts. Ein Hupkonzert erfüllte die Wolkerkratzerschluchten Südmanhattans. Aggressionen wurden erzeugt und abgebaut. Um diese Zeit auf der Straße sein zu müssen war eine Strafe. Der Big Apple mutete in diesen Stunden an wie ein alles verschlingender Moloch.
Nun, es dauerte eine ganze Ewigkeit, aber wir kamen beim Stadtgefängnis an, und ich fand sogar eine Parklücke, in die ich den Van zwängte. Ich atmete auf. Sarah strich sich eine Strähne ihrer Haare aus der Stirn.
Zehn Minuten später saßen wir Wilson Howard, dem Geschäftsführer der „Paradise Bar“, im Vernehmungsraum gegenüber. Er vollführte mit den Fingerkuppen seiner rechten Hand einen nervösen Trommelwirbel auf der Tischplatte. Es war deutlich, dass er sich nicht wohl fühlte in seiner Haut. Seine ganze Körperhaltung drückte dieses Unbehagen aus. Er saß da wie auf dem Sprung.
„Sie haben ein gewaltiges Problem am Hals, Howard“, begann ich. „Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass insgesamt vier Jugendliche aus dem Waisenhaus in Ihrem Schuppen auf dem Strich gegangen sind. Sie werden kaum länger leugnen können, dass Sie nichts davon wussten. Einer der Jugendlichen hat vor einigen Tagen Selbstmord begangen. Er wurde heute beerdigt. Die anderen werden wir noch vernehmen müssen.“
„Ich wusste von nichts!“, behauptete der Bursche steif und fest. „Außerdem ist es nicht mein Schuppen. Ich war James Steeles Geschäftsführer, sonst nichts. Dass in der Bar einige Girls und auch einige Kerle als Stricherinnen und Stricher tätig waren, ist mir neu. Wenn ihr Drogen gefunden habt – was hab ich damit zu tun? Wendet euch an die Leute, die die Drogen hatten.“
„Sie halten es mit den drei weisen Affen, Howard, wie?“, fuhr ihn Sarah an. „Nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen.“
Wilson Howard maß meine Partnerin mit einem geringschätzigen Blick. Er griente schief. Aber er sagte nichts.
„Wir werden die drei Jungs noch in die Mangel nehmen, Howard“, versprach ich. „Und sicherlich fallen dann Namen. Vielleicht wurden die Burschen sogar mit Drogen gefügig gemacht. Gnade Ihnen Gott, Howard, wenn Ihr Name in diesem Zusammenhang fällt.“
„Kennen Sie die Paradise Bar?“, fragte mich Howard, und ohne eine Antwort abzuwarten fuhr er fort: „Da war jeden Abend der Teufel los. Da vergnügten sich wohl an die dreihundert Gäste, und ich kenne keine fünf Prozent von denen. Sicher, manche Gesichter tauchten immer wieder auf. Ich selbst war jedoch die wenigste Zeit in der Bar anwesend. Und wenn, dann kümmerte ich mich kaum um die Gäste. Dann kümmerte ich mich darum, dass der Geschäftsbetrieb reibungslos lief. Dafür war ich ja auch angestellt.“
Irgendwie klang das, was er sagte, plausibel. Dennoch war ich davon überzeugt, dass er Bescheid wusste. Sowohl über die Stricherinnen und Stricher, die in dem Lokal anschafften, wie auch über die Drogendeals, die in der Bar abliefen. Bei einem der Keeper war Heroin gefunden worden. In einem Schubfach im Tresen lagen Ecstasytabletten herum. Und eine Reihe von Gästen hatte Heroin, Crack, Haschisch und Ecstasy am Mann. Eine Handvoll von ihnen mehr, als sie für den Eigenbedarf benötigten.
Da stank einiges zum Himmel. Da war ich mir sicher.
„Die Namen der Jungs sind Tom Russel, Jim Wright, Ken Osborne und Rob Whitmore“, setzte ich noch einmal an, um seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, „genannt werden sie Tommy, Jimmy, Kenny und Robby.“
„Namen“, grunzte Howard. „sie sagen mir nichts. Ich kann sie nicht zuordnen. Wenn es auch Leute gibt, die mir aufgefallen sind, weil sie oft in der Bar waren – ich hab sie nicht nach ihren Namen gefragt.“
Wir kamen nicht weiter mit ihm.
Sarah und ich wechselten einen Blick. Der Ausdruck in Sarahs Augen sagte mir, dass wir aufgeben sollten. Ich ließ Wilson Howard wieder abführen. Frustriert verließen wir das Gefängnis.
7
Das Haus, in dem Patricia Whitmore wohnte, hatte die Nummer 324. Es war ein Apartmenthaus mit sechs Stockwerken. Das Apartment Patricias hatte die Nummer 43. Es war also Apartment 3 im 4. Obergeschoss.
Es war nach 11 Uhr. Patricia lag im Livingroom auf der Couch und schaute fern. Es lief ein Thriller, in dem es um die Entführung eines Kindes ging. Patricia war nur mit halbem Herzen bei der Sache. Unablässig musste sie an Robby denken, der tot in dem einfachen Sarg zwei Meter unter der Erde lag, und dessen junges Leben auf ausgesprochen tragische Weise endete.
Etwas schien in Patricia mit dem Tod ihres Bruder abgestorben, zerbrochen zu sein. Sie wollte Rache. Blutige Rache. Robby war in den Tod getrieben worden. Einen der Schuldigen kannte Patricia. Aber sie wollte die Kerle alle. Robby hatte über einen auserlesenen Kundenstamm verfügt. Soviel wusste sie. Aber wer waren diese Kunden? Sie wollte Namen, Adressen – sie wollte die Kerle kennen, die Robby auf dem Gewissen hatten.
Ein Geräusch bei der Tür ließ Patricia aus ihrer Versunkenheit aufschrecken. Sie drehte den Kopf. Im Fernseher war Geschrei. Hatte sie sich geirrt? War das seltsame Geräusch, das nicht zu der Reihe der übrigen passen wollte, aus dem TV-Gerät gekommen? Hatten ihr ihre überreizten Sinne einen Streich gespielt?
Patricia erhob sich. Auf Zehenspitzen glitt sie zur Tür und lauschte. Draußen machte sich tatsächlich jemand am Schloss zu schaffen. Patricia staute den Atem. Sie dachte nach. In vierundzwanzig Stunden lief das Ultimatum ab, das sie Jack McRaney gestellt hatte. Wenn sie bis zum nächsten Abend von ihm nicht die Namen der Perverslinge erhielt, die Robby missbrauchten, würde sie dessen Abschiedsbrief der Polizei zur Verfügung stellen.
Wollte McRaney das verhindern?
Schickte er ihr einen Killer?
Zwischenzeitlich traute Patricia dem Heimleiter jede Niedertracht zu. Es ging um seine Existenz. Sie, Patricia, konnte sie vernichten.
Das Mädchen entschloss sich von einem Augenblick zum anderen. Es huschte von der Tür weg, lief zu einer Kommode, zog den Schub auf, und entnahm ihm eine Pistole. Sie hatte die Waffe einen Tag nach Robbys Tod in einer Kneipe in Spanish Harlem erworben. Es war eine Glock 21 mit Schalldämpfer.
Patricia griff nach ihrer Handtasche auf der Kommode und verstaute die Pistole darin. Dann begab sie sich in die Küche, schob das Fenster in die Höhe und stieg hinaus auf den Rettungssteg aus Metallrosten, der zur Feuerleiter führte.
Patricia schob von außen das Fenster wieder nach unten und kauerte nieder, so weit, dass sie über den unteren Rand des Fensters in den Raum blicken konnte.
Sie hatte die Tür zum Livingroom offenstehen lassen. Etwas Licht fiel durch das Rechteck in die Küche. Ihre Geduld wurde auf keine lange Probe gestellt. Dann verdunkelte eine Gestalt die Tür. Das Licht im Hintergrund umriss scharf die Konturen. Es war ein Mann. Und er trug eine Maske, die nur die Augen frei ließ. In der Hand des Burschen schimmerte der Stahl einer Waffe.
Patricia schlich zur Feuerleiter und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass der Killer sie zuerst im Schlafzimmer suchte. Sie bewegte sich lautlos, und ihr Stoßgebet wurde erhört. Als sie vernahm, dass oben ein Fenster hochgeschoben wurde, befand sie sich schon auf der Höhe der 2. Etage. Sie kauerte nieder und verschmolz mit den tintigen Schatten der Nacht hier im Hinterhof des Hauses.
Oben schepperte leise einer der Gitterroste. Der Killer war also aus dem Fenster gestiegen. Patricia wartete nicht länger, sondern richtete sich auf und hastete trotz der Dunkelheit die Treppen hinunter. Sie erreicht die 1. Etage, und hier endete die Leiter. Es ging an die drei Yards in die Tiefe. Der Boden lag in absoluter Finsternis. Patricia sprang. Sie landete auf hartem Untergrund, aber sie landete geschmeidig und rannte sofort los. Im vagen Licht war ihre Gestalt allenfalls schemenhaft auszumachen.
Der Gangster auf der Leiter feuerte. Es gab keine Detonation. Er hatte einen Schalldämpfer aufgeschraubt. Die Kugel klatschte dicht neben Patricias Füßen auf die Betonplatten. Kleine Splitter pfiffen wie Geschosse durch die Luft. Die Kugel wurde abgefälscht und wimmerte in die Nacht hinein.
Dann rannte Patricia durch die Ausfahrt und befand sich gleich drauf in der 52. Straße. Sofort wandte sie sich nach links. Das Rockefeller Center war ihr Ziel. In dem Labyrinth aus Wegen, Gärten und Geschäftshäusern konnte sie dem Killer entkommen.
Patricia rannte wie nie vorher in ihrem Leben. Als sie einmal einen Blick über die Schulter warf, sah sie den Kerl etwa 50 Yards hinter sich auf dem Gehsteig. Er hatte sich die Maske heruntergerissen. Von seinem Gesicht konnte sie jedoch kaum etwas erkennen.
Patricia hatte seltsamerweise keine Angst. Die Waffe in ihrer Handtasche verlieh ihr ein hohes Maß an Sicherheit. Dennoch wollte sie dem Killer entkommen, denn sich mit ihm auf eine Schießerei einzulassen hätte unangenehme Fragen wegen des Erwerbs und des Besitzes einer nicht registrierten Waffe nach sich gezogen, und man hätte ihr die Pistole weggenommen. Die Waffe aber brauchte sie. Der Fluch Robbys, der von gewissenlosen Schuften zum Sexsklaven degradiert worden war, musste sich erfüllen.
Patricia war besessen von dem Gedanken davon.