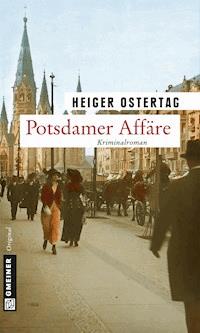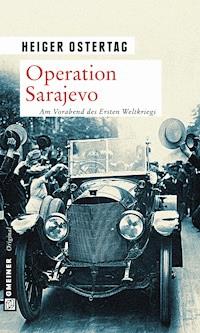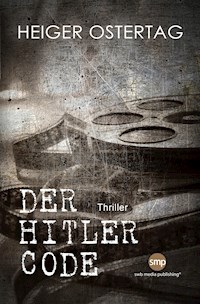Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Am 7. Mai 1866 geht Unter den Linden nahe der russischen Botschaft der 22-jährige Student Ferdinand Cohen-Blind aus Tübingen dem preußischen Ministerpräsidenten Graf Otto von Bismarck hinterher, zieht seinen Revolver und drückt mehrmals ab. Bismarck überlebt das Attentat nahezu unverletzt und kann seinen Widersacher sogar stellen. Cohen-Blind ist nicht der Einzige, der es auf den Ministerpräsidenten abgesehen hat. Denn sein hartnäckigster Widersacher erwartet ihn bereits.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heiger Ostertag
Abgründe der Macht
Historischer Roman
Impressum
Für meine Frau Angelika
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © AKG Images
ISBN 978-3-8392-4580-4
Inhalt
Impressum
Ein dunkler Plan
Schüsse und Schmisse
Liebe, Lust und Leidenschaft
Zähmung eines Wilden
Abenteuerliche Begegnungen
Intrigen und Kriege
Sieg und Niederlage
Nachklang
Literatur- und Quellenhinweise
Danksagung
Lesen Sie weiter …
Ein dunkler Plan
Als normales Product unsres staatlichen Unterrichts verließ ich Ostern 1832 die Schule als Pantheist, und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Ueberzeugung, daß die Republik die vernünftigste Staatsform sei, und mit Nachdenken über die Ursachen, welche Millionen von Menschen bestimmen könnten, Einem dauernd zu gehorchen, während ich von Erwachsenen manche bittre oder geringschätzige Kritik über die Herrscher hören konnte. Dazu hatte ich von der turnerischen Vorschule mit Jahn’schen Traditionen (Plamann), in der ich vom sechsten bis zum zwölften Jahre gelebt, deutsch-nationale Eindrücke mitgebracht. Diese blieben im Stadium theoretischer Betrachtungen und waren nicht stark genug, um angeborne preußisch-monarchische Gefühle auszutilgen. Meine geschichtlichen Sympathien blieben auf Seiten der Autorität. Harmodius und Aristogiton sowohl wie Brutus waren für mein kindliches Rechtsgefühl Verbrecher und Tell ein Rebell und Mörder.
Otto von Bismarck. Gedanken und Erinnerungen, Band 1. I. Kapitel
*
Der Mann trat in das Zimmer, warf heftig die Tür zu und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Er atmete schwer und es dauerte einige Zeit, bis er zur Ruhe kaum. Der Raum, in dem er sich befand, war ein Esszimmer, eingerichtet mit einem großen, ovalen Tisch, sechs Stühlen und einer Anrichte aus dunklem Nussholz. Ein bürgerliches Zimmer, einfach, aber solide eingerichtet. Der eben Eingetretene gehörte allerdings seiner Kleidung nach nicht dem bürgerlichen Stand an, da sie von einem guten Schneider gefertigt worden war und einen gewissen modischen Chic besaß. Zudem haftete dem Auftreten des Mannes etwas entschieden Militärisches an. Er selbst mochte einem Betrachter jung erscheinen und durfte Ende zwanzig, höchstens Anfang dreißig sein. Er war groß gewachsen, schlank und von einem durchaus ansprechenden Äußeren.
Nach einigen Minuten erhob sich der Mann und begann mit großen Schritten, zornig den Raum zu durchmessen. Seine Bewegungen hatten, selbst im Augenblick seiner offensichtlichen Unruhe, etwas ungemein Kraftvolles und Geschmeidiges. Eine Weile lief der Mann unruhig auf und ab. Schließlich blieb er am Fenster stehen und blickte hinaus auf die Straße. Dabei sah er jedoch nicht auf die Menschen, die dort ihrem Tagewerk nachgingen. Er hörte nicht das Rollen der Wagen und Kutschen, das Traben der Hufe, sondern starrte, blind für alles andere, in eine imaginäre Ferne.
»Er ist ein verfluchter Tyrann, er muss stürzen!«, rief er plötzlich laut. »Dabei«, fügte er für sich leiser hinzu, »ist er wahrhaftig eine denkbar interessante Figur. Ein Mann, der dem Zweckdienlichen alles unterordnet, mit dem beständigen Hang, die Menschen zu betrügen. Er glaubt sich im Besitz eines vollendeten Wissens, vermischt, schlau wie er ist, Persönliches und Allgemeines, Hässliches und Schönes mit Beifallsbedürftigkeit und einer geradezu kolossalen Lässigkeit.« Er schwieg einen Augenblick.
»Ja«, sprach er dann weiter und wurde wieder lauter: »Ich gestehe es vor aller Welt. Er ist mir widerwärtig, dieser geborene abscheuliche Tyrann!«
Der Mann schwieg erneut, fuhr sich mit beiden Händen durch das wirre, lockige Haar und verließ endlich den Platz am Fenster. Er begab sich zu einem Schreibtisch, setzte sich auf einen Stuhl und holte aus einem Fach einen Bogen weißes Papier hervor. Er legte das Blatt auf den Tisch, beugte sich vor und öffnete ein vor ihm befindliches Tintenfass.
»Ich will alles niederschreiben, was mich bewegt und was ich plane!«, rief er, griff zur Feder und begann gemäß des wirren Flusses seiner Gedanken zu schreiben. Ganz eigensinnig kamen diese einher, wild, quer und ungeordnet. Eine Zeit lang schrieb er so, dann hielt er inne und las das letzte Wort: »Genug!«
In der Tat, jetzt war es genug. Das Tun des verfluchten Despoten hatte ein derartiges Unrecht geschaffen, dass dieses niemand mehr dulden oder gar akzeptieren konnte. Frech hatte er sich hingestellt und die junkerlichen Weisheiten verkündet, wer solchen Gebrauch von seinen Rechten mache, gehöre ins Tollhaus! Das war die Begründung dafür gewesen, die Freiheit der Völker mit Kommisstiefeln zu zertreten. Doch es stimmte, was er dann sagte. Die großen Fragen konnten wahrhaftig nur durch das Eisen und durch Blut beantwortet werden. Der Mann hatte somit sein eigenes Urteil gesprochen, dessen Vollstreckung ihn bald ereilen solle. Der Schreiber legte das Blatt zur Seite.
Er hatte den Mann früher bewundert. Früher, doch seine Bewunderung war längst in Hass umgeschlagen. Vor allem seitdem er mehr über dessen Tun und Treiben erfahren hatte. Allein es genügte nicht, jenen zu hassen und ansonsten seinen Taten hilflos ausgeliefert zu sein. Er musste handeln, unverzüglich und sofort. Zunächst galt es aber, einen brauchbaren Plan zu fassen. Er hatte sich daher intensiv mit dem Objekt seiner Wut zu beschäftigen und diesem bis in die kleinsten Details seines Lebens nachzuspüren. Wer war also der Mensch, der so eiskalt über Leichen ging? Einmal hatte er ihn aus der Ferne gesehen, dann war er ihm noch ein zweites Mal begegnet. Beim letzten Mal hatte er ihn deutlich wahrnehmen können. Jede Geste, jede Miene des Mannes, jeder Zoll seiner riesigen Gestalt verkörperte arrogante Macht, war fleischgewordene Intrige und Gewalt. Gewalttätig war auch das ganze Handeln des Mannes. Er hatte bereits einmal das Schwert gezogen, und er würde es wieder aus der Scheide holen. Nein, die Zeitform stimmte nicht, er war eben dabei, es erneut zu zücken. Doch wer das Schwert führte, der würde durch das Schwert verderben. Ihm das Verderben zu bringen, war nun seine Aufgabe. Er musste ihn töten und er würde ihn töten! Mit dem Degen in der Hand oder, wenn es nicht anders ging, mithilfe einer Schusswaffe. Der Mann trat an einen Wandschrank in der Ecke, öffnete ein Fach und holte einen Revolver hervor. Er legte ihn auf den Tisch und betrachtete ihn eine Weile stumm. Dann nahm er ihn wieder in die Hand, ließ die Trommel rollieren und richtete ihn mit einer fast spielerischen Geste auf das Fenster.
Schüsse und Schmisse
Mein deutsches Nationalgefühl war so stark, daß ich im Anfang der Universitätszeit zunächst zur Burschenschaft in Beziehung gerieth, welche die Pflege des nationalen Gefühls als ihren Zweck bezeichnete. Aber bei persönlicher Bekanntschaft mit ihren Mitgliedern mißfielen mir ihre Weigerung, Satisfaction zu geben, und ihr Mangel an äußerlicher Erziehung und an Formen der guten Gesellschaft, bei näherer Bekanntschaft auch die Extravaganz ihrer politischen Auffassungen, die auf einem Mangel an Bildung und an Kenntniß der vorhandnen, historisch gewordnen Lebensverhältnisse beruhte, von denen ich bei meinen siebzehn Jahren mehr zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte als die meisten jener durchschnittlich ältern Studenten. Ich hatte den Eindruck einer Verbindung von Utopie und Mangel an Erziehung. In mein erstes Semester fiel die Hambacher Feier (27. Mai 1832), deren Festgesang mir in der Erinnrung geblieben ist, in mein drittes der Frankfurter Putsch (3. April 1833). Diese Erscheinungen stießen mich ab, meiner preußischen Schulung widerstrebten tumultuarische Eingriffe in die staatliche Ordnung.
Otto von Bismarck. Gedanken und Erinnerungen, Band 1. I. Kapitel
*
Man schrieb das Jahr 1866. Der lange Winter war vorbei und der Frühling zeigte sich in der Mark Brandenburg, dem Kernland des Königreich Preußen, endlich in höchster Pracht. Die Hauptstadt des Landes, Berlin, erlebte einen lauen Maitag. In vierzehn Tagen würde das Pfingstfest gefeiert werden; die Zeit der langen, heißen Tage, deren Licht kein Ende zu nehmen schien, näherte sich.
Geschäftig durcheilten die Menschen die Straßen der preußischen Metropole, ein wahrer Strom flutete hin und her. Handel und Verkehr füllten die Gassen, Kutschen und Pferdedroschken rollten durch die weite Stadt. Fuhrwerke brachten Lasten und Waren in Fabriken und Läden. Da und dort erklang Militärmusik. Auf der Prachtstraße Unter den Linden schien das Tempo auf dem ersten Blick gemäßigter, doch auch hier herrschte buntes Treiben. Gesetzte Bürger mit Ehefrauen und blühenden Töchtern spazierten auf dem Trottoir. Dunkel gekleidete Beamte aus den nahen Ministerien eilten mit wichtiger Miene vorüber. Elegante Damen in weiten Überröcken und breitrandigen Florentinerhüten, unter denen Locken hervorquollen und die ein feiner Duft nach Maiglöckchen und Eau de Cologne umgab, strebten in die Cafés. Offiziere in blauer Uniform folgten ihnen mit Blicken und grüßten höflich. Weiter unten in der Straße in Richtung Stadtmitte schritten Herren in Überrock und hellen Westen, an denen schwere Uhrketten baumelten, und besprachen Geschäftliches. Jetzt erschien eine kichernde, große Schleifen tragende Gruppe von Backfischen, begleitet von Gouvernanten. All diese Menschen schlenderten, flanierten und liefen auf und ab und füllten die große Prachtstraße mit vielfältigem Lärmen.
Mitten unter der bewegten Menge in Höhe des russischen Gesandtschaftshotels spazierte gemessenen Schrittes ein gut gekleideter Herr. Er befand sich dem Äußeren nach in den besten Mannesjahren und war von beeindruckender Gestalt. Der Herr musste eine bekannte Persönlichkeit sein, denn er wurde ehrfurchtsvoll gegrüßt, und er grüßte seinerseits gemessen zurück, indem er den Zylinder leicht lüftete. Der Spaziergänger war der preußische Ministerpräsident Graf Otto von Bismarck, der nach einem Vortrag bei König Wilhelm das königliche Palais verlassen hatte und sich nun auf dem Heimweg befand.
Der Graf fröstelte leicht, eine Erkältung der letzten Tage machte ihm noch immer zu schaffen. Seine Gattin Johanna hatte am Mittag darauf bestanden, dass er, trotz des angenehmen Maiwetters, einen dicken Mantel über Rock, Weste und Hemd anzog, dazu eine seidene Unterjacke. Dennoch war ihm kühl, die Krankheit schien noch nicht völlig überwunden.
»Otto, du musst dich mehr um deine Gesundheit kümmern«, ermahnte ihn ständig seine Frau. Johanna hatte sicher recht, seit dem Jagdunfall in Schweden im Sommer 57 häuften sich die Krankheiten. Beinahe wäre als Spätfolge des Sturzes vom Pferd vor sieben Jahren sogar sein linker Unterschenkel amputiert worden. Zum Glück hatte er sich gegen den russischen Chirurgen Dr. Pirogoff durchsetzen können und das Bein behalten. Aber die Rekonvaleszenz hatte lange gedauert. Und jetzt, er sah sich im besten Alter, denn er war im letzten Monat gerade einundfünfzig geworden, quälte ihn seit einigen Wochen ein grässlicher rheumatischer Schmerz unter dem linken Schulterblatt. Graf von Bismarck schüttelte ärgerlich den Kopf. Krankheit war letztlich Einbildung, er durfte an diese Schmerzen einfach nicht denken. Mit einem guten Essen, einem herzhaften Frühstück mit Braten, Schinken und Eiern und Kuchen ließen sich die Lasten eines Tages einfach besser bewältigen und alle Krankheiten kurieren. Obwohl – der Vortrag bei Seiner Majestät war anstrengend gewesen, zumal die aktuelle politische Lage im Bund äußerste Brisanz zeigte. Wieder einmal Österreich und die Sachsen! Bismarck seufzte. Österreich rüstete für den Krieg, an den Börsen gab es Unruhe und Bewegung, und vor allem war den Franzosen und ihrem Kaiser nicht recht zu trauen. Die Schleswig-Holstein-Frage stand erneut im Mittelpunkt, und damit die Bundesfrage, ja im eigentlichen die Frage der Einheit. Nein, dachte er leicht missmutig, diese Fragen beantwortete er heute nicht mehr, obwohl er sich die eine oder andere Antwort vorstellen konnte. Aber so einfach waren mit Seiner Majestät Antworten nicht zu finden.
Der Ministerpräsident blieb stehen, zog die Taschenuhr hervor und warf einen Blick auf das Ziffernblatt – gleich halb sechs. Zu Hause erwarteten ihn Gäste und ein kräftiges Abendessen. Er beschleunigte seinen Schritt, fiel dabei unwillkürlich in den Rhythmus des gerade vorbeimarschierenden 1. Bataillons des 2. Garde-Regiments zu Fuß. Den kommandierenden Offizier kannte er gut. Bismarck trat auf ihn zu, um ihn kurz zu begrüßen, da knallte es in seinem Rücken zweimal laut.
Was war das?
Pistolenschüsse, wer schoss?
Er drehte sich rasch um. Unmittelbar hinter ihm befand sich ein schmaler junger Mann von vielleicht zwanzig, zweiundzwanzig Jahren. Der Mann sah ganz ordentlich aus. Er war mit einem anständigen dunklen Anzug bekleidet und hatte ein graues Plaid über die Schulter geworfen. Sein Hut war ihm entfallen. War er der Schütze? Da sah Bismarck, dass der junge Mann einen Revolver direkt auf ihn gerichtet hielt. Ja, der Kerl hatte offenbar gerade auf ihn geschossen und augenscheinlich nicht getroffen! Bismarck zögerte nicht und sprang vor. Er ergriff den Burschen an der Kehle und packte gleichzeitig den rechten Arm des Mannes. Ein weiterer Schuss krachte. Ein in der Nähe befindlicher Herr versuchte ebenfalls, den Angreifer in seinem Tun zu hindern. Doch dem Attentäter gelang es, den Revolver in die linke Hand zu nehmen und diesen auf die Brust Bismarcks zu setzen. Erneut drückte der Mann ab. Der Graf spürte einen kurzen Druck, einen jähen Schmerz – war das der Tod? Einen Augenblick durchfuhr ihn ein Schwindel, der sofort wieder verschwand. Nein, nichts war passiert, den Schmerz musste er sich eingebildet haben, denn das Herz schlug weiter. Er atmete, er lebte; die Kugeln hatten trotz der kurzen Distanz ihr Ziel verfehlt – er war unverletzt! Die Soldaten und Offiziere des 2. Garde-Regiments eilten hinzu, der Schütze wurde ergriffen, entwaffnet und mit gefesselten Händen zur Polizeiwache in der Dorotheenstraße gebracht. Bismarck blieb zurück, besorgte Bürger umringten ihn.
»Sind Eure Exzellenz verletzt worden?«
»Nicht im Geringsten, nur der Stoff ist etwas verbrannt.«
»Und Sie fühlen sich wohl?«
»Gewiss, es ist nichts passiert!«
Sie beglückwünschten den Ministerpräsidenten zum glimpflichen Ausgang des Mordanschlags und geleiteten ihn schließlich unter Hochrufen heim in die Wilhelmstraße 76. Das Ganze war ihm lästig, aber unvermeidbar, und irgendwie rührte ihn die Anhänglichkeit der Bürger. Daran, ein Krankenhaus aufzusuchen, dachte er nicht, er wollte nur nach Hause.
Dort warteten im Salon bereits ungeduldig die Gäste. Die Damen und Herren wurden allmählich hungrig, allein der Ministerpräsident ließ weiter auf sich warten. Die Gastgeberin, Bismarcks Ehefrau Johanna, trat ans Fenster und hielt nach ihrem Gatten Ausschau. Auf der Straße war die vertraute Silhouette noch nirgends zu sehen. Sie wandte sich mit einem Seufzer vom Fenster ab.
»Dein Vater wird länger bei Seiner Majestät sein, als er angenommen hat. Es ist auch immer so viel zu besprechen«, sagte sie zu ihrer Tochter Marie.
»Heute hätte Papa ruhig pünktlich sein können«, erwiderte Marie leise und zog einen Schmollmund.
Ihre Mutter ging nicht weiter auf die Bemerkung ein und begab sich zurück zu ihren Gästen. Dort bemühte sie sich redlich, der Gesellschaft die Wartezeit mit Plaudereien zu verkürzen. Johanna von Bismarck liebte Musik und spielte selbst ausgezeichnet Klavier, so lenkte sie das Gespräch auf ihr Lieblingsthema. Bald sprach die Runde über den in Bayern lebenden Sachsen Richard Wagner. Noch immer bewegte die letztjährige Aufführung seiner Oper ›Tristan und Isolde‹ die Gemüter und es wurde gleichermaßen gelobt wie getadelt.
»Ich stehe mit dem Meister in enger Verbindung«, tat die Gräfin von Schleinitz-Wolkenstein, Gattin des preußischen Hausministers Alexander von Schleinitz, selbstgefällig kund. »Mein Gemahl hat vor, den Meister nach Berlin einzuladen.«
»Wie überaus interessant«, erwiderte Johanna, die die Salonnière und deren leidenschaftliches Engagement für den Komponisten übertrieben fand. »Mir ist Wagners Musik einfach zu ungestüm. Aber mein Mann schätzt ihn sehr. Otto liebt auch sonst Musik über alle Maßen. Als er im letzten Jahr zu Beginn des Septembers mit Seiner Majestät Baden besuchte, war er abends beim Grafen Flemming eingeladen und berichtete mit Freude von dem prächtigen Quartett mit Josef Joachim, der seine Geige wirklich wunderbar spielte.«
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und der Hausherr trat ein. Bismarck war sichtlich gut gelaunt. Aufgekratzt begrüßte er die Anwesenden mit einigen Scherzen und entschuldigte sich, er müsse leider noch eine Nachricht an Seine Majestät senden, dann erst könne er sich voll und ganz der Gesellschaft widmen. Darauf verschwand der Graf in seinem Arbeitszimmer, griff zu Papier und Tinte und schrieb rasch an den König. Er teilte Seiner Majestät in wenigen Worten mit, was sich Unter den Linden ereignet hatte. Schließlich war der Hausherr fertig, löschte die Tinte mit Sand, siegelte den Brief und übergab das Schreiben einem Diener zur sofortigen Beförderung. Der Graf wechselte den Rock, kehrte darauf in den Salon zurück, und die Gesellschaft setzte sich zu Tisch. Während dies geschah, trat Bismarck auf seine Gemahlin zu. Er umarmte kurz die schlanke Gestalt, küsste sie auf die Stirn und sagte wie beiläufig in ruhigem Ton: »Mein Kind, heute haben sie auf mich geschossen, aber es ist nichts.«
Johanna erbleichte. »Um Gottes willen, Otto, was ist passiert?«, rief sie entsetzt. »Welcher ruchlose Mensch hat auf dich geschossen?«
Stimmengewirr entstand, Fragen wurden laut.
»Geschossen?«
»Wer war das?«
»Ist der Täter gefasst?«
»Wie kann so etwas geschehen?«
»Was ist da zu verwundern?«, sagte Bismarck. »Wer als öffentliche Zielscheibe dasteht, wird mitunter beschossen.«
Die erschrockenen Gäste drängten den Grafen, den Vorfall zu schildern. Bismarck setzte sich lächelnd hin und bat darum, sich erst stärken zu dürfen. Während er sich mit großem Behagen den Speisen widmete, berichtete er den Anwesenden vom Hergang des Attentats:
»Ich ging Unter den Linden auf dem Fußweg zwischen den Bäumen vom Palais nach Hause. Als ich in die Nähe der russischen Gesandtschaft gekommen war, hörte ich dicht hinter mir zwei Pistolenschüsse. Ohne zu denken, dass mich das anginge, drehte ich mich unwillkürlich um und sah etwa zwei Schritte vor mir einen kleinen Menschen, von bräunlicher Gesichtsfarbe, der mit einem Revolver auf mich zielte. Ich griff nach seiner rechten Hand, während der dritte Schuss losging, und packte ihn zugleich am Kragen. Er aber schoss noch zweimal. Als Jäger sagte ich mir, die letzten beiden Kugeln müssen gesessen haben, ich bin ein toter Mann. Doch es war nicht an dem. Ein unbekannter Herr half mir, den Kerl festzuhalten. Es eilten auch sogleich Schutzleute herbei, die ihn abführten. Mir tat eine Rippe etwas weh, ich konnte aber zu meiner Verwunderung bequem nach Hause gehen.«
Robert von Keudell, ein guter Freund des Hausherrn, wandte sich besorgt an den Grafen. »Otto, ich fürchte, Sie nehmen das Ganze zu leicht. Sie müssen sich untersuchen lassen. Vielleicht ist doch mehr passiert, als Sie wahrhaben wollen.«
Bismarck schüttelte energisch den Kopf. »Nein, ich habe von dem Ganzen höchstens ein paar blaue Flecke bekommen. Die Angelegenheit ist der Aufregung nicht wert. Lasst uns jetzt in Ruhe speisen, meine Freunde!«
Indessen hatte Johanna doch zu einem Arzt geschickt, der alsbald erschien und den Grafen untersuchte. In der Tat war ihm außer einigen Prellungen nichts weiter geschehen.
»Wie ist nur möglich, dass drei Kugeln aus solcher Nähe fehlgehen und die eine, die die Brust traf, unschädlich blieb!«, rief ein Gast.
»Das ist ein Zeichen der Vorsehung«, bemerkte Hedwig von Keudell, die Ehefrau Robert von Keudells. »Das Schicksal hat noch Großes mit Ihnen vor.«
Die übrigen Gäste stimmten ihrer Aussage zu.
Die Gesellschaft aß weiter, doch die Stimmung hatte sich verändert. Man fand nicht mehr zum leichten Plauderton zurück und spekulierte, wer hinter dem Anschlag stecken mochte.
»Ein Anschlag der Österreicher?«
»Oder radikaler Studenten?«
»Der Bayern oder gar der Franzosen?«
»Ich traue den Württembergern nicht!«
Schließlich endete das Diner, aber einig wurde man sich nicht. Die Herren erhoben sich, um im Rauchsalon eine Zigarre zu genießen und dort weiter zu debattieren, als ein Diener hereinstürzte und höchsten Besuch meldete: »Seine Majestät der König!«
König Wilhelm I. hatte, als er vom Attentat erfuhr, sein eigenes Mahl verlassen, anspannen und zum Ministerpalais fahren lassen, um persönlich seinem Ministerpräsidenten zur Rettung zu gratulieren. Bismarck ging Seiner Majestät bis zur Treppe entgegen und empfing einen herzlichen Händedruck.
»Mein lieber Bismarck«, sagte der bewegte König mit bebender Stimme, »ich danke Gott aus tiefster Seele für die Gnade, dass Sie mir erhalten geblieben sind. Welch ein Verlust für das Vaterland, wenn Sie uns genommen worden wären! Ein Abgrund hätte sich aufgetan! Jetzt erst fühlt man so recht, wie unersetzlich Sie sind!«
Wilhelm wurde von seinem Leibarzt Professor Lauer begleitet, der Bismarck auf Drängen des Königs in einem Seitenkabinett in Wilhelms Anwesenheit nochmals untersuchte. Auch er stellte fest, dass der Graf unverletzt war. Die ersten Schüsse, die der Attentäter aus der Entfernung abgegeben hatte, hatten offenbar nur den Rock gestreift. Lediglich eine der letzten Kugeln, die im Handgemenge direkt auf Bismarcks Brust abgefeuert wurden, hatte die Kleidung durchbohrt, war aber von der Rippe abgeglitten und hatte nichts mehr hinterlassen als besagte, etwas schmerzende Prellung. Für den Professor grenzte dies fast an ein Wunder und so äußerte er sich. »Hier ist keine andere Erklärung als die, dass Gottes Hand dazwischen gewesen ist.«
Bismarck lächelte verbindlich, sagte jedoch nichts weiter. Seine Majestät gratulierte erneut und verabschiedete sich dann mit dem Professor, der dringend Ruhe empfahl. Das war allerdings kaum möglich, dem Ratschlag nachzugehen, denn in den nächsten Stunden füllte sich die Wohnung mit immer neuen Gästen.
Kurz nachdem der König gegangen war, wurden Seine Königliche Hoheit Prinz Karl und Feldmarschall Wrangel gemeldet, denen im Laufe des Abends eine ununterbrochene Reihe von Staatsbeamten, Generälen und Offizieren, Bürgern und städtischen Angestellten, welche sich teils in ein eigens ausgelegtes Buch eintrugen, teils ihre Karten abgaben, folgten. Wrangel, der mit Bismarck sehr vertraut war, küsste ihn auf beide Wangen und rief mit Pathos: »Mein Sohn, ick preise den lieben Gott. Du bist wie unsere olle Jarde, die niemals stirbt.«
Die Nachricht vom Attentat verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Tausende von Menschen kamen an den Ort der Tat und vor die Ministerwohnung. Graf von Bismarck musste sich mehrere Male am Fenster dem Publikum zeigen, das ihn mit lauten, lebhaften Zurufen begrüßte.
»Gottes Hand und der dicke Mantel mit Rock, Weste und Hemd haben mich beschützt«, sagte Bismarck später zu seiner Gemahlin, als die Gäste nach Mitternacht endlich gegangen waren und Ruhe eingetreten war. »Doch«, wandte er sich an Hauslehrer Braune, »es wird mir recht schwer werden, heute mein Vaterunser zu beten. ›Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern‹ ist nach einem solchen Geschehen schwer zu sagen.«
»Ganz recht, Ottochen«, stimmte ihm Johanna zu. »Wenn ich einmal tot bin und die Himmelsleiter hinaufsteige und komme an der Höllentür vorbei und sehe den Kerl da stehen, dann gebe ich ihm einen Stoß, dass er ganz tief in die Hölle hinabfliegt«, fügte sie hinzu.
»Ach, Johanna, wenn du in dem Augenblick noch so denken könntest, wärest du ganz bestimmt nicht auf der Himmelsleiter«, antwortete der Graf lachend. Dann zogen sich die Bismarcks zur Ruhe in ihre Gemächer zurück. Hier in der privaten Abgeschiedenheit fiel Johanna ihrem Otto weinend um den Hals.
»Auf dich zu schießen! Das war ein wahrer Mordbube, ein Teufel, den man wie ein wildes Tier töten muss!«
Bismarck schüttelte den Kopf. »Nein, das war kein Teufel, sondern nur ein verwirrter junger Mensch. Einer wie damals der Student Sand, der Kotzebue tötete.«
»Das ist mir gleich, Otto. Ich habe im Nachhinein schreckliche Angst um dich. Fast wie damals, als du in dieses sinnlose Duell verwickelt warst.«
»Das ist doch so lange her, Johanna«, erwiderte Bismarck. »Darüber musst du nicht mehr nachdenken. Alles vorbei und längst vergessen. Grübele nicht mehr und mach dir keine unnötigen Sorgen. Mir passiert nichts. Ich stehe in Gottes Hand. Schlaf jetzt, es ist schon spät!«
*
Was war nur mit ihm los gewesen? Was hatte ihn so handeln lassen, wie er gehandelt hatte? Er hatte alles mit angesehen, war in nächster Nähe gewesen, als der Mann auf den Ministerpräsidenten schoss und hatte sogar geholfen, ihn festzunehmen. Warum nur? Warum zog er nicht auch die Waffe und vollendete, was dem anderen nicht gelungen war? Etwas, er wusste nicht genau was, ließ ihn zögern, löste die Hand von der Pistole in der Tasche und hielt ihn von der Tat ab. Seine Gedanken rasten. Alles in ihm war wirr, war in Bewegung und durcheinandergeraten. Dabei war es gar nicht so lang her, dass sein Leben, seine Welt völlig in Ordnung gewesen zu sein schien. Ordnung, was für ein seltsames Wort voller falscher Beruhigung. Ordnung, Ordnung, wiederholte er mehrmals, wie sinnlos das klang. Er fuhr sich mit der Hand an den Kragen. Das alles nahm ihm die Luft, er hatte das Gefühl, als könne er nicht mehr atmen. »Nein!«, rief er laut. »Ich halte es hier nicht mehr aus!«
Der Mann sprang auf, verließ die Wohnung und das Haus. Er eilte hinaus auf die Gasse. Es begann zu regnen, immer stärker, bis es wie aus Kübeln goss. Er achtete nicht darauf, dass er völlig durchnässt wurde. Er lief und lief. Bilder schossen ihm durch den Kopf, wirre Gedanken, er wusste nicht welche und was – und vergaß das Gedachte gleich wieder. Schließlich kehrte er im Scheunenviertel in einer der vielen Wirtschaften ein. Ein dunkles Lokal, schmutzig und verraucht, voller Trinker und Dirnen; aber man hatte dort seine Ruhe. Der Mann wehrte eine der armseligen Kreaturen ab, die ihm ihre billigen Reize verkaufen wollte, und drückte sich in eine Ecke. Er ließ sich ein Bier bringen, trank einen tiefen Zug und kam langsam wieder zur Ruhe.
Die erste Veränderung war im Dezember geschehen. Die Festtage waren bereits vorüber und das neue Jahr stand vor der Tür. Er war gerade nach Berlin zum Dienst in der Gesandtschaft zurückgekehrt, nachdem er das Weihnachtsfest bei seiner Mutter und dem Onkel in Dresden verbracht hatte, da erreichte ihn die Nachricht von dem Unglück. Seine Mutter, die Freifrau Friederike Marie von Sandersleben und ihr Schwager Georg, der jüngere Bruder seines vor mehr als zehn Jahren verstorbenen Vaters Freiherr Karl von Sandersleben, waren beide kurz nach seiner Abreise bei einem Schlittenunfall getötet worden. Fünfzig Jahre war die Mutter nur alt geworden, Onkel Georg war noch jünger gewesen. Anfang Dezember, genauer am siebten, dem Tag nach Nikolaus, hatten sie gemeinsam ihren Geburtstag begangen; der Onkel feierte den fünfundvierzigsten und er, Eduard, seinen achtundzwanzigsten. Nicht nur der Geburtstag war gefeiert worden, sondern auch, dass Eduard endlich, nach einigen bewegten Jahren im Dienst seines Landes, in denen er in Österreich, in Ungarn, in Turin gelebt hatte und schließlich nach Berlin kommandiert worden war, im kommenden Jahr, im Sommer oder vielleicht schon im Frühling, wieder nach Dresden zurückkehren durfte, wo seine Verlobte Luise bereits sehnsüchtig auf ihn wartete.
Kurz vor Silvester kam der schwarz geränderte Brief. Eine tiefe Traurigkeit erfasste ihn, als er diesen zögerlich öffnete und die beiden Todesmeldungen las. Er machte sich, so schnell es ging, von seinem Dienst frei, meldete sich bei seinem Vorgesetzten ab und fuhr mit der Eisenbahn von Berlin nach Dresden, um alles, was aufgrund des Todes der Mutter und des Onkels anfiel und zu tun war, mithilfe des im Haus verbliebenen treuen Dieners Karl zu erledigen. Die Beerdigung von Mutter und Onkel war unter großer Anteilnahme erfolgt. Eine Militärkapelle spielte einen getragenen Trauermarsch, und Generalmajor von Schimpff kondolierte ihm persönlich. Dies insbesondere, da der Onkel als Major das sächsische II. Infanterie-Bataillon geführt hatte und, wie früher Eduards Vater, vielfach im Ausland als Attaché und Kriegsberichterstatter im Einsatz gewesen war. Onkel Georg war unverheiratet verstorben, und so musste sich Eduard, neben dem mütterlichen Nachlass, auch um seine Hinterlassenschaften kümmern. Und damit fing alles an …
*
Johanna schloss brav die Augen, und bald zeigten ihre regelmäßigen Atemzüge, dass sie eingeschlafen war. Bismarck hingegen wälzte sich hin und her – und fand, trotz seiner Worte, selbst keinen Schlaf.
Der Tag war sehr anstrengend gewesen. Morgens war dieser obskure Brief gekommen, es war bereits der dritte in diesem Jahr. Er hatte ihn kurz überflogen und dann ärgerlich den Kopf geschüttelt. Alles, was er enthielt, waren Lügen und bösartige Unterstellungen. Ein einziger übler Schmutz und giftiger Unrat. Ähnlich den Schreiben, mit denen sich vor Jahren Freund Scharlach beschäftigt hatte. Angeekelt hatte er die Blätter ins Feuer geworfen. Mittags trafen neue Nachrichten aus Frankfurt und Italien ein; langsam braute sich über Deutschland ein böses Unwetter zusammen. Er konnte nur hoffen, dass alles so ablief, wie er es geplant hatte und sich ihm und dem Land nicht ein Abgrund öffnete. Wenigstens war das am Nachmittag geführte Gespräch mit Seiner Majestät ein gewisser Lichtblick gewesen. König Wilhelm folgte in allen aktuellen Fragen seinem Rat, auch wenn er da und dort gewisse Vorbehalte zeigte und mitunter recht schwierig und starrköpfig sein konnte. Aber insgesamt war Bismarck mit dem Resultat der Unterredung mit Seiner Majestät durchaus zufrieden gewesen. Doch am Ende des Tages hatte man dann auf ihn geschossen. So etwas geschah nicht ohne Absicht, das war geplant, und es stellte sich die Frage, wer das Attentat veranlasst hatte. Wer steckte hinter dem Geschehen? Eine Organisation, ein feindlicher Agentenring oder handelte es sich nur um einen verwirrten Einzeltäter, wie er gegenüber Johanna behauptet hatte? Vielleicht um jemanden aus dem Kreise der liberalen Opposition? Nein, das waren keine Mordbuben, die Herren würden offen gegen ihn auftreten und ihn notfalls fordern. So wie damals Vincke. Das vermaledeite Duell, auf das seine Frau angespielt hatte. Lange hatte er nicht mehr daran gedacht.
Georg von Vincke, ein früheres Mitglied der Frankfurter Versammlung und später Abgeordneter der preußischen zweiten Kammer, war ihm schon immer unsympathisch gewesen. Während der sogenannten Revolution des Jahres 48 hatte der Freiherr sich sogar auf die Seite der Aufständischen geschlagen. Er sah die Szene noch vor sich. Ein Billett des Freiherrn bat ihn, sich mit ihm im Hotel des Princes, Parterre rechts, zu einer wichtigen Konferenz zu treffen. Dort behauptete Vincke, im Auftrag von Höheren zu sprechen. »Nur Sie können den König bewegen, auf unseren Antrag einzugehen«, sagte er. »Es ist eine überaus schwierige Angelegenheit.«
»Ich bin gespannt und ganz Ohr«, erwiderte Bismarck und fragte, wer die »Höheren« seien, die Vincke zu seiner Darlegung ermächtigt hätten.
»Das will ich nicht verschweigen«, antwortete dieser mit gedämpfter Stimme. Er schob die wulstige Unterlippe vor. »Um es kurz zu machen: die Nation fühlt, dass Seine Majestät der König den nationalen Ansprüchen nicht genügen kann, nicht genügen will. Man wünscht daher die Abdankung des Königs.«
»Das ist ein revolutionärer Akt, den ich vor meinem Gewissen nicht verantworten könnte«, entgegnete Bismarck scharf. »Wenn Sie allerdings Garantien geben, dass Preußen die Leitung der deutschen Angelegenheiten erhält, so ließe sich darüber reden. Der Prinz von Preußen würde das Ruder sicher fest ergreifen.«
»Oh nein«, erwiderte Vincke, »nicht der Prinz ist derjenige, auf den wir unsere Hoffnung setzen. Ich darf ohne Übertreibung behaupten, er ist der unpopulärste Mann im ganzen Lande.«
»Die Armee denkt anders.«
Vincke schnippte verächtlich mit den Fingern. »Der Prinz ist unmöglich. Nein, wir wünschen die Regentschaft der Prinzessin während der Minderjährigkeit ihres Sohnes, der liberal erzogen werden wird.«
Bismarck erhob sich kerzengerade und sah Vincke fest an. »Auf einen solchen Antrag kenne ich nur eine Antwort: die Anklage auf Hochverrat!«
»Sie nehmen, werter Herr, das Ganze zu tragisch. Es handelt sich um eine politisch gebotene Maßregel! Ihr Prinz wird Kartätschenprinz genannt, man sagt, er habe 1849 auf die Bürger schießen lassen. Das Volk liebt ihn nicht, wenn auch die Bezeichnung Kartätschenprinz übertrieben ist.«
»Leider!«, gab Bismarck scharf zurück.
»Ich habe Ihren Kommentar nicht gehört, Herr von Bismarck«, sagte Vincke, »sonst müsste ich aufgrund Ihres Wortes Konsequenzen ziehen.«
»Ich bin zu jeder Satisfaktion bereit«, erklärte Bismarck kühl.
Aber Vincke hatte gekniffen, und die Satisfaktion musste bis zum März 1852 warten. Wieder provozierte ihn der Freiherr durch Worte. Er attackierte ihn öffentlich im Landtag und behauptete, Bismarcks einzige diplomatische Leistung als Gesandter am Frankfurter Bundestag sei bisher eine brennende Zigarre gewesen, worauf dieser scharf konterte – und daraus erwuchs nun endlich ein Duell.
Der Graf konnte sich gut an den Abend vor dem Kampf erinnern. Er verbrachte diesen zunächst bei einem alten Bekannten, dem General Leopold Gerlach. Sie saßen im Herrenzimmer, rauchten Zigarren und tranken dazu dunkles Bier, denn Gerlach war der Meinung, dass der Zigarrengeschmack sich nur mit Bier vertrüge. Man sprach über die aktuelle Lage im Parlament, wo es wieder hoch herging.
»Das Parlament ist der reinste Exerzierplatz für die Zunge, ein wahrer Tummelplatz für allerlei Spitzfindigkeiten«, ereiferte sich Bismarck. »Nulla dies sine linea! Kein Tag ohne Quatsch!«
Sein Gastgeber lachte.
»Sie haben mit Ihrer Charakteristik gewiss recht, Bismarck, aber mitunter übertreiben Sie einfach. Gestern erst der Zwischenfall mit Vincke. Seine verbale Attacke gegen Sie war kräftig, aber Ihre Reaktion … «
»Meine Reaktion?« Bismarck nahm einen kräftigen Zug aus seinem Glas. »Vincke wirft mir von der Tribüne Mangel an diplomatischer Diskretion vor und spielt dabei auf die Angelegenheit mit der brennenden Zigarre an. Sie kennen die Geschichte meiner Gegnerschaft zu Friedrich von Thun und Hohenstein, dem österreichischen Gesandten, der im Frankfurter Bundestag den Vorsitz führte. Jener erlaubte sich, als einziger im Tagungszimmer des Militärausschusses zu rauchen. Da ich nicht die Absicht hatte, Österreich besondere Privilegien einzuräumen, zog ich ein paar Tage später im Sitzungssaal, wo bisher nur der Vorsitzende geraucht hatte, eine Zigarre aus der Tasche und bat Thun höflich um Feuer. Das nächste Mal zog der bayerische Gesandte nach, bis schließlich alle, wenn auch nur aus Prestigegründen, rauchten. Das hatte ich Vincke unter vier Augen als Anekdote erzählt, und er nimmt darauf öffentlich Bezug und verspottet mich. Nein, nein, ich denke, meine Antwort war völlig berechtigt. Vincke besitzt nicht einmal die normale Diskretion, wie man sie gewöhnlich unter Männern von Ehre und Erziehung erwarten darf!«
»Unter diesem Aspekt, denke ich, hatten Sie das Recht dazu, sich derart kräftig zu äußern«, gab Gerlach zu, »aber die Antwort wird sicher Folgen haben.«
»Das ist richtig«, bestätigte Bismarck unbekümmert. »Ich habe meinen Schwager Oskar Arnim und Eberhard zu Stolberg-Wernigerode beauftragt, für mich etwaige Nachrichten Baron Vinckes entgegenzunehmen.«
»Und?«
»Vincke hat mich durch August von Saucken-Julienfelde auf viermaligen Kugelwechsel gefordert. Meines Schwagers Vorschlag, Säbel zu nehmen, lehnte er ab. Der Säbel wäre mir lieber gewesen, aber auch das Schießen wird gehen.«
»Ein Pistolenzweikampf mit viermaligem Schusswechsel«, rief Gerlach. »Und das sagen Sie mir erst jetzt! Wann soll das Treffen stattfinden?«
»Gleich morgen früh um acht. Das Duell muss sein, es gibt keinen anderen Weg mehr, die Angelegenheit zu klären. Am späteren Abend werde ich mit Superintendent Büchsel eine Betstunde abhalten. Der ist natürlich gegen den Zweikampf und nennt das Duell unchristlich. Aber, Sie begreifen sicher, es muss sein, ich kann nicht anders handeln und werde mich mit Vincke schießen.«
Der General schüttelte betrübt den Kopf. »Ich will Ihnen natürlich nicht abraten, vom Kampf zurückzutreten. Doch es ist eine furchtbare Vorstellung, ein Mann, der dem Lande derart nützlich dient, könnte durch eine Zufallskugel zu Tode kommen. Ich werde für Sie beten, mehr kann ich nicht tun.«
Am nächsten Morgen, es war der 25. März, herrschte warmes Frühlingswetter und Sonnenschein, obwohl es in den Tagen zuvor noch geschneit hatte. Im Waldplatz am Tegeler Seeufer zwitscherten die Vögel und es roch nach Wasser und Erde. Bismarck dachte an Johanna und die Kinder – und unterdrückte jeden Gedanken an seine Lieben, um nicht zu verzagen. Im Stillen betete er: Gott, halte deine schützende Hand über mich, damit ich mit meinem Leben dem Land auch in Zukunft nützen werde!
Der Unparteiische, Ludwig von Bodelschwingh, versuchte vor dem Zweikampf, eine Versöhnung der Parteien zu erreichen. »Meine Herren, ehe Sie beginnen, darf ich zu diesem Ehrenhandel bemerken, dass die Forderung den Umständen nach zu harte Konditionen hat. Ich schlage daher zur Mäßigung einen einmaligen Kugelwechsel vor!«
Nach kurzer Beratung erklärte Vinckes Sekundant August von Saucken-Julienfelde: »Wir gehen darauf ein.« Darauf wechselte er mit Eberhard zu Stolberg-Wernigerode halblaut einige Worte. Dieser nahm Bismarck beiseite. »Die Gegenpartei lässt Ihnen sagen, sie wolle die Affäre gütlich beilegen, falls Sie Ihre zu schroffe Äußerung jetzt vor den Zeugen bedauerten und zurücknehmen.«
»Das wäre eine bewusste Lüge«, erwiderte Bismarck. »Die begehe ich nicht. Der Freiherr verdient eine Lektion. Ich bedauere nichts!« Er fühlte sich absolut im Recht und hätte auch nicht anders gekonnt, als sich zu duellieren. Seine Werte waren echte Werte, für die er männlich einstand, und sie mussten notfalls durch das Duell verteidigt werden. Ein Verzicht auf den Kampf hätte für Bismarck einen öffentlichen Ehrverlust und drohende Lächerlichkeit bedeutet.
Der Unparteiische lud die Pistolen und reichte sie weiter. Die Gegner nahmen gegenüber Aufstellung. Auf sein Kommando – »Eins« – hoben sie die Waffen. Auf »Zwei« zielten sie, und wenige Sekunden nach dem Kommando krachten beide Schüsse. Ein endloser Augenblick der Unsicherheit erfüllte Bismarck, war er getroffen worden? Nein, er fühlte keinen Schmerz, war also unverletzt, sein Kontrahent hatte ihn verfehlt! Als der Rauch sich verzogen hatte, stand sein Gegner Vincke ebenfalls aufrecht da.
Mit gerührter Stimme verkündete Bodelschwingh das Ergebnis.
»Gottlob, es ist alles vorbei. Der Ehre ist Genüge getan worden.«
Die Herren schüttelten sich die Hände. Kurz hatte Bismarck überlegt, ob er überhaupt auf Vincke schießen solle. Als er aber doch schoss und ihn verfehlte, ärgerte er sich. Schuld waren die unpräzisen Pistolen, die mitgebracht worden waren. Ja, das Ganze glich ein wenig dem heutigen Geschehen. Nur, dass er damals selbst geschossen hatte. Jedenfalls lebte er, Gott war auf seiner Seite, denn er hatte ihn vor den Kugeln bewahrt. Bismarck gähnte herzhaft und glitt in den Schlaf. Das lange Sinnieren hatte ihn schließlich doch ermüdet, und er fand zur verdienten Ruhe.
*
Die Papiere der Mutter waren schnell gesichtet. Das Leben der Freifrau Friederike Marie von Sandersleben schien auf den ersten Blick keine großen Geheimnisse zu bergen. Ein paar Karten, einige Schreiben, Bankbriefe und Besitzurkunden. Alles war wohl geordnet gewesen und klar nach Soll und Haben aufgelistet. Zudem hinterließ die Mutter ein kleines Vermögen, das Eduard bei seinem kargen Sold, trotz aller Trauer, sehr gelegen kam. Ein junger Offizier hatte eben seine Ausgaben. Anders sah es bei Onkel Georg aus. Zwar hatte auch er einiges an Geldwerten besessen, das aufgrund des Testaments Eduard zufiel und ihn jetzt durchaus vermögend werden ließ. Aber sonst hatte es der Onkel an Ordnung missen lassen. Unzählige Briefe, jede Menge Notizen und andere Blätter lagen in den Schubladen wild durcheinander. Außerhalb des militärischen Dienstes musste sich der Onkel wenig um Klarheit und Strukturen gekümmert haben. Allerdings hatte er akribisch Tagebuch geführt. Eduard fand bei seiner Nachlasssichtung in einer Schublade des großen Schreibtisches im früheren Arbeitszimmer des Onkels mehrere Kladden, die eine Vielzahl sehr eng beschriebener Blätter enthielten. Zunächst hatte er nur ein wenig in ihnen geblättert und da und dort eine Passage genauer gelesen; schließlich aber biss er sich regelrecht in den Aufzeichnungen fest. Besonders die Eintragungen, die sich auf einen militärischen Spezialauftrag des Onkels bezogen, ließen Eduard nicht mehr los.
›Es ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her‹, hatte der Onkel notiert, ›dass Oberstleutnant d’Elsa vom I. Infanterie-Bataillon und ich zum Kriegsminister von Rabenhorst nach Dresden ins Ministerium befohlen wurden. Natürlich waren wir eine Viertelstunde vorher zur Stelle und vertrieben uns die Wartezeit im Vorzimmer mit allerlei Spekulationen, was Herr von Rabenhorst von uns wollen könne. Dass es um einen speziellen Auftrag gehe, war uns beiden klar, denn schon mehrmals hatten Oberstleutnant d’Elsa und ich geheime Aufträge im Ausland für das Ministerium zu erledigen. Doch was auf uns wirklich zukam, hatten wir uns in dieser Form nicht vorgestellt. Das Gespräch selbst war kurz.
»Meine Herren«, sagte von Rabenhorst in seiner direkten Art. »Ich habe Sie kommen lassen, da Sie beide hervorragende Offiziere sind. Sie, Major von Sandersleben stammen aus altem Adel, Ihre Familie, die dem Staat immer wieder wertvolle Dienste geleistet hat, lässt sich fast sechshundert Jahre zurückführen, und Ihre Vorgesetzten sind im Hinblick Ihres Diensteifers und Ihrer militärischen Leistungen voll des Lobes. Dazu gelten Sie in der Gesellschaft als guter Tänzer, sind gebildet und parlieren perfekt Französisch und Englisch. Und Oberstleutnant d’Elsa, Ihr Säbel und Ihre Pistolenkünste werden überall gerühmt. Auch Ihre planerischen Fähigkeiten haben Sie bereits mehrfach unter Beweis gestellt und stets ausgezeichnete Arbeit geleistet. Sollten Sie die anstehende Aufgabe ähnlich gut lösen, woran ich nicht zweifle, meine Herren, steht Ihnen die Tür zur Karriere weit offen! Kurz, meine Herren, Sie sind für einen Spezialauftrag ausgewählt. Seine Majestät der König und ich erwarten höchsten Einsatz!«
Des Weiteren ließ der Minister wissen, sie hätten den Auftrag, sich um die preußische Auslandsvertretung in Paris zu kümmern und das Ministerium regelmäßig über alle Vorgänge zu informieren.
»Besonders halten Sie sich an den Herrn von Bismarck. Er war bis vor Kurzem Preußens Gesandter in St. Petersburg und ist seit Mai in Paris. Wahrscheinlich wird er bald von dort nach Berlin zurückkehren. Wir gehen davon aus, dass Bismarck dem Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen im Amt des Ministerpräsidenten folgen wird. Ein wichtiger Mann mit Zukunft, Grund, ihn genauer zu studieren. Und genau das, meine Herren, werden Sie tun! Heute Abend geht ein Zug nach Paris ab, den Sie nehmen werden. Alles Weitere wird Ihnen Oberstleutnant von Carlowitz mitteilen.«
Die Offiziere nahmen pflichtgemäß den Auftrag an; sein Onkel, der Major Georg von Sandersleben, allerdings mit einem leichten, inneren Zögern, da ihn anderes bewegte. Es ging um eine Herzensangelegenheit, wie er knapp notierte. Vor einem Jahr war er in Karlsbad einem reizenden russischen Fräulein begegnet, das sich in der Stadt zur Kur aufhielt. Er sah es erstmals in Begleitung einer älteren Matrone im Kurpark flanieren. Die schlanke Gestalt war ganz in Weiß gekleidet und das schöne Antlitz schien von einer gewissen, geheimnisvollen Melancholie überzogen. Georg kreuzte ihren Weg und verliebte sich unsterblich in ihre dunklen Augen und die herrlichen Linien ihres Gesichtes. Allein er versäumte es, die schöne Unbekannte anzusprechen, zumal diese sich in Begleitung befand. Er schaute der Erscheinung nach, bis diese in der Menge der Flanierenden verschwunden war und löste sich dann erst aus seiner bewundernden Erstarrung. Ein bekannter Offizier erklärte ihm später, bei dem Fräulein handle es sich um eine Russin, die mit ihrer Mutter und der Tante den Kurort besuche, und die grimmig blickende Begleiterin sei eben diese Tante gewesen. Leider, sagte der Offizier, wisse er nicht den Namen, doch ließe dieser sich leicht erfragen. Am nächsten Tag fehlte das Fräulein jedoch und war weder im Park noch bei den Brunnen oder in einem der Kaffeehäuser aufzufinden. Trotz aller Bemühungen gelang es ihm nicht, die geheimnisvolle Schöne wiederzufinden. Kurz und gut, die Damen waren abgereist und niemand vermochte ihm Genaueres über ihre Herkunft und Umstände zu sagen; selbst der Name der Russin blieb unbekannt. Tief unglücklich reiste der Offizier ab und kehrte zu seinen Pflichten zurück. Der tägliche Dienst, die Routine des militärischen Alltags des Exerzierens, Reitens und Schießens dämpften seine Gefühle, und nach einer Weile ließ das Brennen in Georg von Sandersleben nach. Vor etwa zwei Wochen nun kehrte er von einer Inspektionsreise per Bahn nach Dresden zurück. Als er sein Abteil verließ, fuhr gerade auf dem gegenüberliegenden Gleis ein anderer Zug ab. Am Fenster eines Abteils der ersten Klasse sah er für einen kurzen Augenblick das schöne Bild wieder, seine Karlsbader Unbekannte, und stand im Nu erneut völlig in Flammen. Seitdem hatte von Sandersleben mehrfach versucht, seinem Ideal auf die Spur zu kommen. Dutzende von Möglichkeiten, an Informationen über das Fräulein zu kommen, waren bemüht worden und hatten sich als Misserfolg herausgestellt. Nur eines wusste er, der Zug war nach Berlin gefahren.
In diesem aufgewühlten Zustand wurde er mitsamt d’Elsa ins Ministerium befohlen. Der Auftrag sollte ihn nun in eine gänzlich andere Richtung führen. Aber ein Offizier diskutierte Befehle nicht, schrieb er, schon gar nicht, wenn diese vom Kriegsminister persönlich erteilt wurden. Er hörte also aufmerksam den Instruktionen zu. Ihr Auftrag sei, Herrn von Bismarck zu folgen, gleichsam zu seinen Schatten zu werden, hieß es. Dies sei im höchsten Grade wichtig und für das sächsische Vaterland von großer Bedeutung.