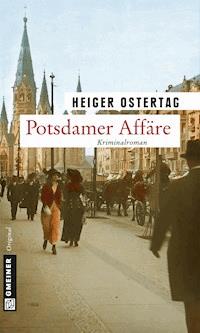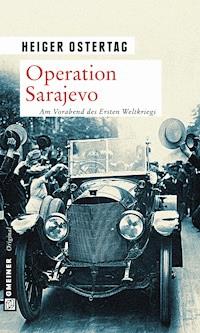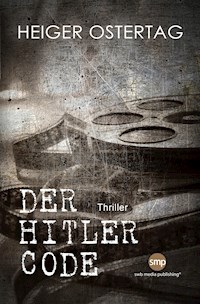Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Berlin im Jahr 1962, im Oktober kommt es zur Regierungskrise, als der Spiegel feststellt, die BRD könne nicht verteidigt werden. Dass die Lage ernst ist, zeigt die parallel anlaufende Kubakrise. Russen und Amerikaner pokern um die Macht, ein Spiel, das fast im III. Weltkrieg endet. Am Ende kommt es zu einem Patt. Doch was wäre, wenn sich alles ganz anders gestaltet hätte? Wenn in Bonn Brandt Adenauer abgelöst und die Schwäche der Supermächte genutzt hätte, um in einen Überraschungscoup den Mauerfall und damit die Wiedervereinigung zu erzwingen? Bisher unbekannte Quellen belegen, es gab deutliche Chancen dafür. Der vorliegende Politthriller schreibt die dazu gehörende Geschichte neu. Hart, explosiv, voller Spannung und Dramatik: Operation Mauerfall!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Mutter Rita Ostertag:ein Roman aus der Zeit, als sie jung war
Ich bedanke mich bei Herrn Hans-Jochen Tschiche, Bürgerrechtler, Mitglied des Runden Tisches und ehemaliger Abgeordneter im Bundestag sowie im Landtag von Sachsen-Anhalt, für seine freundliche Unterstützung. Ebenfalls bedanke ich mich bei Herrn Michael Bradler, Zeitzeuge, ehemaliger Stasigefangener und heutiger Besucherreferent der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, für seine bewegenden Worte, die im Roman in der Schilderung der dortigen Zustände Eingang gefunden haben.
Vorwort
Der vorliegende Roman spielt in den Jahren 1962/1963 im Umfeld der Kubakrise und der Spiegel-Affäre und reicht zeitlich bis zum Mord an dem US-Präsidenten John F. Kennedy. Was geschildert wird, entspricht der Realität oder hätte der Realität entsprechen können, wenn die einzelnen Persönlichkeiten im Sinne des Romans gehandelt oder die Chance gehabt hätten, so oder so ähnlich zu handeln. Bei allen Konjunktiven haftet den erzählten Ereignissen eine kräftige Portion von Realität an, denn die Handlung bewegt sich deutlich entlang einer bestimmten Wirklichkeitslinie, wobei da und dort Abläufe komprimiert und in Zeitraffer dargestellt wurden; andere erscheinen zeitlich »gelängt«. Die dargestellten Persönlichkeiten sind nahezu alle Personen des öffentlichen Lebens. Ihre Dialoge entsprechen zumeist ihren in den benutzten Quellen dokumentierten Äußerungen, manches wurde ihnen allerdings in den Mund gelegt, hätte aber wohl ihrem Charakter und Auftreten entsprochen. Sonstige Figuren sind erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen somit rein zufälliger Natur. Der Autor dankt an dieser Stelle ausdrücklich der Wochenzeitung ZEIT und dem SPIEGEL, in deren Archiven sowie in anderen, öffentlich zugänglichen Quellen vielseitiges und packendes Material zu finden war. Der Artikel »Bedingt abwehrbereit« im 1. Kapitel wurde als zeitgenössische Quelle in Auszügen wörtlich zitiert. Der Roman selbst ist eine Uchronie und lädt zu Spekulationen ein. In diesem Zusammenhang ist der Autor der Meinung, dass die von ihm angeführte Nobelpreisvariante historisch gesehen die korrektere Lösung darstellt. Die jüngste Entscheidung des Nobelpreiskomitees – nach Beendigung des Grundskripts – hat die dort angestellten Überlegungen für 2012 in gewandelter Form in die Wirklichkeit umgesetzt. Eine interessante Entscheidung. Im Übrigen sei allen Lesern ein spannendes Lesevergnügen gewünscht!
Dr. Heiger Ostertag
Mauerblicke
»Ich verstehe Ihre Frage so: Dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, da sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.«
Walter Ulbricht, Staatsratsvorsitzender der »DDR« auf einer Pressekonferenz, 5. Juni 1961.
Westberlin, 13. August 1961
In den frühen Morgenstunden des 13. August setzt eine Masseninvasion der Westberliner in den Tiergarten ein. Zu Tausenden ballen sich die Westberliner unmittelbar an dem Halbrund des Brandenburger Tores. Wer dort steht, muss zornig zusehen, wie Arbeiter und Bausoldaten, von schwer bewaffneten Volksarmisten und Polizisten bewacht, mit Pressluftbohrern die Straße aufreißen und quer über die Fahrbahn metertiefe und meterbreite Gräben ausheben. Die Menge pfeift hilflos. Drüben werden bereits Steine und Asphalt zu Barrieren aufgeschichtet, dann Betonpfeiler eingelassen sowie Stacheldrahtverhau gezogen. Die Straßen des ehemaligen Regierungsviertels der alten Reichshauptstadt gleichen einem weiten Heerlager. Überall in den Straßen sind Mannschaftswagen abgestellt. In den Hauseingängen der Ministerien und der Verwaltungsgebäude stehen bewaffnete Angehörige der sogenannten Betriebskampfgruppen. Nahe des Bahnhofs Friedrichstraße fahren sogar Schützenpanzer und Panzer sowjetischer Bauart auf; am Ende des Tages teilt eine riesige Mauer die Stadt.
»Am 13. August 1961 haben die friedliebenden Berliner eine Schlacht um den Frieden gewonnen«, meldet am nächsten Tag der Ostrundfunk. »Die Kampftruppen der Berliner Arbeiterklasse setzten der Wühltätigkeit der in Westberlin stationierten Agentenzentralen, Menschenhändler und Revanchistenorganisationen gegen die DDR gemeinsam mit den Genossen der Nationalen Volksarmee und den Genossen der Deutschen Volkspolizei in der Hauptstadt der DDR ein Ende. Geschlagen wurden die Kräfte des Krieges und der Reaktion. Der Sieg wurde errungen von den liebenden Deutschen, von den guten Deutschen, über die Bonner Ultras und deren Handlanger in Westberlin. Gescheitert ist die Kriegspolitik der USA. Wir sagen: ›Ami, go home‹.«
9. November, abends
An den innerstädtischen Grenzübergängen Berlins versammeln sich auf der Ost- und Westseite spontan die Menschen. Auch Achim Holthus und Claudia Gellner fahren zur Bornholmer Straße, dem Übergang vom Prenzlauer Berg nach Wedding. Dort stehen über hundert Trabis sowie an die tausend Wartende. Nieselregen fällt, es ist unangenehm kalt, die Menschen sind unruhig und frieren. Es stinkt nach Benzin und Braunkohle. Immer mehr Menschen werden es. Die Grenzkontrolleure wissen sich nicht mehr anders zu helfen, als die Bürger einzeln durch die Baracken zu lassen. Doch die Masse wächst, und es schallt aus Tausenden von Kehlen: »Tor auf! Tor auf!« Die Grenzer auf dem eingezäunten Areal der Kontrollstelle bekommen es mit der Angst zu tun. Sie sind sechzig Mann: Jenseits der Gittertore und Schlagbäume stehen jetzt dreißigtausend Menschen, wenn nicht mehr. Den Männern wird deutlich, die Menschenmassen werden nicht zurückweichen oder länger warten; sie werden weiter vorwärtsdrängen, die Posten überrennen und die Grenze hinwegfegen. Schließlich gibt der Kommandant den entscheidenden Befehl: »Stellt die Kontrollen ein, öffnet die Tore und schwenkt die Schlagbäume aus dem Weg! Wir fluten jetzt!«
Es gibt kein Halten mehr: Die Frau und der Mann und all die anderen neben und hinter ihnen rennen los …
In Washington klingelt das rote Telefon, es ist der deutsche Kanzler. »The wall is open, it’s time for the German Unity«, teilt er dem US-Präsidenten mit. Dieser antwortet: »We all are Berliner!«
Sektkorken knallen, Menschen liegen einander in den Armen. Die Mauer ist endlich gefallen.
1. Kapitel – Bedingt abwehrbereit!
»Die Deutschen sind für die NATO lebensnotwendig. Das ist geographisch, psychologisch und auf andere Weise begründet.«
John Galvin, US-General.
Mittwoch, 10. Oktober 1962
Der Morgen war kühl, und ein frischer Wind wehte in den Straßen. Achim Holthus schlug den Kragen seines Mantels hoch, um vor der Kälte etwas geschützter zu sein. Rasch ging er zum nächsten Zeitungskiosk und kaufte wie jede Woche den neuen Spiegel. Auf dem Cover des Hamburger Magazins prangte das Konterfei des Generalinspektors der Bundeswehr Foertsch. Der ehemalige Heeresgruppenchef sah auf diesem Bild ziemlich grimmig drein. Holthus schlug das Heft auf und blätterte zum Leitartikel auf der Seite 32, er begann zu lesen.
Der Kanzler verließ seine Hauptstadt Bonn. Wie der Führer zu Beginn des Westfeldzuges am 10. Mai 1940 frühmorgens bezog er einen Befehlsbunker in der Eifel. Den Kanzler begleiteten die Herren des Bundesverteidigungsrates und die Führungsstaffeln der Bundeswehr. Es war höchste Kriegsgefahr: Das Manöver »Fallex 62« (Herbstübung 1962), eine Stabsrahmenübung der NATO, ging aus der Phase der »Spannungszeit« in die des »Verteidigungsfalles« über. Der europäische NATO-Oberbefehlshaber, US-General Norstad, hatte »General Alert« gegeben, nachdem westliche Vorposten angegriffen worden waren …
Als er die Lektüre des Artikels beendet hatte, schüttelte der junge Mann bedenklich den Kopf. »Bedingt abwehrbereit!«; der Spiegel mochte mit seiner Darstellung recht haben, das Magazin war für seine exakten Recherchen bekannt und für seine Polemik berüchtigt. Aber so ein Artikel, der gnadenlos die eigenen Schwächen analysierte, lud den Osten geradezu zu einem sofortigen Angriff ein. Bei aller journalistischen Freiheit, diese Art von Offenheit grenzte fast an Verrat und schadete auf jeden Fall der politischen Stabilität. Holthus war gespannt, was seine Kollegin Brigitte und die Freunde zu dem Artikel sagen würden. Er zündete sich eine Zigarette an und machte sich auf den Weg in sein Zeitungsbüro in der Kochstraße. Holthus war selbst vom Fach. Der Achtundzwanzigjährige arbeitete in der Frontstadt Berlin für eine Frankfurter Tageszeitung, war aber auch als freier Journalist und Fotoreporter tätig. Was keiner seiner Kollegen ahnte, geschweige wusste: Der große sportliche Mann gehörte dem Bundesnachrichtendienst an. Ein Onkel von ihm hatte den studierten Politologen nach dessen Abschluss mit summa cum laude nach München eingeladen und dann wie von ungefähr den Kontakt mit dem BND in Pullach hergestellt. Seine liberale politische Grundhaltung störte dort niemanden und schien überraschenderweise sogar förderlich zu sein, zumal Holthus in nationalen Fragen konservativ dachte und agierte. Ihn faszinierte seine neue Aufgabe, die ihn direkt zum Brennpunkt des Ost-West-Konfliktes nach Berlin führte. Dort hatte er die letzten zwei Jahre in einer Studentenwohnung im tiefsten Kreuzberg in der Gegend um die Oranienstraße verbracht, das dortige Kneipen- und Kulturleben genossen und dabei auch den Bau der Mauer miterlebt. Bisher hatte seine nachrichtliche Aufgabe darin bestanden, aktuelle Informationen aus dem Ostteil der Stadt zu sammeln. Stimmungsbilder, Berichte von Geflüchteten und Geschichten, die alliierte Soldaten aus ihren Kontakten mit ostzonalen Grenzern und den Sowjets erzählten. Vor einem halben Jahr hatte er dabei etwas höchst Interessantes erfahren. Einem Studienfreund war es gelungen, über ein altes, labyrinthartiges Keller- und Gangsystem, das noch aus dem letzten Krieg stammte, seine Ostberliner Freundin in den Westen zu bringen. Ralf hatte Achim von dem Keller erzählt. Der Einstieg liege in der Nähe des Moritzplatzes, berichtete er, machte aber sonst keine genaueren Angaben. Dann waren Ralf und Ruth nach Hamburg gezogen und hatten das Wissen über den Verlauf des geheimen Fluchtwegs mitgenommen. Achim Holthus behielt die Information im Gedächtnis, vielleicht konnte sie ihm eines Tages nützlich sein. Er zog seinen Mantel fester und lief weiter.
Auch an anderen Orten wurde der Spiegel gelesen, vor allem im Bundesverteidigungsministerium fand die aktuelle Ausgabe zahlreiche Leser, denen insbesondere der Titelartikel wenig Freude bereitete. Verteidigungsminister Franz Joseph Strauß, als Bayer ohnehin ein Mann von hitzigem Temperament, kochte geradezu vor Wut.
Der Dritte Weltkrieg begann an jenem Freitag vor fast drei Wochen in den frühen Abendstunden. Die Manöverleitung ließ eine Atombombe von mittlerer Sprengkraft über einem Fliegerhorst der Bundeswehr explodieren. Weitere Atomschläge gegen die Flugplätze und Raketenstellungen der NATO in der Bundesrepublik, in England, Italien und der Türkei folgten.
Sofort berief der CSU-Minister ein geheimes Treffen seines Führungsstabes mit General Josef Kammhuber, Generalmajor Albert Schnez, General Hans Speidel und General Friedrich Foertsch ein. Anwesend war auch Staatssekretär Volkmar Hopf. Der Minister hielt sich nicht lange mit Formalitäten auf und kam gleich zur Sache.
»Haben Sie gelesen, meine Herren, was diese journalistischen Schmierfinken vom Spiegel wieder zusammengeschludert haben?«, polterte der bullige Mann los. »Ich zitiere: Nach wenigen Tagen waren erhebliche Teile Englands und der Bundesrepublik völlig zerstört. In beiden Ländern rechnete man mit zehn bis fünfzehn Millionen Toten. In den Vereinigten Staaten, die inzwischen von mehreren sowjetischen Wasserstoffbomben getroffen wurden, waren die Verluste noch größer.
Das ist eine ungeheure Sauerei, mit derart defätistischen Schreckensszenarien das Volk zu beunruhigen. Mehr noch, das ist Landesverrat! Dagegen werde ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln vorgehen!«
Selbst in Ostdeutschland fand der Artikel aufmerksame Leser. In seinem Büro in Straußberg studierte Armeegeneral Heinz Hoffmann, der Minister für Nationale Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik, nachdenklich die recherchierten Fakten.
Der Zweck von »Fallex 62« war, die militärische Bereitschaft der NATO und die Funktionsfähigkeit der Führungsstäbe zu prüfen … Es zeigte sich, daß die Vorbereitungen der Bundesregierung für den Verteidigungsfall völlig ungenügend sind … Bundesinnenminister Hermann Höcherl gewann die Erkenntnis, in einer solchen Katastrophe könne nur helfen, was vorher vorbereitet sei. Er zog das Fazit der mangelhaften Vorbereitungen: »Unter den gegenwärtigen Umständen hat fast keiner eine Chance.«
Hoffmann lächelte süffisant, stand auf und ging zu einem Wandtresor, den er öffnete und aus ihm einen schmalen Ordner nahm. Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, schlug diesen auf und begann zu lesen.
Plan Rot. Einsatzstärke 20 000 Kampfpanzer, 10 000 Schützenpanzer, 16 000 Geschütze sowie 135 Divisionen aus den sozialistischen Bruderstaaten. Luftunterstützung durch 6 000 Jäger und Jabos sowie 2 000 Kampfhubschrauber. Hauptstoß über Thüringen. Start der Feuerwalze: 5 Uhr. X plus 3, Schweinfurt ist erreicht, Fortführung der Operation entlang des Mains auf Frankfurt. Polnische Kräfte drehen über Hamburg nach Norden in Richtung Jütland ab. Die baltische Flotte durchstößt den Skagerrak und landet starke Kräfte zwischen Lübeck und Flensburg an. Ein weiterer Stoß erfolgt durch die norddeutsche Tiefebene über die Weser nach Westen …
Diese westlichen Journalisten hatten verdammt recht. Die bundesdeutschen Imperialisten würden keine Chance haben, wenn man die aktuelle Lage rechtzeitig zu nutzen wusste. Hoffmann griff zum Telefon und wählte die Nummer des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht.
In der sengenden Sonne der Karibik war ein Trupp schwitzender Männer dabei, auf einem Plateau den Boden eines größeren Baufeldes mit Beton auszugießen. Am Rande wurden bereits für den nächsten Bauabschnitt Stahlröhren verbunden und verschweißt. Ungefähr zwanzig Männer in Arbeitshosen und Unterhemden oder nackten Oberkörpern trugen Material herbei und schleppten Steine zur Seite. Dazwischen ratterten Planierraupen. Am Rande stand eine Gruppe Uniformierter, die Papiere und Pläne überprüften und Anweisungen erteilten. Weiter hinter zeigten sich Bewaffnete, die lässig an den Bäumen lehnten und rauchten. Der Leiter des Trupps, ein Mann in grüner Uniform, schaute auf seine Uhr. Halb sechs Uhr morgens, das Thermometer zeigte bereits 22° C und würde bis zehn Uhr auf über dreißig Grad steigen. Kein Lüftchen wehte, es stank nach Diesel und Abgasen. In der Ferne ballten sich Wolken zusammen, vielleicht brachte ein Gewitter Abkühlung. Es konnte auch einer von diesen verdammten Wirbelstürmen sein, das wusste man auf dieser Insel vorher meist nicht. Ein mieser Knochenjob für seine Männer, bei einer derartig schwülen Hitze zu arbeiten. Den Kubanern schien die Sonne nichts auszumachen. Die meisten von ihnen waren dunkel, ihre Haut schimmerte ölig vor Schweiß, doch die schwarzen Kerle lachten und sangen. Oberleutnant Sergej Tscherschinsky verstand kaum Spanisch, aber den Gesten nach, mit denen die Männer ihre Lieder begleiteten, musste es sich um sehr derbe Texte handeln.
»Miguel kommt heim zu Juanita, die auf dem Lager schläft. Sie hat nur ein Hemdchen an. Er legt sich zu ihr …«
»Es ist gut, Genosse Pawel, du brauchst mir den Text nicht zu übersetzen«, knurrte der Oberleutnant. Vor seinem inneren Auge sah er die junge Kreolin, die ihnen abends das Essen brachte. Bei ihr würde es sich schon lohnen, Miguel zu sein, dachte er. Da heulte plötzlich eine Sirene auf, und mehrere Flakgeschütze hämmerten los. Die Männer spritzten zur Seite und suchten unter den Bäumen am Rand der Baustelle Deckung.
»Verdammt, was ist passiert?«, rief Tscherschinsky in das Stakkato des Flakfeuers hinein.
»Die Gringos landen«, brüllte einer der Kubaner.
Später erfuhr der Russe, dass die kubanische Flak irrtümlicherweise einen verirrten Wetterballon für einen amerikanischen Aufklärer gehalten hatte.
Das Gespräch im Verteidigungsministerium auf der Bonner Hardthöhe hatte sich inzwischen konkreten Abwehrmaßnahmen zugewandt. Kaffee war gebracht worden, und der Herr Minister bot Zigarren und ein Schnäpschen an. Also entspannt überlegten die versammelten Herren, wie gegen den Artikel, seinen Autor und die Zeitung insgesamt vorgegangen werden konnte. Die Generalität plädierte für ministerielle Gespräche mit der Industrie, um dem Blatt den Werbehahn zuzudrehen. Generalmajor Schnez riet vor direkten Aktionen gegen den Spiegel ab. Die anwesenden Offiziere stimmten zu. Sie fürchteten die Macht der übrigen Presse, die auf polizeiliche Maßnahmen sicher mit einer geschlossenen Kampagne reagieren würde. Die im Artikel aufgeworfene Kritik an Strauß fand der eine oder andere der Versammelten weniger problematisch. Auch im innersten Zirkel wurden gewisse Entscheidungen des Ministers mit Skepsis betrachtet. Besonders mit der aktuellen Beschaffung von Waffen und Gerät waren einige der Generäle äußerst unzufrieden, vor allem seit der HS-30 Angelegenheit. Zudem fanden viele das ministerielle Auftreten mitunter sehr befremdlich. Erst im März dieses Jahres hatte der Minister die Generäle, die zum Rapport angetreten waren, eineinhalb Stunden warten lassen. Aber die Quintessenz des Artikels, die Armee sei nicht abwehrfähig, einte sie in gemeinsamer Empörung. Die Vorschläge gingen hin und her, man schien nicht weiter zu kommen.
»Herr Minister«, meldete sich schließlich Staatssekretär Hopf zu Wort. »Wir sollten die Frage eines möglichen Verrates juristisch prüfen lassen. Der Staatsrechtler Professor von der Heydte in Würzburg wird uns sicher rasch ein entsprechendes Gutachten präsentieren, und dann können wir gezielte Schritte unternehmen.«
»Von der Heydte«, wiederholte Strauß. »Seit 47 ist er in der CSU, gehörte einige Jahre dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken an und hat der Bundesregierung in Sachen Parteifinanzierung vielfach gute Dienste geleistet. Und auch im Juni, als der Spiegel schon einmal versuchte, die Regierung zu verleumden, hat sich von der Heydte in mannhafter Weise in die Bresche geworfen.«
»Von der Heydte ist ein guter Mann«, bestätigte General Foertsch. »Er ist Oberst der Reserve und war im Krieg Kommandeur des Fallschirmjägerregiments in der Normandie in der Schlacht um Carentan.«
»Die Beförderungsurkunde zum ›Brigadegeneral‹ liegt seit Juni im Präsidialamt vor«, warf Hopf ein. »Könnte man nicht die Prüfung beschleunigen?«
»Ein absolut einmaliger Fall, es hat in Deutschland noch nie einen General der Reserve gegeben«, wandte General Speidel ein. »Ich weiß, dass der Herr Bundespräsident deswegen zögert.«
»Nehmen Sie unverzüglich mit dem Mann Kontakt auf«, entschied der Minister. »Besser noch, Hopf, Sie rufen ihn gleich an. Er soll prüfen, wie wir diesem Augstein ans Leder gehen können. Ich bin es satt, dass unsere Bundeswehr durch die heimatlosen Linken mit Denunziationen, Drohungen und Verleumdungen besudelt wird. Teilen Sie dem Freiherrn mit, dass er auf den Lohn für seine Tüchtigkeit nicht mehr lange wird warten müssen. Wir zählen auf sein Können und seine vaterländische Gesinnung. Meine Herren«, wandte er sich an die versammelte Generalität. »Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.«
Holthus’ schmales Büro, das er sich mit einer Kollegin teilte, lag in einem Geschäftsgebäude in der Kochstraße in der Nähe der Kreuzung mit der Friedrichstraße nahe der Stelle, wo sich der »Checkpoint Charlie« befand. Von seiner Wohnung aus konnte er das Stück zu Fuß laufen; schneller ging es mit dem Bus, mit der U-Bahn musste er zu oft umsteigen. Meist lief er und nutzte die Zeit zum Nachdenken. Im Büro stank es nach kaltem Rauch, und Holthus öffnete das Fenster, um durchzulüften. Er war Gelegenheitsraucher, der nur ab und zu zur Zigarette griff, im Büro rauchte er nicht. Er hängte den Mantel auf und zog das Jackett aus, dann setzte er sich. Auf dem Schreibtisch fand er eine Nachricht, er solle umgehend die 08979315671 anrufen. Das war die Nummer der Abteilung LB – Informationsbeschaffung – des BND in Pullach, offenbar ging es um einen dringlichen Auftrag, wenn er im Zeitungsbüro angerufen wurde. Holthus wählte die angegebene Nummer und fragte nach Herrn Jacobi. Eine neutrale Stimme auf der anderen Seite der Leitung teilte ihm mit, es gebe dort keinen Herrn namens Jacobi. Holthus bedankte sich und legte auf. Er blickte auf seine Armbanduhr und wiederholte exakt nach zwei Minuten den Anruf. Diesmal wurde er sofort mit seinem Führungsoffizier Wendland verbunden, der ihm zu seiner Überraschung mitteilte, dass er morgen Mittag um zwölf Uhr zehn in Tempelhof landen werde.
»Sie holen mich am Flughafen ab. Ich trage einen grauen Mantel und den Spiegel. Wenn die Luft rein ist, fragen Sie mich, ob ich der Herr Jacobi bin. Wenn Sie mich anders ansprechen oder ich verneine, ist das Treffen geplatzt. Sie werden dann neue Anweisungen erhalten.«
Wendland, ob er wirklich so hieß, wusste Holthus nicht, beendete das Gespräch. Es klopfte an der Tür und, ohne auf seine Antwort zu warten, kam die Kollegin Brigitte Möller herein. Sofort füllte ein zarter Parfümgeruch den Raum. Brigitte war jünger als Holthus und studierte noch, in der Redaktion arbeitete sie nebenbei. Sie wirkte im Auftreten, in der Kleidung und in ihrer ganzen Erscheinung wie eine perfekte Kopie der französischen Schauspielerin und Namenscousine Brigitte Bardot. Nur zeigte ihr Haar eine rötliche und nicht blonde Färbung. Alles andere aber, vor allem ihre Figur und ihr Schmollmund, schienen nahezu identisch. Brigitte liebte zudem extravagante Kleidung, heute trug sie einen engen Rock und einen ebenso eng anliegenden Pulli, dazu hohe Stöckelschuhe. Sie drehte sich vor ihm im Kreis und schaute ihn auffordernd an.
»Nun, wie findest du meinen neuen Rock? Rudi behauptet, ich könne nicht so herumlaufen. Ich würde wie die Nitribitt aussehen. Du weißt doch, wie diese ermordete Frankfurter Lebedame. Das ist doch Unsinn, Achim, oder?«
Achim Holthus ließ sich mit der Betrachtung seiner Kollegin Zeit. Sie bot einen durchaus anregenden Anblick. Alles Wichtige saß stramm am rechten Platz und wurde in seiner Fülle durch den dunklen Stoff deutlich betont. Brigitte war wirklich eine anziehende Erscheinung. Und sie ist intelligent dazu, dachte er, schade, dass sie mit diesem Rudi herumzieht. Ob er an dessen Stelle begeistert wäre, wenn Brigitte derart in die Öffentlichkeit ginge, bezweifelte er.
»Der Stoff liegt sehr eng an«, sagte Holthus vorsichtig. »Also ich habe nichts dagegen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Rudi ...«
»Ach, Unsinn!«, unterbrach ihn Brigitte. »Ihr Männer seid alle gleich. Ihr gönnt einem Mädchen einfach keinen Spaß und seid auf alles und jeden eifersüchtig.«
»Bist du nur deswegen gekommen, um herumzumaulen?«, fragte der Journalist. »Ich müsste noch etwas arbeiten.«
»Nein, die Frankfurter riefen an und sagten, wir sollten Straßeninterviews machen. Was hält der normale Berliner von den Aussagen des neuesten Spiegel-Artikels? Geht die Angst um in Berlin? – Oder so ähnlich.«
»Okay, du fragst die Leute, ich mache Fotos. Bei deinem Auftreten bekommst du bestimmt jede Menge Antworten und Angebote!«, stichelte Holthus.
»Nicht alle Männer sind so oberflächlich wie du«, gab seine Kollegin schnippisch zurück, »und starren nur auf das Äußere. Im Übrigen ziehe ich einen Mantel an, dann wird den männlichen Fantasien ein Riegel vorgeschoben.«
Holthus zuckte mit den Schultern und holte seine Kamera aus einem Fach seines Schreibtisches. Brigitte warf ihren Mantel über, und beide zogen los. Sie fuhren mit der U-Bahn zum Kurfürstendamm, wo zu dieser Mittagstunde viele Menschen unterwegs waren. Während der Fahrt sprachen sie über den Spiegel-Artikel.
»Der Inhalt ist schon starker Tobak, kritisch, klar und gnadenlos«, meinte Brigitte. »So etwas imponiert mir. Ich würde mich wundern, wenn Strauß nicht alle Register zieht und versuchen wird, gegen das Blatt und seinen Herausgeber rechtlich vorzugehen.«
»Verstehen kann ich’s. Mich interessiert vor allem, wie die Öffentlichkeit reagiert und wo die Grenzen der Presse verlaufen.«
»Die Grenzen sind zum Glück sehr weit gesteckt«, erwiderte die Reporterin. »Im Neuen Deutschland wirst du so einen Artikel nie finden.«
Die beiden erreichten ihr Ziel und begannen ihre Umfrage direkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Bis halb zwei hatten sie fast fünfzig Leute interviewt; das reichte fürs Erste, und sie beschlossen, im KaDeWe Mittag zu essen.
Washington, D.C., 8 Uhr
Präsident John F. Kennedy saß im Oval Office an seinem Schreibtisch vor dem großen Südfenster. Er war früh erwacht und hatte sich entschlossen, direkt in sein Büro zu gehen, um noch vor der täglichen Zeitungslektüre einige Vorlagen und Berichte seines Stabes durchzugehen. Kennedy blätterte in einer Akte mit Angaben zum aktuellen Außenhandel, als an die Tür geklopft wurde. Wenige Sekunden später betrat Verteidigungsminister Robert S. McNamara das Zimmer.
»Mr. President, wir haben soeben von einem kubanischen Kontaktmann erfahren, dass die Russen auf Kuba offenbar weitere Militäranlagen bauen. Was die Roten im Detail bauen, konnte uns der Mann leider nicht sagen. Auch unsere anderen Kanäle schweigen sich dazu aus. Es scheint aber, wie bereits im August vermutet, etwas Größeres zu sein.«
»Was ist mit dem Aufklärungsflug, den ich gestern angeordnet habe? Gibt es noch keine Bildauswertung?«
»Mr. President, der Wetterlage nach muss mit Gewittern und Turbulenzen in den oberen Wolkenschichten gerechnet werden. Unsere Lockheed U-2 Dragon Lady ist zwar mit ihrer enormen Flughöhe für die feindliche Abwehr unerreichbar, doch die Maschine ist auch extrem wetteranfällig. Der Einsatz ist daher auf den 13. Oktober verschoben worden.«
»Senator Keating behauptet, auf Kuba befänden sich sechs Mittelstreckenraketenbasen in Bau, ist das korrekt?«
»Darüber besitzen wir keine verlässlichen Informationen, Mr. President. Dem Pentagon liegen lediglich Aufnahmen von Flugabwehrraketen vom Typ SA-2 Guideline und von Kampfflugzeugen vom Typ MiG-21 vor. In vier Tagen wissen wir mehr.«
»Ich habe den Kreml vor der Stationierung von Offensivwaffen gewarnt«, sagte Kennedy mit einem Anflug von Sorge in der Stimme. »Und Chruschtschow hat behauptet, Kuba besäße nur Verteidigungswaffen. Was machen wir, wenn die Russen wirklich Nuklearwaffen auf der Insel stationieren?«
»Dann käme es zu einer Krise, Mr. President«, antwortete McNamara, »genauer gesagt, zu einer sehr schweren Krise.«
Zur gleichen Zeit, nur um sechs Stunden verschoben, saß im Bonner Bundeskanzleramt im Palais Schaumburg Kanzler Dr. Konrad Adenauer ebenfalls an seinem Schreibtisch. Die Uhr zeigte hier kurz nach zwei nachmittags. Der Kanzler las stirnrunzelnd in einem Schreiben des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, das ihm soeben seine Sekretärin Anneliese Poppinga vorgelegt hatte. Der »Alte Fuchs von Rhöndorf«, wie er von den Insidern und Journalisten mit einer Mischung von Respekt und Kritik genannt wurde, ärgerte sich über den Brief. Der Inhalt hatte es denn auch in sich. John F. Kennedy schlug nichts weiter vor, als dass die Verteidigungsausgaben im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland für 1963 um die satte Summe von 1,3 Milliarden Mark erhöht werden sollten. Adenauer verstand sich mit dem in seinen Augen zu jungen Amerikaner nur bedingt, hatte sich jedoch bisher um eine gute Zusammenarbeit mit Washington bemüht. Dieser Versuch aber, sich in die deutsche Haushaltsplanung einzumischen, war aus der Sicht des Kanzlers ein Eingriff in die Souveränitätsrechte der jungen Republik. Seit 1945 hatte Adenauer darum gekämpft, für das zerstörte und besetzte Land die Eigenständigkeit zurückzugewinnen. Er hatte dafür die Aufstellung der Bundeswehr und den Aufschub der Einheit auf sich genommen. Mit Präsident Eisenhower war er bestens ausgekommen, doch mit diesem Kennedy war es von Anfang an nicht gut gelaufen. Ein eisiger Raureif überzog nach dem Amtsantritt Kennedys das deutsch-amerikanische Verhältnis. Adenauer hatte das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Bei einem Empfang, der zu Ehren des Kanzlers im vergangenen November im Weißen Haus gegeben worden war, sprach der Präsident deutliche Worte: »Herr Bundeskanzler, es gibt Menschen in diesem Raum, die Sie wegen Ihres politischen Erfolges bewundern, der außergewöhnlich ist. Es gibt andere, eigentlich alle, die bewundern Sie, weil Sie sich so lange in den Dienst Ihres Landes gestellt haben.«
Adenauers und John Foster Dulles’ Zeit des Einverständnisses als Basis der deutsch-amerikanischen Freundschaft war offenbar vorüber. Im Zentrum der deutsch-amerikanischen Meinungsverschiedenheiten stand Berlin. Für den neuen Präsidenten war die geteilte Stadt kein deutsches Problem. Für ihn war Berlin ein amerikanischer Stützpunkt im feindlichen Gebiet; entsprechend verhielt er sich. Erst im letzten Jahr hatte der Amerikaner untätig zugesehen, wie Moskaus Scherge Ulbricht mitten durch Berlin eine Mauer errichten ließ. Die gescheiterte Invasion in Kuba im gleichen Jahr war ebenfalls kein Ruhmesblatt gewesen. Dann die Geschichte mit dieser Schauspielerin, die dem Präsidenten zu seinem Geburtstag extra ein Ständchen gebracht hatte. Adenauer lag ein Bericht des BND vor, nachdem Kennedy mit der Dame, Marilyn Monroe hieß die Frau, eine leidenschaftliche Affäre gehabt habe. Angeblich sei auch der Bruder des Präsidenten, Justizminister Robert F. Kennedy, mit Monroe eng vertraut gewesen. Ihr Tod im August des Jahres sollte im Zusammenhang mit diesen Beziehungen stehen. Der Kanzler hielt Geheimdienstnachrichten nicht immer für glaubwürdig; Gerüchte waren Gerüchte. Aber ohne Feuer gab es keinen Rauch, und auch andere, durchaus glaubwürdige Stellen hatten von dieser fragwürdigen Liaison berichtet. Der streng katholisch erzogene CDU-Kanzler hielt ein solches Verhalten für unverzeihlich; ein Seitensprung gehörte sich für einen Staatschef nicht. Doch die Erhöhung des Verteidigungshaushalts, um die es im Brief ging, kam aus anderen Gründen nicht infrage. Bundesfinanzminister Heinz Starke von der FDP hatte ihm bereits einen Entwurf für den Bundeshaushalt 1963 vorgelegt, der Einnahmen und Ausgaben in einer Höhe von insgesamt 56,8 Milliarden Mark vorsah. Das bedeutete eine Deckungslücke von rund zwei Milliarden, die nur über den Weg der Steuererhöhung aufzufangen war. Das BMVG war an dieser Lücke mitschuldig. In den 18,4 Milliarden des Verteidigungshaushaltes waren vierhundert Millionen eingesetzt, die die Bundeswehr bereits in diesem Jahr überplanmäßig ausgegeben hatte. Weitere zwei Milliarden Mark wollte Bundesverteidigungsminister Strauß für die Beschaffung von Flugzeugen und Raketen ausgeben. Doch das Geld gab es einfach nicht, und der Inhalt des sogenannten Juliusturms, die Rücklagen des ersten Finanzministers Fritz Schäffer, war schon lange geleert worden. Adenauer entschloss sich, den Brief vorerst zu ignorieren. Andere Themen waren wichtiger, so dieser hetzerische Spiegel-Artikel. Er hatte seinen Minister aufgefordert, ihm um halb drei über die zu ergreifenden Maßnahmen Bericht zu erstatten.
In Langley, Virginia versammelte sich im Besprechungsraum der Central Intelligence Agency eine Gruppe von hochkarätigen Fachleuten. Im Zentrum des heutigen Treffens standen die Vorgänge auf Kuba. John Alex McCone, der Direktor, ein sechzigjähriger, grauhaariger Brillenträger, wirkte in seinem grauen Anzug nicht wie der Boss der neben dem KGB mächtigsten Geheimdienstorganisation der Welt. McCone hatte das Amt primär aufgrund seiner organisatorischen Kompetenz erlangt, die er vor allem in seiner Zeit als Unterstaatssekretär im Department of the Air Force und als Vorsitzender der US Atomic Energy Commission gezeigt hatte. Die meisten der übrigen Anwesenden, die um den runden Stahlrohrtisch saßen, gehörten zur Kontrollgruppe des Anti-Kubaprogramms, der Special Group for Counterinsurgency. Im Einzelnen waren dies General Maxwell Taylor, McGeorge Bundy, General Lyman Lemnitzer und Roswell Gilpatric vom Pentagon sowie Edward R. Murrow, der Direktor der United States Information Agency. Dazu der Lateinamerikaspezialist Porter Johnston Goss, General Edward Geary Lansdale und der mit dem KGB und seinen Methoden besonders vertraute CIA-Agent Charles D. Ford, insgesamt eine hochkarätige Runde.
»Die Lage ist ernst, meine Herren«, eröffnete McCone die Debatte, »nach den mir vorliegenden Informationen bin ich sicher, dass die Russen dabei sind, in Kuba Mittelstreckenraketen zu stationieren, die den ganzen Süden unseres Landes bedrohen.«
»Was sagt der Präsident zu den angeblichen Raketen?«, unterbrach ihn ungeduldig Roswell Gilpatric. »Ich bin überzeugt, dass er längst gehandelt hätte, wenn an diesen Berichten etwas dran wäre. Aber ganz gleich, wie es dort aussieht, wir sollten Castro eliminieren, dann wird sich das kubanische Problem von allein lösen«, fügte er mit ruhiger Stimme hinzu.
»Bringen wir den Kerl um die Ecke und landen parallel auf der Insel«, polterte der breitschultrige General Lansdale los. »Die Operation SWIFT STRIKE II im August hat gezeigt, dass fünfundsechzigtausend Mann genügen, um die Roten wegzufegen. Was meinen Sie, Goss? Können Sie den Burschen nicht direkt ausschalten?«
»Denkbar ist vieles«, antwortete vorsichtig der junge Agent, der extra aus Miami eingeflogen worden war. »Ich denke, mit einem guten Team ist alles möglich.«
Der dreiundvierzigjährige McGeorge Bundy, nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten und typischer Yale-Absolvent, schüttelte energisch den Kopf.
»Ich bin gegen überstürzte Maßnahmen. Noch so ein Fiasko wie die fehlgegangene Invasion in der Schweinebucht können wir uns nicht erlauben. Wir sollten zunächst alle sonstigen Optionen prüfen.«
Jetzt meldete sich der ehemalige Fernsehjournalist Edward R. Murrow zu Wort. Der schmale Kettenraucher, dessen Sendung »See It Now« zum Sturz des Kommunistenjägers Senator Joseph McCarthy beigetragen hatte, war ein umtriebiger Charakter und besaß einen messerscharfen Verstand. John F. Kennedy hielt große Stücke auf Murrow und hatte ihm mit Beginn seiner Präsidentschaft die Leitung der United States Information Agency, einer Einrichtung für »öffentliche Diplomatie«, angeboten.
»Es gibt eine ganze Menge Optionen, Gentlemen«, begann er und drückte seine Zigarette aus. »Außer einer Invasion und der Beseitigung Fidels könnte die Navy zum Beispiel den russischen Nachschub blockieren.«
»Und wenn die Roten mit einem Nuklearschlag drohen?«, warf General Lemnitzer ein. »Ich bin im Sinne der Operation Northwoods für eine Invasion, dann ist die Sache klar.«
»Der Präsident hat es im März abgelehnt, kommunistisch-kubanische Terroraktionen zu inszenieren, General«, wies Murrow den Beitrag zurück. »Die Möglichkeit eines sowjetischen Erstschlags dürfen wir allerdings nicht vernachlässigen. Aber ich glaube, John, du hast eine Idee?«, wandte er sich an John Alex McCone.
»Die habe ich«, grinste der CIA-Chef, »und deswegen habe ich Sie alle kommen lassen. Es geht um die russischen Nuklearcodes …«
Die Interviews zeigten deutlich, dass die Menschen in der »Frontstadt« von der Darstellung des Spiegels – soweit sie den Artikel gelesen hatten – verunsichert waren. Weit mehr aber erregten sich die Berliner über die Ermordung des Lacksieders Anton Walzer durch SBZ-Grenztruppen, von der die BZ und Bild ausführlich berichteten. Zwei Tage zuvor hatte Walzer versucht, an der Oberbaumbrücke im Ostberliner Bezirk Friedrichshain über ein Betriebsgelände am Spreeufer zu flüchten. Er kletterte unbemerkt auf einen Lastkahn, sprang im Schutz der Dunkelheit vom Schiff ins Wasser und schwamm auf das gegenüberliegende Westberliner Ufer zu. Doch ein Grenzposten entdeckte den Schwimmer und eröffnete das Feuer. Mehrere Geschosse schlugen am westlichen Gröbenufer ein. Ein Westberliner Streifenpolizist schoss daraufhin zurück. Auf der Spree näherte sich unterdessen ein SBZ-Boot dem Flüchtenden. Trotzdem feuerten die Grenzer weiter, bis eine Kugel Anton Walzer tödlich im Kopf traf und er im Wasser versank.
Holthus und seine Kollegin Brigitte verstanden den Unmut der Menschen über die »Mörder« von der anderen Seite. Am 17. August war der achtzehnjährige Maurergeselle Peter Fechter beim Fluchtversuch im Todesstreifen im Kugelhagel der Grenzer verblutet. Eine Woche später hatte Helmut Poppe, der neue Stadtkommandant von Ostberlin verkündet: »Kein Grenzverletzer darf lebend Westberlin erreichen.« Und erst vor vier Tagen war in den frühen Morgenstunden ein junger Mann, der an der Sektorengrenze des Bezirks Neukölln ostdeutschen Bürgern die Flucht durch einen Tunnel ermöglichen wollte, von Grenzern angeschossen worden. Von westlicher Seite hatte es dazu mehrfach Versuche gegeben, die Mauer teilweise zu beseitigen. Am 4. Oktober riss kurz nach Mitternacht ein Sprengkörper im Bezirk Mitte, Stresemannstraße/Köthener Straße ein Loch in die Mauer. Ein ähnliches Attentat geschah zwei Tage später im Bezirk Mitte. Der Kalte Krieg nahm in Berlin mitunter sehr heiße Züge an.
Die beiden Journalisten kehrten zurück in ihr Redaktionsbüro, um ihre Eindrücke niederzuschreiben. Abends um halb sechs machten sie Schluss, heute würde nichts Aufregendes mehr passieren. Holthus startete noch einen lahmen Versuch, Brigitte zu einem gemeinsamen Kinobesuch zu überreden. Zu gern wäre er mit ihr in den neuesten Edgar-Wallace-Film »Das Gasthaus an der Themse« gegangen, der vor zwei Wochen im Ufa Pavillon uraufgeführt worden war. Doch Brigitte winkte ab.
»Heute Abend gehen Rudi und ich aus. Wir fahren zum La Grotta in der Bleibtreustraße. Dort gibt es ein ganz neues Speiseangebot: echte italienische Pizza! Ich bin gespannt, wie Pizza schmeckt, das Gericht soll sehr würzig sein.«
Also ging Achim Holthus allein nach Hause. Immer zog sie mit diesem Rudi herum, dachte er ärgerlich. Was sie nur an diesem öligen Typen findet? Verstimmt schmierte er sich ein paar Stullen und verbrachte den restlichen Abend mit einem Bier vor dem Fernseher. Zunächst schaute er im ersten Programm Bella Musica an, eine Musikshow aus dem Süden mit dem Orchester Nino Impallomeni und dem Hamburger Fernsehballett. Um neun wechselte er ins ZDF. Dort zeigte man ein Schauspiel von Elmer Rice: Ruf zur Leidenschaft, welches ihn derart langweilte, dass er kurz vor zehn wieder zur ARD und zu Alfred Hitchcock zurückschaltete.
Donnerstag, 11. Oktober 1962
Die Soldaten der Nationalen Volksarmee Major Brägler und Leutnant Karsch sowie Stabsfeldwebel Schulze überquerten um sechs Uhr morgens in einem Ford Taunus die innerdeutsche Grenze bei Hof. Die drei trugen keine Uniform, denn sie befanden sich im »feindlichen Ausland« und im geheimen Einsatz. Die Männer gehörten der »12. Verwaltung« an. Ihr Auftrag lautete, im rückwärtigen Bereich des gegnerischen Territoriums durch spezielle Sabotageakte für Störungen zu sorgen, um den feindlichen Nachschub zu behindern und bei der Zivilbevölkerung Angst und Verwirrung hervorzurufen. Der Leiter ihrer Abteilung Generalleutnant Arthur Franke hatte den Major gestern Abend persönlich instruiert und ihm mündlich die entsprechenden Aufträge erteilt. Ihr Ziel war das Allgäu. Vor allem im Raum Ulm, Leipheim und Memmingen sollten die dort befindlichen Militäreinrichtungen der Amerikaner und der Bundeswehr getroffen und möglichst umfangreich beschädigt werden. Dort sollten sie auf weitere Gruppen stoßen, die im Laufe der Nacht über Österreich in die Bundesrepublik eingeschleust worden waren.
Der Major war zweiundvierzig Jahre alt, er hatte am Weltkrieg als Leutnant teilgenommen und war in russische Gefangenschaft geraten. Dort schloss er sich dem Nationalkomitee Freies Deutschland an und wandelte sich vom Saulus zum Paulus. Er war ein hagerer, durchtrainierter Mann, der nie etwas anderes als Soldat zu sein gelernt hatte und jeden Befehl ohne Skrupel ausführte. Der Oberstabsfeldwebel Schulze war dagegen ein bulliger, breitschultriger Mann. Im gleichen Alter wie der Major hatte er als überzeugter Kommunist im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft und galt als absolut hart und brutal. Der Jüngste in der Gruppe war der zweiundzwanzigjährige Leutnant Karsch, ein schmaler Mensch, der wie durchdrungen war vom Geist des Marxismus-Leninismus und darauf brannte, dies im Einsatz zu beweisen.
Brägler und Karsch waren für ihre Aufgabe in Varna in Bulgarien und in Ostrava nahe des Balatonsees in speziellen KGB-Lagern ausgebildet worden. Der Stabsfeldwebel war im Trainingslager Karlsbad gewesen. Alle drei fieberten dem Einsatz entgegen. Endlich ging es los mit dem Kampf gegen den Klassenfeind, ein Kampf, der mit der Vernichtung des Imperialismus und Kapitalismus enden würde.
Achim Holthus stand um sieben Uhr auf und trank zum Frühstück zwei Tassen schwarzen Kaffee. Dann machte er sich ohne Eile auf den Weg in sein Zeitungsbüro. Heute fuhr er Bus. Während der Fahrt las er die Morgenzeitung. Viel Neues gab es nicht. Papst Johannes XXIII. eröffnete am Morgen das Zweite Vatikanische Konzil. Im Fall des »Boston Strangler«, seit Juni hatten sich in der amerikanischen Ostküstenstadt bereits sechs Morde an Frauen ereignet, gab es bislang noch keine Spur. Der Revisionsantrag Vera Brühnes, die im Juni zusammen mit Johann Ferbach wegen Doppelmordes an dem Arzt Otto Praun und seiner Haushälterin zu einer lebenslangen Haftstrafe im Zuchthaus verurteilt worden war, würde vom Bundesgerichtshof verhandelt werden. Was das jetzt noch sollte? Die Frau war eindeutig die Mörderin, davon war Holthus fest überzeugt. Dann berichtete ein Artikel über das Gerücht, ein sowjetischer Militärtransporter sei im Frühjahr mit einem Zug kollidiert. Bei einem russischen Panzer habe sich eine Sicherung gelöst und die sich bewegende Kanone einen vorbeifahrenden Schnellzug getroffen. An die hundert Soldaten seien getötet worden, doch die Ostzonen-Behörden hätten den Unfall umgehend vertuscht. Eine Geschichte, der Holthus unbedingt nachgehen würde. Über den Spiegel-Artikel fand er kein Wort.
Brigitte Möller traf gleichzeitig mit ihm im Büro ein, was ungewöhnlich war. Meist kam sie erst nach neun, es sei denn, sie musste zur Uni, dann erschien sie erst nachmittags. Ihre Augen waren gerötet, und sie rauchte. Zudem trug sie heute einen weiten, schwarzen Pullover, dazu eine Jeanshose. Die Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengeknotet. Ihre Existenzialistenuniform, nannte Achim Holthus diese Kleidung; alles Zeichen, dass es Brigitte momentan nicht gut ging. Sie grüßte kurz, warf ihren Mantel achtlos über einen Stuhl und setzte sich mit finsterer Miene an ihren Schreibtisch. Sie drückte ihre Zigarette aus und zündete sich sofort eine neue Overstolz an. Dann spannte sie ein Blatt in ihre Triumph und begann in die Tasten zu hauen. Nach gut fünf Minuten hielt Brigitte abrupt im Schreiben inne, legte den Kopf auf den Schreibtisch und begann zu weinen.
»Brigitte, was hast du denn?«, fragte Holthus etwas hilflos und stand auf. Er trat zu ihr und strich ihr tröstend über den Kopf.
»Lass mich in Ruhe!«
Brigitte schüttelte seine Hand ab, sprang auf, griff zum Mantel und rannte aus dem Zimmer, wobei sie die Tür offen ließ.
Achim Holthus starrte ihr nach. Was war bloß in seine Kollegin gefahren? Frauen waren wirklich sehr komplizierte Wesen!
Der neu eröffnete Moskauer Flughafen Domodedowo befand sich zweiundzwanzig Kilometer weit von der Stadt entfernt im Süden. CIA-Agent Charles D. Ford landete mit der Maschine um elf Uhr dreißig und ließ über den Moskowskaja kolzewaja awtomobilnaja doroga, den ebenfalls erst kürzlich hergestellten vierspurigen Autobahnring, im Taxi zum Leningrader Prospekt fahren, wo er im Sowjetskaja-Hotel, einem luxuriösen, im Stalin’schen Architekturstil erbauten Hotel unter dem Namen Boris Wladimir Kolokolzew ein reserviertes Zimmer bezog. Ford war gleich nach der Besprechung in Langley mit einem Jet der »Firma« nach Rom gebracht worden, wo er in einen normalen Airliner nach Moskau stieg. Bereits vom Fiumicino aus war er unter der langjährig angelegten russischen Tarnexistenz gestartet. Sein blondes Haar war jetzt braun, den Bart hatte Ford abrasiert und seine Ausrüstung sowie die Kleidung bestand, einschließlich der Unterwäsche, aus Produkten, wie sie unter anderem das Moskauer Groß-Kaufhaus GUM anbot. Auf alles andere hatte Ford verzichtet, sicher war sicher. Für eine Waffe und die nachrichtendienstliche Sonderausrüstung würde unauffällig die Moskauer US-Botschaft sorgen. Die Passkontrolle war ohne Schwierigkeiten verlaufen, und auch das Check-in im Hotel ging ohne Probleme über die Bühne. Das Sowjetskaja war im Eigentlichen ein Funktionärshotel und große Teile des Hauses primär für ausländische Staatsgäste vorgesehen. Im Juli war Raúl, der Bruder des kubanischen Máximo Líder Fidel Castro im Hotel untergebracht gewesen; mit ein Grund für den Agenten, sich hier einzuquartieren. Mithilfe verschiedener Dollartransaktionen gelang das sonst nicht denkbare Vorhaben. Auf seinem Zimmer im dritten Stock fand Ford ein Päckchen für den Genossen Boris Wladimir Kolokolzew vor. Er ging ins Bad, schloss die Tür. Er legte das Paket in die Dusche, trat in diese, zog den Vorhang zu und ging in die Hocke. Im Schein einer Taschenlampe, die er mit seinem Körper abschirmte, öffnete Ford das Paket. Er fand eine Luger sowie einen Minisprechfunksender und eine schmales Codebuch vor, dazu ein Bündel Krawatten. Ford steckte die Waffe, den Sender und das Büchlein zu sich. Das geöffnete Paket mit den Krawatten ließ er demonstrativ auf einem Hocker liegen. Nachdem er sich rasiert, geduscht und umgezogen hatte, verließ er sein Zimmer und fuhr mit dem Fahrstuhl hinab zum Foyer. Er nahm in einen roten Sessel in der Eingangshalle Platz, griff sich eine Prawda vom Tisch und begann zu lesen. Etwa eine halbe Stunde später setzte sich eine schlanke, rothaarige Frau neben ihn.
»Genosse Kolokolzew, nehme ich an?«, fragte sie mit dunkler, rauchiger Stimme. »Ich bin Nadja und soll dem Genossen Moskau zeigen.«
Ford legte die Zeitung zur Seite und betrachtete »Nadja«. Sie war keine Schönheit im westlichen Sinn und schon gar nicht Marilyn Monroe. Aber ihr fein geschnittenes Gesicht und die grünen Augen wirkten durchaus attraktiv.
Ford nickte zustimmend.
»Gut, Genossin Nadja, brechen wir auf. Zunächst möchte ich zum Roten Platz.«
Bonn, BMVG, Spätvormittag
Franz Joseph Strauß saß an seinem breiten Schreibtisch mit Blick auf das beschauliche Bonn und ließ die aktuelle Lage Revue passieren. Gestern Mittag hatte er den Kanzler informiert, und dieser hatte ihm völlige Handlungsfreiheit signalisiert. Danach ließ der Minister seinen Apparat und seine Beziehungen spielen – mit Erfolg, wie es sich zeigte. Vor einer Stunde war es über den Ticker gekommen. Der Mann, der gestern im Gespräch gewesen war, der Würzburger Staatsrechtler und Oberst der Reserve Friedrich August Freiherr von der Heydte, hatte noch am gleichen Abend gegen die Redaktion des Spiegels eine Anzeige wegen Landesverrates erstattet. Der CSU-Mann rieb sich die Hände. Bald würden Augstein und Co. für ihr jahrelanges unbotmäßiges Verhalten bezahlen. So hatte im letzten Jahr der Spiegel berichtet, er, Strauß, habe seinem früheren US-Kollegen Thomas Gates die Firma Fibag empfohlen, um in der Bundesrepublik mehrere Tausend Wohnungen für die US-amerikanische Armee zu bauen. Natürlich hatte er das getan, und natürlich war er als Treuhänder an der Fibag beteiligt gewesen. Der Amerikaner hatte ihn nach einer verlässlichen Firma gefragt, und Firmen, an denen er sich beteiligte, waren verlässlich. Kein Grund, die Angelegenheit derart aufzubauschen. Auch diese unverschämte Meldung, Aloys Brandenstein, der »Onkel« seiner Frau Marianne, solle bei diversen Rüstungsgeschäften mit Geld bedacht worden sein, war in dieser polemischen Form falsch und entbehrte im Prinzip jeglicher Grundlage. Auf dem Höhepunkt dieser sogenannten Affäre hatte ihm der Generalinspekteur versichert, dass die Bundeswehr in voller Loyalität hinter Strauß stehe. Das war eindeutig, was wollten die Journalisten eigentlich? Der Spiegel jedenfalls hatte es auf ihn abgesehen, erst vor vierzehn Tagen hatte das Magazin behauptet, Kanzler Adenauer halte es für möglich, dass Strauß nach Bayern heimkehren wolle, und habe sich nach einem Nachfolger umgesehen. Der Kanzler solle Wohnungsbauminister Lücke gefragt haben, ob er bereit sei, das Bundesverteidigungsministerium zu übernehmen, worauf Paul Lücke nicht abgeneigt gewesen sei. Ein absoluter Unsinn, auf ihn warteten noch ganz andere Aufgaben in Bonn, wenn der Alte erst einmal weg war … Mit diesem linksjournalistischen Spuk würde es jedenfalls bald vorbei sein. Gut wäre es, dachte der Minister, wenn er die Bundesanwaltschaft und dort den Ersten Staatsanwalt Siegfried Buback anriefe. Buback sollte sofort einen Haftbefehl gegen Augstein ausstellen und am besten die Spiegel-Räume im Hamburger Pressehaus durchsuchen lassen. Da würde sich bestimmt weiteres Material finden. Der Minister griff energisch zum Telefon.
Punkt zwölf Uhr zehn landete in Tempelhof die Lufthansamaschine aus München. Es dauerte keine fünf Minuten, und ein schlanker Herr um die fünfzig im grauen Mantel, mit einem Aktenkoffer in der einen und dem Spiegel in der anderen Hand, kam vom Rollfeld in die Schalterhalle.
Holthus hatte dort gewartet und trat auf den Herren zu: »Herr Jacobi?«
Der Angesprochene blickte sich kurz um, dann nickte er.
»Wir nehmen ein Taxi und fahren zum Hotel am Zoo.«
»Zum Hotel der Berlinale?«, fragte Achim Holthus verblüfft.
»Ich besuche Berlin in meiner Eigenschaft als Repräsentant der Bavaria Filmstudios in Geiselgasteig«, erklärte »Jacobi«. »Da residiere ich natürlich im offiziellen Hotel der Berliner Filmfestspiele. Ansonsten, während der Fahrt kein Wort.«
Im Hotel am Zoo bezog »Jacobi« sein Zimmer. Anschließend trafen sich die Männer an der Bar.
»Hier sind wir gerade wegen der relativen Öffentlichkeit ziemlich ungestört«, erklärte der BND-Offizier. Der Münchner bestellte zwei Kognak. »Aber bitte einen Hennessy«, wies er den Barmann an. Das Bestellte kam, und er nahm einen genießerischen Schluck. »Jacobi« nickte, trank sein Glas aus und nötigte Holthus mitzutun.
»Das Gleiche noch einmal«, orderte er. Dann kam »Jacobi« endlich zur Sache.
»Die Amerikaner haben uns einen Tipp gegeben, dass drüben in Ostberlin etwas zugange ist, nach Erstinformationen handelt es sich um eine hochbrisante Angelegenheit. Weder die noch wir wissen, worum es dabei genau geht. Es könnte mit diesem Artikel im Spiegel zu tun haben, der gestern erschienen ist. Aber das ist nur eine Vermutung. Sie haben den Artikel gelesen?«
Holthus nickte.
»Gut, dann können Sie sich denken, dass die Amis fürchten, die Sowjets würden die Gunst der Stunde nutzen und zumindest Berlin überrennen. Daher ihr großes Interesse an rascher Aufklärung. Unsere Informationen sind in der Hinsicht derzeit allerdings eingeschränkt. Wir haben zwar einen Mann in Pankow, doch der ist seit Tagen nicht erreichbar; da stimmt was nicht. Es muss jemand in den Osten und die Sache überprüfen. Ich dachte an Sie. Sie fahren morgen oder übermorgen nach Ostberlin und klären, was dort los ist!«
Holthus schaute »Jacobi« überrascht an.
»Ich habe mit solchen Erkundigungen überhaupt keine Erfahrung und wüsste auch nicht, wie ich vorgehen sollte.«
»Keine Sorge, Herr Holthus. Ich werde Sie genau instruieren. Sie haben schon einen grundsätzlichen Vorteil. Ihre ganze Person, vor allem Ihr Gesicht, ist im Osten niemandem bekannt. Ich habe zusätzlich dafür gesorgt, dass auch in Pullach nichts über Sie vorhanden ist. Ich traue niemandem und bin ziemlich sicher, dass die Russen oder die Ostdeutschen Informanten in unserem Haus sitzen haben. Zunächst aber zeige ich Ihnen die Lage unserer Kontaktstellen sowie die Position der toten Briefkästen.«