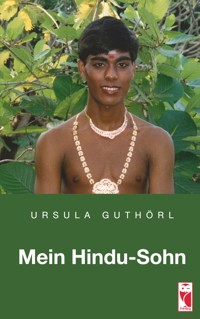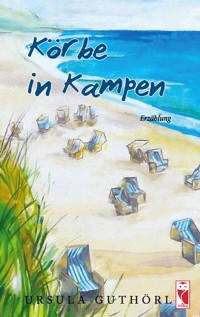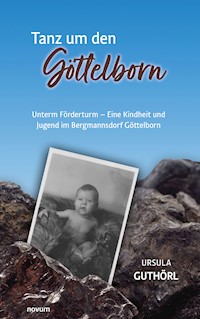Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frieling-Verlag Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jammern die Menschen von heute auf hohem Niveau? Dieser Frage wird unter anderem in den Episoden aus dem Leben von Ursula Guthörl und ihrem Umfeld nachgegangen. Wie war es damals und wie ist es heute? Der Konsum und die Ansprüche der Menschen sind gewachsen. Hat der Mensch dadurch auch in seinem Menschsein Fortschritte gemacht? Informativ und kritisch hinterfragend beleuchtet Guthörl die harten Lebensverhältnisse der Nachkriegszeit, beschreibt die komplizierten Lebensumstände für die Frauen jener Tage und veranschaulicht die mühsame "Annäherung der Geschlechter". Dass jede junge Generation im Laufe der letzten Jahrzehnte mit Herausforderungen zu kämpfen hatte, dokumentiert die Autorin mit spannenden Zeitzeugnissen in Form von Originalbriefen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Weitere Publikationen der Autorin:
„Körbe in Kampen“(Frieling-Verlag Berlin, 2023)„Die Erde hängt an einem Faden“(August von Goethe Literaturverlag, 2023)„Tanz um den Göttelborn“(novum Verlag, 2022)„Zeichen und Gnade“(edition sawitri, 2021)„Wasser-Morgen oder Intuition und Liebe“(Edition Göttelborn, 2005)
INHALT
Vorwort
Sorgen, Wunder und Liebe
Heute und gestern
Das Berufsleben einer Sekretärin
Die Nachkriegszeit
Annäherung der Geschlechter
Wahrheitsliebe
Eltern
Verkehrsmittel
Schule
Lieblingsbeschäftigungen und Träume
Hier und jetzt
Hoffnung, Freuden und Pflichten
Frustrationen und Erfüllung
Emanzipation
Fazit
Für meine Mutter, Wilhelmine Häbel, für Hermann Lenz, für Makarand Paranjape, für Peter Handke, für alle Freunde, für alle Menschen
With confidence we shall advance, With certitude we shall wait. (Mirra Alfassa alias „The Mother“)
Mit Zuversicht werden wir vorankommen, Mit Gewissheit werden wir warten.
Vorwort
Als ich begann, diesen Text niederzuschreiben, zog ich in Erwägung, ihn unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Immerhin gebe ich einige Geheimnisse von mir preis. Jetzt, wo die Blätter vor mir liegen, fände ich es angesichts meines Anspruchs, aufrichtig und wahr über versunkene Zeiten zu berichten, etwas feige, meinen Namen zu verschweigen. Schließlich geht es mir um Kommunikation und ich würde mich über Reaktionen der Leser(innen) freuen. Auch sie wären anonym weniger wertvoll für mich.
Obwohl mein langer Aufsatz auf den ersten Blick wie eine Autobiografie aussehen mag, war dies nicht meine Absicht. Ich lasse lediglich Zustände, Ereignisse – persönlicher und allgemeiner Art – wie in einem Prisma zusammenfließen, um einen begrenzten Ausschnitt einer Zeitspanne lebendig werden zu lassen. Natürlich ist mein Erfahrungsreichtum damit noch lange nicht ausgeschöpft.
In erster Linie versuche ich, jungen Menschen von heute einen ungefähren Eindruck davon zu vermitteln, wie schwierig und oft rückständig die Zeit vor 70, 60, 50, ja 30 Jahren war. Vielleicht hilft es Ihnen ja ein wenig, die Gegenwart besser zu ertragen und zu schätzen, wenn Sie sich bewusst werden, dass auch die Nachkriegsgenerationen nicht immer auf Rosen gebettet waren.
Vor meinem geistigen Auge zogen moderne Teenies und Gruftis vorbei, während ich auf meiner Lieblingsinsel Porto Santo im Atlantik altmodisch in mein Heft kritzelte. Deshalb bezeichne ich das Ergebnis als ein Jugend- und Altenbuch. In den Mädchenjahren meiner Mutter nannte man die junge ungestüme, leicht alberne Spezies Backfische. Für und über sie wurden schmalzige Bücher geschrieben, die relativ wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatten. Heute würden Teenager mitleidig darüber lächeln, denke ich mal. Mein Lieblingsbuch war „Steffys Backfischzeit“ von Magda Trott. Meine Mutter bekam es 1928 von ihrer lieben – jung gestorbenen – Schwester zu Weihnachten geschenkt, als sie 13 war. Wir haben es beide gleichermaßen geliebt und unsere Weltanschauung davon verklären lassen. Der Roman handelt von einem jungen Mädchen, das nach langem Hin und Her seinen ersten Kuss bekommt. Das fand ich mit 15 Jahren unheimlich aufregend. Junge Damen von heute machen in jenem Alter wahrscheinlich schon ganz andere Erfahrungen und könnten sich über so viel Naivität nur amüsieren. Vielleicht würden sie das Buch aber auch ein wenig romantisch finden und mit Spaß lesen, wer weiß. Die entscheidenden Sätze in „Steffys Backfischzeit“ lauten:
„Ich habe noch keine Braut, Fräulein Steffy, aber ich denke, recht bald eine zu haben.“ „Wir wollen Veilchen suchen.“ [= Steffys ausweichende Antwort] Jetzt würgten Tränen in ihrer Kehle. Da riss er sie in seine Arme. „Steffy, fühlst du nicht, wie gut ich dir bin? Weißt du denn nicht, dass dir mein ganzes Herz gehört?“ Nur einen einzigen Augenblick sah sie zu ihm auf, dann schmiegte sie sich in seine Arme. Er schloss ihr mit einem Kusse den Mund. [Man beachte das e am Ende von Kusse.] „Meine Steffy denkt jetzt nicht mehr an Schopenhauer und kümmert sich mehr um Haushalt [na also!] und um ihre Stunden [welche?]. Willst du das tun, Liebling?“ [Natürlich wollte sie.]
So habe ich mir jahrelang meinen ersten Kuss ausgemalt. In der Realität war er dann nur nass wie von einem Karpfen, und ich traute mich nicht, mir den Mund abzuwischen, weil ER dadurch gekränkt sein könnte. Der neun Jahre ältere Knabe mag sich dagegen gefragt haben, warum ihn dieses 16 jährige Kind verlegen wie ein Honigkuchenpferd angrinste, wenn er es „in seine Arme riss“. Sicher hatte ich irgendwo gelesen, dass man immer lieb und freundlich zu den Männern sein sollte.
Nach der Hochzeit hat Steffy wahrscheinlich Eheromane gelesen und viel später – als Großmutter – Erbauungsromane.
Wenn ich das Radio anschalte, vernehme ich ständig, wie prekär die Zeiten sind. Wir haben eine „Schönwetterdemokratie“, hörte ich zum Beispiel jemand sagen. Man müsse warnen, um den Anfängen zu wehren und den dumpfen Rechten keine Chance zu geben, falls sich die Probleme doch nicht so schnell in den Griff kriegen lassen würden. Die Menschen in unserem Land hätten es jedoch satt, immer als „die Bösen“ beschimpft zu werden. Trotzdem wäre die Jugend sehr schlecht über die Zeit vor dem Krieg, während seiner Dauer und danach informiert. Zeitzeugen hätten aber leider die Tendenz, den Nationalsozialismus zu rechtfertigen. Teenager wären außerdem wenig an komplizierten, theoretischen Abhandlungen über jene unrühmliche Zeit interessiert. Private Erlebnisse kämen besser bei ihnen an. Warum machen wir dann nicht das Erzählen und den Humor zu unseren Verbündeten? Ich nehme mir das jetzt zu Herzen, überwinde die Hürde meiner scheuen Zurückhaltung und versuche, meine „subjektiven Wahrheiten“ mit Heiterkeit und einem verschmitzten Augenzwinkern in die Welt zu setzen. Überglücklich wäre ich, wenn beim Lesen ab und zu ein herzhaftes Lachen erschallen würde, sodass die Nachbarn entnervt an die Wand klopfen. Das habe ich in Luxemburg tatsächlich schon selbst erlebt.
Sorgen, Wunder und Liebe
Jeden Tag werden neue Hiobsbotschaften verkündet: Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel (inzwischen ist es scheinbar umgekehrt), Geldnot der Kranken-, Pflege- und Pensionskassen, die gigantische Verschuldung des Bundes, Attentate, Zerstörung der Umwelt und so weiter und so fort. Die Bürger machen sich Sorgen. Ein bisschen mulmig kann einem wirklich werden. Wo führt das hin? Haben wir das Recht, unseren Nachkommen – falls wir unsere Vermehrungspflicht überhaupt erfüllt haben – einen solchen Schlamassel zu hinterlassen? Wer muss die Zeche letztendlich bezahlen? Vielleicht kann nur noch ein Wunder helfen. (Das Wort Wunder wird im Moment ziemlich überstrapaziert.) Neue, utopische Ideen müssten verwirklicht werden, die uns bessere Wege aufzeigen. Vielleicht liegen sie ja schon irgendwo in Schubladen. Kramen wir sie doch mal mit vereinten Kräften hervor.
Es heißt: Die Wohlhabenden werden immer reicher und die Mittellosen immer ärmer. Dabei hatten wir im Westen doch gedacht, die größten Ungerechtigkeiten überwunden zu haben. Pessimisten unken: „Eines Tages werden sich die Verlierer zusammenrotten, um sich das ihnen Zustehende mit Gewalt zu holen.“ Ich bin lieber Optimist und weigere mich, an einen Krieg „Arm gegen Reich“ auch nur zu denken. Kaputt machen und wiederaufbauen ist nicht nachhaltig und außerdem langweilig. Seit ewigen Zeiten haben wir die gleichen Fehler wiederholt. Macht, Sieg und Vorherrschaft bringen nichts Dauerhaftes zustande. Das sollten wir, die „Krone der Schöpfung“, inzwischen gelernt haben. Solidarität, Liebe, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Mäßigung sind im Grunde die „stärkeren Waffen“. Wenn wir diese Werte nicht länger unterdrücken, könnten sie der Humus für eine neue Kultur werden. Zugegeben, einfach ist es nicht, jemanden zu lieben, der uns gerade gekränkt oder beleidigt hat, wie ich mitunter selbst am eigenen Leibe erfahren habe.
Heute und gestern
Dieser Text soll kein theoretisches Traktat werden, in dem ich nur Beobachtungen und längst bekannte Binsenwahrheiten aneinanderreihe. Vielmehr möchte ich mich selbst und meine Familie mit einbringen. Denn nur eigene Erfahrungen können einigermaßen authentisch wiedergegeben werden, sofern Ehrlichkeit der Antrieb ist.
Zurück zu den aktuellen Diskussionen über anstehende Veränderungen, die den Lebensstandard zahlreicher Menschen der entwickelten westlichen Länder in den kommenden Jahren möglicherweise reduzieren werden. Es ist natürlich hart, liebe Gewohnheiten zu ändern oder aufzugeben, weil das Geld nicht mehr ausreicht. Mir scheint jedoch, wir sind ganz schön anspruchsvoll geworden. Dinge, die in meiner Kindheit und Jugend nur Wunschträume oder noch gar nicht erfunden waren, werden heute mit größter Selbstverständlichkeit benutzt und konsumiert. Die junge Generation denkt vielleicht, dass ihnen all dies zustehe. Die Eltern strampeln sich im Beruf ab, auch um vor ihren Kindern nicht als Versager dazustehen. Das wird nicht immer mit Dankbarkeit belohnt. Die anderen haben all die begehrten Dinge doch auch! Wenn den Sprösslingen etwas versagt wird, sind sie womöglich übellaunig oder machen gar selbst Schulden, um ihre überzogenen Ansprüche zu befriedigen. Obendrein beschweren sie sich dann auch noch, wenn die Eltern keine Zeit und keine Kraft mehr für sie haben. Dies ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Junge Schulabgänger, die keine Lehrstelle finden, nach einer Ausbildung nicht übernommen werden und deshalb keine Perspektiven für ihr Leben zu erkennen vermögen, haben natürlich mein vollstes Verständnis und Mitgefühl. Doch auch sie lässt man nicht nackt auf der Straße liegen, wie das zum Beispiel in Ländern wie Indien oft der Fall ist.
Trotz allem Grund zur Besorgnis möchte ich auch daran erinnern, dass selbst Menschen mit einem Mindesteinkommen immer noch viel mehr besitzen als die Generation der Kriegs- und Nachkriegszeit. Das karge Leben dehnte sich bis in die Sechzigerjahre aus. Dann ging es allmählich aufwärts.
Eigentlich bin ich froh, als Kind und junge Frau „arm“ gewesen zu sein, denn so konnte es nur bergauf gehen. Heute bin ich dankbar für alle meine Errungenschaften, darunter die Waschmaschine, der Elektroherd, die Zentralheizung, der Kühlschrank, die Spülmaschine, das Telefon, der Fernseher, der Computer, die neuen Designer-Sitzmöbel, der Esstisch mit Glasplatte, der Couchtisch mit dimmbarer Lampe, die süßen Kitschfigürchen aus Portugal, der Sandelholz-Ganesha aus Indien, die selbst gebastelten Ketten aus Meeresschnecken, die mir das Meer geschenkt hat, der lange Black-Denim-Rock mit smaragdgrüner, figurbetonter Walkjacke von Hess-Natur und – das Allerwichtigste – ein privates WC mit Waschbecken. – Auch wenn ich das alles nur sozusagen „ausgeliehen“ habe und in ein paar Jahren einzig das Wesentliche, das Innere mitnehmen darf.
Ich weiß noch genau, wie sehr wir uns in meiner Familie über jede Neuanschaffung freuten. Zuerst hieß es jedoch eisern sparen. Schulden machen wäre uns nicht in den Sinn gekommen. Das war nur gerechtfertigt, wenn man den Bau eines Hauses in Angriff nahm.
1950 wurde in unserem Dorf ein Verein (Ketteler-Verein) zum gemeinsamen Bau bescheidener Einfamilienhäuser gegründet. Auch meine Eltern wurden Mitglieder. Wer wenig Geld hatte (wie wir), musste seine Arbeitskraft einbringen. Mein Vater arbeitete rund fünf Jahre lang jeden Tag nach seiner Berufsarbeit (Vermessungssteiger bei der Grube Göttelborn) auf dem Bau. Er hatte sich das Zimmererhandwerk angeeignet und erstellte mit einem Team alle Dächer von schätzungsweise 40 Häusern. Als wir selbst bereits in unser Haus eingezogen waren, musste er weiterarbeiten, damit auch die Letzten mit noch weniger Geld ihr Haus bekamen. Sogar die Mauersteine wurden in Eigenarbeit hergestellt. Es war eine wirkliche Leistung, so wenige Jahre nach dem Krieg. Es funktionierte. Jedes Mitglied besaß am Ende ein eigenes Haus. Es hätte ja auch schiefgehen können, wenn das Geld ausgegangen wäre und der Verein Pleite gemacht hätte. Alles endete gut mit vereinten Kräften ohne allzu große Ansprüche.
Wir mussten sehr sparsam leben. Wenn Vater am Monatsende sein Gehalt nach Hause brachte, wurde es sofort eingeteilt. Das Haushaltsgeld bewahrte Mutter in einem großen Heft auf. Für jede Woche wurde eine feststehende Summe zwischen die Seiten gelegt. Ein Bankkonto hatten wir damals noch nicht. Wir gaben nicht mehr aus, als uns zur Verfügung stand. Nur ein einziges Mal – ausgerechnet vor Weihnachten! – kam eine unvorhergesehene Ausgabe dazwischen und wir standen völlig blank vor dem Fest. Wir hielten einen Familienrat ab und kratzten alle Franken zusammen. (Das Saarland gehörte damals zur Frankenzone.) Ich war 18 und mein Bruder 14 Jahre alt. Wir beschlossen, sehr bescheiden zu feiern und nur so viel zu essen, dass wir nicht hungerten. Mein Bruder hatte gerade eine Schreinerlehre begonnen und bekam ein kleines Weihnachtsgeld. Das schenkte er großzügig seinen Eltern und seiner Schwester, die noch zur Schule ging. So rettete er die Ehre seiner Familie. Wir hätten in unserem kleinen Kaufmannsladen nie anschreiben lassen. Noch jetzt bin ich ganz gerührt über Werners liebe Opferbereitschaft. (Inzwischen schaut mein lieber Bruder von „oben“ herunter.)
50 Jahre danach stehen die Häuser immer noch. Inzwischen sind wahrscheinlich alle Erbauer gestorben und die Kinder und Kindeskinder haben ein Haus geerbt. Dadurch war es für sie bereits ein wenig leichter, auf einen grünen Zweig zu kommen. Das nächste Haus war dann etwas komfortabler.
Meinem Vater hat diese Arbeit Spaß gemacht. Er war stolz, etwas Sinnvolles zu leisten. Außerdem genoss er die Unabhängigkeit von der Willkür irgendwelcher Hausbesitzer. Aus dem Haus werfen konnte ihn nun keiner mehr. Die Arbeit empfand er wie ein Hobby. Als das Werk vollendet war, fehlte ihm irgendwie diese handwerkliche Beschäftigung im Freien. Der Einzug ins eigene Haus gehörte zu unseren befriedigendsten Familien-Erlebnissen. Die Einrichtung war nicht perfekt, doch das machte uns nichts aus. Im Bad gab es zunächst noch kein warmes Wasser. Das musste für eine Weile im Wasserkessel der Waschküche erhitzt und in Eimern nach oben getragen werden. Die jüngste Schwester meiner Mutter (zu Besuch) mokierte sich darüber, obwohl sie in Dortmund selbst sehr eingeschränkt lebte und gern bei uns kostenlos Urlaub machte. Immerhin hatten wir aber jetzt ein Badezimmer. Vorher hatten wir in einer Dienstwohnung gewohnt, die der Grube gehörte. In diesen Häusern gab es keine Bäder. Einmal die Woche wurde ein Kessel in der Waschküche im Keller mit Kohlefeuerung in Betrieb genommen und das Wasser in Zinkbadewannen gegossen. Dann konnte das Badefest losgehen. Mutter, mein Bruder und ich badeten vereint. Leider wurde unsere fortschrittliche, „unprüde“ Mutter dafür von der Schwägerin mit Schmutz beworfen. Wir Kinder fanden es vollkommen normal, sie auch ohne Kleider zu sehen.
Während der Woche wusch man sich mit einem Handtuch um die Brust am Spülstein in der Küche. Für die intime Wäsche setzte man sich in eine längliche, emaillierte Blechwaschschüssel. Eltern und Geschwister genierten sich nicht voreinander. Alles fand ganz natürlich in Anwesenheit der anderen statt. Meinen Vater habe ich allerdings nie auf dieser Waschschüssel sitzen sehen. Er badete täglich in der Waschkaue seiner Arbeitsstelle, wenn er rußschwarz aus der Grube kam. Unter Tage machte er Messungen für Flöze des Kohlenabbaus. Manchmal erzählte er, dass er durch ganz niedrige neue Streben auf dem Bauch und den Ellbogen kriechen musste. Seltsamerweise machte es ihm nichts aus, dass er in der dunklen, gefährlichen Tiefe arbeitete. Er war es von Jugend auf gewöhnt und empfand sogar eine Art Stolz dabei. Wenn er nach Hause kam, waren seine Augen wie mit Kajal schwarz umrändert. Meine Mutter oder ich reinigte sie ihm mit Nivea auf einem Wattebausch. Mir fällt noch ein, dass er von seiner Arbeit mit Holz beim Dächerbau sehr oft Splitter in den Fingern hatte. Ich übernahm es, sie ihm mit einer feinen Nähnadel herauszupulen. Vorher wurde die Nadel an einem Faden ein paar Minuten in kochendes Wasser gehalten, um die Bakterien abzutöten. Ob das wirklich der Fall war, bezweifle ich. Mein Vater war nicht wehleidig, und ich hatte ein Erfolgserlebnis, wenn es mir gelang, den Splitter herauszuziehen. Es entzündete sich nie. Mein Vater sagte danach lobend: „Das hast du gut gemacht!“
Unser Grubenhaus wurde von zwei Familien bewohnt. Wir wohnten oben. Ursprünglich waren es Einfamilienhäuser. Nach dem Krieg mussten die Grubenangestellten zusammenrücken, weil Franzosen in unser Dorf im Saarland zogen und die leitenden Positionen bei der Grube übernahmen. Also musste Wohnraum für sie gefunden werden. Deshalb erhielten wir die Aufforderung, unser geliebtes Einfamilienhaus zu verlassen und in ein Nachbarhaus zu ziehen, wo unten bereits ein älterer Bruder meines Vaters mit Frau und zwei Söhnen wohnte. Das war ein schwerer Schlag für uns. Meine Mutter, mein Bruder und ich weinten. Ich war zehn Jahre alt. Voller Sehnsucht dachte ich in den darauffolgenden Jahren an mein verlorenes Heim.
Die Verantwortlichen der Grube sollen zueinander gesagt haben: „Stecken wir die zwei Nazi-Brüder doch zusammen in ein Haus.“ Beide waren nämlich Parteimitglieder der NSDAP gewesen. Ich kann mir allerdings schlecht vorstellen, dass mein Vater irgendjemand etwas Unrechtes angetan hat. Er fand die neue Ideologie gut, weil sie vorgab, Deutschland seine Würde zurückzugeben. Mein Vater wollte wieder stolz sein auf sein Vaterland. Die Partei war eine Art Klub für ihn, wo er sich mit Gleichgesinnten treffen und seine Freizeit gestalten konnte. Diese Zugehörigkeit verlieh ihm mehr Wichtigkeit und steigerte sein Selbstwertgefühl. Ich denke, das spielte für viele sogenannte „Mitläufer“ eine Rolle. Viele Menschen, die wie mein Vater normalerweise korrekt und anständig waren, fielen auf die hohle Propaganda herein. Sie wurden manipuliert von einer machthungrigen „Wolfselite“ und merkten es in ihrer Naivität nicht einmal.
Wir, die wir nicht mehr ganz so dumm sind, können ihre demütige, unkritische Haltung kaum nachvollziehen. Es ekelt einen regelrecht an, wenn man die alten Filme sieht und die Stimmen der damaligen Machthaber hört. Nach der Kapitulation hatten solche Verführten ein Gefühl des totalen Verlusts ihrer Identität. Daraus konnten sie sich anscheinend nur mithilfe einer Art Amnesie retten. Ihre Irrtümer und Fehler einzugestehen, das war ungeheuer schwer, wenn nicht gar unmöglich.
„Habe ich denn alles falsch gemacht?“, jammerte mein Vater verzweifelt und verärgert, als ich ihn einige Jahre nach Kriegsende um Aufklärung bat, warum er Parteimitglied geworden war. Meine Mutter sah für sich keine Notwendigkeit und keinen Reiz darin, in die Partei einzutreten, obwohl Karlheinz, ein junger Nazi-Nachbar, sie unter Druck setzte. Sie weigerte sich standhaft, und doch litt sie nun am meisten unter der Entnazifzierung. Die Frau des Bruders war eine intrigante, ziemlich hässliche Klatschtante. Sie machte meiner hübschen, jungen Mutter das Leben schwer. Mein Vater hatte leider nicht die Zivilcourage, sie vor den Schikanen der Verwandten zu schützen. Das kränkte sie sehr und machte sie oft krank. Einmal wollte ich als kleines Mädchen meiner Mutter helfen, indem ich von der Treppe herunter die Tante anschrie: „Du blödes Weib!“
Schlimm war, dass es nur ein Klo in diesem Haus gab. Es befand sich in einem kleinen Vorbau der Haustür gegenüber und war eiskalt im Winter. Ein Waschbecken gab es auch nicht darin. Dieses wichtige Örtchen wurde also von neun Menschen aufgesucht. Der älteste Sohn des Onkels war nämlich verheiratet und wohnte mit seiner Frau ebenfalls im Haus. Mir ist immer noch schleierhaft, wie wir zurechtgekommen sind. Schließlich mussten wir morgens alle früh aufstehen.
Noch heute habe ich wiederkehrende Albträume, dass ich keine Toilette finde oder dass sie total verschmutzt ist. Mein kleiner Vetter hinterließ das Örtchen nämlich immer in unsäglichem Zustand. Ein großer Vorteil war allerdings, dass es eine Wasserspülung gab. Wir gehörten nämlich zu der etwas privilegierteren Klasse der mittleren Angestellten. Die Arbeiterhäuser hatten nur Plumpsklos außerhalb des Wohnbereichs. Die Eltern meines Vaters zogen elf Kinder in einem Arbeiterhaus groß. Der Großvater hatte ursprünglich einen selbstständigen Anstreicherbetrieb, machte aber Pleite (weil er – laut meinem Vater – die Wandergesellen auch im Winter, wenn es kaum Arbeit gab, behielt und durchfütterte) und fing notgedrungen als Arbeiter bei der Grube an.
Wenn ich meine Großmutter besuchte (den Großvater habe ich nicht mehr kennengelernt, weil er mit 59 Jahren starb), ging ich besonders gern aufs Plumpsklo. Es klatschte so schön in der Tiefe, und den Geruch fand ich interessant. Einmal entdeckte ich dort ein altes Schullesebuch meiner Tante Else (anstelle von Toilettenpapier). Das riss ich mir unter den Nagel und habe es noch heute im Bücherregal stehen. Der Inhalt hat mich als Kind fasziniert. Als die Kinder dieser Großfamilie klein waren, liefen sie auch draußen nur mit einem Hemdchen bekleidet herum. Das war praktisch, weil man dann keine Windeln und nassen Höschen wechseln musste.
Die kleinen, unwichtig erscheinenden Beschwerlichkeiten machen uns oft am meisten zu schaffen. Ich bin mir natürlich gleichzeitig dankbar bewusst, dass unsere Familie ein unverschämtes Glück hatte. Niemand war im Krieg geblieben, ja nicht einmal verwundet oder ausgebombt worden. Auch ernährungstechnisch mussten wir nicht allzu große Not leiden, weil wir große Gärten hatten.
Die Tatsache, dass ich eine weiterführende Schule besuchte, war durchaus nicht selbstverständlich in unserem Dorf. Nur einer Handvoll Kindern meines Jahrgangs wurde dies ermöglicht. Ich durfte also täglich mit dem Zug 15 Kilometer weit zur Mittelschule (Realschule) nach Saarbrücken fahren. Bahnhöfe gab es in den Nachbarorten Merchweiler und Quierschied. Busse verkehrten im ersten Jahr noch nicht. Daher blieb mir mit elf Jahren nichts anderes übrig, als rund drei Kilometer (je hin und zurück) zu Fuß zu laufen. Um sechs im Dunkeln bei jedem Wetter mit unpassender Kleidung und mangelhaftem Schuhwerk machte ich mich auf den Weg.
Trotz all dieser Widrigkeiten darf man nicht denken, wir wären unglückliche Jammerlappen gewesen. Wir kannten es schlichtweg nicht anders oder nahmen die Gegebenheiten hin und freuten uns unseres Lebens, so gut wir konnten.
Mit diesen Erinnerungen möchte ich den jungen Menschen, die heute Probleme haben, Mut machen. Mit Bescheidenheit und Fantasie kann man auch mit wenig Geld fröhlich sein.
Nun könnte man meinen, nach unserem anstrengenden, kargen Alltag hätten wir wenigstens einmal im Jahr einen erholsamen Urlaub an einem Meeresgestade oder in den Bergen verdient. Aus heutiger Sicht ist das ja auch ganz selbstverständlich, doch uns kam ein solcher Wunsch überhaupt nicht in den Sinn. Das Wort Urlaub war ohne reale Bedeutung für uns. Schulferien gab es natürlich, und die verbrachten wir in unseren Gärten, Höfen und Wäldern.
Das Meer habe ich zum ersten Mal im Alter von 21 gesehen. Im dritten Jahr meiner Banktätigkeit hatte ich endlich so viel Geld gespart, dass ich mutterseelenallein für zwei Wochen (mehr Urlaub hatte ich ja nicht) mit dem Zug nach Rimini fahren konnte. Ich traf am frühen Morgen dort ein und nahm mir am Bahnhof eine Kutsche, um stolz damit vor dem bescheidenen Hotel vorzufahren. Der Preis für die Pferde war allerdings eigentlich unvereinbar mit meinem Budget. Zu so früher Stunde war das Hotel noch zu und ich setzte mich müde und ergeben neben meinen Koffer auf ein Mäuerchen, bis sich das Tor öffnete. Als ich das weite, blaue Meer zum ersten Mal erblickte, war ich überwältigt. Diese Erfahrung hatte ich nun meiner Mutter voraus. Mein Vater war während seiner Soldatenzeit schon einmal an der Nordsee gewesen.
Das Klo gegenüber der Haustür bot mir nebenbei einen Vorteil. Nach dem Mittagessen – wenn ich schulfrei hatte – war es meine Aufgabe, das Geschirr zu spülen. Ich hasste das, zumal es damals keine Spülmittel gab und das Wasser in einem Kessel auf dem Kohlenherd erhitzt werden musste. Deshalb verdrückte ich mich manchmal zuerst einmal aufs Klo. Von dort zwängte ich mich dann durchs winzige Fensterchen zum Hof und traf mich mit den Nachbarskindern, die schon draußen spielen durften und anscheinend nicht spülen mussten.
Zu diesen Grubenhäusern gehörten sehr große Gärten mit vielen Obstbäumen und Beerensträuchern. Während der Hungerjahre nach dem Krieg bekamen wir dadurch im Sommer immer genug Vitamine. Das Gemüse, das mein Vater anbaute, war allerdings nicht besonders appetitlich. Die Möhren waren zum Beispiel regelmäßig von Würmern durchfressen. Das lag wohl am Dünger. Der kam nämlich aus der Jauchegrube der Klos (die Bezeichnung Toiletten wäre zu elegant). Mit kleinen Eimerchen an langen Holzstangen schöpfte man die stinkende menschliche Gülle in Eimer, um sie auf die Gartenbeete auszubringen. Mein Vater erzählte uns gern die Geschichte von dem Kind, das einst ins Jaucheloch gefallen war und von ihm gerettet wurde.
Dass wir nichts anderes kannten als unser bescheidenes Dasein, stimmt auch nicht ganz. Der Vater meiner besten Freundin Marianne war Betriebsdirektor bei der Grube und wohnte mit seiner Familie in einer Villa mit Park. Jedes Kind hatte sein eigenes Zimmer. Zusätzlich gab es ein Extraspielzimmer und natürlich auch ein Bad. Ich liebte das großzügige Haus mit den vielen Spielsachen und war fast täglich Gast in diesem Luxus. Ich war nicht etwa neidisch, sondern fühlte mich richtig zu Hause dort.
Der Vater kam nach dem Krieg für einige Zeit ins Gefängnis. Bei der Grube müssen Unterschlagungen im Zusammenhang mit den freiwilligen russischen Bergarbeitern vorgekommen sein. Diese Russen waren mit Familie nach Deutschland gekommen, weil sie keine Kommunisten sein wollten. Wir „Hinterwäldler“ fanden diese Menschen exotisch. Sie lebten in Baracken hinter einem Zaun außerhalb des Dorfes. Sonntags pilgerten wir dorthin, um „Russen zu gucken“, als wären sie wilde Tiere im Zoo. Ich erinnere mich noch an ihre Kinderwagen. Sie waren sehr hoch, wie es später nach dem Krieg auch bei uns Mode wurde. Lebensmittel, die für die Russen bestimmt waren, verschwanden. Und so ging es den Emigranten schlecht. Ob der Vater meiner Freundin in den Skandal verwickelt war, weiß ich nicht. Frau und Kinder wirkten nicht besonders traurig während seiner Abwesenheit. Und die Villa mussten sie auch nicht verlassen. Irgendwann war er dann zurück und nahm seine Tätigkeit bei der Grube wieder auf.
Sogar sonntags ging ich oft mit der Familie meiner Freundin spazieren. Als uns meine Eltern einmal im Wiesental begegneten, waren sie etwas befremdet und meinten später zu Hause: „Spazieren gehen kannst du in Zukunft auch mit uns. Und überhaupt kommt deine Freundin nie zum Spielen in unsere Wohnung. Sag ihr das.“ Was ich folgsam tat. Es änderte sich trotzdem nichts. Marianne hatte wahrscheinlich keine Lust, bei uns in der Küche mit meiner Puppenstube zu spielen. Der Rat meiner Eltern bewog mich schließlich, meine Besuche in der Villa einzustellen. Sie hatten ja recht. Ich war ebenfalls nicht zufrieden damit, dass meine Freundin nie zu uns kam. Ihrer Mutter tat es leid. Sie hatte es immer gern gesehen, dass ich die Freundin ihrer Tochter war.
Als wir dann ab dem elften Lebensjahr nach Saarbrücken zur Schule gingen – sie aufs Gymnasium und ich auf die Mittelschule –, hatten wir uns sowieso nicht mehr viel zu sagen. Natürlich sahen wir uns noch im Zug. Ich bemühte mich schon früh um ein gesittetes, erwachsenes Benehmen (zum Beispiel bei der Art, im Zug zu sitzen), während sie sich noch ein wenig albern wie ein Kind auf die Bank fläzte. Das gefiel mir nicht. Ich dagegen machte eine Phase durch, während der ich gar nicht mehr wusste, wie ich ungezwungen sitzen und gehen sollte, weil ich mich selbst zu viel beobachtete. Beim Gehen fand ich es zum Beispiel langweilig, beide Arme einfach schlenkern zu lassen. Oder beim Sitzen im Zug legte ich eine Hand in den Schoß und die andere neben mich auf die Tasche. Ich wollte immer etwas asymmetrische Abwechslung in meine Körperhaltung bringen und dachte, dass jeder mich beobachten würde. Heute kommt mir das ziemlich blöd und egozentriert vor. Vielleicht haben andere junge Menschen ja ähnliche Probleme in der Pubertät. Manchmal fragte ich meine Mutter: „Wie bin ich denn eigentlich?“, und sie antwortete: „Sei einfach natürlich.“ Ich wusste aber nicht, wie das ging.
Als ich etwas älter wurde und mit 16 einen Tanzkursus besucht hatte, wuchsen sich diese Unsicherheiten allmählich aus. Ich übte das Schreiten wie ein Mannequin mit einem Buch auf dem Kopf, indem ich die Füße voreinander setzte und nicht breit auseinander. Das fand ich unmöglich. Wenn ich stand, stellte ich den linken Fuß gerade und den rechten etwas schräg dahinter. So kaschierte ich meine leichten O Beine.
Was mein Äußeres anbetraf, war ich sehr selbstkritisch. Jeden Tag entdeckte ich etwas anderes, das mir nicht an mir gefiel. Viel Zeit verbrachte ich vor dem Spiegel. Auch unterwegs musste ich immer mal wieder mithilfe des Handspiegels das richtige Gesicht aufsetzen, kontrollieren und Pickel mit einem amerikanischen Abdeckstift betupfen. Manchmal fand ich mich dann wieder einigermaβen hübsch und freute mich, wenn mir die Männer anerkennend nachschauten oder pfiffen. Ich begann sehr jung damit, mein Gesicht zurechtzumachen, weil ich die Akne überschminken musste und ich mich sonst auch zu ausdruckslos fand.
An regnerischen Sonntagen zu Hause war ich ziemlich gelangweilt und deprimiert, weil nichts passierte und ich im Dorf auch keine Freundin mehr hatte. Ewig hockte ich zu Hause bei meinen Eltern und drehte am Radio herum, aus dem selten Musik kam, die mir gefiel. Sonntagnachmittags gab es immer nur populär-klassische Musik. Die konnte ich nicht ausstehen. Noch heute erinnere ich mich an dieses frustrierende Gefühl. Es war wie in dem Popsong „Lemon Tree“ von Fools Garden.
Ein Lieblingsschlager meiner Jugend war zum Beispiel: „Ich war ein Mädchen tugendsam, ein Blümlein, rühr’ mich nicht an, so lange, bis mein Friedrich kam, der wunderschöne Mann. Er hat um mich geworben, ich bin fast vor Wonne gestorben, und dann kam, wie es kommen musst’, der erste zarte Kuss. Wenn das die lieben Eltern wüssten, auwei, auwei, auwei …“ und so weiter. Ich sang ihn mit Begeisterung.
Auch Bully Buhlan gefiel mir sehr gut. Er sang unter anderem: „Ham Se nich, ham Se nich, ham Se nich ’ne Braut für mich? Ja, ja, ja, wir ham schon eine da. Eine, die mir gefällt mit ’nem großen Haufen Geld, ja, ja, ja, wir ham schon eine da. Sie muss chic sein, nicht zu dick sein, mit viel Zaster, keine Laster, nicht zu müde, nicht zu prüde, kurz und klein, sie muss ein Engel sein.“ Ich wäre gern der Engel gewesen.
Ein paar Jahre später zerschlugen die Konzertbesucher vor Begeisterung die Stühle, wenn Bill Haley mit „Rock Around the Clock“ auftrat. Auch ich sprang herum wie eine Tarantel, sobald diese Klänge einsetzten. Dabei konnte ich gar nicht richtig Rock ’n’ Roll tanzen. Das hatten wir nämlich noch nicht im Tanzkurs von Herrn Euschen gelernt. Ich war so brav, dass ich immer noch die Vorschriften unseres Tanzlehrers beherzigte. Eine Dame durfte auch während des Tanzens der Band keinen Beifall klatschen. Das war unfein. Weil ich fein sein wollte, hielt ich mich daran, bis ein Tanzpartner mich einmal erstaunt fragte: „Gefällt dir die Musik denn nicht?“ Auch die Beine übereinanderzuschlagen, war verpönt. Eine elegante Frau stellte die Beine parallel etwas schräg zur Seite geneigt nebeneinander. Das führte uns die Tochter des Tanzlehrers vor. Damals trug man allerdings noch keine Miniröcke, die einen indiskreten Einblick hätten ermöglichen können, ohne festes Übereinanderschlagen der Oberschenkel.
Später – als verrückte Alte – schwärmte ich für Peter Freudenthaler, Volker Hinkel und die anderen jungen Männer von Fools Garden. Ihnen habe ich 1996 sogar einen Fanbrief geschrieben, und Peter Freudenthaler antwortete handschriftlich mit diesen süßen Zeilen:
Liebe Frau Guthörl,
vielen Dank für Ihren netten Brief, über den wir uns alle sehr gefreut haben, zumal es sehr selten vorkommt, dass wir von „älteren“ (zahlenmäßig versteht sich!) Menschen solche schönen Komplimente bekommen. Das ehrt uns sehr. Leider habe ich momentan nicht die notwendige Zeit alle Ihre Fragen zu beantworten, da ein Riesenstapel Fanpost vor mir auf dem Tisch liegt, der bearbeitet werden muss. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu enttäuscht darüber. Vielen Dank auch für das nette Gedicht über die „Honigbiene“.
Alles Gute für Ihr weiteres Leben und herzliche Grüße.