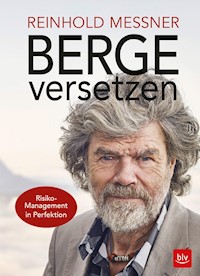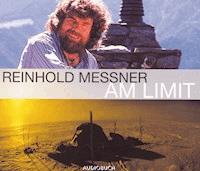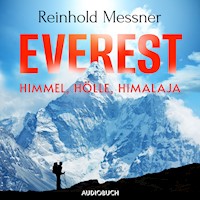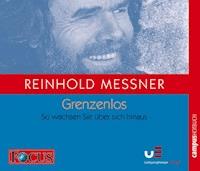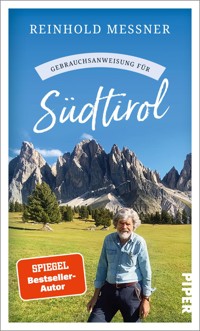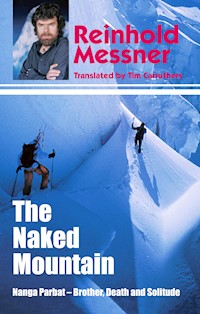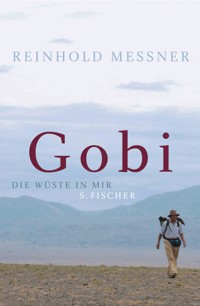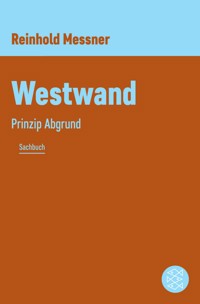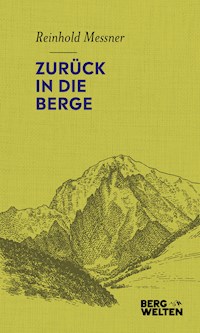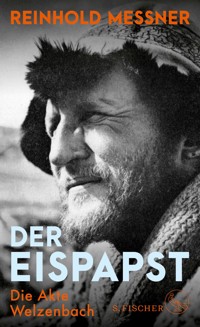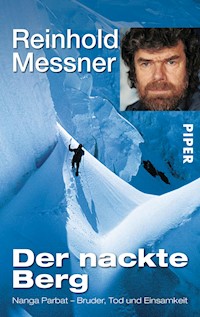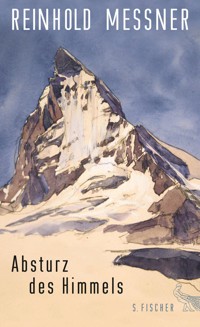
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Am 14. Juli 1865 steht der fünfundzwanzigjährige Engländer Edward Whymper als erster Mensch auf dem Matterhorn, aber beim Abstieg stürzen vier seiner Begleiter in den Tod: ein Seil ist gerissen. Wenige Tage nach Whympers Aufstieg von Zermatt aus erreicht der einheimische Bergführer Jean-Antoine Carrel von der italienischen Seite aus den Gipfel. Er ist der eigentliche Held in Reinhold Messners atemberaubender Geschichte von der Eroberung eines unverwechselbaren Berges, vermutlich der erste Mensch, der eine Besteigung des Matterhorns für möglich hielt. Carrel ist das Gegenbild zu dem dandyhaften Whymper: wortkarg, instinktiv und voller Verantwortung für seine Männer bis in die Stunde des eigenen Todes – fünfundzwanzig Jahre später, am Matterhorn. Das Matterhorn ist auch heute noch ein Mythos. Im Jahr 1865 war es der letzte noch unerstiegene große Alpengipfel, einer der letzten weißen Flecken auf der Landkarte – mitten in Europa. Warum bei Edward Whympers Erstbesteigung das Seil reißt, ist eine Frage, die damals halb Europa bewegt hat. Die Frage, wer dafür verantwortlich ist, lässt Reinhold Messner auch heute noch nicht los. In seiner fesselnden Erzählung von Verantwortung, Vertrauen und Verrat wird er Teil der Seilschaft von 1865: »Ich will nochmals mit den Bergsteigern hinaufsteigen. Ich will nachempfinden, was sie getragen hat – und was sie ertragen mussten.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Reinhold Messner
Absturz des Himmels
Über dieses Buch
Am 14. Juli 1865 steht der fünfundzwanzigjährige Engländer Edward Whymper als erster Mensch auf dem Matterhorn, aber beim Abstieg stürzen vier seiner Begleiter in den Tod: ein Seil ist gerissen. Wenige Tage nach Whympers Aufstieg von Zermatt aus erreicht der einheimische Bergführer Jean-Antoine Carrel von der italienischen Seite aus den Gipfel. Er ist der eigentliche Held in Reinhold Messners atemberaubender Geschichte von der Eroberung eines unverwechselbaren Berges, vermutlich der erste Mensch, der eine Besteigung des Matterhorns für möglich hielt. Carrel ist das Gegenbild zu dem dandyhaften Whymper: wortkarg, instinktiv und voller Verantwortung für seine Männer bis in die Stunde des eigenen Todes – fünfundzwanzig Jahre später, am Matterhorn.
Das Matterhorn ist auch heute noch ein Mythos. Im Jahr 1865 war es der letzte noch unerstiegene große Alpengipfel, einer der letzten weißen Flecken auf der Landkarte – mitten in Europa. Warum bei Edward Whympers Erstbesteigung das Seil reißt, ist eine Frage, die damals halb Europa bewegt hat. Die Frage, wer dafür verantwortlich ist, lässt Reinhold Messner auch heute noch nicht los. In seiner fesselnden Erzählung von Verantwortung, Vertrauen und Verrat wird er Teil der Seilschaft von 1865: »Ich will nochmals mit den Bergsteigern hinaufsteigen. Ich will nachempfinden, was sie getragen hat – und was sie ertragen mussten.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: buxdesign, München
Coverabbildung: Edward Harrison Compton, Matterhorn, Sammlung Reinhold Messner
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403509-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Nachwort
Anhang
Die wichtigsten Versuche, das Matterhorn zu ersteigen
Literatur
Abbildungen aus:
1
Carrel schreit im Schlaf auf, hebt den Kopf, als sei er aufgewacht.
»Hat er gerufen?«, fragt Sinigaglia.
»Nein«, sagt Gorret, der junge Bergführer. »Er träumt. Vielleicht vom Viehtrieb, von der Jagd.«
»Hat er Angst?«
»Wovor?«
»Vorm Unwetter vielleicht.«
Gorret schaut auf Carrel, der auf seiner Pritsche liegt und schnarcht. In der kleinen Hütte auf halbem Weg zum Gipfel ist er sofort eingeschlafen.
»Nein, er ist eingeschlafen, bevor der Sturm losbrach.«
»Warum dann dieser Schreckensschrei?«
»Jean-Antoine ist müde, seit Tagen schon um Mitternacht auf den Beinen, zuerst am Mont Blanc, dann der Übergang von Chamonix über die Pässe nach Courmayeur.«
»Verstehe, er muss wirklich sehr müde sein.«
»Rückzug?«, fragt Sinigaglia, der sich am Feuer die Hände wärmt.
Gorret schüttelt den Kopf, sieht den Italiener von der Seite an, nur kurz, murmelt etwas von »no, no«. Nein, sie werden nicht zurückgehen, er braucht den Führerlohn für seine junge Familie. Das Matterhorn ist sein Arbeitsplatz.
In dem kleinen gemauerten Ofen knacken die Holzscheite, am Dach zerren Orkanböen.
Als Carrel aufwacht, sieht er sich um, schnuppert in den rauchigen Raum, hört in den Sturm – ein Tier, das aufgeschreckt ist.
»Was ist das für ein Sturm?«, fragt er wie abwesend.
»Er kam plötzlich, aus dem Nichts«, sagt Gorret.
»Gefällt mir gar nicht.« Langes Schweigen. »Liegt Neuschnee?«
»Hagel und Schnee.«
»Wie viel?«
»Weiß nicht.«
Carrel begreift, während er langsam zu sich kommt, dass an einen weiteren Aufstieg am Matterhorn nicht zu denken ist. Auch das Abklettern wird extrem schwierig sein, der Fels ist nicht zu sehen, die Route vereist. Seine Route ist in einem denkbar schlechten Zustand. Aber mehr quält ihn die Befürchtung, tagelang hier festzusitzen. Sollen sie den Abstieg trotzdem wagen? Gleich jetzt? In der Hütte auszuharren, wenn der Sturm anhält, kann zum Alptraum werden.
Aber Sinigaglia möchte abwarten. Eine Nacht lang wenigstens.
Dann einigen sich die beiden Bergführer auf einen Plan. »Wenn der Wind nachlässt, steigen wir ab«, sagt Carrel. »Morgen, heute ist es zu spät.«
»Und wann morgen?«, will Sinigaglia wissen.
»Mit dem ersten Tageslicht.«
»Wir alle drei?«
»Immer der Herr in der Mitte.«
»Können wir den Abstieg nicht noch verschieben?« Sinigaglia hofft immer noch auf eine Wetterbesserung. Er ist der Gast. Er zahlt.
»Der Wind ist zu stark«, antwortet Carrel, »über Wochen wird kein Aufstieg zum Gipfel möglich sein.«
»Warum das?«
»Der Treibschnee klebt überall: in den Spalten, an den Graten, auf den Bändern.«
Carrel schlägt die Decken zur Seite, setzt sich stöhnend auf und steigt dann umständlich von seiner Pritsche herab. Er sieht nicht verschlafen, er sieht alt aus: die Wangen eingefallen, der Rücken leicht gekrümmt, der Bart fahl. Nur seine Augen – weit geöffnet in den dunklen Höhlen – glänzen. Er zieht sich die Schuhe an – genagelte knöchelhohe Lederstiefel, wie sie die Bauern im Gebirge bei der Holzarbeit tragen – und geht zur Tür. Der Boden knarrt, obwohl er wie ein seekrankes Gespenst über die Dielen schleicht. Als wolle er das Unwetter draußen erschrecken.
Zuerst sieht er gar nichts. Dann, als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, Flockenwirbel. Der Wind zerrt an seiner Lodenjoppe, nasse Kälte fährt ihm in die Lungen. Die Stufen, die von der Plattform, auf der er steht, zum Aufstiegsweg führen, sind verschwunden, im Neuschnee verwischt. Dann schaut er nach oben: Die Überhänge am großen Felsturm, unmittelbar über ihrer Hütte, sind noch dunkler als der Abgrund unter ihm. Und wo ist der Rest der Welt? Hinter jagenden Wolken sieht Carrel den Wintermond, so fern und flüchtig, als gehöre er nicht zu dieser Welt.
»Kein Himmel mehr«, hört Gorret den Alten sagen, als der zurück in die Hütte tritt. Carrel schüttelt sich, hebt den Kopf, murmelt etwas. Auch Sinigaglia weiß jetzt: Es sieht nicht gut aus.
Als sie am späten Vormittag die Hütte erreicht haben, sind sie dort auf Daniele und Antonio Maquignaz, Pietro Maquignaz und Edoardo Bich gestoßen, die höher oben am Berg Fixseile angebracht hatten. Die jungen Bergführer bestärkten Sinigaglia in der Hoffnung, der folgende Tag werde ausgezeichnetes Wetter bringen: Carrel würde sein Team sicher zum Gipfel führen! Gegen drei Uhr nachmittags ist die Maquignaz-Gruppe nach Breuil abgestiegen. Carrel hat den vier Burschen nachgesehen und mit einer Handbewegung ein letztes Mal gegrüßt. Dann hat er sich kurz ausruhen wollen.
Jetzt, zurück in der Hütte, schweigt Carrel.
Noch einmal sieht er nach dem Wetter. Sturmwolken treiben vom Mont Blanc her, der Himmel jetzt so düster wie ein aufgewühlter Ozean. Als er ein drittes Mal vor die Hütte tritt, hat das Sturmtief die Dent d’Hérens erreicht, die geläufigen Séracs und filigranen Eisgrate dort sind verschwunden, am großen Berg im Westen ist nur noch Chaos: ein expressionistisches Gemälde in Blauschwarz.
Carrel hofft, es sei ein Gewitter, das vorbeiziehen werde. Aber er ahnt Ungemach, ist unsicher. Der Nordwind steigert sich Stunde um Stunde. Carrel sinniert, lässt die schlimmsten Schlechtwettereinbrüche seiner Bergführerzeit in seinem Gedächtnis wieder lebendig werden. Als gelte es, aus überstandener Lebensgefahr Überlebenskraft zu schöpfen. Er trägt die Verantwortung, er darf jetzt keinen Fehler machen, seinen Gast nicht beunruhigen. Wären sie weiter zum Gipfel gestiegen, wie dieser es wollte, sie säßen jetzt auf der anderen Seite, beim Abstieg, in der Falle: irgendwo, ohne Schutz, hoch oben am Berg.
Auch Sinigaglia ahnt inzwischen, dass sie schon tot wären, hätte sich Carrel nicht durchgesetzt mit seinem »Abwarten«. Hat der Alte den Wettersturz voraussehen können? Ahnen, was kommt? Erst nachdem die vier jungen Männer die Hütte verlassen hatten, war das Wetter schlechter geworden. Und zwar so rapide, wie es weder Sinigaglia noch Gorret je erlebt hatten: dieser Sturm! Schneefall, aus heiterem Himmel zuerst, dann Graupelschauer.
»Du hättest mich wecken sollen«, sagt Carrel jetzt zu Gorret. Es ist kein Vorwurf, vielleicht eine Mahnung. Für die Zukunft.
Es ist zu spät, den jungen Männern ins Tal zu folgen.
Gegen Abend dreht der Wind. Ganz plötzlich. Wenig später bricht ein so heftiger Hagelsturm über das Matterhorn herein, dass es auch Carrel mit der Angst zu tun bekommt. Immer wieder Donner, Steinschlag, es kracht ohne Unterlass. Als würde ihr Berg unter ihnen zusammenbrechen. Und über ihnen einstürzen. Blitze zucken durch die pechschwarze Nacht, die Luft, elektrisch geladen, leuchtet im Zwielicht. Zwei Stunden lang schimmert es wie Nordlicht durch die kleinen Fenster. Immer wieder erleuchten Blitze das Innere der Hütte – so hell, als wäre es Tag. Und der Sturm hält an: die ganze Nacht lang, einen weiteren Tag und noch eine Nacht.
Carrel liegt unter Decken und friert. Er fühlt sich machtlos, im Traum sieht er sich schrumpfen. Als sei all seine Erfahrung nichts mehr wert, seine Energie aufgebraucht, sein Mut nichts als die Hybris eines Wahnsinnigen.
Draußen immerzu Schneefall, der Wind rüttelt an Dach und Wänden. Die Temperatur sinkt weit unter den Gefrierpunkt, das talseitige Fenster ist schneeverklebt. Auch im Inneren der Hütte ist alles gefroren, es hat Minusgrade. Draußen im Freien wäre ein Überleben jetzt unmöglich, weiß Carrel. Zum Glück ist die Hütte stabil – trägt sie denn nicht seinen Namen? – hat er sie nicht mit aufgebaut? Nein, nicht auszudenken, wenn sie nicht da wäre.
»Ein fluchtartiger Abstieg jetzt ist der sichere Tod«, sagt Carrel leise.
Als das Brennholz verbraucht und aller Proviant verzehrt ist, erwägt Carrel dennoch einen Ausbruch. Trotz Todesgefahr beim Abstieg, null Sicht. Das Schlimmste ist der viele Neuschnee! Doch besser, sie warten ab, sagt ihm sein Instinkt. Also wickeln sie sich in Decken, verfeuern das Mobiliar – die Bänke, ein loses Regal, den Tisch – und warten. Die Angst zu erfrieren wird unerträglich. Im Tagtraum sieht sich Carrel ins Tal absteigen. Hundertundein Mal ist es ihm gelungen, und alles, was Menschen an seinem Berg erlebt und ertragen haben, geht ihm durch den Kopf, eine Endlosschleife von Bildern. Er muss es auch dieses Mal nach unten schaffen, ins Tal mit seinem Gast, zurück in ihr Leben. Nur noch einmal. Er trägt die Verantwortung.
2
Im Zwielicht stehen drei Gestalten vor einer der armseligen Hütten in Avouil, dort, wo die Enge des Tals sich zu weiten beginnt und den Blick freigibt auf eine Almlandschaft, die bis zu den Gletschern reicht. Die Männer gestikulieren, weil der Gletscherbach, der etwas unterhalb von ihnen schäumt, so laut ist, dass sie sich kaum verständigen können. Es sieht aus, als ob sie den Berg, der im Widerschein der untergegangenen Sonne wie ein Kristall strahlt, beschwören wollten. Von nirgendwo sonst im Tal wirkt das Matterhorn so bestimmend: ein stumpfer Riesenkeil, der in die Unendlichkeit ragt.
»Also morgen früh«, sagt einer im Weggehen.
»Gute Nacht«, der Zweite.
»Bis morgen.«
»Vor Tagesanbruch und in aller Stille«, betont der Dritte. Noch einmal grüßt er mit einer flüchtigen Handbewegung. Um keinen Verdacht zu erregen, soll am nächsten Morgen jeder der drei aus einer anderen Richtung aus dem Dorf zu diesem Treffpunkt kommen. Genau so wie sie jetzt einzeln zu ihren Häusern zurückkehren.
Avouil, eine Gruppe kleiner Gehöfte am untersten Rand des Südhangs, die Häuser aus Stein und Rundholz gebaut, ist in den Sommermonaten das Zuhause einer Handvoll Familien. Von hier treiben sie ihre Tiere auf die hochgelegenen Weideflächen, hier lagern sie Butter, Käse und Brennholz.
In der Morgendämmerung – am Himmel die allerletzten Sterne, das Tal noch im Dunkel der Nacht – gehen die drei dem Gebirge zu. In Avouil heißt es, sie gingen Murmeltiere fangen, und sie haben auch den »grafio« dabei, einen langen Stock aus Eschenholz mit eisernem Haken am unteren Ende, wie er hier zum Murmeltierfang verwendet wird.
Es sind drei merkwürdige Gestalten, die an diesem wolkenlosen Morgen dem Matterhorn zustreben, das die Alten im Tal »La gran becca« nennen, »der große Schnabel«. Da ist Jean-Jacques Carrel, dunkel gewandet, hager, ein weitkrempiger Hut auf seinem Kopf. Als Ältester scheint er das Kommando zu haben. Er ist Jäger, mit untrüglichem Instinkt für das Gelände und einem Einfühlungsvermögen ausgestattet, das ihn manchmal wie ein Tier empfinden lässt. Bei der Suche nach Gämsen, an den steilen Südhängen des Matterhorns, läuft, klettert, springt er, als sei er selbst eine Gämse. Er hat, sagt man, im ganzen Tal nicht seinesgleichen: das Gesicht sonnenverbrannt, die Hände zerfurcht, die Augen schmale Schlitze unter der Hutkrempe. Die Zeit, die er auf den Almen und zwischen den höchsten der zugänglichen Felsfluchten zugebracht hat, um bei Frost und Hitze, Regen und Nebel dem Wild nachzustellen – hat ihn geformt. In seinem Gebaren steckt viel Selbstsicherheit, aber kein Stolz. Wie alle Männer im Tal redet er wenig, geht sonntags in die Kirche und werktags seiner Arbeit nach. Vor fast einem Vierteljahrhundert war er der Einzige gewesen, der den Mut hatte, am Theodulferner in eine Gletscherspalte hinabzusteigen, in der ein Verunglückter lag. Und noch immer steckt die Bereitschaft in ihm, das Leben zu wagen.
Jean-Antoine Carrel sieht nicht nur aus wie ein Outlaw, sein verwegener Blick und sein Mut haben ihn zu einem Außenseiter gemacht. Im Tal nennt man ihn spöttelnd den »Hahn von Valtournenche«. Gorret ist viel jünger und als angehender Priester zwar neugierig, aber vorsichtiger als die beiden Älpler.
Jetzt steigen die drei – Jean-Jacques voraus – zügig bergwärts. Nach mehreren Wintern mit geheimen Besprechungen und einsamen Sommern auf der Alm – immer öfter den Blick auf das Matterhorn gerichtet – wollen sie endlich herausfinden, wie hoch sie an ihrem Berg kommen können. Sie sind trittsicher, ausdauernd, ausgezeichnete Fußgänger. Ihre Schritte setzen sie gleichmäßig und ohne miteinander zu reden. Trotzdem, es sieht verboten aus.
Beim Weiler Planet treffen sie auf Gabriel Maquignaz und Carrel »le peintre«, erwähnen ihr Vorhaben aber nicht. Ein bisschen reden sie über Murmeltiere und das Wetter, dann gehen sie weiter. Die beiden Hirten grüßen verlegen und schütteln den Kopf, als wollten sie nicht einmal Komplizen sein bei der gefährlichen und verbotenen Hochgebirgsjagd. Noch weiter oben stoßen die drei auf einen Senner, der ihnen zuwinkt. Sie schwenken ihren »grafio« und steigen schneller. Noch höher glotzen ihnen nur noch die Kühe, die auf der Weide stehen, aus großen Augen nach.
»Ein böser Tag für die Murmeltiere«, hören sie den Hirten flüstern, während sie an seiner Herde vorbeisteigen. Als schwarze Punkte entschwinden sie ihm bald am steilen Berghang. Auf der höchsten Alm ist zum Glück niemand. Nur Ziegen kommen des Weges, neugierig und nach Salz an ihren Kleidern schnuppernd.
Endlich allein – Murmeltiere pfeifen, ein Adler kreist zwischen vereinzelten weißen Wolken, im Gletscher rechts vor ihnen rauscht das Schmelzwasser –, bleiben sie stehen. Jetzt können sie sich Zeit lassen. Als sie sich dann langsam der Vegetationsgrenze nähern, ziehen sich allerorten die Murmeltiere in ihre Löcher zurück.
An der Moräne des Matterhorn-Gletschers wenden sie sich dem Felsgrat zu, der den Gletscher links begrenzt. »Keu de Tzarciglion«, sagt der Jäger, der alle Felsen hier kennt und benennen kann. Er weiß, schon sein Großvater ist bis hierher gekommen, auf der Jagd nach Gämsen. Sie steigen, ein paar Stunden weit, über einen gut gestuften Felsgrat empor. Ohne einen bestimmten Plan, ohne ein weiteres Wort. Stufe um Stufe. Alles geht glatt. Nur der Blick auf die zerklüfteten Felswände weiter rechts, über dem Gletscher, lässt sie schaudern.
Noch bevor sie den höchsten Punkt einer Scharte links vom Matterhorn erreicht haben, trennen sie sich: Der Jäger sucht seinen Weg über harten Schnee, während die beiden anderen auf den Felsen bleiben, wo ihnen das Weiterkommen sicherer erscheint. Als Gorret den Jäger um Hilfe rufen hört, eilt Jean-Antoine herbei. Jean-Jacques kann weder vorwärts noch zurück, keinen einzigen Schritt weit. Eine einzige falsche Bewegung schon könnte ihn aus dem Gleichgewicht werfen und Hunderte Meter tief abstürzen lassen. An dieser Stelle ist die Eisfläche so steil und glatt, dass kein Halten ist, wenn einer abrutscht.
Aus der gemeinsamen Schockstarre löst sich zuerst Jean-Antoine Carrel. Er ist der Geschickteste der drei und übernimmt jetzt das Kommando. Der »Bersagliere«, wie er im Tal auch genannt wird, und Amé Gorret, der Seminarist, versuchen dem Jäger zu Hilfe zu kommen. Schritt für Schritt, den Bergstock in der Hand, wagen sie sich, einer am anderen sich haltend, auf das Eis. Es gelingt ihnen, Jean-Antoine immer voraus, sich bis zum Jäger vorzutasten. Nachdem das Beil, das Jean-Jacques bei sich trägt, aus dessen Tasche gezogen ist, schlägt Jean-Antoine Stufen ins Eis, auf denen alle drei zurückbalancieren können. Bis zu den Felsen.
Man kann nur mit seinesgleichen auf Berge steigen. Jean-Antoine sagt es nicht, er speichert diese Erkenntnis in seinem Gedächtnis, sie wird ihm zum Instinkt.
Außer Atem erreichen die drei wenig später die Grathöhe zwischen der Tête du Lion und der Dent d’Hérens, von wo sie erstmals auf die andere Seite der Bergkette schauen können. Dort tut sich ihnen eine völlig neue Welt auf: Erschrocken blicken sie auf den fünfhundert Meter unter ihnen liegenden Tiefenmatten-Gletscher! Hatten sie nicht die Geschichte gehört, hinter dem Matterhorn liege die Ortschaft Hérens? Diese Legende von einer Zivilisation hinter den Bergen erzählt man im Valtournenche seit Jahrhunderten. Aber da ist kein Dorf, da ist nur ein vergletschertes Tal, von riesigen Felsmauern umschlossen. Ein überwältigender Blick in die Tiefe! Einige Augenblicke lang schweigen sie, noch immer erschrocken über die Stille der Bergwelt – Felsgrat hinter Felsgrat gestaffelt –, die ganz anders ist als ihr grünes Heimattal, anders auch als das Paradies, wie es der Pfarrer an hohen Feiertagen von der Kanzel herab beschrieben hat. Was für Abgründe! Zerrissene Gletscher, darüber himmelhohe Gipfel, für die Bauern aus Breuil alle ohne Namen. Sie stehen im Sattel zwischen ihrem Heimattal und der menschenleeren Wildnis dahinter. Links führt der Grat zum Gipfel der Dent d’Hérens, rechts über der Tête du Lion ragt das Matterhorn auf.
Plötzlich beginnt einer der drei damit, Steinblöcke in den Abgrund zu rollen. Sie sehen die Trümmer kollern, folgen ihnen mit den Augen und sind begeistert, wie sie, in die Tiefe springend, Wolken von feinem Schnee aufwirbeln, weiter unten in gigantischen Sätzen und mit dumpfem Aufprall an Felsen zersplittern und ganz unten in geheimnisvollen Schlünden am Gletscher verschwinden.
Sie haben keine Eile. Sie sind zwar müde, aber die Sonne steht hoch, und das Matterhorn ist ganz nah. Seine Felsfluchten wirken von hier aus gegliederter als von Avouil. Und der Gipfel über ihnen! Jean-Antoine weiß, er wird ihn eines Tages erreichen.
»Sonderbar«, sagt einer von ihnen, »aus dieser ungewohnten Perspektive wirkt das Matterhorn weniger abweisend als aus dem Tal.«
Der Berg gehört ihnen zwar nicht – oder doch, schließlich kann ihn niemand wegtragen –, Jean-Antoine aber macht ihn an diesem Tag zu seinem Ziel.
Die anderen zwei denken nicht weiter an eine Besteigung, sondern setzen den Aufstieg aus purer Neugier fort. Ohne Schwierigkeiten erreichen sie die Tête du Lion, von wo sie erstmals auf die breite Kluft hinabsehen, die sie vom eigentlichen Matterhorn trennt. Auf der anderen Seite – vorerst unerreichbar – türmt sich der steile Fels bis zum Himmel.
Als sie längs der Südflanke der Tête du Lion ins Tal absteigen, entdecken sie eine Reihe von Felsbändern im Gelände, über die es möglich ist, zum Fuß des Matterhorns zu gelangen, viel einfacher als über ihren Aufstiegsweg.
3
Seit diesem Tag spricht man im Valtournenche von Jean-Antoine Carrel wie von einem Gerücht. Ein Narr, wer auf die »Becca« wolle, sagen die Leute, passt aber zum »Gockel«, denn im Tal gilt das Matterhorn als »Berg des Teufels«: Seine Flanken seien wie das Höllentor, die beiden Spitzen nur für Geister gemacht.
»Jedenfalls nicht für Menschen«, sagt der Pfarrer.
Jean-Antoine Carrel antwortet nicht. Er weiß: Sein Matterhorn ist besteigbar.
Sein Onkel, Kanonikus in Aosta, der nur noch selten ins Valtournenche kommt, beschwichtigt, als er von Jean-Antoines Aufstieg erfährt: Der Ausflug sei nichts als ein unüberlegter Lausbubenstreich gewesen, das Ganze nicht der Rede wert. Im Stillen aber glaubt auch er an die Möglichkeit, das Matterhorn zu besteigen. Er bewundert Geschicklichkeit, Mut und Energie seines Neffen. Und schon seit langem verfolgt ihn selbst der Gedanke, die umliegenden Berge von Aosta müssten erforscht werden. In jungen Jahren schon, als noch niemand daran dachte, die Phänomene der Alpen zu studieren, errichtet er ein erstes Observatorium auf dem Dach seines Pfarrhauses. Bald soll es zur wichtigsten meteorologischen Forschungsstation Italiens werden. Schon als Student hat er mit seinen Aufzeichnungen begonnen, sammelt immer noch Daten zu Pflanzen, zum Wetter, zu Gletschern. Er hat dabei ständig gegen die Voreingenommenheit seiner Landsleute zu kämpfen, die in seiner Sehnsucht, der Wissenschaft zu dienen und Gipfel zu besteigen, nichts als eine Narretei sehen. Unschädlich zwar, aber unnütz.
Der Kanonikus kennt das Matterhorn seit seiner Jugend, er sieht es über den Gipfelkranz um Aosta hinausragen, wenn er hoch genug gestiegen ist, und schwärmt: La gran becca! Wenn auch nicht die höchste Bergspitze Europas, so doch unbestreitbar die schönste! Seit Jahrzehnten beschäftigt ihn die Frage nach der Besteigbarkeit dieses Gipfels und der Verantwortung dabei. Darf der Mensch ein Wagnis eingehen, das nicht völlig zu kontrollieren ist? Auch wenn es unnütz ist? Niemand sonst als dieser gebildete Mann erkennt im Matterhorn ebenso viel Abschreckendes wie Wertvolles. Er spricht von seinem Matterhorn, immer wieder gibt er sich der Hoffnung hin, er selbst werde es einmal besteigen können. In Eigenverantwortung! Verbindet er mit diesem Berg doch den Gedanken der Askese: Ist nicht jede Bergwanderung ein Akt der Läuterung, jeder Aufstieg eine Pilgerreise? Dass seine Heimat dank der Fremden, die mit der Besteigbarkeit des Matterhorns vermehrt ins Tal kämen, bekannter würde, kommt hinzu. Den größeren Wohlstand, der damit erreicht wäre, sieht er ebenso voraus. Die mächtige Felspyramide mag keinen wirtschaftlichen Wert haben, denkt er, als Wahrzeichen aber ist sie unbezahlbar. Seine Erstbesteigung wird dem Tal und seinem Neffen Ruhm einbringen, hofft er insgeheim.
Weiß der Vikar, dass Gabriel Maquignaz und Victor Carrel, der Maler, noch im selben Jahr, 1857, einen anderen Zustieg zum Berg ausforschen? Sie steigen über die Ostseite der Tête du Lion auf, werden jedoch durch die in den Felsrinnen niederstürzenden Steine beinahe getötet. Ein weiteres Vordringen ist ihnen unmöglich. Tief erschrocken und stillschweigend kehren sie zu ihren Almen zurück.
4
Weißhorn und Matterhorn sind die Berge, die der einundzwanzigjährige Edward Whymper 1861 besteigen will. Als Erster! Es ist sein zweiter Alpensommer, und schon greift der Jüngling nach den Sternen: Die allerschwierigsten Viertausender müssen es sein. Ist es Dummheit, Überheblichkeit oder die Hybris der Jugend, die ihn blendet? In Breuil angekommen, hört er – hoffentlich ist es nur ein Gerücht –, das Weißhorn sei bestiegen worden; vom Matterhorn sagt man, es sei unmöglich, John Tyndall aber werde es trotzdem angreifen. Der Herr Professor sei in Breuil, um seinen Sieg über das Weißhorn mit der Erstbesteigung des Matterhorns zu krönen. Im Valtournenche ist dieser Professor Tyndall ein geschätzter Mann – großzügig seinen Bergführern gegenüber und umgänglich mit den Trägern. Über Whymper hingegen munkelt man bald, er müsse deshalb zu Fuß gehen, weil ihm das Geld für die Kutsche fehle.
Whymper ist nicht mittellos, er ist geizig, mit Führern, sagt er, habe er nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Er hält nicht viel von ihnen. Sie seien nur als Träger und Fährtensucher zu gebrauchen, ansonsten große Verzehrer von Fleisch und Branntwein. Ein paar seiner Landsleute aus England wären ihm im Gebirge als Helfer lieber als diese primitiven Bauern, Jäger, Kleinhäusler oder Hirten, die sich in den Alpen »Führer« nennen. In seinen Augen scheint diesen Älplern alles Edle zu fehlen. In ihren Gesichtern sieht er nichts als Bosheit, in ihren Gebärden Hochmut, in ihren Forderungen Habgier. Dazu Neid auf sein Auskommen, Fremdenhass und Hinterhältigkeit. Keine guten Eigenschaften also.
Trotzdem fragt er, eben erst in Breuil angekommen, nach dem bestmöglichen Begleiter für eine Besteigung des Matterhorns. Einstimmig wird ein Carrel aus Valtournenche genannt: Jean-Antoine Carrel.
In einer düsteren Hütte in Avouil – kleine Fenster, niedrige Türen, alles voller Rauch – trifft er auf einen Mann mittleren Alters. Bäuerliche Herkunft, offensichtlich aber ein gebildeter Bursche. Sein Gesicht – Bart, stechende Augen, Hakennase – hat etwas Abweisendes und Einnehmendes zugleich.
»Sind Sie Carrel?«, fragt Whymper forsch.
»Ja, Jean-Antoine.«
»Ich bin Whymper und suche einen Führer für die Besteigung des Matterhorns.«
»Sind Sie allein?«
»Nein, ein Engländer und ein Schweizer Führer sind mit mir.«
»Das Matterhorn ist sehr schwierig.«
»Ich weiß, deshalb bin ich ja hier. Ich brauche den besten Mann vor Ort.«
»Langsam. Was haben Sie bisher an Touren gemacht?«
»Viele. Und ich habe das Matterhorn studiert, im vergangenen Jahr, beim Übergang von Zermatt nach Breuil.«
Carrel hört zu. Ist er bereit mitzugehen?
»Wie viel?«, fragt Whymper.
»Zwanzig Franken am Tag, wie weit immer wir kommen.«
Whymper willigt ein. Carrel aber fordert, dass ein zweiter Mann, ein Freund von ihm, mitkommt. Aus Gründen der Sicherheit. Whymper, der die Kosten scheut, winkt ab.
»Ich habe schon einen Führer.«
»Zwei Führer für zwei Gäste ist zu wenig.«
»Nein, das reicht, ich klettere selbständig.«
»Ich bestehe auf meinem Mann«, sagt Carrel.
»Weshalb?«
»Wir tragen die Verantwortung.«
»Ich trage meinen Teil selbst, wozu also dein Mann?«
»Es braucht ihn!«
»Ist der Weg so schwierig?«
»Lang und sehr schwierig – für einen Fremden vielleicht zu schwierig … in Ihren weißen Hosen«, fügt Carrel in einem Dialektsatz, den Whymper nicht verstehen soll, an.
»Warum zu schwierig für uns Engländer?«
»Sie kennen den Berg nicht.«
»Ich brauche nur einen Mann von hier, als Wegweiser.«
»Ich aber gehe nur mit, wenn einer meiner Leute dabei ist.«
»Was für eine Sturheit!«
»Mit einem unserer Führer oder gar nicht!«
»Wozu so viele Leute?«
»Für den Rückzug zum Beispiel.«
»Ich setze auf Gipfelsieg!«
»Auch vom Gipfel müssen wir zuletzt alle in unser Leben zurück.«
»Sicher, mehr Leute aber bedeutet mehr Risiko, mehr Aufwand, mehr Zeit.«
»Ja, sicher.«
»Wozu also dein zweiter Mann, du bist doch Führer?«
»Es ist ohne nicht zu machen, unmöglich.«
»Woher weiß er das?«
»Das Matterhorn ist nicht wie der Mont Blanc oder der Monte Rosa. Alle Versuche, diesen Berg zu besteigen – von Breuil, von Zermatt aus –, sind fehlgeschlagen!«
»Und?«
»Ein halbes Dutzend Versuche umsonst!«
»Ich kann es trotzdem schaffen!«
»Vielleicht ins Grab«, warnt Carrel.
»Er hat also Angst. Deshalb ein zweiter Führer?«
Whymper ist in seinem Element, er will Carrel unbedingt für seinen Plan gewinnen, ihn überzeugen und zugleich demütigen.
»Nicht nur«, sagt dieser ganz ruhig.
»Also was sonst?«
»Wie soll ich Sie von ganz oben im Notfall am Berg herunterbringen?«
»Ich steige schon selbst ab, und so sicher wie diese Bauern hier klettere ich allemal.«
»Trotzdem, ich will Ihr Husarenstück nicht verantworten.« Jean-Antoine Carrel bleibt bestimmt. Er klopft mit seiner Rechten an die getäfelte Stubenwand, eine Männerstimme antwortet, und eine große Gestalt tritt aus dem Dunkel des Raums: ein düsterer Kerl mit Bart, grobschlächtig, mit langen hängenden Armen. Whymper erschrickt, lehnt mit einer herablassenden Geste ab und geht zur Tür. Die Verhandlung ist abgebrochen.
5
Edward Whymper sieht sogar in seinem Trotz gut aus. Eine Umhängetasche über die rechte Schulter gelegt und ein modisches Hütchen auf dem Kopf, geht er in seinen hellen Hosen jetzt weit ausschreitend zurück nach Breuil. Auf der ganzen Strecke hat er freie Sicht aufs Matterhorn. Was soll er nur an diesem tristen Ort, denkt er, mit diesen rückständigen Älplern? Wäre da nicht das Matterhorn, der merkwürdigste Berg, den er kennt. Ihm ist wie vor einem Gefängnisausbruch zumute: Gletscher rundum, Felswände, die senkrecht aufragen, düstere Waldflächen. Darüber steht mit seiner bestechenden Individualität der letzte der großen Alpengipfel, der unbestiegen ist. Hier unten aber leben diese ungepflegten Bauern, auf die er angewiesen ist und die ihn hinhalten. Nicht seine Überheblichkeit nährt seinen Stolz, es ist der Berg – sein Berg. Whymper weiß: Die erste Besteigung wird so einmalig sein wie der Gipfel selbst. Aber die Ablehnung Carrels – eine Frechheit! Im Notfall muss er das Matterhorn allein angreifen.
»Was diese Bauern können, kann ich allemal«, sagt er halblaut vor sich hin.
Wer ihm auf dem schmalen Pfad ins Almdorf entgegenkommt, tritt zur Seite oder verschwindet in einer der Hütten. Geht man ihm aus dem Weg? Die Kleider dieser Älpler sind schmucklos, abgetragen, häufig geflickt. Ihre Gesichter sind so düster wie ihr Gewand, ihre Mienen ernst, ohne ein Lächeln. Alle scheinen Whymper hier zu meiden. Sogar die niedrigen Häuser – dunkle Hütten, dicht aneinandergedrängt – haben etwas Abweisendes, Strenges. Als wären sie gegen die Hoffnungslosigkeit gebaut worden, als müssten sie sich wechselseitig vor der Kälte schützen, im Haufen dem Ansturm der Gewitter und Winde Widerstand leisten. Das Leben hier ist hart, und die Menschen leiden stumm. Angst und Schrecken ohne Ende. Lawinen bis ins Tal, verhungerte Tiere, unter der Last des Schnees geborstene Häuser. Die Sommer sind kurz, der Großteil des Jahres bleibt Winter. Der Älpler hockt dann geduldig am Ofen in seiner Stube, schläft in dumpfen Räumen und wartet, wartet, wartet. Oder er betet. Dass die Sonne wiederkehrt. Das Frühjahr ist schnell wieder vorbei, die Erntezeit mühsam, und im Herbst kommt mit dem ersten Schnee tiefe Resignation über das Dorf. Wieder und wieder.
Whymper kann jetzt zwischen den ärmlichen Hütten die Kirche sehen, mit dem Turm, dessen Glocken für die Menschen im Tal immer gleich trist klingen. Sie sagen Geburten wie Begräbnisse, Unfälle wie Hochzeiten an. In dieser weltabgeschiedenen Gegend scheint sogar die Religion Schrecken zu verbreiten, denn die Bilder an den Kirchenwänden erzählen nicht von Hoffnung und Liebe, sondern von Marter und Tod.
Whymper ist diese Welt fremd, ja peinlich. Er ist Künstler. Aus London. Dabei bedauert er die Menschen hier nicht einmal, er verachtet sie. Und deshalb kann er es nicht verwinden, dass Carrel ihn abgewiesen hat: Braucht er das Geld nicht? Oder glaubt er, die Engländer seien alle reiche Taugenichtse oder Schnösel?
Angesichts der dumpfen Armseligkeit, mit der die Menschen in dieser großartigen Bergnatur leben, fühlt er sich völlig fehl am Platz. Zwischen ihnen und der Natur ist nur Überlebenskampf, kein Gefühl der Erhabenheit, keinerlei Sehnsucht, nichts. Welche Beziehung haben sie denn zu ihrem Berg? Keine!
»Verhungern sollen sie ohne mein Geld«, schimpft er leise, als er die ersten Häuser von Breuil erreicht. »Sollen sie doch für immer unten bleiben!«
6
Carrel und seine Leute begnügen sich mit dem, was die Erde in dieser Höhe hergibt. Sie kennen keine Extravaganzen. Schicksalsergeben fügen sie sich in die Talgemeinschaft, lassen exotische Wünsche nicht zu. Die Armut, der sich hier niemand zu schämen braucht, schafft eine natürliche Gleichheit, wobei die Arbeit, die alle zu tun haben und die für alle gleich ist, für Gerechtigkeit sorgt. Sie alle sind Selbstversorger, tauschen ihre Erzeugnisse untereinander, Geld ist fast unbekannt. Nur Sparsamkeit gedeiht auf diesem geizigen Boden. Die Sicherheit einer Familie wurzelt in einem kleinen Stück Land, einer Alm unterm Himmel, der sich – abgegrenzt von den filigranen Linien der Bergkämme – über eine Heimat spannt, in der man geboren ist und stirbt.
Auf einem Saumpfad ist Horace-Bénédict de Saussure – der Schweizer Wissenschaftler, der die Erstbesteigung des Mont Blanc mit einem Geldpreis angeregt hatte – in diese arme Welt gekommen. Nicht als Eroberer, als Forscher. Und das zweimal. Fünf Jahre nach seinem Gipfelgang am höchsten Berg der Alpen – es war die dritte Besteigung – widmete er sich dem »schönsten«. Die »Valtorneins« wussten zuerst nicht, wer er war, auch nichts von seiner Neugier. Dann aber hofften die Viehzüchter und Ackerbauern, Jäger und Schmuggler, dem großzügigen Forscher würden andere folgen, der Tourismus Wohlstand bringen. Vor allem die Frauen und Mütter, die in jener Zeit das Geld aufbewahrten, für Essen sorgten, die Kleider nähten, die Wäsche wuschen und die Kinder aufzogen, hofften auf ein zusätzliches Einkommen – war es bei schlechten Ernten oft doch unmöglich, mit den Vorräten über den Winter zu kommen.
Vorerst aber bleibt alles beim Alten: Das Brot, das zweimal im Jahr aus Roggenmehl gebacken wird, muss bis zum Winterende reichen – Brot, das wie in einer heiligen Handlung, die mehrere Tage und Nächte andauern kann, von jeder Familie gebacken wird. Brot, mit dem man sechs Monate lang auskommen muss, das den Alten in die Milch gebrockt wird, um es aufzuweichen. Nur an besonders schönen Wintertagen steigen die Männer das Tal hinauf, um das Holz, das sie im Sommer aufgeschichtet haben, und Heu, das in den Sennhütten lagert, auf Schlitten ins Tal zu fahren. Zwischen diesen periodischen Wanderzügen ist Abwarten.
Mitte Juni dann ziehen viele der Talbewohner zu den Almweiden empor. Entweder mit dem eigenen Vieh oder als Senner und Hirten auf die Gemeinschaftsalmen. Allmählich steigen Vieh und Mensch höher, von Weide zu Weide. Wenn eine Fläche abgegrast ist, geht es zur nächsten und weiter bis zur höchsten Alm. Bis dorthin, wo kaum noch Gras wächst, die Hänge für die Tiere zu steil und damit zu gefährlich sind. Bis zur Moräne am Fuße des Matterhorns. Meist sind die jüngsten Kinder dabei, die in dieser Gegend entweder stark werden oder zu krank, um überleben zu können. Zu Michaeli steigen alle wieder hinunter, zurück in die Enge des Tals.