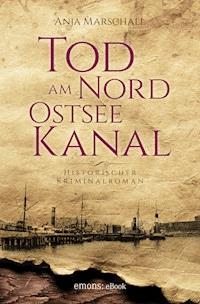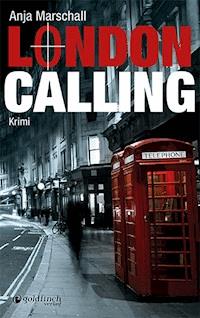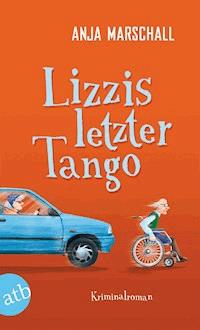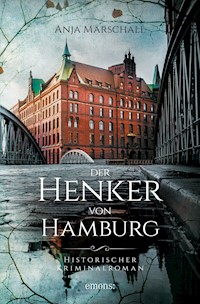14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Als der Sturm kam« | Die Hamburger Sturmflut von 1962 Deiche brechen im Minutentakt, Straßen werden zu reißenden Flüssen, Menschen sind vom Wasser eingeschlossen. Es ist die Stunde der Wahrheit. Für die spannende Reihe »Schicksalsmomente der Geschichte« erzählt Anja Marschall in ihrem historischen Roman von Hamburgs dramatischsten Stunden seit dem Zweiten Weltkrieg: Als die Flutkatastrophe über Hamburg hereinbricht, wird die Schreibkraft Marion der Leitung von Polizeisenator Helmut Schmidt unterstellt. Ein Krisenstab muss eingerichtet, NATO-Verbündete um Hilfe gebeten, Hubschraubereinsätze geplant werden. Marion kämpft gegen Müdigkeit und hat Angst um ihre bettlägerige Mutter, die mitten im überfluteten Gebiet von Wilhelmsburg in einer Gartenkolonie wohnt. Zur gleichen Zeit versucht der Hubschrauberpilot Hermann unter Einsatz seines Lebens, die Menschen von den Dächern ihrer Häuser zu retten. Die Nacht ist eiskalt, und das Wasser steigt noch immer … 100.000 vom Wasser eingeschlossene Menschen, 15.000 Helfer, 315 Tote: Die Hamburger Sturmflut von 1962 war für die Hansestadt die größte Katastrophe der Nachkriegszeit. Im Februar 1962 wütet an der Nordseeküste ein Orkan. Gefühlt weit weg für die Hamburger, die sich in Sicherheit wähnen. Doch der Sturm ist längst auf dem Weg und überrascht die Menschen im Schlaf. Kurz nach Mitternacht brechen in Minutenfolge die Deiche, die Hamburg schützen sollen. Straßen werden zu reißenden Flüssen, in der gesamten Stadt fällt der Strom aus. Helmut Schmidt, damals Polizeisenator in Hamburg, beginnt noch in der Nacht, die Rettungsaktionen zu koordinieren. Exzellent recherchiert und packend erzählt: Anja Marschall schildert in ihrem bewegendem Roman die Geschichte der Menschen, die in den Stunden der Sturmflut um ihr Leben kämpfen. Anja Marschall kam im Jahr der Sturmflut in Hamburg zur Welt. Dort arbeitete sie vor ihrer schriftstellerischen Karriere u.a. als Lokaljournalistin und Pressereferentin. Bei Piper erschien zuletzt ihre Erfolgsserie »Töchter der Speicherstadt«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Als der Sturm kam« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Nadine Buranaseda
Covergestaltung: t. mutzenbach design, München
Covermotiv: akg-images / picture-alliance / dpa und Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
Freitag, 16. Februar 1962
15 Uhr, Deutsche Bucht, Position 54° 00′00″ N und 08° 10′40″ E
15:40 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg, hundert Kilometer landeinwärts
16 Uhr, Bahnstrecke Hamburg–Celle, Niedersachsen
16:50 Uhr, Landungsbrücken, Hamburg
17:09 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
18:10 Uhr, Altes Land, Hamburg
20:30 Uhr, Deutsches Hydrographisches Institut, St. Pauli, Hamburg
22:05 Uhr, Cuxhaven, Nordseeküste
22:32 Uhr, Döse, bei Cuxhaven
22:35 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
22:45 Uhr, Deutsches Hydrographisches Institut, Hamburg
23:15 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
23:20 Uhr, Grenze DDR-BRD, Lauenburg
23:30 Uhr, Hamburg-Finkenwerder
23:55 Uhr, Altes Land, Hamburg
23:57 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
Samstag, 17. Februar 1962
0:30 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
1 Uhr, Jungfernstieg, Hamburger Innenstadt
1:10 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
1:15 Uhr, Materialplatz des THW, Rissen
1:45 Uhr, Fliegerhorst Faßberg, Niedersachsen
1:50 Uhr, Hamburg-Neuenfelde und Finkenwerder
1:55 Uhr, Hamburg-Wilhelmsburg
2 Uhr, Materialplatz des THW, Rissen
2:10 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
2:45 Uhr, Vogelhüttendeich, Wilhelmsburg
3:20 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
3:30 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
4 Uhr, Hamburg-Wilhelmsburg
4:25 Uhr, Hamburg-Neuenfelde
5:40 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
5:50 Uhr, Fliegerhorst Faßberg, Niedersachsen
6:40 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
8 Uhr, Fliegerhorst Faßberg, Niedersachsen
10 Uhr, Hamburg-Wilhelmsburg
10:20 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
10:15 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
10:30 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
10:40 Uhr, Hamburg-Wilhelmsburg
10:45 Uhr, Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel
11:10 Uhr, Hamburg-Wilhelmsburg
11:30 Uhr, Überflutungsgebiet
11:50 Uhr, nahe Stübenplatz, Hamburg-Wilhelmsburg
12 Uhr, Hamburg-Wilhelmsburg
13:25 Uhr, Überflutungsgebiet
15:50 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
20:30 Uhr, Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel
20:50 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
Sonntag, 18. Februar 1962
0:30 Uhr, Hamm, Südosten von Hamburg
12 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
14:30 Uhr, Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel
Montag, 19. Februar 1962
9:15 Uhr, Polizeihaus, Karl-Muck-Platz, Hamburg
9:30 Uhr, Planten un Blomen, Hamburg
13 Uhr, Notunterkunft, Hamburg-Harburg
11:30 Uhr, Alter Elbpark, Hamburg
Mittwoch, 21. Februar 1962
11 Uhr, Rathaus, Hamburg
Donnerstag, 22. Februar 1962
16 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
Sonntag, 26. Februar 1962
16:45 Uhr, Rathausmarkt, Hamburg
Fakten, Fiktion und Hintergründe
Tatsächliche Personen
Chronologie
15. Februar
16. Februar
17. Februar
18. Februar
19. Februar
20. Februar
21. Februar
26. Februar
1. März
Danksagung
Ein ganz besonderer Dank
Quellen (Auswahl)
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort
Dieser Roman hat die schwere Aufgabe, Ihnen die katastrophale Sturmflut vom 16. auf den 17. Februar 1962 in Hamburg näherzubringen. Er will erklären, beleuchten und schildern, zu welch übermenschlichen Taten ein jeder fähig ist, wenn er um sich und seine Lieben fürchten muss. Die folgenden Seiten sollen aber auch zeigen, dass der Mensch manchmal ein weitaus besseres Wesen ist, als er von sich selbst denkt.
So akribisch wie möglich habe ich die Katastrophe aufgearbeitet, die damals über die Stadt hereinbrach. Die Zeiten im Text musste ich gelegentlich an die Handlung anpassen. Ich bitte hier um Nachsicht.
Viele historische Persönlichkeiten kommen in diesem Roman in einer kleinen oder größeren Rolle zu Wort. Dazu gehören der damalige Senator Helmut Schmidt ebenso wie seine Sekretärin Ruth Wilhelm (später Loah), Werner Eilers, leitender Regierungsdirektor, und Polizeioberrat Martin Leddin, der in den ersten Stunden den Einsatz vom Polizeihaus aus geleitet hat. Da sie alle bereits verstorben sind, konnte ich mich in der Recherche nur auf Archive, Presseberichte, ehemalige Weggefährten oder meine Fantasie verlassen. Diese Personen könnten so oder so ähnlich gehandelt haben oder auch nicht. Ich hoffe allerdings, dass ich ihnen gerecht werden konnte.
Im Anhang finden Sie einige Informationen über die schicksalhafte Nacht und die Tage, die ihr folgten. Sie werden dort neben einer Chronologie der Geschehnisse auch eine Abgrenzung von Fiktion und Fakten nachlesen können sowie Hinweise auf empfehlenswerte Quellen, falls Sie das ein oder andere genauer wissen möchten.
Wichtig war mir vor allem, dass in diesem Roman die damaligen Opfer und ihre Familien geschützt werden. Sie werden hier also keine tatsächlichen Namen von Menschen finden, die ihr Leben lassen mussten oder ihr Zuhause in jener Nacht verloren. Ihre traumatischen Schicksale dienten mir als Vorlage für die nun folgende Geschichte.
Ich bin mir sicher, Sie stimmen mir zu: Der Respekt vor den Opfern der Flut gebietet diese Rücksichtnahme. Und so erleiden meine fiktiven Figuren viel von dem, was in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar echten Menschen passierte.
Als Hamburgerin wurde ich im Jahr der Flut geboren. Mein Herz hängt an dieser Stadt, von der Helmut Schmidt in einem anonymen Artikel im Juli 1962 in der ZEIT einmal schrieb: Ich liebe sie mit Wehmut, denn sie schläft, meine Schöne, sie träumt, sie ist eitel mit ihren Tugenden, ohne sie recht zu nutzen. Sie genießt den heutigen Tag und scheint den morgigen für selbstverständlich zu halten. Sie sonnt sich ein wenig zu selbstgefällig und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein.
Freitag, 16. Februar 1962
15 Uhr, Deutsche Bucht, Position 54° 00′00″ N und 08° 10′40″ E
Eine eisgraue Wasserwand erhob sich vor Elbe 1, Gischt spritzend näherte sie sich dem Schiff, stieg hoch und höher. Es war unmöglich, den finsteren Himmel über ihr zu erkennen. Dann stürzte der stählerne Schiffskörper in die Tiefe, die See lief unterm Heck durch. Elbe 1 versuchte, sich erneut aufzubäumen, als auch schon die nächste See über dem Vorschiff tonnenschwer zusammenbrach. Unermüdlich ergossen sich schwere Brecher übers Deck. Ein heftiges Zittern ging durch den Rumpf.
Seit Tagen forderten die Elemente das Feuerschiff in der Deutschen Bucht heraus. Der Sturm wollte einfach nicht nachlassen. Trotzdem mussten sie ihre Position halten, denn nur sie konnten verhindern, dass andere Schiffe vom Kurs abkamen, auf Untiefen liefen, um mit Mann und Maus unterzugehen. Einen Sturm wie diesen hatte Tetje Dittmers noch nie erlebt. Seine Wache erschien ihm heute endlos lang.
Mit gewaltigem Donnern schlug ein weiterer Brecher aufs Vordeck. Der eiserne Rumpf unter seinen Füßen fuhr steil in die Tiefe. Tetje hielt die Luft an, als die Woge gegen das Fenster krachte und Elbe 1 mächtig durchrüttelte. Für einen Moment wurde es draußen schwarz. Die Lampen auf der Brücke flackerten. Es waren Sekunden, in denen unklar war, ob das Schiff bereits unterging oder der Kampf andauern würde.
Elbe 1 hing an einer zweihundertfünfzig Meter langen Ankerkette. Sie und der speziell angefertigte Pilzanker mit seinen drei Tonnen hielten das rote Feuerschiff auf Position. Gefangen.
Das Wasser an der Scheibe lief ab. Streifen blassgrauen Lichts fielen herein. Dahinter tosten die Wellen unbändig weiter. Erleichtert sog Tetje die abgestandene Luft auf der Brücke ein, während Elbe 1 wie von Geisterhand auf dem Rücken einer neuen Woge emporgehoben wurde. Es war schwer auszumachen, wo die Nordsee aufhörte und der Sturmhimmel begann.
In die Dämmerung hinein zuckte der Lichtstrahl des Zweitausend-Watt-Feuers oberhalb der Brücke. Dieses Licht war der Grund, warum sie hier waren. An ruhigen Tagen sah man den Schein der Lampe dreiundzwanzig Seemeilen weit. Nun erhellte es nur das schieferfarben kochende Meer um sie herum. Ein fünf Sekunden andauerndes Blinken, das war ihr Zeichen. Dann Düsternis für weitere fünf unendlich lange Sekunden, bevor das Leuchtfeuer erneut aufgrellte und den Blick auf die nächste Woge freigab, die direkt auf das Schiff zuhielt.
Zwischen den Wellenbergen meinte Tetje das Leuchtfeuer der Kollegen von Elbe 2 nahe dem Großen Vogelsand aufblitzen gesehen zu haben. Deren Kennung waren zwei Blinksignale. Es war tröstlich zu wissen, dass sie hier draußen nicht allein waren. Feuerschiff Elbe 3 lag gemütlich vor Neuwerk. Aber auch die schüttelte der Sturm sicherlich mächtig durch.
Drei kleine rote Schiffe gegen einen Sturm, damit auch bei diesem Sauwetter die anderen Kähne sicher in die Elbe kamen. Konzentriert starrte Tetje zum Vorschiff hinaus, wo sich der nächste Brecher aus dem Wasser schob.
Der Sturm nahm zu. Doch er war nicht der einzige Grund, warum das Schiff unter seinen Füßen unruhig hin- und herhüpfte. An dieser Position liefen selten gemächlich lange Wellen, denn der Elbstrom, die Gezeiten und die Sandbänke im Wattenmeer selbst neigten dazu, aus dem ruhigsten Wasser eine schwere Kabbelsee zu machen. Und so rollte Elbe 1 seit Stunden hin und her, während es gleichzeitig vor und zurück ging.
Das Kreischen der Stags und das Knarzen der Bolzen in der eisernen Stahlhaut bohrten sich in Tetjes Mark. Er hatte schon so manchen Sturm erlebt, aber dieser war anders. Wütender. Fordernd zog der Orkan über sie hinweg, hinüber zum Festland, als hätte er dort eine Verabredung, die es einzuhalten galt.
An Land hatten sie den Sturm Vincinette getauft, die Unbesiegbare. Sie brüllte derart laut, dass auf der Brücke selbst die Stimme von Radio Norddeich kaum zu verstehen war. Tetje drehte den Knopf bis zum Anschlag auf. Wortfetzen drangen durch das Heulen des Windes an sein Ohr.
Die Tür neben ihm öffnete sich. Stolpernd fiel Kapitän Jensen auf die Brücke. Gerade noch konnte er sich am Tisch festhalten.
»Scheun Schiet!«, brüllte er und stellte sich breitbeinig neben Tetje.
»Jo.«
Gemeinsam blickten sie nach draußen, in der Hoffnung, kein anderes Schiff zu entdecken, das den Fehler beging, bei diesem Sturm Richtung Hamburg einzulaufen.
»Wollte dir eigentlich ’n Tass Kaff bringen, aber die Kanne hat sich mit ordentlich Schisslaweng aufn Fußboden verabschiedet«, brummte Jensen. »Der neue Smutje hat versucht, die Sauerei aufzuwischen. Ging nicht. Jetzt schwappt der ganze Schweinkram auf dem Boden hin und her. Er hat geflucht wie ’n Fischweib.«
»Was kocht der auch bei so ’nem Seeschlag Kaffee?«
»Irgendwie müsst ihr ja wach bleiben.«
»Auch wahr.« Seit gestern hatte keiner der Mannschaft Schlaf finden können. Die Nerven lagen blank.
Wieder hob sich der Bug. Tetje und sein Kapitän gingen mit der Bewegung in die Knie, um das Schaukeln auszugleichen.
»Das Wasser schiebt sich die Elbe hoch!«, rief Tetje. »Zu Hause kriegen sie bestimmt wieder nasse Füße!«
»Is ja nix Neues.«
Plötzlich holte das Schiff hart über und warf sich schwer auf die Seite. Stolpernd versuchte Tetje, nicht zu Boden zu stürzen. Da ging ein heftiger Schlag durch den Rumpf.
»Schiet! Die Kette ist gerissen!«, rief Kapitän Jensen und warf die Hand auf den roten Knopf neben sich. Sofort erzitterte Elbe 1, als sich die tonnenschwere Ankerkette vom Schiff trennte und donnernd in der kochenden See versankt. Ein greller Ton überflutete alle Räume im Inneren von Elbe 1.
»Alle Mann an Deck!«, brüllte Jensen. »Maschinen volle Kraft. Schleppanker setzen! Tetje, ab ans Ruder!«
Ohne Kette konnten sie in diesem Sturm die Position nur mit der Maschine halten. Nun mussten sie um ihr eigenes Leben kämpfen und versuchen, nicht unter Land zu treiben. Auf Hilfe konnten sie vorerst nicht hoffen.
15:40 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg, hundert Kilometer landeinwärts
Marion Klinger stemmte sich gegen den Sturm, der an ihrem Mantel und dem Kopftuch riss. In den eiskalten Händen hielt sie zwei Einkaufstaschen, vollgepackt mit Lebensmitteln, die sie bei der PRO-Filiale in der Fährstraße gekauft hatte. Seit sie im Polizeihaus eine Anstellung als Schreibkraft gefunden hatte, ging es ihr und ihrer Mutter finanziell besser. Heute hatte sie roten Heringssalat und sogar ein Pfund Jacobs Kaffee dabei. Vielleicht stimmte das die Mutti ein wenig milder, denn in diesen Tagen waren die Schmerzen in ihren Beinen besonders schlimm.
Gertrud Klinger litt darunter, seit sie 1942 ausgebombt worden waren. Zwei Nächte hatte sie unter den Trümmern auf Hilfe gehofft, bevor man sie endlich fand. Die Knochenbrüche waren nie gut verheilt. Wie auch? Damals war Krieg gewesen. Bis zu Papas Tod hatte Marions Mutter wenig geklagt. Seither aber nörgelte sie über alles und jeden. Am meisten beklagte sie sich darüber, dass ihre Tochter noch immer nicht verlobt war, und das, obwohl sie den vierundzwanzigsten Geburtstag bereits hinter sich hatte. Dass kaum geeignete Heiratskandidaten existierten, wollte die Mutti nicht gelten lassen. »Eine Frau muss nehmen, was der liebe Gott ihr bietet«, sagte sie und mahnte Marion, nicht auf einen Prinzen zu hoffen, wenn es nun einmal nur Frösche gab. »Die Karin, ja, die war plietsch«, pflegte sie zu sagen. »Die hat sich rechtzeitig den Dieter geangelt. Sieh dir an, was aus dem Mädchen geworden ist. Zwei Kinder hat sie, dabei ist sie genauso alt wie du. Und ihr Dieter, der wird es noch weit auf der Werft bringen. Vorarbeiter ist er ja schon. Glaub mir, es dauert nicht lange, und die Karin zieht in eine der schnieken Wohnungen von der Neuen Heimat, drüben in Altona. Mit Badezimmer, Einbauküche, Balkon und allem sonstigen Pipapo.«
Marion hatte sich angewöhnt, nicht mehr auf die Litaneien ihrer Mutter zu reagieren, obwohl die Worte sie schmerzten. Früher hatte sie sich gewehrt, einmal sogar vorgeschlagen, die Mutti könnte sich ja selbst einen Mann suchen, wenn sie unbedingt aus der Laubenkolonie in eine Neubauwohnung ziehen wollte. Mit fünfundfünfzig Jahren war eine moderne Frau für so etwas nicht zu alt. Der Streit danach war zu heftig gewesen, um keine Wunden in beide Seelen zu graben.
Daher verzichtete Marion auf diese Replik, wenn die Vorwürfe mal wieder laut wurden. Manchmal fragte sie sich, warum ihre Mutter nicht stolz auf sie war. Immerhin hatte Marion eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin erfolgreich abgeschlossen und vor drei Monaten eine Anstellung im Polizeihaus am Karl-Muck-Platz angetreten. Heiraten konnte sie später auch noch, sollte ihr der Richtige zufällig über den Weg laufen. So leicht wie im Kino war es im echten Leben nämlich nicht, einen Mann zu finden, der zu einem passte. Und irgendeinen zu nehmen, nur damit die Mutti endlich zufrieden war, wollte Marion ganz bestimmt nicht.
Eine Böe riss sie fast um. Stolpernd versuchte Marion, ihr Gleichgewicht zu finden, als sie aus dem Augenwinkel einen Schatten bemerkte. Erschrocken machte sie einen Satz zurück. Da krachte ein dicker, kahler Ast genau an der Stelle zu Boden, wo sie eben noch gegangen war.
Sie musste vorsichtiger sein! Dass bei einem solchen Orkan Sachen durch die Luft flogen, war nichts Besonderes. Sie sprang über den Ast, der sich quer zum Weg gelegt hatte, als wollte er sie daran hindern weiterzugehen.
Stürme kannten sie in Hamburg zur Genüge. Wahrscheinlich waren die Landungsbrücken und der Fischmarkt längst überflutet.
Immer wieder musste sie mit den beiden Tüten in den Händen um Pfützen herumbalancieren, die sich in den Sand des Wegs gegraben hatten.
Sie passierte die Laube vom Ehepaar Kollwitz. Die Kollwitzens gehörten zu all jenen, die damals vor den Russen geflüchtet waren und ihre Heimat in Ostpreußen verlassen hatten, um in Hamburg neu anzufangen. Mit handwerklichem Geschick und viel Sinn für Humor hatte Opa Kollwitz die Gartenlaube zu einem Kleinod ausgebaut. Letztens hatte er sich ein tragbares Radio gekauft, aus dem manchmal Musik dudelte, während er im Garten das Gemüsebeet umgrub oder Obst pflückte.
Marion entdeckte den Nachbarn auf dem Dach seines Häuschens.
»Moin, Opa Kollwitz!« Sie winkte ihm zu.
»Moin, moin!« Er hielt den Hammer in der Hand hoch. »Die Dachpappe ist weggeflogen!«, rief er, als müsste er erklären, warum er bei diesem Wetter dort oben herumkraxelte.
Zwei Lauben weiter entdeckte Marion den kleinen Uwe, der seinem Vater half, Holzscheite von einem Stapel neben dem Haus in eine Schubkarre zu werfen. Uwe war in der ersten Klasse und seither sehr stolz darauf, dass er schon so groß war. Auf alle Fälle größer als seine Schwester Ursula, die jeder nur Klein-Uschi nannte, weil es in der Siedlung noch eine große Uschi gab, die eine Ausbildung zur Schneiderin machte.
Marion blieb am Gartentor stehen. »Na, seid ihr wieder fleißig? Und das bei diesem Wetter.«
Uwes Papa Dieter Krämer kam zur Pforte.
»Wat mutt, dat mutt. Von allein wird der Ofen nicht warm.« Er schob die Schippermütze tiefer ins Gesicht, damit sie ihm nicht vom Kopf wehte. »Und du? Heute schon Verbrecher gefangen? Oder haben die bei diesem Schietwetter frei?«
Marion lachte. »Ich habe dir oft gesagt, dass ich keine Polizistin bin, sondern nur eine Schreibkraft. Ich tippe Vernehmungsprotokolle und manchmal einen Brief, ich stenografiere oder kümmere mich um die Ablage.«
»Aber wenn du keine bösen Jungs fängst, dann doch hoffentlich bald einen stattlichen Udel in Uniform. Davon laufen bestimmt eine Menge im Polizeihaus herum, richtig?«
»Dass im Polizeihauptquartier auch Polizisten herumlaufen, liegt in der Natur der Sache«, entgegnete Marion, denn sie ahnte, warum er dieses Thema anschnitt. »War deine Karin etwa wieder bei Mutti?«
Dieter grinste breit. »Jo. Deine Mutter will wissen, wann sie endlich mit einem Beamten als Schwiegersohn rechnen kann. Falls da nichts zu finden ist, soll ich ran.«
Marion riss die Augen auf. »Wie bitte?«
»Na, die beiden Frauensleute haben ausklamüsert, dass ich dir ein paar von meinen Kollegen vorstellen soll. Die Howaldtswerke laden nämlich zum alljährlichen Fasching in die Kantine ein, und ich habe den Auftrag, dich zu fragen, ob du mitkommen willst.«
Marion seufzte. »Ich muss arbeiten. Leider.«
»Aber du weißt ja gar nicht, an welchem Tag der Schwof ist.«
»Muss ich auch nicht. Ich bin mir sicher, dass ich an dem Tag arbeiten muss, ganz bestimmt.« Konnte ihre Mutter nicht endlich damit aufhören, sie an den nächstbesten Mann zu verkuppeln? Wut stieg in Marion hoch.
Er lachte. »Genau. Die Jungs sind eh nichts für dich.«
Fragend legte sie den Kopf zur Seite und schaute ihn aus schmalen Augen an. »Was meinst du denn damit?«
Verlegen nahm Dieter die Mütze ab. »Na ja, bist halt was Besseres, so mit Mittlerer Reife und diesem Abschluss als Fremdsprachensekretärin. Jetzt hast du sogar eine Stelle bei der Polizei. Da trauen sich die Jungs von der Werft nicht ran, wenn du verstehst, was ich meine.«
Marion hörte im Kopf die Worte ihrer Mutter. »Für einen reichen Mann bist du nicht hübsch genug und für einen von unseren zu hochnäsig. Du bekommst niemals einen ab. Was habe ich in deiner Erziehung nur falsch gemacht?«
Hinter ihnen hatte Uwe aufgehört, Holz in die Schubkarre zu werfen, und näherte sich mit ein paar Salatblättern dem Hasenstall.
»Ich finde ja«, fuhr Dieter fort, »dass zu dir viel besser einer in Uniform passen würde oder was aus dem Büro. Keine Malocher, wie wir es sind, mit Dreck unter den Fingernägeln.«
Ähnliches hatte ihr die Mutti auch kürzlich gesagt. Nur hatte sie es nicht so nett formuliert. Ihrer Ansicht nach glaubte Marion, für einen einfachen und fleißigen Mann zu gut zu sein. Sie sei arrogant, darum würde ihre Tochter auch als alte Jungfer enden. Aber das stimmte nicht. Marion fand sich überhaupt nicht hochnäsig.
Damals hätte sie gerne den Dieter genommen, nur war ihre beste Freundin Karin schneller gewesen. Die hatte keine Hemmungen gehabt, ihr den Mann vor der Nase wegzuschnappen, obwohl sie wusste, wie sehr Marion in den Dieter verliebt gewesen war. Nächtelang hatte Marion geweint und sich über Monate geweigert, auch nur ein Wort mit der ehemals besten Freundin zu wechseln. Irgendwann arrangierte sie sich mit ihrem Unglück. Im Stillen war sie sich jedoch sicher, dass Dieter die Falsche geheiratet hatte.
Und so machte Marions Herz noch heute jedes Mal einen Hüpfer, wenn sie ihm begegnete. Ob die Karin wusste, dass der Dieter einmal heimlich das Fahrrad von Pastor Lampe ausgeborgt hatte, nur um sich mit ihr am Deich zu treffen? Natürlich hatte er das Rad zurückgebracht, bevor der Herr Pastor das Fehlen seines Drahtesels bemerkt hatte. Dennoch hatte es Marion damals imponiert, dass jemand so etwas Verwegenes für sie tat. Manchmal fragte sie sich, ob Dieter das auch für Karin getan hätte.
»Ich geh dann mal«, sagte sie. »Hatte Nachtschicht. Bin hundemüde.«
Uwe lief zum Gartenzaun. Im Arm trug er einen grauen Hasen mit langen Ohren, von dem Marion wusste, dass er Mümmel hieß und Uwes Lieblingstier war, gleich neben Kater Grumpel und den drei Hühnern, die der Junge jeden Morgen vor der Schule fütterte.
»Wir fahren heute mit dem Zug zu Oma und Opa nach Hamm!«, rief Uwe. Seine Wangen glühten. »Die haben eine neue Wohnung mit ’nem echten Balkon. Und einen Fernseher haben sie auch. Uschi und ich dürfen auf dem Klappsofa schlafen.«
Marion drehte sich um. »Und eure Eltern? Wo bleiben die?«
Dieter strich seinem Sohn übers Haar, der wiederum Mümmel streichelte. »Ich habe morgen Frühschicht auf der Werft. Danach hole ich Karin bei den Schwiegereltern ab. Wir feiern unseren Hochzeitstag bei einem Abendessen im Atlantik.«
»Vornehm geht die Welt zugrunde, sag ich ja man nur. Seid ihr unerwartet zu Geld gekommen?« Marion grinste.
»Nee, auch wenn ich Lotto spiele. Das ist ein Geschenk von Karins Eltern. Da kann ich ja schlecht Nein sagen, oder?«
»Nee, das geht überhaupt nicht«, antwortete Marion süffisant. »Bestimmt schreit der Gewerkschaftsmann in dir Zeter und Mordio, sobald du dich unter die Kristalllüster zu den reichen Bonzen an den Tisch setzen sollst. Leider musst du diese Tortur ertragen, armer Dieter.« Sie schlug ihm auf den Oberarm. »Nimm es als Kampf hinter den Linien des Klassenfeinds, und vergiss nicht, deinen besten Anzug anzuziehen.«
Sie lachte, als sie sein säuerliches Gesicht bemerkte. Er war ein fleißiger Mann, der seine Schichten schob und dazu mit Leib und Seele als Gewerkschaftler für die Rechte der Arbeiter im Hafen stritt. Nebenher fand er noch Zeit, beim Technischen Hilfswerk anzupacken und in der Laubenkolonie als erster Vorsitzender seine Abende zu verbringen. Er war ein guter Kerl, der respektiert wurde und gerne lachte. Es gab niemanden, der Dieter nicht mochte. Und was tat sie selbst? Nichts. Sie lebte nur bei Muddern.
Marion überlegte, ob sie eifersüchtig auf sein erfülltes Leben war, in dem sie eine Rolle hätte spielen sollen und nicht Karin. Vielleicht fiel es ihr darum so schwer, diese kleinen Hiebe zu lassen, sobald sie mit Dieter sprach. Zum Glück nahm er ihr die Spötteleien nicht übel.
»Na denn. Ich wünsche euch einen schönen Abend!«, rief sie und machte sich mit einem Winken auf den Weg nach Hause.
»Tschühüss«, hörte sie Uwe noch rufen.
Die Laube ihrer Mutter war nicht annähernd so gut in Schuss wie die von Dieter und Karin oder jene von Opa Kollwitz. Die Bude hätte längst gestrichen werden müssen. Und wenn der Westwind tobte, pfiff es durch die Fenster. Der Schlot, den ihr Vater vor Jahren selbst gemauert hatte, zog auch nicht mehr richtig. Sie würde Dieter fragen, ob er helfen könnte. Außerdem waren einige Bretter vom Dach lose, durch die es bei ungünstigem Wind und Schauer hereinregnete.
Trotz aller Mängel aber war die Laube ihr Zuhause. Solange der Papa gelebt hatte, war ihr Heim immer recht schmuck gewesen, auch wenn die Behörden es abfällig Behelfsheim nannten. Mutti war damals besonders stolz auf ihren Gemüsegarten und die Obstbäume gewesen, das Linoleum in der Küche und die Doppelspüle, die nicht einmal die Kollwitzens hatten. Als der Papa krank wurde, dauerte es noch drei Jahre, bis der Tod ihn endlich erlöste. Mit ihm hatte ihre Mutter auch ihren Lebensmut verloren und sich in Schmerzen und Vorwürfe gegen die Tochter geflüchtet.
Mit der Hüfte stieß Marion die Gartenpforte auf, die klemmte und längst hätte geölt werden müssen. Eilig ging sie den schmalen Plattenweg entlang, der zwischen den unkrautübersäten Gemüsebeeten verlief. Die Äste des Apfelbaums griffen, vom Wind gepeitscht, wirr um sich. Schnell lief Marion daran vorbei, aus Angst, einer könnte sie erwischen.
Schon hatte sie die Haustür erreicht. Keine Veranda und kein Vordach boten Schutz vor dem Sturm, der aus Nordwest kam. Mit aller Kraft musste sie die Tür aufziehen, um ins Trockene zu gelangen, bevor der Wind sie hinter ihr zuwarf.
»Hallo? Ist da jemand?«
»Ich bin’s, Mutti.«
Marion stellte die Taschen auf den Boden, zog den feuchten Mantel aus, hängte ihn an den Garderobenhaken neben der Haustür und nahm das Kopftuch ab. Sie warf einen prüfenden Blick in den Spiegel.
Seufzend versuchte sie, ihre Frisur zu richten, die sich trotz Haarspray hartnäckig weigerte, auszusehen wie jene von Jacqueline Kennedy. Sie bog die Haarspitzen nach vorne, nahm die weiche Bürste aus der Schale unterm Spiegel und frisierte ihr kastanienbraunes Haar. Das Kopftuch hatte den auftoupierten Hinterkopf völlig platt gedrückt. Und die hübsch zur Seite gekämmte Strähne pappte wegen des Regens an ihrer Wange, als hätte sie sie mit Uhu dort festgeklebt. Ob die Männer wussten, wie aufwendig es für Frauen war, auch nur einigermaßen attraktiv zu sein?
»Kind, wo bleibst du?«
Rasch legte sie die Bürste zurück. »Ich komme ja schon.«
Die Mutter lag in ihrem Bett, das fast den ganzen Raum einnahm. Nur ein Nachttisch fand noch Platz darin. Von draußen fiel an diesem Tag kaum Licht in das kleine Schlafzimmer. Die Luft war stickig, weil der Sturm es unmöglich machte, das Fenster zu öffnen.
Früher hatten hier die Eltern geschlafen. Marion hingegen musste sich mit der Couch im Wohnzimmer begnügen. Erst nach Walter Klingers Tod hatte die Mutti eine Holzwand ziehen lassen, damit Marion ein eigenes Zimmer hatte.
»Die Schmerzen«, lamentierte die Mutter, als Marion eintrat. »Habe fast nicht geschlafen. Die ganze Nacht war ich wach. Und dieser Kurpfuscher Doktor Helm will mir keine Tabletten mehr geben. Kannst du dir das vorstellen? Man sollte ihn melden.«
Auf dem Nachtschrank entdeckte Marion eine hellblaue Metalldose mit der Aufschrift Contergan. Die Pillen gegen ihre Schlaflosigkeit nahm ihre Mutter seit Jahren. Im silberfarbenen Röhrchen daneben befanden sich weiße Aspirin-Tabletten. Gegen ihre Melancholie schwor die Mutti auf Frauengold. Mittlerweile leerte sie täglich ein bis zwei der braunen Fläschchen, die Wohlbefinden und Lebensfreude versprachen, aber längst nicht mehr halfen.
»Hast du etwas gegessen, Mutti?«
»Warum sollte ich?«
»Bist du denn noch gar nicht aufgestanden?« Marion nahm das leere Wasserglas vom Nachtschrank, um es in die Küche zu bringen. Ein scharf-süßlicher Frauengold-Geruch strömte ihr daraus entgegen. »Es ist nach eins. Denkst du nicht, du solltest dich mehr zusammenreißen?«
»Wenn dir meine Art zu leben nicht passt, musst du dir ein neues Zuhause suchen«, verfolgte sie die krächzende Stimme aus dem Schlafzimmer. »Heirate endlich. Ich will mich nicht mehr um dich kümmern müssen. Bist ja schließlich alt genug, um einen eigenen Haushalt zu führen!«
Marion stellte das Glas in die Spüle.
»Wer sich hier wohl um wen kümmert?«, murmelte sie. Auf dem Küchentisch entdeckte sie den Teller mit den Broten, die sie in aller Frühe für ihre Mutter zubereitet hatte, bevor sie das Haus verlassen hatte. Die Mettwurst wellte sich, der Rand der Käsescheibe war trocken. »Du hast ja nicht einmal dein Frühstück gegessen!«, rief Marion ins Schlafzimmer.
»Ja und? Ich hatte eben keinen Hunger.«
Wütend ging sie zurück. »Du benimmst dich wie ein Kind, Mutti! Sagst, ich soll mir einen Mann suchen und ausziehen. Und was wird aus dir? Verhungern wirst du.«
»Rede nicht solchen Unsinn, schon gar nicht in dem Ton, verstanden?« Ihre Mutter versuchte, sich im Bett aufzusetzen. »Undankbar bist du!« Ihr Oberkörper wankte. Schwer ließ sie sich ins Kissen zurückfallen. »Man schlägt die Hand nicht, die einen nährt.«
»Wem sagst du das?«, zischte Marion und riss den Vorhang zu, der den Schlafraum vom Wohnzimmer trennte. »Es wäre schön gewesen, wenn mich nach der Arbeit ein warmes Essen erwartet hätte statt einer übellaunigen Alten.«
»Wie redest du mit mir?« Der wütende Ton ihrer Mutter kippte ins Jämmerliche.
Marion antwortete nicht, sondern lief zurück in die Küche, um sich dort eine Kleinigkeit zu essen zu machen. Es musste noch Labskaus von gestern im Kühlschrank stehen. Sie nahm den Topf heraus und knallte ihn auf den Tisch. Aus der Schublade holte sie eine Gabel und aß kurzerhand die kalten Reste aus dem Pott. Den Heringssalat würde sie selbst essen. Der war zu schade für ihre Mutter.
Sie sei undankbar? Pah! Ohne sie würde die Mutti von ihrer mickrigen Witwenrente am Hungertuch nagen. Empört schob Marion eine Gabel von dem mit Rote Bete und Corned Beef gemischten Kartoffelstampf in den Mund, während draußen der Wind heulte und der Regen an der Fensterscheibe hinunterlief. Es wurde allerhöchste Zeit, dass sie die Laubenkolonie verließ. Wie lange sollte sie ihre Mutter noch pflegen?
Ihr Blick fiel ins Wohnzimmer. Auf dem kleinen Tisch stapelten sich Frauenzeitschriften und Reisekataloge. Die alten Ausgaben von Bunte und Quick bekam ihre Mutter von den Nachbarinnen geschenkt. Die Kataloge daneben gehörten Marion. Manchmal ging sie nach der Arbeit in das Reisebüro am Gänsemarkt, um sich einige davon mitzunehmen. Wann immer sie Zeit hatte, blätterte sie darin herum, um sich an die schönsten Orte in Italien zu träumen oder in Gedanken Städte zu besuchen, die sie niemals bereisen würde. Wie gerne wäre sie in die Welt gefahren, um ein aufregenderes Leben zu führen als in der Laubenkolonie. Manchmal fragte sie sich, ob sie es wirklich tun würde, falls sie die Möglichkeit dazu hätte. Träumereien waren kaum mehr als unverbindliche Freizeitbeschäftigungen. Es zu tun, erforderte Mut. Hatte sie den? Sie wusste es nicht. All die Sprachdiplome, die sie in der Abendschule abgeschlossen hatte, waren wertlos, wenn sie hierblieb.
Wahrscheinlich hatte ihre Mutter recht. Irgendwann würde sie heiraten müssen. Basta.
Marion aß weiter und lauschte dem Pfeifen des Windes, wie er um die Laube herumging und sein schauerliches Lied sang.
Als ihre Wut verraucht war, beschloss Marion, den Abwasch auf später zu verschieben und sich erst einmal eine Tasse Kaffee zu kochen. Dazu würde sie ein Stück Schokoladenpuffer essen, der vom letzten Sonntag übrig war. Ihre Mutter würde sie nicht fragen, ob sie auch etwas davon wollte. Marion setzte Wasser im Kessel auf und stellte ihn auf den Herd, in dem zum Glück noch ein Brikett glühte. Sie hatte es in eine nasse Zeitung gewickelt, damit genügend Glut im Ofen war, wenn sie heimkehrte. Jetzt legte sie zwei kleine Holzscheite in die Klappe, die mit etwas Pusten kurze Zeit später Feuer fingen.
Bald darauf wehte der würzige Geruch von gemahlenem Kaffee durch das Häuschen. Unterdessen rüttelte der Sturm draußen an den Fenstern und ließ die Äste der Bäume wie Peitschen auf- und abschießen.
Sie war müde und sehnte sich nach ihrem Bett.
Als das Wasser kochte, goss sie es in den mit zwei Löffeln Kaffeepulver gefüllten Papierfilter.
»Mutti, möchtest du eine Tasse Kaffee?«, rief sie. Schließlich war sie kein Unmensch. Niemand antwortete. Wahrscheinlich war ihre Mutter noch immer beleidigt.
Kurz darauf ging sie, mit einer der Porzellantassen aus der Anrichte in der Hand und einem Stückchen Puffer in der anderen, ins Schlafzimmer hinüber. Sie wollte sich nicht streiten. Kaffee und Kuchen sollten ein Friedensangebot sein.
Sie zog den Vorhang beiseite. »Mutti, möchtest du auch ’n Tass Kaff mit richtiger Sahne?«
Ihre Mutter reagierte nicht. Stattdessen hörte Marion ein sonores Schnarchen vom Bett her. Die Flasche Frauengold lag leer auf dem Fußboden.
Enttäuscht kehrte sie zurück in die Küche. Dann würde sie eben den Kaffee allein trinken und beide Kuchenstücke essen. Sie setzte sich an den Tisch.
In das Heulen des Windes mischte sich das gleichmäßige Ticken der Standuhr im Wohnzimmer. Die heutige Ausgabe des Hamburger Abendblatt lag auf dem zweiten Stuhl. Wahrscheinlich hatte Karin sie mitgebracht, als sie und Mutti eine neue Strategie ausbaldowert hatten, um die unvermittelbare Tochter an irgendeinen willigen Mann zu bringen.
Marion schlug die Zeitung auf. Morgen sollte es weiter starke Böen geben und schauerartigen Schneeregen bei vier Grad, stand auf der Titelseite oben rechts. Wichtiger war wohl, dass sich ein Siebzehntausend-Tonnen-Schiff in Kiel wegen des Sturms auf die Seite gelegt hatte. Ein großes Foto schmückte Seite eins der Zeitung.
Marion nahm einen Schluck Kaffee und blätterte weiter. Weiter hinten hieß es: Seit heute früh tobt über der Nordsee und über dem norddeutschen Küstengebiet wieder ein schwerer Südweststurm. Im Laufe des Tages soll er sich nach Angaben des Hamburger Seewetteramts zum Orkan steigern. Wie am vergangenen Montag wird in der Deutschen Bucht abermals Windstärke 12 erwartet. In der nördlichen Nordsee ist die Schifffahrt vor Orkanböen gewarnt worden …
Sollte dieser Sturm denn nie enden? Sie blickte durch die von Regenschlieren übertünchte Fensterscheibe in den Garten. Das verzerrte Bild erinnerte sie an ein modernes Gemälde in der Kunsthalle. Alles floss ineinander wie Wasserfarben, als Marion ihre Nachbarin Karin mit einem Fremden durch das Gartentor kommen sah. Beide stemmten sich gegen den Wind zur Laube. Der Schirm in der Hand des Mannes hing in Fetzen.
Marion grinste. Der war wohl nicht von hier.
Stirnrunzelnd ging sie zur Tür. Es klopfte. Kaum öffnete sie die Haustür, riss ihr der Sturm die Klinke aus den Fingern. Mit einem entschlossenen Satz konnte sich der Besucher gerade noch retten, bevor die aufschwingende Tür ihn erwischte.
»Hallo, Marion!«, rief Karin. »Können wir reinkommen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, schob sie sich in den Flur. »Wir wollen nicht stören.« Sie blickte sich um. »Ist deine Mutter nicht da?«
»Die schläft.«
»Oh, tscha, also, nur kurz: Also, das ist der Günter Seifert. Er arbeitet auf der Werft, genau wie mein Dieter, aber bei den Schlipsträgern. Er ist in der Buchhaltung.«
Der Mann reichte Marion seine eiskalte, teigweiche Hand. Er deutete eine zackige Verbeugung an. »Angenehm. Seifert, Günter.«
»Hörte ich schon«, erwiderte Marion unnötigerweise, woraufhin Seifert, Günter überrascht Karin ansah. Von einer frechen Göre in der Klinger-Laube hatte die ihm wohl nichts erzählt. »Was wollt ihr?«
Nur kurz aus dem Konzept gebracht, berichtete Karin vom Faschingsfest auf der Howaldtswerft. »… und damit du da nicht allein hinmusst, hat sich der Günter bereit erklärt, dein Begleiter zu sein. Wie gefällt dir das?«
Das gefiel Marion nicht im Geringsten. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Hast du das etwa mit meiner Mutter abgesprochen?«
»Ja, und wenn schon?«, kam es aus dem Schlafzimmer hinterm Vorhang. »Du bist nicht mehr die Jüngste.«
»Hallo, Muddern Klinger!«, rief Karin in die Laube und wandte sich wieder an Marion. »Das wird bestimmt lustig.« Sie lachte verlegen. »Mein Dieter ging letztes Jahr als Bürgermeister, mit Faltkragen und schwarzer Robe. Du hättest mal die Gesichter der Genossen sehen sollen. Herrlich!«
»Interessant«, kommentierte Seifert, Günter. »Bedauerlicherweise war ich im letzten Jahr nicht dabei.« Er machte ein betretenes Gesicht. »Persönliche Gründe hielten mich davon ab.«
Marion unterdrückte ein Gähnen. Die Schicht im Polizeihaus war lang gewesen. Nur um die beiden wieder loszuwerden, gab sie nach. »In Ordnung. Ich komme mit.«
Der Mann strahlte. »Als was gehen Sie, Fräulein Klinger? Ich als Cowboy. Vielleicht könnten Sie ja als Squaw erscheinen. Die Leute sollen ja wissen, dass wir zusammengehören.« Seine Wangen nahmen eine rosige Farbe an, und Marion vermutete, dass das nicht nur vom kalten Wind herrührte.
»Ich werde schauen, was ich finden kann.« So freundlich es ging, drückte sie Karin und Seifert, Günter zur Tür.
»Morgen um acht, ja?«, hakte er nach.
»Morgen schon? Wo soll ich denn so schnell ein Kostüm herkriegen?«
»Ich hätte eins«, meinte er eifrig. Sein blassgraues Augenpaar rutschte langsam an ihrem Körper rauf und runter. »Das müsste passen.«
Fragend sah Marion ihre Nachbarin an, die erklärte, dass seine Damalige Seifert, Günter kurz vor der Faschingsfeier im letzten Jahr hatte sitzen lassen.
»Dabei waren die Karten schon gekauft. Jede kostete fünfzehn Mark.« Er setzte einen leidenden Hundeblick auf, bei dem sich Marion nicht sicher war, ob er den verfallenen Eintrittskarten oder der entlaufenen Freundin galt.
Müde nickte sie. »Also gut.«
Seine stumpfblassen Augen begannen zu leuchten. »Sehr schön, sehr schön. Das Geld für die Eintrittskarte können Sie mir ja vorher geben. Ein Getränk und das Essen sind inbegriffen.«
Karin lächelte peinlich berührt. »Nach der schlechten Erfahrung, die er im letzten Jahr gemacht hat, kann man es ihm nicht verübeln, dass er dich nicht einlädt.«
»Meinetwegen, aber wir treffen uns um halb acht bei Karin. Nicht hier«, verkündete Marion. Niemals würde sie mit dem Kerl allein in ihrer Laube sein wollen und sich hinter dem Vorhang umziehen, während er im Wohnzimmer saß und ihre Mutter alles kommentierte. Sie öffnete die Tür. Sofort schoss der Regen in den Flur.
»Also, bis morgen, Marion!«, rief Seifert, Günter gegen den Wind. Sie konnte sich nicht entsinnen, ihm das Du angeboten zu haben. Schnell schloss sie die Tür hinter ihnen.
Gerade wollte sie in ihr Zimmer gehen und sich hinlegen, als sie die Drecksspuren seiner Stiefel auf dem Linoleum und dem Vorleger entdeckte. Sie hatte erst gestern das ganze Haus geputzt.
»Das kann ja richtig nett werden«, murmelte sie.
»Das will ich hoffen«, hörte sie die Stimme ihrer Mutter hinterm Vorhang. Sie mochte es in den Beinen haben, aber hören konnte sie gut. »Und dieses Mal wirst du liebenswürdiger zu deiner Begleitung sein. Der andere hatte sich nach eurer ersten Verabredung nie wieder blicken lassen. Mir wäre so etwas früher nicht passiert.«
Seufzend griff Marion zum Lappen unter dem Spülbecken und wischte die Sauerei weg.
16 Uhr, Bahnstrecke Hamburg–Celle, Niedersachsen
Irgendwo hinter Bad Bevensen war der Zug stehen geblieben. Sie warteten jetzt schon seit einer Stunde darauf, dass der umgestürzte Baum von den Gleisen gezogen würde. Die anderen Fahrgäste wurden langsam unruhig, ob die Reise überhaupt weitergehen sollte.
Georg Hagemann war es egal, wann er wieder in Faßberg eintraf. Niemand rechnete dort mit ihm, denn er hatte seinen Urlaub gerade erst angetreten und hätte eigentlich bis Sonntagabend in Hamburg bleiben können. Leider hatten sie sich gestritten, er und Helga. Warum das so gekommen war, begriff er noch immer nicht. Jedenfalls hatte sie ihn gleich nach dem Essen vor die Tür gesetzt.
Darum hockte er nun in diesem Abteil. Ihm gegenüber saß der Alte, der ihm seit der Abfahrt am Hauptbahnhof mit seinem Gerede über die gute alte Zeit jede Minute zur Hölle machte. Am liebsten hätte Georg ihm die Meinung gegeigt, was er nicht tat. So ein schmalzlockiger Rocker war er nicht. Er war Soldat. Und Ärger mit seinem Vorgesetzten wollte er auch nicht riskieren, nicht wegen so eines Ewiggestrigen. Stattdessen ließ er den Altnazi weiter von Hitler und dem glorreichen Reich schwadronieren, während er selbst aus dem Fenster in die Dämmerung starrte.
»Feigling«, hatte Helga zu ihm gesagt und die Haustür vor seiner Nase zugeknallt.
Angefangen hatte es damit, dass sie wissen wollte, warum er vor drei Jahren unbedingt in diese vermaledeite Bundeswehr hatte eintreten müssen. Es gab anständigere Arbeit, meinte sie und verstand nicht, dass Georg schon immer hatte fliegen wollen. Als man ihm die Ausbildung zum Hubschrauberpiloten anbot, griff er sofort zu, ohne es Helga zu sagen. Damals waren sie nicht so fest zusammen gewesen wie heute. Erst später hatte er festgestellt, dass sie wie all die anderen war, die die neue Bundeswehr nicht mochten.
Georg konnte das irgendwie verstehen. Der Krieg steckte den Leuten nach wie vor in den Knochen, auch wenn sie es nicht zugeben wollten. Von den zerbombten Häusern war längst nichts mehr zu sehen. Statt der Ruinen standen überall moderne Bürohäuser oder Siedlungen, Schnellstraßen und Einkaufszentren. Man schien sich gegenseitig darin übertreffen zu wollen, die Scham der Niederlage und des Grauens zu vergessen, obwohl die Herzen der meisten seit damals still vor sich hin bluteten, trotz Coca-Cola, Partys mit Käseigeln, Marilyn Monroe, Fußball und VW Käfer. Der Mensch war von jeher ein Meister des Verdrängens, egal zu welcher Zeit und an welchem Ort.
Helga wollte keinen Soldaten im Haus, hatte sie gesagt. Die Nachbarn würden reden. Dabei war er nie in Uniform bei ihr erschienen. Nicht nur ihretwegen, sondern auch, weil es schon mehrmals vorgekommen war, dass ein Soldat auf Heimaturlaub von Zivilisten verprügelt worden war. Seit einiger Zeit gab es die Anweisung von oben, nicht in Uniform auf die Straße zu gehen. Also tat er es nicht. Dennoch erkannte man offenbar den Soldaten in ihm. Vielleicht war es der kurze Haarschnitt. Gerade hatte er die Jacke ausgezogen, da hatte Helga geklagt, man hätte sie schon wieder auf ihn angesprochen.
Keiner im Land glaubte, dass dieser lächerliche Haufen von Vaterlandsverteidigern im Notfall auch nur eine halbe Stunde gegen die Kommunisten bestehen könnte, hatte Helga ihm an den Kopf geworfen. Wozu also brauchte man sie?
Das aber war nicht der Grund gewesen, warum er und Helga sich gleich nach seiner Ankunft so heftig in die Wolle gekriegt hatten. Nein, bestimmt nicht.
Der Alte im Abteil hatte sich mittlerweile in Rage geredet.
»… schon in Verdun hätte es anders laufen müssen. Das war der Anfang vom Ende«, ereiferte er sich und nannte Bundeskanzler Adenauer einen Verräter. »Wenigstens haben wir jetzt den Starfighter. Sie sind einer von den Piloten drüben in Faßberg, oder?«
Georg nickte zögerlich. Man sah es ihm also tatsächlich an. Inständig hoffte er, den Alten bald loszuwerden, der nun über seine eigenen Heldentaten im Krieg berichtete und davon, dass Himmler ihm persönlich einen Orden verliehen hatte. Typen wie der lernten nicht aus dem Gewesenen und würden wohl auch niemals aussterben. Leider.
Wann, verdammt, fuhr dieser Zug endlich weiter?
Georg versuchte, sich zu konzentrieren, doch die Gedanken wirbelten in seinem Kopf umher, als machten sie sich einen Spaß mit ihm. Anfangs war sein Besuch in Helgas kleiner Wohnung gut gelaufen. Sie hatte extra für ihn ein Rezept aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Neue Welt der Frau gekocht. Etwas ganz Besonderes für einen ganz besonderen Abend, sagte sie kryptisch, musterte ihn erwartungsvoll über den hübsch gedeckten Tisch hinweg an und hob das Glas Cinzano, während im Hintergrund Peter Kraus eine Schnulze vom Plattenteller säuselte. Beim Nachtisch ließ sie die Bombe platzen.
Sie sei schwanger.
Von ihm.
Dabei waren sie nicht einmal verlobt.
Sprachlos sah er Helga an und wusste nicht, was er auf diese angeblich frohe Neuigkeit hin hätte sagen sollen.
»Freust du dich nicht?«
Er hatte keine Ahnung.
Plötzlich sprang sie auf und weinte. Sie könne das Kind ja illegal wegmachen lassen, wenn er nicht Vater werden wolle. Dazu keifte sie laut, damit es die Nachbarn auch hörten. Allein jedenfalls würde sie die Schande nicht ertragen, ein uneheliches Kind unter ihrem Herzen zu tragen. Ihre Eltern würden sie fortjagen, und die Anstellung bei Hertie sei dann garantiert auch futsch.
Wie gelähmt ließ er ihren Ausbruch über sich ergehen und wünschte sich weit fort. Er hatte doch gerade erst die Pilotenprüfung abgelegt. Mit fünfundzwanzig Jahren fühlte er sich viel zu jung, um schon Vater zu sein.
Wie benahmen sich Väter überhaupt? Er hatte keine Vorstellung, denn seinen eigenen Vater hatte er im Krieg verloren und die Mutter bald darauf bei einem Bombenangriff. Mit dreizehn Jahren steckte man ihn in ein Heim. Woher sollte er wissen, was richtige Väter taten oder nicht? Eine Familie gründen? Wie machte man so etwas?
Helga schien davon klare Vorstellungen zu haben, wie auch von allen anderen Details ihrer gemeinsamen Zukunft. Vielleicht in dem Versuch einer Versöhnung, legte sie ihm eine Gästeliste für ihre Hochzeit vor. Wortlos nahm er die Seiten in die Hand. Er kannte niemanden darauf.
»Und? Was denkst du?«
Machte sie ihm gerade einen Antrag? War das nicht seine Aufgabe?
»Natürlich musst du vor mir auf die Knie gehen. Das gehört sich so.«
Die Namen auf der Liste verschwammen vor seinen Augen. Heiraten? Helga? Liebte er sie überhaupt? Diese Frage hatte er sich noch nie gestellt. Sie konnte gut tanzen und kochen und hatte auch sonst gewisse Qualitäten, die er schätzte, aber heiraten?
Sein erneutes Schweigen machte sie wieder wütend.
Irgendwann setzte sie ihn mitsamt Rucksack vor die Tür und nannte ihn einen Feigling. Ein Drückeberger sei er und der größte Fehler ihres Lebens. »Hätte ich das gewusst, wäre nie etwas aus uns geworden.«
Zum Abschied gab sie ihm bis morgen Zeit, darüber nachzudenken, was er eigentlich wollte. Dann hatte sie die Tür vor seiner Nase zugeknallt.
Ein Ruck ging durch Georg, als der Zug anfuhr.
Der Alte stieg in Uelzen aus. In der himmlischen Stille nickte Georg ein. Erschreckt fuhr er hoch, als sie den Bahnhof Unterlüß erreichten, griff nach seinen Sachen und sprang aus dem Zug.
Eine Stunde später stieg er vor dem Kasernentor aus dem Bus.
Der Wachhabende grinste breit. »Na, das war ja ein kurzer Heimaturlaub. Entweder hat sie einen anderen, oder sie hat dich rausgeworfen.«
Georg riss ihm seinen Ausweis aus der Hand. »Ach, halt doch die Klappe!«
Bevor er in seine Stube ging, führte ihn sein Weg am Flugfeld vorbei, wo gerade eine Bell 47G-2 betankt wurde. Die Rotorblätter wippten im scharfen Wind auf und ab. In der Kaserne war der Sturm nicht so sehr zu spüren wie noch in Hamburg. Dennoch würde kein Hubschrauber starten, solange die Windgeschwindigkeiten nicht unter acht Beaufort fielen.
Georg flog alles, was nicht bei drei in der Luft war. Die Sycamore Bristol 171, die als Rettungshubschrauber eingesetzt wurde, mochte er am liebsten. Wendig und elegant war das kleine Ding. Man hatte ihn aber auch auf dem neuen Sikorsky-Transporthubschrauber H34 ausgebildet, von dem mehrere Maschinen hinten beim Hangar standen. Der massige Helikopter sog seine Kühlluft vorne über ein gebogenes Gitter oberhalb des Motors ein, was ihm ein recht miesepetriges Aussehen verlieh. Genauso fühlte sich Georg gerade.
Zum Glück war das Leben in der Kaserne einfacher. Hier ging alles seinen geregelten Gang, und keiner der Kameraden würde sich trauen, ihn einen Feigling zu nennen. Zackig grüßte ihn ein Obergefreiter, der aufs Tor zuhielt. In der Fliegerstaffel respektierte man Leutnant Georg Hagemann. Dass man ihn und die anderen Soldaten außerhalb der Kasernen nur naserümpfend ertrug, war ihm egal. Hier war er wer.
In der Stube, die er mit drei anderen teilte, zog er hastig seine Zivilkleider aus. Kurz darauf warf er sich in Felduniform auf sein akkurat gemachtes Bett. Nachdenklich legte er die Hände unter den Kopf und starrte die Unterseite von Angermeiers Koje an. Bis Sonntag würde er hier allein sein. Eine gute Gelegenheit zum Nachdenken.
Georg schloss die Augen und ahnte, dass er wohl an der wichtigsten Weggabelung seines Lebens stand. Er musste sich nur entscheiden. Oder hatte Helga schon für ihn entschieden?
16:50 Uhr, Landungsbrücken, Hamburg
Das Wasser im Hafen bei den Landungsbrücken stieg und stieg. Längst hatte es eine Höhe von fast vier Metern über Normalnull erreicht. Unten an den Anlegern hüpften die Pontons mit jeder Welle auf und ab. Gischt spritzte bis an die Buden, wo sich an schönen Tagen die Hamburger und Touristen mit Fischbrötchen und einer Tasse Kaffee oder einem Bier eindeckten, bevor sie zum Sonntagsausflug ins Alte Land aufbrachen oder zu ihren Arbeitsplätzen auf der anderen Flussseite schipperten.
Missmutig, den Rücken dem Sturm entgegengedreht, wartete an diesem späten Freitagnachmittag Hauke Brüning mit einigen Kollegen an Pier 7 auf die Fähre nach Steinwerder. Sie alle arbeiteten drüben bei Blohm & Voss auf der Werft, wo sie gleich ihre Nachtschicht antreten sollten. Der Boden unter ihren Stiefeln wogte auf und ab. Niemand sagte etwas.
Hauke wollte eine rauchen. Er schüttelte eine Attika aus der Schachtel, fummelte das Feuerzeug hervor und drehte sich mit dem Rücken gegen den Wind. Mehrmals versuchte er vergeblich, die Zigarette anzuzünden. Fluchend warf er irgendwann die nasse Kippe fort. Diese blieb für einen Moment in der Luft stehen, als müsste sie nachdenken. Dann schoss sie zurück, dicht an ihm vorbei, und landete im Wasser, wo weiße Schaumkronen sie verschluckten.
»Schietwetter«, grummelte Hauke.
Keiner widersprach.
»Hinten am Fischmarkt steht das Wasser schon bis zu den Haustüren!«, rief der Kollege neben ihm. Er trug schwarze Cordhosen und eine geölte Seemannsjacke, deren Kragen er hochgeschlagen hatte. Die Strickmütze hatte er weit über die Ohren gezogen.
»Das gibt mal wieder volle Keller«, entgegnete Hauke. Wie zur Bestätigung flogen Fetzen einer Feuerwehrsirene zu ihnen herüber.
»Die Jungs dürften heute bannich viel zu tun haben«, meinte der andere.
»Jo.«
Aus dem gischtvernebelten Halbdunkel hopste der Bug einer Fähre aus dem Wasser. Wie ein Kinderball wurde sie von den Wellen hin- und hergeworfen. Schnaufend schob sie sich dem Pier entgegen. Erst beim dritten Mal gelang das holprige Anlegemanöver.
»Macht zu!«, brüllte der Festmacher, als er an Land kam und den Tampen locker um den Poller warf.
Mit einem Satz sprangen Hauke und die anderen an Bord.
17:09 Uhr, Laubenkolonie Alte Landesgrenze e. V., Hamburg-Wilhelmsburg
Otto Kollwitz saß vor seinem Radio und hörte Freddy Quinn Heimweh singen, dabei reparierte er den Wackelkontakt in der Nachttischlampe seiner Frau. Das gute Stück flackerte immer dann, wenn seine Alma bei ihrem neusten Jerry-Cotton-Heft an die spannendste Stelle kam, wie sie ihm versicherte. Mit zusammengekniffenen Augen versuchte er, die kleine Schraube zu lösen, was beim dritten Versuch auch endlich gelang. Im Hintergrund warnte der Nachrichtensprecher vor einem Sturm an der Küste.
»Orkanböen mit Windstärke bis zu 12 werden an der Nordseeküste und den Halligen erwartet …«
Otto zog das beschädigte Kabel mit seinen knorrigen Arthritisfingern ab. Wenn er es gleich hinter der Bruchstelle abknipste, könnte er das neue Ende wieder um den Kontakt wickeln. Kein Problem. Nur fummelig würde es werden. Und so gut gucken wie früher konnte er auch nicht mehr.
Aus der Küche hörte er Topfklappern. Heute war Freitag, also kochte Alma Pellkartoffeln und briet in Eipanade gewendete Heringe für ihn. Dazu würde es wie immer ein kühles Bier geben. Bei Tisch würde er ihr sagen, dass ihr Abendmahl der Himmel auf Erden war. Genau wie sie. Daraufhin würde sie lachen und nachfüllen.
Das Lachen hatten sie erst mühsam wieder lernen müssen, nachdem sie damals in Ostpreußen über Nacht vor den Russen nach Westen hatten fliehen müssen. In Hamburg fingen sie Ende ’45 ganz von vorne an, auch weil ihre beiden Söhne im Krieg geblieben waren. Der eine vor Stalingrad, der andere in Frankreich. Seither hatten sie nur noch sich.
Einmal in der Woche spielten sie mit den Nachbarn Skat. Im Garten bauten sie Kartoffeln, Bohnen und Kürbisse an. Der Boden in Wilhelmsburg war dafür prima geeignet. Alma schwor, dass sie zu Hause in Ostpreußen nie so große Kartoffeln geerntet hatten. Niemals hatte sie ihrem Otto einen Vorwurf daraus gemacht, als er damals beschloss, sie müssten ihre Heimat verlassen. Doch er ahnte, dass sie Heimweh hatte.
Dass er und seine Frau älter wurden, die Knochen Tag für Tag müder, sodass jeder Gang zur Straße auf den nahen Deich hinauf immer beschwerlicher wurde, versuchten sie zu ignorieren.
Dennoch ertappte Otto in letzter Zeit Alma immer öfter dabei, wie sie schwermütig vor sich hin starrte. Sie hatte wieder angefangen, von den Jungs zu reden, und fragte sich, was wohl aus ihnen geworden wäre, wenn sie nicht so jung hätten sterben müssen. Sie redeten stundenlang von damals und von Daheim in Ostpreußen. Ob das Haus noch stand? Und wer sich wohl all die Jahre um die Obstbäume gekümmert hatte?
Almas Heimweh machte ihm Angst, denn er wusste, dass sich jeder Mensch am Ende seiner Tage zurück in die Zeit sehnte, als das Licht noch schien und man eine Zukunft hatte. War es nicht so? Er wollte nicht, dass sie ging.
18:10 Uhr, Altes Land, Hamburg
Ein Stück elbabwärts spähte Enno Petersen durch das kleine Fenster des Kuhstalls hinaus in den dräuenden Himmel. Eine tiefschwarze Wolkenfront rollte schnell näher. Das Vieh hinter ihm war unruhig, so wie er selbst auch.
Die Tiere spürten, dass der Sturm mit seinem Werk noch immer nicht zufrieden war. Muhen kam von den beiden Viehgattern, zwischen denen ein Gang lag. Von dort aus hatte er eben die Silage an seine Viecher verteilt. Nur wenige Tiere fraßen das gegorene Gras, das er im Sommer auf den Weiden eingefahren hatte. Die meisten Kühe liefen bange auf und ab, ganz so wie er, der nun schon zum dritten Mal an das schlierige Stallfenster trat, um hinauszusehen.
»Schön’ Schiet«, grummelte er, als er den umgekippten Apfelbaum entdeckte, der eben noch neben dem Schuppen gestanden hatte. Na, wenigstens brachte der Stamm gutes Brennholz. Zwei Klafter mindestens.
Ein letzter besorgter Blick auf seine Kühe, dann zog er die Schultern hoch und die grüne Schirmmütze tiefer ins Gesicht. Er drückte sich gegen die Holztür, die kaum aufgehen wollte, weil der Wind von der anderen Seite dagegenhielt. Mit Schwung stieß er die Tür auf und trat in die verdammt steife Brise hinaus. Dröhnendes Brausen umfing ihn. Eine Böe hob ihn kurz an, er wedelte mit den Armen, stützte sich an der Wand ab und kam wieder zum Stehen.
»Verdoorig ober ock!«, schimpfte er den Schreck weg und überquerte gebeugt den Hof.
In den Fenstern des Haupthauses brannte Licht. Er sah einen Schatten über den Hof schlingern, direkt auf die Haustür zu. Das musste Knut sein, der noch bei der Milch gewesen war. Bei diesem Sturm waren die Melkhelfer aus dem Dorf nicht gekommen, und Knut hatte die Arbeit allein erledigen müssen.
Gemeinsam stolperten sie in die Diele. »Mock de Dör dicht!«, brüllte Enno unnötigerweise.
Sein Knecht warf sich gegen die Tür, bis sie ins Schloss fiel.
Der würzige Geruch von Bratkartoffeln hing in der Luft. Sogleich besserte sich Ennos Laune. Er zog die Füße aus den hohen Gummistiefeln, stellte sie auf eine Matte neben die Tür, stieg in seine Pantoffeln und hängte die Jacke neben die von Knut.
»De Melkpott is randvull.« Der Knecht seifte im Emaillebecken auf der Diele seine groben Hände mit Kernseife ein. Es schäumte ordentlich zwischen seinen Fingern.
Enno stellte sich neben ihn und griff ebenfalls nach der Seife.
»Bi de Höhners wor ick ock«, fuhr der Knecht fort. »De sün all narsch worden bi düssen Storm. De Dör is wohl op gohn un hett klappert.«
»Und, hast du die Tür wieder zugemacht?«
»Jo. Hebb een Stein davor legen. Ober Eier gifft dat morgen garantiert nich.«
»Macht nix. Dann essen wir eben keine Eier, sondern Marmeladenbrot zum Frühstück. So wie die in der Stadt.«
Sie grinsten sich an, während sie ihre Hände mit einem groben Leinentuch abtrockneten, und machten sich auf, in den Wohntrakt des Hauses zu gehen, wo seine Frau bereits den Küchentisch gedeckt hatte, die Bratkartoffeln mit dem Speck in der Pfanne brutzelten und zwei große Gläser Bier standen, während draußen der Sturm über das hohe Reetdach zog, an Fensterläden rüttelte und das dreihundert Jahre alte Gebälk des Hofs zum Ächzen brachte.
20:30 Uhr, Deutsches Hydrographisches Institut, St. Pauli, Hamburg
Regierungsdirektor Walter Horn rückte seine Brille auf der Nase zurecht. Als Leiter der Abteilung V, Bereich Gezeiten, Astronomie und Zeitdienst, wurden ihm die Hochwasserstände aus Cuxhaven mehrmals täglich vorgelegt. Am Morgen hatten sie noch mit einem Hochwasserstand der Nachmittagstide von zweieinhalb Metern gerechnet. Gegen 7 Uhr am Abend hieß es bereits, dass die drei Meter im Hafen bald erreicht werden würden. Das gefiel ihm nicht. Der Sturm drückte die Wassermassen von der Deutschen Bucht weiterhin in die Elbe, dazu kam die Flut. Wegen des Windes hatte die Ebbe den Wasserstand in Hamburg nicht senken können. Und nun stieg das Wasser und stieg.
Er spürte ein Ziehen in der Magengegend.
Auch wenn sie bisher nur davon ausgingen, dass hauptsächlich die Nordseeküste betroffen war, sagten ihm viele Jahre Erfahrung, dass dieses Mal nicht nur die Speicherstadt und die Landungsbrücken überspült werden könnten.
Er hatte schon im Laufe des Tages alle zuständigen Stellen informiert. Polizei und Feuerwehr hatten sich ordnungsgemäß auf eine Sturmflut vorbereitet, so wie sie es immer taten, doch da war diese Unruhe in seinem Gedärm, aus dem es jetzt mächtig grummelte.
Regierungsdirektor Horn fingerte einen Pfefferminzbonbon aus der Schreibtischschublade und blickte zu der großen Uhr an der Wand hoch. Es war gleich halb neun. Die Nachrichten waren längst vorbei. Sollte er die Bevölkerung noch einmal informieren lassen? Die Hamburger waren nasse Füße in der Innenstadt gewohnt. Trotzdem, heute Nacht würde es schlimmer werden, denn die Flut begann erst zu steigen. Wenn das so weiterging, könnten die Wasserstände gefährlich hoch werden. Vielleicht würde das Wasser sogar über die Deichkronen und Schleusentore schwappen.
Andererseits könnte es auch eine ganz normale Sturmflut sein, die in wenigen Stunden vorbei war. Er würde sich lächerlich machen, wenn er die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzte.
Er kaute auf dem Bonbon herum, das krachend zwischen seinen Zähnen zerbrach. Dann griff er zum Telefonhörer.
»Verbinden Sie mich mit dem Norddeutschen Rundfunk. Ich bleibe am Apparat.« Regierungsdirektor Horn wartete.
Die gespenstische Stille in der Leitung machte ihn von Minute zu Minute unruhiger, während der Sturm vor seinem Bürofenster in der Bernhard-Nocht-Straße wirkte, als wäre er ein wildes Tier kurz vor dem Sprung. Endlich war ein Klingeln zu hören. Horn konzentrierte sich. Jemand nahm das Gespräch an. In knappen Worten übermittelte er die Warnung vor einer sehr schweren Sturmflut und bat darum, das laufende Radioprogramm zu unterbrechen. Seine Mitteilung wurde notiert. Gut.
Er legte den Hörer zurück auf die Gabel des schwarzen Bakelittelefons und faltete die Hände vor sich auf der Schreibtischunterlage. Er hatte getan, was die Vorschriften verlangten. Dennoch wollte die Unruhe nicht weichen. Vincinette, die Unbesiegbare. Ein Omen?
Walter Horn erhob sich und ging in den Raum mit den Fernschreibern. Dort schaute er seinem Mitarbeiter über die Schulter, der soeben die hereinkommenden Berichte aus Cuxhaven auswertete. Das Wasser stieg weiter. Der Sturm nahm zu. Hundertfünfzig Stundenkilometer.
Das war nicht gut.
22:05 Uhr, Cuxhaven, Nordseeküste
Sirenenfetzen hetzten über Dächer hinweg, verloren sich in der Dunkelheit am Hafen. An den Fenstern der Häuser blickten die Leute auf die Männer der Freiwilligen Feuerwehr hinunter, wo Wehrführer Friedhelm Alsen und seine Kameraden seit Stunden versuchten, den Durchlass im Deich, den sie hier Slippe nannten, zu schließen. Sollte ihnen das nicht gelingen, würde das Wasser ganz Cuxhaven überschwemmen.
Im Schein der wankenden Straßenlaternen schwappten bereits kleine Wellen über das Kopfsteinpflaster in die Stadt. Der Landwehrkanal war längst vollgelaufen. Und das Wasser stieg verdammt schnell.
Überall zuckte ein blaues Lichtermeer. Seine Jungs eilten umher. Die Tore wollten sich nicht schließen lassen! Verrostet. Außerdem waren keine Balken vorhanden, um die Lücke an der Deichaußenseite zu schließen.
Alsen griff nach dem Ärmel eines Mannes, der in der Deichreihe alles neugierig beobachtete. »Renn rüber zur Imbissbude. Die haben ein Telefon. Sag ihnen, sie sollen Sönnichsen anrufen. Der soll bei den Bauern nachfragen, ob sie Balken von woanders herbringen können. Schnell!«
Der Angesprochene rannte los. Unterdessen stemmten sich Alsens Löschgruppe und einige Helfer mit aller Macht gegen die Tore. Das Wasser drückte sie immer wieder auf. Schon stand es wadenhoch.
Endlich trafen die angeforderten Balken ein. So schnell es ging, nahmen die Männer sie vom Anhänger, den ein Bauer an seinen Trecker gehängt hatte, und stapelten sie zwischen den Deichenden, um die Slippe auch außendeichs zu verrammeln. Immer drei Mann schleppten einen Träger herbei. Der Orkan aber riss ihnen die groben Balken ständig aus den steif gefrorenen Händen.
Neugierige lungerten herum und guckten. Es wurden immer mehr. Einem seiner Kameraden riss der Geduldsfaden, weil er es mit einer Fuhre Sandsäcke nicht durch die Menge schaffte. Kurzerhand gab er dem Nächstbesten, der ihm dumm kam, eine Ohrfeige. Gerangel.
Alsen brüllte ein paar Befehle, die Männer an der Pumpe drehten sich um und eilten dem Freund zu Hilfe. Flüche flogen umher, während sich immer mehr Wasser in die Stadt schob. Der Streit konnte schnell beigelegt werden. Die Nerven lagen blank. Jeder wusste, was passieren würde, wenn sie die Slippe nicht dichtmachen konnten.
Alsen wies den Bauern an, mit einem Trecker die beiden verrosteten Tore der Slippe zuzudrücken. Kurze Erleichterung erfasste die Männer. Dann aber wies jemand zwischen die beiden Tore, wo sich weiter Wasser sammelte.
»Verdammt! Das reicht nicht! Wir müssen Sandsäcke dazwischen werfen!«
»Rammen! Wir brauchen Rammen!«, schrie jemand, als das Wasser aus der Slippe quoll.
Unruhe breitete sich unter den Schaulustigen aus. Die Ersten rannten zurück in ihre Häuser und packten hektisch ihre Sachen. Wenn der Deich brach, war es besser, woanders zu sein.
Den Koffer in der Hand, die Kinder auf dem Arm, hasteten bereits einige zu ihren Borgwards und Käfern oder nahmen ihre Fahrräder und Mofas. Knatternd rollten sie Richtung Altenwalde auf ihrer Flucht vor den Fluten. Ihnen entgegen fuhren die eilig herbeigerufenen Soldaten der nahen Kaserne, die bei der Deichbefestigung helfen sollten. Hupen von allen Seiten.
Irgendwann war kein Durchkommen mehr. Zwei Polizisten versuchten, den im Chaos gefangenen Lastwagen einen Weg herauszuwinken. Drüben, beim Lotsenhaus am Steubenhöft, war der elektronische Pegelanzeiger seit fast einer Stunde ausgefallen. Keiner wusste, wie hoch das Wasser tatsächlich war. Auch Hamburg nicht, wo man die Daten unbedingt benötigte, um sich vor der Flutwelle zu schützen.
Friedhelm Alsen war hinübergerannt.