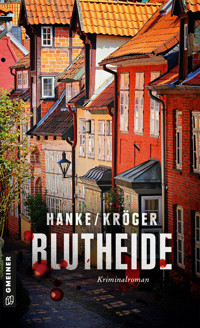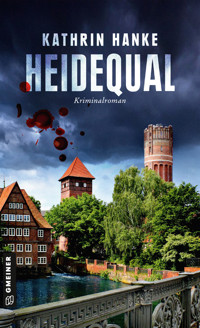Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Peter Lüders
- Sprache: Deutsch
In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 bricht die Sturmflut über Hamburg ein. In der Stadt herrscht das Chaos und es sind viele Helfer unterwegs. Der Wilhelmsburger Johannes Becker nutzt die Katastrophe jedoch für seine eigenen Zwecke: Er bringt die Nachbarstochter Anne, in die er seit Jahren unerwidert verliebt ist, in seine Gewalt. Anne stirbt und nur Beckers Freund, Kommissar Peter Lüders, ahnt, dass die junge Frau nicht durch die Flut umgekommen ist. Lüders beginnt im Alleingang zu ermitteln und dringt dabei in menschliche Abgründe vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kathrin Hanke
Als die Flut kam
Hamburg-Krimi
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Museum Elbinsel Wilhelmsburg e.V.
ISBN 978-3-8392-6860-5
Zitat
»Anderen kannst du oft entfliehen, dir selbst nie.«
(Publilius Syrus)
Prolog April 1945, Vormittags
Er saß hinter dem Busch. Eigentlich hatte seine Mutter ihn und die Großen losgeschickt, Löwenzahn zu rupfen. »Husch, husch, raus mit euch. Sucht auf den Wiesen Löwenzahnblätter, damit wir mal wieder etwas Frisches zwischen die Zähne bekommen«, hatte sie gesagt und jedem von ihnen eine Blechschüssel in die Hand gedrückt. Seine Schwester Magda und sein Bruder Helmut waren sofort losgestürmt. Auch er war aus der kleinen Laube, in der sie lebten, hinausgegangen, aber nicht gelaufen. Die Großen ärgerten ihn sowieso nur, wenn die Eltern nicht dabei waren, und deshalb wollte er woanders nach Löwenzahn suchen und nicht gemeinsam mit Magda und Helmut. Er mochte seine Geschwister nicht. »Häng doch nicht immer an meinem Rockzipfel«, schnauzte Magda ihn immer an, wenn er ihr zu nahe kam, und Helmut nannte ihn ständig »Baby«. Dabei war er gar kein Baby mehr. Er war schließlich schon ein Schulkind und machte schon lange nicht mehr in die Hose. Leider aber ins Bett. Nicht jede Nacht, doch irgendwie schon ziemlich häufig. Aber dafür konnte er doch nichts. Wie sollte man im Schlaf merken, wenn man mal musste? Er hatte keine Ahnung, wie die Großen das machten, da konnte er vor dem Schlafengehen noch so oft pinkeln gehen und nichts trinken. Natürlich wurden seine Geschwister, mit denen er sich ein Bett teilte und zwischen denen er lag, genauso wach wie er, wenn sich die Nässe, die aus ihm herauskam, auf der dünnen Matratze ausbreitete. Meistens riefen sie dann »Iiiih« und »Ist das eklig« und solche Sachen. Davon wurden dann die Eltern wach und schimpften. Doch die Schimpfe war nicht so schlimm wie das Schämen. Er wollte so gern groß sein und seiner Mutter, die dann schläfrig und vor sich hin murrend das Bett neu bezog und ihm etwas Neues zum Anziehen gab, nicht so viel zusätzliche Arbeit machen. Es klappte einfach nicht. Das nachts Einpinkeln passierte ihm immer wieder. Gerade gestern Abend hatte er deswegen versucht, nicht einzuschlafen, aber es hatte nicht funktioniert, und er und seine Geschwister waren mitten in der Nacht durch die Feuchtigkeit unter ihnen aufgewacht, die er verschuldet hatte. Wieder war das Geschrei groß gewesen. Dieses Mal war jedoch Vater aufgestanden, weil es Mutter nicht gut ging. Was sie hatte, wusste er nicht. Vater hatte bestimmt, dass er selbst die Wäsche wechselte, während alle anderen zuschauten. Er hatte die Schlafmatte umdrehen und dann das frische Laken darüberlegen müssen. Wenn die Mutter das machte, ging das ganz schnell. Bei ihm hatte es eine Ewigkeit gedauert, obwohl er sich angestrengt hatte. Aber die Schlafmatte war schwer, und als er sie endlich umgedreht hatte, wollte das olle Laken sich einfach nicht glattziehen lassen. Magda meckerte darüber die ganze Zeit herum, bis Vater lospolterte, dass er seinen Schlaf bräuchte und keine Kinder, die nachts miteinander zankten. Die Mutter lag während alledem im Elternbett, schaute erschöpft zu und sagte gar nichts – wenn der Vater in solch einer Stimmung war, war das auch besser. Als sie endlich wieder alle in ihren Betten waren und Vater schnarchte, flüsterte Helmut in sein Ohr, dass er allen Kindern in der Kolonie erzählen würde, dass sein Bruder ein Bettnässer sei. Schon deswegen wollte er jetzt nicht mit seiner Schwester und dem Bruder zusammen Löwenzahn pflücken. Sie würden bestimmt auch andere Kinder treffen, und wenn Helmut denen erzählte, dass er noch ins Bett machte, würden sie alle über ihn lachen und das brachte ihn dann zum Weinen, was noch peinlicher war. Sowieso machten ihm die vielen anderen Kinder oft Angst. Sie waren laut und rangelten andauernd miteinander. Das mochte er nicht. Sein einziger Freund Peter, der mit seiner Familie neben ihnen wohnte, machte ihm niemals Angst. Im Gegenteil fühlte er sich an dessen Seite absolut sicher, denn Peter war sein Beschützer. Der zwei Jahre Ältere stellte sich sogar vor Helmut, wenn dieser ihn schubsen oder ihm noch Schlimmeres antun wollte. So viel Mut hätte er ebenfalls gern und er hoffte, wenn er größer war, würde er sich das auch trauen.
Er war nur wenige Schritte weit gekommen, als er das Mauzen gehört hatte. Er war neugierig stehen geblieben, um zu lauschen, woher das klägliche Rufen kam. Er liebte Tiere. Sie waren anders. Nicht so wie Menschen. Vor Tieren hatte er keine Angst. Noch nicht einmal vor Wespen, denn wenn man nicht zappelte, taten sie einem nichts. Tiere waren lieb, und sie mochten ihn.
Er erinnerte sich noch gut daran, als der Vater zu Weihnachten ihr letztes Kaninchen geschlachtet hatte. Er hatte geweint, und Helmut hatte ihn Memme genannt, aber er hatte nichts gegen die Tränen tun können. Das Kaninchen hatte ihm so unendlich leidgetan. Als es dann als Braten auf dem gedeckten Tisch gestanden hatte, hatte er es trotzdem gegessen – er hatte wie immer einfach großen Hunger gehabt – und das Fleisch hatte ihm sogar geschmeckt.
Noch heute meldete sich sein schlechtes Gewissen, wenn er an das Kaninchen dachte. Er hatte miterlebt, wie es groß geworden war, und oft mit ihm gespielt, es gestreichelt und gefüttert. Sein Vater hatte ihm gesagt, er sollte ihm keinen Namen geben, aber wenn er mit ihm allein gewesen war, hatte er es Muckel genannt. Muckel war zutraulich gewesen und ganz flauschig. Genauso wie das kleine Kätzchen, das er jetzt auf seinem Schoß hatte und streichelte. Es hatte hinter dem Busch gesessen, als es gemauzt und ihn dadurch auf sich aufmerksam gemacht hatte. Er war in die Hocke gegangen und hatte unter den Busch geguckt. Als er nichts entdecken konnte, es aber weiter mauzte, war er um den Busch herumgekrochen und hatte das schwarze Kätzchen mit den weißen Pfoten gefunden. Es war noch ganz klein und hatte sich bestimmt verlaufen und seine Mutter verloren. Hier gab es einige Katzen und immer wieder Katzenbabys. Seine Eltern fanden das gut, weil die Katzen Mäuse und Ratten wegfingen. Er fand das gut, weil er auf diese Weise oft ein Tier zum Streicheln fand. Manchmal redete er auch mit den Tieren und erzählte ihnen, wie gemein seine Geschwister und deren Freunde zu ihm waren. Jetzt fragte er sich, ob er die Mutter des Kätzchens suchen sollte. Nein, jetzt noch nicht, dachte er. Erst einmal wollte er noch eine Weile mit dem niedlichen Tier kuscheln. Das Kätzchen ließ sich das gern von ihm gefallen und schlief kurz darauf ein. Er wurde auch müde, musste bei dem Anblick des warmen, weichen Tiers gähnen und legte sich behutsam, damit Socke, wie er das Kleine bereits für sich nannte, nicht aufwachte, ebenfalls auf den Boden, rollte sich ein und schloss die Augen.
Gerumpel weckte ihn. Vielleicht war es auch das Tröpfeln des Regens. Er wusste es nicht, und es war auch gleichgültig, denn sofort fiel ihm der Löwenzahn ein. Die Mutter würde sicher schimpfen, wenn er nicht wenigstens ein paar Blätter mit nach Hause brachte – hoffentlich hatte er nicht zu lang geschlafen. Socke war mit ihm wach geworden und sah ihn erschrocken an. Er beruhigte das Kätzchen durch streicheln, setzte es in die neben ihm liegende Blechschüssel, nahm diese in die Hand und stand auf. Das Gerumpel kam näher, und gerade, als er hinter dem Busch hervortreten wollte, sah er den Treck, der vorüberzog. Es war eine größere Gruppe von Menschen, die von einem Pferdewagen angeführt wurde. Sein Herz klopfte. Er fand es spannend. Woher die Leute wohl dieses Mal kamen? Schon öfter waren Flüchtlinge in ihre Kleingartensiedlung gekommen, weil sie von ihrem Zuhause wegmachen mussten. Dass es »wegmachen« hieß wusste er, denn eine der ersten Frauen, die hier mit ihren Kindern angekommen war, hatte das so zu Mutti gesagt. Es waren meistens nur Frauen und Kinder. Manchmal auch alte Leute, aber keine Männer wie der Vater. Die waren ja alle an der Front. Der Vater kämpfte nur nicht mehr für das Vaterland, weil ihm ein Bein fehlte. Das hatte ihm eine Mine genommen und deswegen war er zu ihnen zurück nach Hause geschickt worden. Manchmal hatte Vati seine Phantomschmerzen, dann ging es ihm sehr schlecht, aber Mutti sagte dann immer: »Dafür bist du bei uns und nicht tot.« In der Regel fühlte er sich aber gut, und wenn er seine Prothese abgenommen hatte, hüpfte Vati mitunter durch ihre ganze Laube und sang dabei. Und alles, ohne ein einziges Mal umzufallen.
Er vermutete, dass der Vater dafür viel geübt hatte. Darum hüpfte er selbst auch gelegentlich heimlich auf einem Bein den kleinen Sandweg am Ende der Siedlung auf und ab, um schon einmal zu trainieren. Vielleicht musste er ja ebenfalls irgendwann für Deutschland kämpfen. Dann wollte er aber lieber wie Vati ein Bein verlieren, damit er schnell wieder nach Hause käme. Ihm gruselte vor dem Krieg. Wenn die Bomber kamen, hatte er immer besonders Angst, wie schlimm musste es dann an der Front sein? Durch diese Bomber wohnten sie ja überhaupt erst in der Laube. Sie gehörte ihnen. Bevor sie im letzten Jahr eingezogen waren, hatten sie in der Kirchdorfer Straße gewohnt und die Laube als Garten genutzt, in dem sie Kartoffeln, Salat, Tomaten, Gurken und all so etwas anbauten. Dann war ihr Haus aber bei einem Bombenangriff zerstört worden, und sie waren in die kleine Hütte hier gezogen. Sie hatte kein Fundament, sondern stand auf Ziegelsteinen. Das war besser als auf Holzbohlen, die viele andere Lauben unter sich hatten, denn es war haltbarer, sagte Vati immer. Einige ihrer Wilhelmsburger Bekannten, die wie sie ausgebombt waren, aber keine Laube hatten, waren entweder in den Ley-Häusern oder sogar außerhalb von Hamburg untergebracht worden. Das hatte er mitbekommen. Die waren auch in solchen kleinen Trecks losgezogen. Wegen der Bomber hatte er neulich Mutti gefragt, ob sie nicht auch wegmachen könnten, aber die hatte nur gelacht und gemeint, dass es anderswo noch viel schlimmer sei und er mal dankbar sein sollte, dass sie wenigstens ihr eigenes Dach über dem Kopf hätten. Daran musste er denken, als jetzt der Flüchtlingstreck an ihm vorüberzog. Er wartete, bis die letzten Flüchtlinge mit ihren grauen Gesichtern an ihm vorbei waren, dann trat er hinter dem Busch hervor – er sollte jetzt unbedingt wenigstens ein paar Blätter Löwenzahn sammeln, damit Mutti nicht enttäuscht war. Außerdem wollte er sie und Vati fragen, ob sie das Kätzchen nicht behalten könnten. Das hatte er sich eben überlegt. Er wollte vorschlagen, dass er es großzog. Ganz allein. Das würden ihm die Eltern aber, falls überhaupt, nur erlauben, wenn sie gut gestimmt waren, und schon deshalb brauchte er den Löwenzahn. Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf: Über Kohle würden sie sich noch mehr freuen als über die Blätter für den Salat und dann sicher einwilligen, dass er Socke behalten durfte. Au ja, das war eine gute Idee! Eine, die ihm jedoch auch Angst einjagte, denn Kohle musste er klauen. Sein Freund Peter machte das manchmal für seine Familie – und er wusste, wo Peter das tat. Es war eine versteckte Stelle bei den Bahngleisen, die sein Freund irgendwann einmal beim Spielen entdeckt hatte. Bisher war er selbst nur einmal da gewesen. Er hatte Wache gehalten, und Peter hatte ein paar der Kohlen in einen Beutel geklaubt. Als er gefragt hatte, wem die Kohle gehörte, hatte Peter mit den Schultern gezuckt und gemeint: »Das ist doch egal.«
»Aber das ist doch Diebstahl«, hatte er gesagt. Peter hatte ihn angelacht: »Natürlich ist das Diebstahl. Aber der, der die Kohle hier versteckt, ist bestimmt auch ein Dieb. Warum sollte sie sonst hier liegen und nicht in einem Bahnschuppen?«
Er hatte das logisch gefunden und fand das auch jetzt noch. Eigentlich war er dann kein richtiger Dieb mehr, denn die Kohlen, von denen er sich ein paar nehmen wollte, waren ja schon gestohlen. Trotzdem bummerte sein Herz schon bei dem bloßen Gedanken an seinen Plan doller als sonst. Er gab sich einen Ruck und wandte sich in die entgegengesetzte Richtung, in die der Treck unterwegs war, und da sah er sie zum ersten Mal.
Sie saß nur ein paar Meter von ihm entfernt mit hochgezogenen Knien mitten auf dem Schotterweg. Sie hatte ihre Beine mit den Armen umschlungen und ihren Kopf auf die Knie gebettet. In ihren zusammengelegten Händen hielt sie einen Zettel. Ihr Körper erzitterte in regelmäßigen Abständen, und obwohl er nichts hörte, wusste er, dass das Mädchen weinte. Es hatte hellblonde Locken, die nicht zu Zöpfen gebunden waren, sondern wild vom Kopf abstanden. Bei dem Anblick musste er sofort an Springkraut denken, dessen Früchte er so gern aufplatzen ließ. Das Gesicht des Mädchens konnte er nicht sehen, und dennoch wusste er, dass er es nicht kannte. Solche Haare hatte er noch nie gesehen. Es musste zum Treck gehören, aber weswegen war es nicht bei seinen Leuten? War es verlorengegangen? So wie wahrscheinlich Socke? Er blickte in die Richtung, in die der Treck gezogen war, doch von dort kam niemand zurück. Überhaupt war der Weg inzwischen leer bis auf das Mädchen, ihn und Socke.
Er setzte sich in Gang und kam dem Mädchen Schritt für Schritt näher. Die Kiesel knirschten unter seinen Schuhen, die seinem Bruder zu klein und ihm noch zu groß waren, aber er hatte keine anderen. Eigentlich müsste die Kleine ihn schon wegen des Knirschens hören, aber sie blieb in ihrer Haltung. Und das tat sie auch, als er jetzt an sie herangetreten und vor ihr stehen geblieben war. Er überlegte, was er sagen sollte, während er sie von oben betrachtete. Sie hatte keine Schuhe an, nur dicke Wollstrümpfe, die schon ziemlich löchrig waren. Eben hatte es nur leicht genieselt, jetzt nahm der Regen zu, und er stellte sich vor, wie sie mit ihren löchrigen Strümpfen durch die kalten Pfützen patschte. Sie tat ihm leid. Vielleicht weinte sie ja auch deswegen.
»Warum weinst du?«, fragte er.
Sie sah nicht zu ihm hoch und sagte auch nichts. Aber er wusste, dass sie ihn gehört hatte, denn ihr Körper hörte auf zu beben. Sie weinte nicht mehr.
»Ich bin Johannes, und du?«, versuchte er es weiter, bekam aber wieder keine Antwort. Dann fiel ihm etwas ein. Er nahm das Kätzchen aus der Blechschüssel, die er daraufhin auf den Boden stellte, und setzte sich kurzerhand neben die Kleine. Das Kätzchen platzierte er direkt vor ihren Füßen und sagte dabei: »Und das ist Socke.«
Gerade, als er dachte, sie würde auch darauf nicht reagieren, hörte er sie leise fragen: »Wer ist Socke?« Sie hatte dabei noch immer ihren Kopf zwischen den Knien vergraben, und deswegen nahm er Socke jetzt wieder hoch und hielt das Kätzchen an ihre Hände, die nach wie vor die Beine und den Zettel umklammerten.
»Mein Kater«, sagte er daraufhin nicht ohne einen gewissen Stolz in der Stimme. Dann fiel ihm ein, dass das nicht ganz der Wahrheit entsprach, schließlich hatten die Eltern ihm noch nicht erlaubt, Socke zu behalten. Außerdem wusste er gar nicht, ob Socke ein Junge oder ein Mädchen war. Ihn beschlich ein schlechtes Gewissen, das traurige Mädchen belogen zu haben, doch das war wie weggeblasen, als sie jetzt ihre Hände von den Beinen löste, ihm noch immer ohne aufzublicken den Zettel reichte, den er nahm, und Socke dann befühlte. Johannes sah fasziniert dabei zu, wie sie Socke hochnahm und gleichzeitig ihren Kopf von den Knien hob, sodass sie das Kätzchen betrachten konnte. Ihr Gesicht war schmutzig und von feinen, sauberen Linien durchzogen, die die Tränen hinterlassen hatten. Dann richtete sie die Augen plötzlich auf ihn. An diesen Moment sollte er sich sein ganzes weiteres Leben erinnern. Ihre Augen waren groß, rund und von einem tiefen Blau. Er selbst hatte braune Augen, aber natürlich kannte er viele Leute mit blauen, doch solche wie ihre hatte er noch nie zuvor gesehen. Sie waren blau wie Tinte und noch schöner als ihre Haare.
»Ich bin Anneliese, aber Muttel sagt Anne«, meinte sie, während sie ihn musterte.
»Anne«, wiederholte er, als müsse er erst lernen, den Namen richtig auszusprechen. Noch einmal sagte er »Anne«, dann fragte er: »Wo ist deine Familie?«
Kaum hatte er die Frage gestellt, schossen Tränen in Annelieses Augen. In diesem Moment tat sie ihm so sehr leid, dass auch ihm fast die Tränen kamen, er konnte sie gerade noch herunterschlucken. Er fragte sich, was er machen könnte, um sie zu trösten. War ihre Familie tot? Er richtete seinen Blick auf den Zettel in seiner Hand. Er konnte noch nicht lesen, aber er hatte so einen schon einmal gesehen, und der Vater hatte ihm erklärt, um was für einen es sich handelte. Es war ein wichtiges Dokument, das alle Flüchtlings- und Vertriebenenfamilien bei sich führen mussten, wenn sie in ihre neue Heimat kamen: Es war ein Zuweisungsschein, auf dem stand, wer sie waren und wo sie sich ansiedeln sollten. Da Anne den Zettel bei sich trug, war er sich jetzt fast sicher, dass ihre Familie tot und sie ganz allein unterwegs war.
Ihm fiel nichts Besseres ein, als sie in die Arme zu nehmen, so wie Mutti es tat, wenn er sich verletzt hatte. Sie wiegte ihn dann auch immer hin und her. Das machte er jetzt ebenso mit Anneliese, begleitet von den Worten, die seine Mutter dabei sagte: »Pscht, pscht, alles wird gut.« Und dann setzte er noch das hinzu, was er in diesem Moment fühlte: »Ich werde immer für dich da sein und dich beschützen.«
Zitat
»Schenken, um Freude zu machen, ist immer etwas Gutes, ist etwas, was den Menschen ehrt. Es ist ein Zeichen der Liebe. Die Liebe aber ist im Grund doch die Kraft und die Macht, die allein das Leben lebenswert machen kann.«
(Konrad Adenauer, aus: Weihnachtsansprache 1961)
Kapitel 1 Heiligabend 1961
»Danke«, sagte Johannes. Mehr brachte er nicht heraus. Er hatte gerade vor aller Augen Annes Weihnachtsgeschenk für ihn ausgepackt und war überwältigt. Nicht nur, weil es für Annes Verhältnisse sicherlich recht teuer gewesen war, sondern ebenso, da es eine echte Überraschung für ihn war und sie sich Gedanken darüber gemacht hatte, ihm eine außergewöhnliche Freude zu machen. Die Familie Becker feierte jedes Jahr den Heiligen Abend mit Anne und ihrer Mutter Gertrud. Es war eine schöne Tradition, doch niemand von Johannes’ Familie erwartete im Gegenzug Geschenke von den beiden, die finanziell nicht gut gestellt waren. Dennoch legten Mutter und Tochter jedes Jahr eine kleine Aufmerksamkeit für alle auf den Gabentisch – meist eine große Schachtel Pralinen oder eine andere Süßigkeit. Heute hatten die beiden Kretschmar-Frauen ihre Gastfamilie mit einer großen Dose Quality Street beschenkt, über die sich Johannes’ Vater gleich hergemacht hatte. Dieter Becker liebte vor allem die weichen Karamellstangen und hatte sie sich alle rausgesucht. Für Johannes hatte Anne immer schon ein Extrageschenk dabei. Früher waren es selbst gemalte Bilder gewesen, später dann Bücher. Ein solch wertvolles Geschenk wie heute hatte es noch nie gegeben.
Von seinen Eltern hatte er wie jedes Jahr ein paar selbst gestrickte Socken und ein Buch bekommen. Von seinen Geschwistern nichts – sie hatten ihn noch nie beschenkt, obwohl er sie in den letzten Jahren, seit er eigenes Geld verdiente, stets mit einer Kleinigkeit bedacht hatte. Dabei würden sie es sich leisten können. Magda hatte gut geheiratet – ihr Mann Rainer war, wie er selbst, bei der Bank angestellt – und sein Bruder Helmut arbeitete beim Norddeutschen Rundfunk als Techniker. Anne hingegen hatte nicht viel Geld zur Verfügung. Mit ihrem Sekretärinnengehalt konnte sie keine großen Sprünge machen, zumal sie ihre Mutter noch mit durchfüttern und deren regelmäßigen Arztrechnungen begleichen musste. Die beiden lebten nach wie vor in einer der Lauben in der Kolonie, in der sie vor über 15 Jahren am Ende ihrer Flucht aus Schlesien angekommen waren und Johannes Anne auf dem Weg gefunden hatte – sie waren bisher nicht umgezogen, da die Pacht für die Laube, die sie jährlich an die Stadt zahlten, so niedrig war. Gertrud, Annes Mutter, war damals, kurz bevor der Flüchtlingstreck in der Laubenkolonie angekommen war, zusammengebrochen. Sie hatten sie ein paar Kilometer entfernt in einer Böschung am Deich gefunden – halb verhungert, halb erfroren und halb tot. Annes Mutter hatte sich davon nie wieder ganz erholt. Sie war sowieso eine zierliche Frau, doch seit diesem Tag war sie immer kränklich gewesen, sodass sie kaum einer Arbeit nachgehen konnte. Als Anne noch klein gewesen war, hatte Gertrud Kretschmar sich und ihre Tochter über die Runden gebracht, indem sie für die Frauen der Kolonie nähte. Als gelernte Schneiderin konnte sie aus alten Stoffen die wunderbarsten Kleider, Anzüge oder Hemden zaubern. Genauso besserte sie alte Kleidung aus oder machte sie enger, damit ein Geschwisterkind die abgelegten Sachen der großen Schwester oder des großen Bruders tragen konnte, ohne auszusehen, als wäre es ein Clown. Für Johannes und seine Familie hatte Gertrud Kretschmar allerdings stets ohne Bezahlung genäht. Sie hatte sie abgelehnt. Aus Dankbarkeit. Johannes und seine Eltern hatten sie damals im April 1945 nicht nur todkrank von der Böschung beim Deich gezogen, sondern sie und Anne trotz der ohnehin schon beengten Laube auch bei sich aufgenommen und gepflegt, bis sie einigermaßen genesen war. Ganze vier Monate hatte die kleine Anne auf diese Weise bei Johannes’ Familie gewohnt – es war die schönste Zeit in seinem Leben gewesen.
»Danke«, sagte Johannes jetzt ein weiteres Mal und betrachtete dabei noch immer gerührt die Uhr in seiner Hand. Es war eine Seiko und gerade, als er sie sich nun um sein Handgelenk legen wollte, sagte Magda: »Zeig mal!«, und streckte ihm fordernd ihre offene Handfläche entgegen. Eigentlich wollte Johannes ihr die Uhr nicht geben. Es widerstrebte ihm, dass seine Schwester die Uhr auch nur berührte, dennoch legte er sie ihr wortlos in die Hand. Dann erst suchte er den Blick von Anne, die ihre Augen ebenfalls auf ihn gerichtet hatte und ihn erfreut, dass ihr Geschenk gelungen war, anlächelte. Johannes lächelte zaghaft zurück. Sein Herz klopfte dabei spürbar, und er hatte einen Kloß im Hals. Heute würde er es ihr sagen, doch dazu mussten sie allein sein.
Johannes war aufgeregt, so wie bereits seit Tagen, nachdem er den Entschluss gefasst hatte. Unter dem Weihnachtsbaum hatte Anne bereits ein Geschenk von ihm gefunden, ein Buch. Das Phantom der Oper von Gaston Leroux. Er hatte es selbst vor einigen Monaten gelesen, und die Geschichte hatte ihn berührt, denn auch er kam sich manchmal wie das Phantom in Annes Leben vor. Er war zwar nicht entstellt und lebte nicht verborgen vor allen Menschen, dennoch verglich er sein Leben mit dem von Eric, wie Leroux das Phantom der Oper genannt hatte, denn auch er war unglücklich verliebt und hatte sich bisher der Frau seines Herzens nicht geöffnet. Das wollte Johannes heute ändern, und dafür hatte er eine weitere Gabe im Schrank in seinem Zimmer versteckt, die seine Worte bekräftigen würde. Er musste nur noch auf die passende Gelegenheit warten, bis er es ihr unter vier Augen überreichen konnte.
*
Wenn sie jetzt nicht gleich aufstehen und ins Bad gehen würde, würde sie sich hier am Tisch übergeben. Die Übelkeit war plötzlich gekommen. Sie kannte das schon seit einigen Tagen und wusste deswegen, dass sie dringend aufstehen und sich erleichtern sollte, wenn sie nicht wollte, dass es ihr hier vor aller Augen am Weihnachtstisch hochkam. Denn den Reflex zu unterdrücken, ging meist nicht.
»Anne, was ist mit dir, du bist ja plötzlich ganz blass«, bemerkte Magda nun auch. Es klang nicht besorgt, eher spitz. Magda hatte Anne noch nie besonders gemocht und hatte sie das immer schon spüren lassen. Als sie noch Kinder waren, hatte Magda sie oft geschubst, getreten, gepufft, gebissen oder auch bei den Erwachsenen für Dinge verpetzt, die Anne gar nicht getan hatte. Anne hatte das meist über sich ergehen lassen, und auch jetzt noch, als Erwachsene, nahm sie Magdas Sticheleien einfach hin. Sie hatte schlicht keine Lust auf zwischenmenschlichen Kleinkrieg. Im Grunde tat ihr Magda leid, und wahrscheinlich hatte sie diese Regung schon gehabt, als sie alle noch Kinder gewesen waren, nur nicht benennen können. Als Kind hatte sie auch nicht recht verstanden, warum Magda sie ständig piesackte. Heute wusste sie, dass es auf Eifersucht beruhte, und sie konnte es sogar nachvollziehen. Anne und ihre Mutter waren damals in die Familie Becker hereingeplatzt, als wären sie vom Himmel gefallen, und hatten sofort die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. Nicht nur, weil Muttel schwerkrank gewesen war und Renate Becker sich so selbstverständlich um sie gekümmert hatte, obwohl sie selbst damals unter einer heftigen, langwierigen Bronchitis gelitten hatte. Sie waren vor allem in der Familie aufgenommen worden, als wäre es ihre eigene, und das hatte Magda nicht gepasst. Renate Becker war für Anne wie eine zweite Mutter, Helmut hatte sich sofort als großer Bruder aufgeführt und tat dies auch heute noch, und Johannes war vom ersten Tag an ihr engster Vertrauter gewesen. Aus diesem Grund überkam sie auch jetzt wieder ein schlechtes Gewissen, sich ihm nicht wie sonst sofort mitgeteilt zu haben, doch dies wurde umgehend von der Übelkeit überlagert. Es nutzte nichts, sie musste ins Bad. Jetzt.
*
Johannes konnte schon seit einigen Minuten der Unterhaltung am Weihnachtstisch nicht mehr folgen. Von dem Moment an, seit sie so abrupt vom Tisch aufgestanden und schnellen Schrittes das Esszimmer verlassen hatte, fragte er sich, was Anne hatte. Als seine Mutter und Magda dann das Dessert aufgetragen hatten – Rote Grütze mit Vanillesoße – und Magda laut durch die Diele gerufen hatte: »Anne, was machst du so lange im Bad? Bist du da drinnen eingeschlafen? Es gibt jetzt Nachtisch«, hatte Johannes ernsthaft angefangen, sich zu sorgen, denn Anne war nicht gekommen. Sie hatte auch keine Antwort gegeben. Bis jetzt hatte sich nichts im Bad geregt, soweit er es durch die dicken Holztüren, das Besteckgeklapper und das Stimmengewirr, das am Tisch herrschte, hatte hören können. Kurzentschlossen stand Johannes deswegen jetzt auf, murmelte in die Runde: »Ich geh mal nach Anne schauen«, trat in die lange Diele, von der alle Räume der Wohnung abgingen, und blieb vor der Badezimmertür stehen. Zaghaft klopfte er an und fragte gegen das weißlackierte Holz vor sich: »Anne? Geht es dir gut?«
Er wartete einen Moment, und als keine Antwort kam, sagte er noch einmal gegen die geschlossene Tür: »Anne? Ich komm jetzt rein.«
Er runzelte seine Stirn. Was war nur mit Anne? Solch ein Verhalten kannte er von ihr nicht. Ihn beschlich ein merkwürdiges Gefühl, das er selbst nicht hätte konkret beschreiben können. Irgendwie war es eine Mischung aus Sorge und Verwunderung. Anne war immer fröhlich, und vor allem versuchte sie nie, besonders aufzufallen. Denn genau das tat sie jetzt durch ihre lange Abwesenheit von der Festtafel. Und auch falls sie etwas mit dem Magen oder Darm hätte, könnte sie doch wenigstens durch die Tür antworten.
Johannes drückte langsam die Klinke hinunter. Dabei hielt er den Atem an. Seine Gefühle rangen miteinander. Es widerstrebte ihm, im Bad nach Anne zu schauen – das Badezimmer war für ihn einer der intimsten Orte. Darum hatte er sich auch so aufgeregt, als seine Mutter unlängst den Badezimmerschlüssel verlegt hatte. »Verlegt«, hatte sie gesagt und dabei entschuldigend mit den Schultern gezuckt. Er hatte gewusst, dass sie nur so tat, denn ihre Augen hatten sie Lügen gestraft. Johannes vermutete, dass sie den Schlüssel absichtlich hatte verschwinden lassen, weil Vati es sich in den letzten Monaten zur Angewohnheit gemacht hatte, mit der Zeitung unter dem Arm ins Bad zu gehen und es stundenlang zu besetzen. Mutti hatte das fuchsig gemacht. Nicht nur, da sie dann selbst nicht ins Bad konnte, sondern vor allem, weil es jedes Mal nach so einer »Sitzung« des Vaters im Bad verdächtig nach Zigarrenqualm roch. Da der Arzt ihm das Rauchen streng untersagt hatte und Mutti den Qualm sowieso nicht in der Wohnung mochte, hatte Vati anscheinend keine andere Lösung als das Badezimmer gefunden. Mit seiner Gehbehinderung durch das amputierte Bein vermied er jeden Gang aus dem dritten Stock, in dem ihre Wohnung lag, nach unten auf die Straße. Und wenn er den Balkon zum Schmöken nutzen würde, würde die Mutter schimpfen wegen des Arztes. Das tat sie natürlich auch, seit sie den Badezimmerschlüssel »verlegt« hatte. Mindestens dreimal die Woche verzog der Vater sich nach wie vor ins Bad, doch dann machte Mutti einfach die Tür auf und unterbrach seine Sitzung, indem sie ihm die Zigarre abnahm.
Trotz seines Widerstrebens öffnete Johannes jetzt die Badezimmertür. Er musste einfach wissen, was mit Anne war. Vielleicht war sie ohnmächtig geworden? Er war auf alles gefasst. Als er nun in den beige-braun gekachelten Raum blickte, stutzte er jedoch überrascht. Der Raum war leer. Keine Anne. Dafür roch es nach Erbrochenem. Verwundert blickte Johannes umher, obwohl das Bad quadratisch war und es keine Versteckmöglichkeit gab. Er sah sogar zu dem kleinen Fenster hoch. Es stand auf Kipp. Doch selbst wenn es komplett offen gestanden hätte, hätte noch nicht einmal die gertenschlanke Anne hindurchgepasst. Darüber hinaus lag die Wohnung nicht im Erdgeschoss, und wieso hätte sie in dieser Höhe aus dem Fenster klettern sollen? Das wäre Quatsch. Johannes runzelte seine Stirn. Er konnte sich so gar keinen Reim auf die Leere des Raumes machen und dachte, während er die Tür sachte wieder zuzog, dass es in diesem Moment in seinem Kopf genauso leer aussehen musste. Was war hier los? Wo war Anne? Anscheinend war sie krank, zumindest dem Geruch im Bad nach zu urteilen, der trotz des gekippten Fensters noch im Raum gehangen hatte.