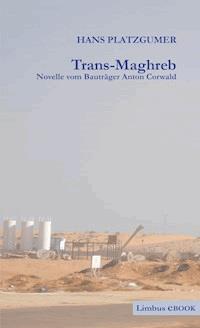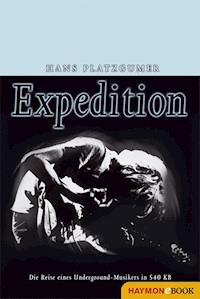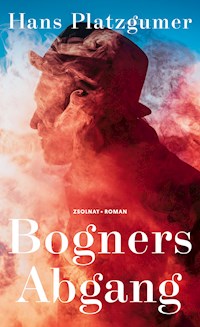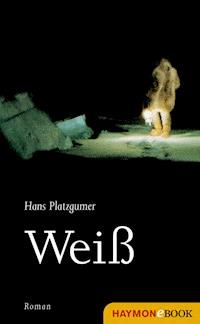Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mensch steigt früh am Morgen auf einen Berg. Sobald es dunkel ist, will er einen letzten Schritt tun. Schon immer lagen der Tod und das Glück für Gerold Ebner nah beieinander. Als Kind hat er seinen ersten Toten gesehen. Später hat er zwei Menschen eigenhändig den Tod gebracht: Er erlöste seine Mutter vom terrorisierenden Großvater und seinen besten Freund von dessen Leiden. Doch ist er damit zum Mörder geworden? Noch einmal entscheidet sich Gerold gegen das Gesetz und findet so sein eigenes Glück, das ihm der Tod wieder nimmt ... Fesselnd bis zum Schluss schildert der Ich-Erzähler die Ereignisse, die ihn an den Rand eines Felsens geführt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Mensch steigt früh am Morgen auf einen Gipfel.
Sobald es dunkel ist, will er einen letzten Schritt tun …
Gerold Ebner hat zwei Menschen umgebracht. Doch ist er tatsächlich ein Mörder? Oder hat er nur konsequent den Menschen, die ihm nahestanden, geholfen?
Zsolnay E-Book
Hans Platzgumer
AM RAND
Roman
Paul Zsolnay Verlag
ISBN 978-3-552-05789-0
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2016
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Foto: © Vincent Penru
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Wenn alle Wege verstellt sind,
bleibt nur der Weg nach oben.
FRANZ WERFEL
Gipfel und Abgrund –
das ist jetzt in eins beschlossen!
FRIEDRICH NIETZSCHE
IRGENDWANN kommt jeder an. Steht, liegt oder sitzt, wie ich jetzt hier auf dem Gipfel. Erkennt den Strich, den er unter alles ziehen kann. Hat den Punkt erreicht, wo jedes Leben dem anderen zu gleichen beginnt, jedes ein ähnlich mickriges wird, aber keines mickrig genug, und jedes sowohl zu lang als auch zu kurz.
Heute ist mein Tag. Keine zehn Stunden sind es, bis die Sonne im Westen und meine Erzählung in der Dunkelheit versinken werden. Ich will aufschreiben, wie ich hierhergekommen bin.
Vielleicht ist dieses Bedürfnis, mich mitzuteilen, ein Vermächtnis der christlichen Weltsicht, die von Anfang an unablässig in mein Hirn gepresst wurde. Hat meine Mutter also doch erfolgreich auf mich eingewirkt, sosehr ich mich dagegen sträubte. Der Fels ist jetzt mein Beichtstuhl und ich öffne mich Ihnen, einer oder einem Unbekannten. Vielleicht ist das feig, schwach, aber Feigheit und Schwäche, alles werde ich mir heute zugestehen. Ich darf alles, denn ich bin angekommen, nach 42 Jahren angekommen, heraufgekommen auf den Bocksberg.
Wenn der Kampf den Menschen zum Menschen macht, gehört auch das Erzählen vom Kämpfen und das Beenden von Kampfhandlungen zu ihm. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn nicht, was dann? Ein Südtiroler kann nicht auf einen Berg steigen, ohne den Gipfel zu erklimmen. Vor dem Ziel umdrehen kostet ihn mehr Überwindung, als dieses zu erreichen. Doch noch ist längst nicht Abend. Die Sonne ist kaum über die felsigen Bergkuppen im Südosten hinausgekommen – auch wenn sie schon vor fast zwei Stunden aufgegangen ist, um 7 Uhr 39, heute, am Donnerstag, dem 11. Oktober 2012, um präzise zu sein. Und präzise will ich jetzt sein, alles andere wäre Zeitverschwendung.
HITOTSU
Lang vor Tagesanbruch bin ich aufgestanden. Den Wecker hatte ich auf viertel nach vier gestellt, aber ich hätte ihn nicht gebraucht. Oft und lang vor dem Wecksignal war ich schon wach, konnte es kaum erwarten, bis er mich aus der Nacht befreite. Ich wusch mich, briet drei Spiegeleier mit Speck, strich dick Butter auf das Vollkornbrot, trank starken Schwarztee mit Milch und fünf Teelöffeln Zucker, machte mir Speckbrote, die mich durch diesen Tag bringen sollten, verpackte sie in Alufolie. Ich schaltete kein Licht in der Küche an. Das kleine Nachtlicht aus dem Schlafzimmer, das wir für Sarah installiert hatten, das Leuchten aus dem Kühlschrank und, was von den Straßenlaternen in die Wohnung fiel, reichten aus. Künstliches Licht habe ich nie gemocht. Den Rucksack mit allem, was ich benötigen würde, hatte ich gestern bereits gepackt. Fast hätte ich auch das Frühstücksgeschirr schon abends vorbereitet, aber Elena hatte vorausschauende Handlungen immer verabscheut, also ließ ich es bleiben. Spießig sei das, kleingeistig, fand Elena. Es zeuge von einer konservativen Einstellung, wenn man davon ausginge, dass jeder Tag das zu bringen habe, was man von ihm erwarte. Kurzsichtig sei, wer meine, den Lauf der Dinge zu kennen, wissentlich schränke er seine Möglichkeiten ein.
Ich diskutierte das Thema nie länger mit ihr, aber widerstand seither meinem Impuls, am Vorabend den Frühstückstisch zu decken. Auch gestern. Die Kleidung jedoch, die ich heute trage, den Anorak, den dicken Pullover, die langen Unterhosen, Wollsocken und Thermo-Handschuhe, hatte ich auf einem Stuhl bereitgelegt. Ein Blinder sagte einmal zu mir: Solang du gut organisiert bist, spielt es keine Rolle, ob du sehen kannst oder nicht. Alles, was du ablegst und später wieder brauchst, musst du hinterlegen, wo du es wiederfinden willst. Jeden Handgriff musst du bewusst vollziehen, nichts unbedacht machen, nichts dem Zufall überlassen. Das prägte ich mir ein. Auch wenn ich nicht blind bin, verrichte ich scheinbare Nebensächlichkeiten so konzentriert, als wäre ich darauf eingestellt, von einem Moment auf den anderen zu erblinden. Alles in der Welt, die ich hinterlasse, ist an seinem Platz. In völliger Ordnung ließ ich die Wohnung in der Heldendankstraße zurück. Warum eigentlich?, fragte ich mich, während ich den Abwasch machte und den Stuhl zurück an den Tisch schob. Muss alles seine Ordnung haben, wenn einer aufbricht? Sogar das Bett machte ich, den Stoffhasen legte ich auf das Kopfkissen, das Leintuch strich ich glatt, wie meine Mutter es im Kinderzimmer getan hatte, früher, als ich noch dort schlief, und später, nachdem man den Großvater hinausgetragen hatte. Das Handtuch im Bad hängte ich säuberlich an seinen Halter, bevor ich ging. Sie werden es ja sehen, wenn Sie die Wohnung betreten. Eigentlich wollte ich, bevor ich die Wohnung verließ, Sarahs Nachtlicht löschen, wie ich es tagsüber immer tat, aber das habe ich in der Aufregung vergessen. Ich bitte Sie, schalten Sie das Lichtchen für mich ab. Ein kleiner Schiebeschalter an der rechten Seite, Sie werden ihn finden.
Die Haustür schloss sich leise hinter mir. Ich huschte die Treppen hinab, und auch auf der leeren Straße im spärlichen Licht der Laternen bewegte ich mich nahezu geräuschlos, als wollte ich niemanden stören – obgleich es eher ich selbst war, der von niemandem gestört werden wollte. Den Wohnungsschlüssel habe ich in den Briefkasten geworfen. Wenn Sie wollen, können Sie ihn mit einem Draht herausfischen. Es macht mir nichts aus, wenn Sie die Wohnung aufsuchen, im Gegenteil, ich lade Sie dazu ein. Wahrscheinlich habe ich deshalb aufgeräumt.
Um halb sechs fuhr der erste Zug von Bregenz nach Dornbirn. Den Fahrschein hatte ich gestern bereits gelöst, für die gesamte Strecke, auch für den Bus Nummer 7, der mich vom Bahnhof hinauf ins Gebirgstal brachte, durch das sich die Ach schlängelt. Niemand wollte mein Ticket sehen, niemand kümmerte sich um mich. Die wenigen anderen Fahrgäste schienen noch zu schlafen oder versteckten sich hinter einer Tageszeitung. Der Busfahrer verweigerte die Welt im Allgemeinen. Ich blickte hinaus in die Dunkelheit, auch wenn ich in den Scheiben mehr das gespiegelte Innere des Busses sah. Durch das Spiegelbild eines Mannes, der sich auf seinem Weg befand, blickte ich hindurch. Es fühlte sich richtig an.
Zwanzig Minuten nach sechs stieg ich aus dem Bus. Jetzt war ich am Fuß meines Berges angekommen, lang bevor die erste Seilbahn zur Bergstation des vorgelagerten Massivs hochfahren würde. Mit ihr hätte ich mir einen Teil des Anstiegs erspart, aber den vorderen, touristischen Teil dieses Wandergebietes wollte ich meiden. Stattdessen machte ich mich, ohne Zeit zu verlieren, zur hinteren, unbekannten Bergroute auf, ein einsamer Weg, der mich hinein in die schwarzen Wälder und in langen Serpentinen hinaufführte. Trotz der Dunkelheit und auch ohne Taschenlampe hielt ich einen zügigen, gleichmäßigen Schritt. Ich fiel in einen Trott, und bald wurde mir warm, obwohl mir feuchtkalte Luft entgegenschlug. Stetig gewann ich an Höhenmetern, fast ohne es zu merken. Alles um mich herum war, eine Stunde vor Sonnenaufgang, dunkel und still, die Zivilisation lag bereits weit hinter mir, alles schien richtig. Ich spürte keine Anstrengung. Mühelos trugen mich die Beine über Steine, Wurzeln, Wiesen und Bäche hinweg, immer weiter hinauf, dem Ziel entgegen. Ich hatte keine Zweifel, es war an der Zeit, den Plan, den ich seit Wochen gefasst hatte, in die Tat umzusetzen.
Bald verengte sich der Forstweg und ging in einen steil ansteigenden Pfad über. In der Dunkelheit des Waldes musste ich vorsichtig auf meine Schritte achten, mich an manch überstehendem Ast vorbeihanteln oder über umgestürzte, rutschige Stämme klettern. Manchmal verlor ich den Halt, stolperte über eine Wurzel, glitt auf einem glitschigen Stein aus. Eine Handvoll abgefallener Tannennadeln sammelte sich in meinen Schuhen und stach mir in die Knöchel. Doch ich blieb nicht stehen, um sie herauszuholen. Lieber gewöhnte ich mich an ihre feinen Stiche und blieb im Rhythmus.
Mit zunehmender Höhe lichteten sich die Bäume. Als ich die ersten Hochebenen erreichte, begann sich der Nachthimmel zu erhellen, und ich konnte mein Tempo steigern. Das konturlose Schwarz über mir ging in ein metallisch, tief aus seinem Inneren leuchtendes Blau über. Hinter dem klammen Dunst, der noch zwischen den Nadelbäumen hing, zeichneten sich in der Ferne die Silhouetten der Bergrücken ab. Wie schlafende Riesen waren sie mir als Kind schon vorgekommen, nach oben blickende Scherenschnitte, die statt Haaren Bäume über Steinstirnen trugen. Ich erkannte die gewölbten Augenbrauen liegender Gesichter, ihre Nasen, Lippen und spitzen Kinnladen, die sich in den Wellungen der Hochplateaus verloren.
Um mich herum begrüßten Vögel nun den anbrechenden Tag, und ich merkte, wie ich mich zu beeilen begann. Als trieben die Tiere mich an. Der mir bevorstehende, steile Anstieg auf den Bocksberg würde noch fast zwei Stunden in Anspruch nehmen. Zehntausend Schritte würde ich noch zu machen haben, hatte ich ausgerechnet, und am Gipfel würde mein Tagwerk erst beginnen. Viel hatte ich mir heute vorgenommen, und alles hing am Tageslicht, dessen Diktatur mich zu unterwerfen ich entschieden hatte. Elf helle Stunden lagen vor mir, neun sind es mittlerweile, die mir davon bleiben. Um halb sieben wird es dunkel. Danach noch ein wenig Dämmerlicht, notfalls der Lichtkegel meiner Taschenlampe, solange die Batterie hält. Dann muss ich mit meinen Aufzeichnungen fertig sein.
Der erste Tod, mit dem ich konfrontiert war, trat so still und heimlich in mein Leben, dass ich ihn jahrelang nicht bemerkte. Eines Tages trug man den Nachbarn, den alten Herrn Gufler, mit den Füßen voraus aus unserem Wohnhaus. Niemandem war aufgefallen, dass er seit mindestens einem Jahr tot war. Viele Monate verharrte er regungslos im Lehnstuhl seines Wohnzimmers, wo er mit aufgesetztem Kopfhörer vor dem Fernseher eingeschlafen und nie wieder erwacht war. Vom Ton des Fernsehprogramms beschallt, war er in seiner Wohnung völlig vertrocknet, nur wenige Meter Luftlinie von mir entfernt. Unzählige Male war ich im Stiegenhaus an der Gufler’schen Mumie vorbeigegangen, meine Hand an der Wand, hinter der Herrn Guflers Fernsehzimmer lag, das seine Totenkammer geworden war. Meist trommelte ich an diese Wand oder strich mit den Fingern an ihr entlang, wenn ich durchs Stiegenhaus huschte. Nie hatte Herr Gufler sich darüber beschwert. Überhaupt hatte er sich nie von uns Kindern belästigt gefühlt oder selbst irgendjemanden belästigt. Sogar im Tod blieb er zurückhaltend, kaum ein Verwesungsgeruch wäre uns aufgefallen. Nein, aus seinem äußerst unauffälligen Leben entschlummerte er eines Tages unbemerkt in einen unauffälligen Tod, den Kopfhörer bei maximaler Lautstärke über die Ohren gestülpt, die geschlossenen Lider angestrahlt von schreienden Bildern. Erst als Verstorbener erregte Herr Gufler ein einziges Mal Aufmerksamkeit in der ganzen Siedlung.
Zum Glück unterbrach das Fernsehen in den siebziger Jahren nachts das Programm und zeigte bloß Testbilder oder von einer Lokomotive aus gefilmte Bahnfahrten. So wurden der Guflermumie wenigstens Pausen gegönnt von dem über ihren Tod wachenden Flackern, diesem Fluch, der ihr auferlegt war. Jeden Tag aufs Neue lärmte das Fernsehprogramm auf den Alten ein. Wäre er noch ein paar Jahre später erst gefunden worden, wäre sein Mumienhals vielleicht so brüchig geworden, dass er der Spannung des gekringelten Kopfhörerkabels nicht länger widerstanden hätte und der Kopf vom Korpus abgerissen worden wäre. Dann endlich wäre Ruhe eingekehrt.
Schon zu Lebzeiten war dieser Lehnstuhl Herrn Guflers angestammter Platz gewesen. Dort hielt er Kontakt zum Weltgeschehen. Jahrelang war der Lärm des Fernsehers täglich durch die dünnen Wände des Wohnblocks gedrungen, aber irgendwann legten die Nachbarn zusammen und kauften Herrn Gufler diese Kopfhörer. Von da an fühlte sich niemand mehr von dem Alten gestört. Wenn wir ihn auf der Straße sahen, dann höchstens vor dem Supermarkt, wo wir gern herumlungerten. Manchmal gab er uns ein paar Schilling für Kaugummis oder ein Eis, wenn er aus dem Geschäft kam. Zitternd lächelte er und nickte und blickte uns nach und lächelte weiter, wenn wir uns umdrehten, und sagte mit einer Stimme, die kaum mehr als ein heiseres Hauchen war, Ja, Ja oder Lasst es euch schmecken. Es fiel uns nicht auf, dass wir ihn irgendwann nicht mehr zu Gesicht bekamen, ein Jahr lang, länger, nie mehr. Er war eben einer, den man übersah. Wir vergaßen ihn. Dass er vor dem Fernseher schlief, wusste jeder, nur, dass er seit über einem Jahr aus dem Fernsehschlaf nicht mehr erwacht war, ahnte niemand.
Eines Nachts wurde ich von einem Knall geweckt. Ich war sieben, aber nicht schreckhaft genug, um in Mutters Schlafzimmer Schutz zu suchen. Eine Weile lag ich wach, überlegte, was dieses Geräusch im Stiegenhaus verursacht haben mochte, wartete ab, was als Nächstes geschehen würde. Doch nichts geschah, und ich schlief wieder ein. Am nächsten Morgen entdeckten Mutter und ich, was vorgefallen war. Einbrecher, die in der Wohnung des alleinstehenden Pensionisten Wertsachen vermutet hatten, hatten Herrn Guflers Wohnungstür aufgebrochen. Vielleicht hatten sie einen Tipp bekommen, weil der Alte früher bei einem Juwelier gearbeitet hatte. Eine Mumie vor dem Fernsehapparat hatten sie wohl nicht erwartet. Vielleicht fiel ihnen aber auch gar nicht auf, dass sie zu Grabräubern wurden. Ein leicht süßlicher Gestank war in einer Rentnerwohnung wenig überraschend. Vielleicht mutmaßten die Einbrecher, dass der Alte schlief, durchsuchten seine Bude schnell und vergebens und verschwanden wieder.
Mutter entdeckte die offen stehende Tür.
– Herr Gufler!, rief sie in die Wohnung hinein. Herr Gufler, alles in Ordnung bei Ihnen?
Sie bekam keine Antwort, nur diese modrige Geruchsmischung aus Staub und Menschenstaub drang ihr in die Nase. Vorsichtig trat sie ein und entdeckte den Toten, wusste die Mumie sofort von einem Schlafenden zu unterscheiden. Als Erstes drehte sie, wie auch ich es getan hätte, den Fernseher ab. Jetzt endlich konnte der Mann in Frieden ruhen.
Dann stand auch ich in der Tür.
– Geh raus hier, Gerold, das ist nichts für dich, sagte Mutter.
Doch ich war schon halb im Wohnzimmer und hatte den Toten im Blick. Lang blieb ich an Ort und Stelle stehen, fasziniert, auch entsetzt, und konnte mich nicht abwenden. Jegliche Kraft, alle Energie war aus Herrn Gufler entwichen, jahrzehntelang hatte er sich durch ein Menschenleben geschleppt, nun war alles aufgebraucht, was er zu bieten gehabt hatte, und nur mehr seine Überreste lagen vor mir auf dem Lehnstuhl. Eine große Natürlichkeit lag in alldem. Herr Gufler trug Hausschuhe, eine dünne Wollhose und eine braune Strickjacke. Seine vertrocknete rechte Hand lag über der Fernbedienung. Sternförmig zog sich ein verästeltes Netzwerk aus Falten vom eingefallenen Mund ausgehend in alle Richtungen, als wäre er in einem in die Ewigkeit gedehnten Oh erstarrt. Ich kann sagen, dass der erste Tote meines Lebens der schönste, der zufriedenste war, mit dem ich je zu tun hatte.
Meine Mutter musste mich mit Gewalt aus der Guflergruft hinausschieben. Da trafen bereits weitere Nachbarn ein und wenig später die Polizei und ein Krankenwagen. Plötzlich interessierte sich jeder für den Tutenchgufler, wie wir ihn in der Folge nannten. Nur zu gerne hätten wir ihn angefasst, um zu sehen, ob er auf die leichteste Berührung hin zu Staub zerfallen würde, wie ich vermutete, aber man ließ uns nicht. Ich stellte mir seine Konsistenz wie altes Pergamentpapier vor, meine Freunde dachten an brüchiges, ausgetrocknetes Leder oder meinten, er sei klebrig wie Schuppen oder faserig wie ein Spinnennetz. Der Peter Innerhofer behauptete, dass man mit dem Finger in ihn hineinbohren und direkt ins vertrocknete Herz hätte greifen können. Er war es auch, der vorschlug, dass wir Guflers Fernsehsessel in Besitz nehmen und im Heizraum im Untergeschoß des Hauses aufstellen sollten. Gegen eine Gebühr könnten wir Kinder von außerhalb der Siedlung darauf Platz nehmen lassen und reich werden mit dieser Attraktion. Die Liegestätte einer echten Mumie!, nannte er es. Doch letztendlich wurden die Pläne nie umgesetzt. Guido wiederum meinte, dass das Herz des Alten vielleicht immer noch schwach schlagen würde, weil es das wohl lang nach dem vermeintlichen Tod mache. Doch als ein Polizeisprecher verlautbarte, wie lange der 71-Jährige tot in seinem Sessel gelegen war, gaben wir die Theorie vom immer noch schlagenden Herzen auf. Verwunderlich sei zwar, meinte der Polizeisprecher, dass das Ableben dieses Mannes keinem Nachbarn aufgefallen war, aber da Miete und Nebenkosten regelmäßig von seinem Konto abgebucht wurden, er keine Verwandten gehabt und kaum Briefsendungen bekommen hatte, hätte niemand von seinem Tod Notiz genommen. Auf einer Bahre wurden vor einigen Schaulustigen die Überreste des Herrn Gufler hinausgetragen. Das war er gewesen, sein kurzer, großer Moment, postum, sein einziges Hurra, bevor er irgendwo verscharrt und vergessen wurde.
HITOTSU
Der Bocksberg ist ein kleiner, spitzer Gipfel. Von hinten führt der verwilderte, schmale Waldpfad hoch, den ich gewählt habe. An der Vorderseite bricht der Berg mit einer steilen Felskante ab, ungefähr zwanzig Meter senkrecht hinunter, bis die Wand in einen abschüssigen Berghang übergeht, der von Gras bewachsen, teils sogar bewaldet ist. Latschen, Krüppelfichten, Lärchen gibt es hier. Weiter unten fällt diese Welle in eine zweite Steilwand. Dort verschwindet der Bocksberg in den ihn umgebenden dunklen Wäldern.
Mächtig und trotzdem unscheinbar ist der Felswall, der diesen Gipfel trägt, unbeliebt bei Kletterern. Meines Wissens hat niemand diese Wand je durchstiegen. Auch über den Pfad oder den vor Jahrzehnten angelegten, südlichen Klettersteig, der mit halbverwilderten Drahtseilen nur unzulänglich gesichert ist, kommt selten jemand herauf. Bloß Adler, Bussarde, Habichte umkreisen diesen Keil, der in den Himmel ragt und in kaum einem Bergführer Erwähnung findet. Wer kennt den Bocksberg schon? Man schätzt den Hohen Freschen, den Widderstein, den Staufen, aber nicht den Bocksberg. In Karten ist er kaum vermerkt, ein wenig beachteter Felsbrocken bloß. Genau deshalb ist er für mein Vorhaben so geeignet.
Es wundert mich, dass hier überhaupt ein Gipfelkreuz errichtet wurde. Der Alpenverein hat das schlichte, aber massive Holzkreuz 1966 aufgestellt, wie auf einem Schild an seinem Fundament vermerkt ist. Überdimensioniert, fehl am Platz wirkt das Kruzifix, drei Meter ragt sein Längsbalken in die Höhe, höher hinauf, als der Gipfel des Bocksbergs an Breite misst. In den Querbalken ist der Satz Das Leben ist der Weg zum »Berg« eingraviert. Einen Moment lang dachte ich über diese Anführungszeichen in der Gravur nach, als ich heute gegen neun den Gipfel erreichte.
Ich ärgerte mich kurz über die Arroganz des Alpenvereins, der mit den, auf jeder Erhöhung errichteten, gesegneten Passionskreuzen die Bergwelt verschandelt. Bevor ich zur Welt kam, waren die meisten dieser Gipfelkreuze schon da. Ich kenne die Alpen nicht ohne sie. Auf der höchsten Stelle des heiligen Berges Fuji in Japan ist ein Getränkeautomat errichtet, und im Himalaya stößt der Bergsteiger allerorts auf verwitterte, tibetische Gebetsfahnen. Bei uns stehen eben diese Kreuze herum, normalerweise nehme ich sie nicht wahr. Nur nach meiner heutigen Ankunft am Gipfel begutachtete ich diesen Ort, als sähe ich ihn zum ersten Mal.
In Brusthöhe war am Kreuz eine verbeulte, bronzene Schatulle befestigt, in der sich das Gipfelbuch befand, ein schäbiger Schreibblock mit gewellten, karierten Seiten, eingepackt in eine steife Plastiktüte. Seit meiner Kindheit, als wir manchmal Obszönitäten hineinschmierten, hatte ich kein Gipfelbuch mehr in Händen gehalten. Die Freude, sich darin zu verewigen, ist Touristen und Minderjährigen vorbehalten. Ein Südtiroler, der das Leben mit Bergen gewohnt ist, vergeudet keinen Augenblick damit. Heute aber warf ich einen Blick hinein. Berg Heil allen Wanderfreunden! auf der ersten Seite. Berg Heil auch auf den meisten folgenden, teils unleserlich bekritzelten Seiten. Ich wilde Sau hab’s geschafft, konnte ich entziffern, Ein herrliches Panorama, oder Heute hat’s viermal schon gehagelt. Dann ließ ich es bleiben. Es gab ohnehin wenige Einträge, selbst in den Sommermonaten kaum mehr als zehn Vermerke. Ich steckte das Buch zurück in die Schatulle und setzte mich auf einen Felsbrocken nahe des Abhangs, so weit wie möglich vom Kreuz entfernt. Hier will ich sitzen bleiben, bis der Tag zu Ende geht. Nur einen Schritt vor meinen Füßen bricht die Felskante ab. Elena mit ihrer Höhenangst hätte hier nicht sitzen können. Sie liebte Berge, Wälder, aber Steilwände hatte sie immer gemieden.
Von meinem steinernen Hocker aus betrachte ich unzählige Bergkuppen, kahles Schiefergestein, krumme Latschen, mancherorts ein paar Sträucher, hartgesottenes Gestrüpp. In die Berge sind Täler eingekerbt, steil abfallende, sanft auslaufende Wälder, Flüsse, die die Landschaft zerschneiden. Wasserfälle sehe ich, Almhütten, Hochleger, Niederleger, Forstwege. Unten dunkles, matschiges Grün, eine Schattenwelt. Nach oben hin wird die Landschaft heller. Ab einer gewissen Höhe frisst das Weiß des Himmels das Grün von den Berghängen, enden Wiesen und Bäume, nur karge Schotterflächen ziehen sich noch weiter hinauf zu den der Sonne entgegengestreckten Gesteinsglatzen. Vereinzelt stechen aufgetürmte Felsen in Wolkenfetzen. Das Schmutzweiß der Gebirge geht in das Schmutzweiß der Höhenluft über. An manchen Stellen liegt Schnee. Unförmige Flecken, die unmotiviert, scheinbar zufällig in die Landschaft gekippt sind. Ein bisschen Schnee ist es um diese Jahreszeit bloß, der Rest, der immer bleibt.
Ich nehme den Schreibblock aus der gelben Plastiktüte mit der Aufschrift eines Supermarkts, in dem ich vor Jahren war. Hundert weiße Seiten stehen mir zur Verfügung. Mit schwarzem Kugelschreiber schreibe ich Datum und Namen, Gerold Ebner, auf die erste Seite.
Wieso meine Mutter mich Gerold nannte, ist mir ein Rätsel geblieben. Der Herrscher mit dem Speer. Nur wenn ich den Speer als Schreibstift interpretiere, ergibt dieser Name einen Sinn für mich. Denn dass die Feder mächtiger als das Schwert ist, davon bin ich überzeugt. Sie selbst halten mein Papier in der Hand. Vielleicht hat meine Mutter 1969 etwas davon geahnt, als sie mich als 21-Jährige im Bauch trug und entschied, mich auszutragen – wie hinderlich das auch bald für ihr Geschäft gewesen sein musste.
Welcher Freier geht schon zu einer Schwangeren? Gut, manchen ist alles egal, Hauptsache, es ist billig und ohne gröbere Komplikationen, mein Vater war wohl so einer. Irgendwann aber war ich ja so groß, da in meiner Mutter drin, dass jeder es gesehen haben muss, der im Schritttempo die Betonstraße entlangfuhr und Ausschau hielt. Irgendwann konnte meine Mutter mich nicht mehr verbergen. Als ich raus aus ihrem Bauch war, wäre theoretisch wieder Platz in ihr für andere gewesen, aber in ihr war dann überhaupt kein Platz mehr, jedenfalls nicht für Irdische, weil sie nicht mehr an der Betonstraße arbeitete, sondern in einem nicht weit von dort entfernten Kloster und Pflegeheim, wo sie Alte und Kranke pflegte und dreimal am Tag mit ihnen betete.
So war es mit den Südtirolerinnen, sagte man, sie wussten nicht, wo sie hingehörten. Mal zu den Faschisten, mal zu den Nazis, mal zu den Widerstandskämpfern. Nicht deutsch und nicht nichtdeutsch waren sie, mal hier, mal da. Meine Mutter auch. Gerade gab sie ihren mädchenhaften Körper noch irgendwelchen Schweizern hin, die über die Grenze kamen, weil Schillingfrauen billiger waren, da stellte sie sich kurz darauf dem lieben Gott zur Verfügung. Eben noch eine schwangere Nutte, dann eine Nonne, die die Männer pflegt, die sie eigentlich hätte hassen sollen.
Bei diesem nonnenhaften Leben ist sie bis heute geblieben, die Frau, die mich empfangen hat, wich nicht mehr ab, blendete alles andere aus. Dieser fromme, keusche, dienende Alltag, bei meiner Geburt hat sie damit begonnen. Nichts erhielt je eine ähnliche Bedeutung für sie. Auch ich, ihr Sohn, nicht. Als wäre es meine Schuld.
Zuerst fiel es mir freilich nicht auf. Es war, wie es war, kein Vater da und die Mutter ständig bei Gott oder den Alten und Sterbenden. Ich begann, mir die Welt selbst zusammenzubasteln. Je älter ich wurde, desto verwunderlicher kam mir Mutter vor. Beharrlich wich sie meinen Fragen aus, bis ich aufhörte, Fragen zu stellen. Jahre dauerte es, bis sie zu ihrer Vergangenheit stand. Die Gerüchte, die in der Siedlung die Runde machten, waren erdrückend geworden, da entschied sie sich, mit dem Rücken zur Küchenwand stehend, wo ich, ein Volksschüler noch, sie gestellt hatte, mir von der Tätigkeit zu erzählen, die sie vor der Krankenpflege ausgeübt hatte.
– Du hast keinen Vater, sagte sie. Es tut mir unendlich leid. Ich büße für meine Sünden, Tag für Tag, mehr kann ich nicht tun. Gott hat es so gewollt.
– Warum sollte Er so etwas wollen?, fragte ich.
– Das sind Dinge, die können wir nicht verstehen. Selbst wenn wir erwachsen sind. Nur immer auf Ihn vertrauen können wir. Müssen wir.
Das Gespräch dauerte wenige Minuten und wurde nie wieder aufgegriffen. Ich nahm die Tatsachen zur Kenntnis und wusste nun mit Sicherheit, dass die Kinder im Recht waren, die mich Hurensohn nannten. Nicht länger empfand ich es als Beschimpfung, sondern als legitime Bezeichnung, mit der ich mich abfinden würde, wie man sich mit seinem Namen, seiner Nase oder seiner Haarfarbe abfand.
Schon damals schätzte ich die Klarheit unumstößlicher Fakten. Ich mag es, wenn Gegebenheiten klargestellt, Entscheidungen getroffen, Handlungen durchgeführt sind. Den Punkt nach dem Satz mag ich, immer suchte ich diesen Punkt, und jene Phasen, in denen lang etwas unklar blieb, waren mir die unliebsten. Mutter war ähnlich, und wie ich blieb auch sie, wenn sie zu einer Entscheidung gekommen war, hartnäckig auf dem eingeschlagenen Weg. Ja, eine große Sturheit in ihrem Wesen, ähnlich der schroffen, mich heute umgebenden Landschaft, begleitete uns durch alles. Menschen wie wir verschwendeten keinen Gedanken daran, wie es anders hätte kommen können. Nur mit einer Entscheidung tat sich Mutter später schwer, so dass ich sie ihr abnehmen musste. Auch das geschah wortlos, nicht in einem Diskurs, sondern durch eine einzige unwiderrufliche Handlung, von der Mutter niemals erfuhr. Nur falls sie diese Zeilen ihres Sohnes in die Hände bekommt, wird sie verstehen, was geschehen ist. Zur Kenntnis nehmen wird sie es, stumm, trocken, und unverändert weitermachen, so wie sie es immer getan hat. Geben Sie ihr meine Zeilen zu lesen, lassen Sie sie abprallen an ihr, ändern wird sich nichts.
Vielleicht tu ich ihr unrecht, wenn ich sie so einseitig beschreibe. Wie soll ein Sohn je zu einer umfassenden Wahrnehmung seiner Mutter gelangen? Nie kann er sie als etwas anderes verstehen als eben die Mutter, nicht mehr, nicht weniger als das, und sie ihn bloß als ihren Sohn. Wie soll er ausgewogen urteilen? Was immer geschieht, die Beziehung zwischen Mutter und Sohn bleibt von einer emotionalen Distanz bestimmt, ihr gesamtes Leben ein beidseitiger Abnabelungsprozess, der nie vollzogen wird. Die Liebe zur Mutter ist so natürlich, dass der Sohn sie gar nicht erkennt. Zuerst ist er ihr zu nah, um klar sehen zu können. Später versucht er beständig, sich von ihr zu entfernen und sie auszublenden.
Ich dachte immer, so weit ich mich zurückerinnere, dass ich meine Mutter nicht liebte. Egal würde es mir sein, würde sie sterben, denn wir hatten keine enge Beziehung, kein Verständnis füreinander entwickelt. Ich hatte mich damit abgefunden, dass sie da war und dass das hin und wieder praktisch und manchmal unangenehm war. Würde sie eines Tages nicht mehr sein, wäre es genauso, in mancher Hinsicht mehr, in anderer weniger praktisch. Doch dann ergriff mich völlig unerwartet vor zehn, fünfzehn Jahren dieser Traum – ich weiß nicht, warum er mich plötzlich überfiel –, in dem meine Mutter starb. Aus irgendeinem Grund war sie gestorben, lag auf dem Totenbett, es verstörte mich zutiefst. Ich weinte, wie ich mich nicht erinnern kann, jemals vorher oder nachher geweint zu haben, ein ungekannter Schmerz überkam mich, blieb an mir haften, noch lange nachdem ich schweißgebadet aufgewacht war. Eine Leere, ein furchtbares Loch klaffte plötzlich in meinem Leben – viel unausweichlicher noch, als mich der Kummer bei den Todesfällen überkommen hatte, mit denen ich im wirklichen Leben konfrontiert war.
Am folgenden Tag rief ich Mutter an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sobald sie den Hörer abnahm, war das tiefschwarze Kummerloch verschwunden, diese größte emotionale Bindung, die ich je zu ihr verspürt hatte. Nur ein Traum. Die Stimme meiner Mutter zerriss die Trauerfetzen, die mir von der Nacht geblieben waren. Kaum hörte ich sie, kam mir meine Frage dämlich vor und war mir der Traum, dieses rührselige Zeug, unangenehm und peinlich. Weggefegt war der Schmerz über die verstorbene Mutter. Er kam nie wieder, aber seither weiß ich, dass unter der Oberflächlichkeit, mit der meine Mutter und ich uns begegnen, noch etwas steckt, brachliegt, mehr, als ich verstehen kann. Das zu wissen genügt mir, nie unternahm ich den Versuch, die verborgenen Tiefen zu erforschen. Lieber fand ich mich mit unserer vertrauten Fremdheit ab. Ich wüsste gar nicht, was ich anstellen müsste, um der Frau näherzukommen, die mich auf die Welt gebracht hat. Sie hat mir mein Leben gegeben, ich habe mir ein eigenes daraus gemacht. Soll ich ihr dankbar sein? Sie tat es schließlich nicht für mich, nicht bewusst. Was überhaupt hat sie für mich getan? Meine Windeln gewechselt? Mir zu essen, zu trinken gegeben? Mir das Bett gemacht und mich das Vaterunser aufsagen lassen, sobald ich mich hineinlegte? Sie pflegte mich, wenn ich krank war, aber all das tat sie als katholische Krankenpflegerin auch. Die Zehn Gebote schrieben ihr die Nächstenliebe vor, mit der sie mich und alle anderen zu behandeln hatte. Weit darüber hinaus hat unsere Beziehung nie gereicht. Wahrscheinlich lag das gerade an der geheuchelten Frömmigkeit, die sich von Anfang an als Keil zwischen uns geschoben hatte. Auch wenn mich Mutters Vorstellungen von der Welt und allem Irdischen und Überirdischen prägten und ich mich bis heute kaum davon befreien kann, so konnte ich trotzdem nie an Gott glauben. Das Glaubensgen in der rechten Gehirnhälfte, über das sie offenbar verfügt, fehlt mir. Ich plapperte ihre Gebete bloß teilnahmslos, sinnentleert nach, erduldete sie, akzeptierte früh schon, dass mit Gläubigen über den Glauben nicht zu diskutieren ist. Für mich war er nur ein Grund, warum Mutter und ich so selten und seicht miteinander sprachen. Ich liebe meine Mutter, das halte ich fest, und auch sie liebt mich, aber der liebe Gott ist immer zwischen uns gestanden und hat uns davor bewahrt, einander näherzukommen.
Wenn Sie schwindelfrei sind, kriechen Sie bitte zum Rand der Klippe vor. Beugen Sie sich ein wenig darüber und blicken Sie hinunter. Spüren Sie den Drang, der Sie hinabzieht? Es ist nicht nur die Gravitation, auch die Schönheit dieses Raums ist es, seine Tiefe, die Sie einlädt. Die direkte Todesnähe überwältigt Sie, die Grenze, an die Sie gekommen sind, die paar Zentimeter, die Ihr Leben von Ihrem Tod trennen. Wenn Sie aufstehen und sich direkt an den Abgrund stellen, mit Ihren Zehen bereits darüber hinaus, fühlen Sie, wie Sie zwischen Leben und Tod schwanken. Ein Windstoß, ein Atemzug bloß, und alles wäre unumkehrbar anders.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: